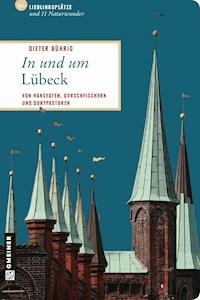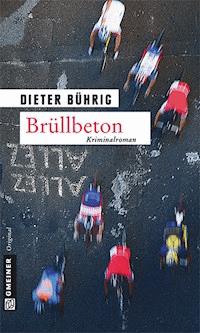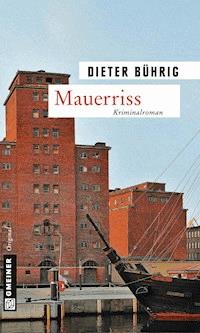
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Schriftsteller Christian
- Sprache: Deutsch
1989: Die DDR hat abgewirtschaftet. Korrupte Funktionäre bereichern sich durch staatlichen Kunstraub und Enteignung privater Antiquitäten. Wahlfälschungen bringen das Fass zum Überlaufen. Wie soll es weitergehen? Das Regime will den realen Sozialismus reformieren, die Gegner fordern die Wiedervereinigung unter kapitalistischen Vorzeichen. Doch der junge Schriftsteller Christian träumt von einem dritten Weg, vom demokratischen Sozialismus. Und auch privat muss er eine Entscheidung treffen … sich zwischen Beata und Dorisa entscheiden. Wem wird er folgen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieter Bührig
Mauerriss
Kriminalroman
Impressum
Dies ist kein Tatsachenbericht, sondern ein Tatsachenroman und erhebt nicht den Anspruch einer wissenschaftlichen Analyse der Zeit vor der Wende. Die Personen sowie die Handlung des Romans sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen wäre rein zufällig. Gleichwohl basiert vieles auf Tatsachen und enthält mannigfaltige Details aus der Realität. In den Anmerkungen am Schluss des Buches werden einige dieser Dinge kurz erläutert.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2014 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung / E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © World travel images – Fotolia.com
ISBN 978-3-8392-4528-6
Vorspiel
(In der Nacht zum 14. Dezember 1979, Westflügel des Gothaer Museums Schloss Friedenstein, DDR)
»In Deckung!«, rief der längste von den Dreien und nahm Reißaus. Den anderen beiden war dieser Befehl so vertraut, dass sie, ohne eine Sekunde zu zögern, zur Seite sprangen. Krachend fiel der Wurfanker auf den Rasen und hinterließ eine hässliche Narbe. Die Zinke hatte keinen Halt finden können und war an der regennassen Dachrinne abgeglitten.
»Idiot!«, schnauzte der Lange den Kleinen an. »So wird das nie was mit dir.«
Und der Dicke konnte es sich nicht verkneifen, hinzuzufügen: »Damit kannst du im Staatszirkus keine Karriere machen.«
»Schnauze!«, kommandierte der Lange. »Jetzt keine politischen Anspielungen!« Er buddelte den Wurfanker wieder frei, rollte das Kletterseil sorgfältig in großen Schleifen auf, sodass es sich nicht verheddern konnte, und trat ein paar Schritte zurück. »Ich werd’ das mal machen. Passt auf und haltet die Steigeisen bereit!« Er musterte den Dachvorsprung. »Da oben links, wo der Blitzableiter sich abzweigt, da wird es gehen. Außerdem sind wir da ganz dicht am Oberlicht dran.«
Wie ein geübter Diskuswerfer schwang er Anker samt Seilschlingen ein paar Mal hin und her, bis er das Bündel mit einem entschiedenen Ruck nach oben warf. Der Wurfanker verfing sich sofort an der Schelle des Blitzableiters.
»Na also, geht doch!«, prahlte der Lange. »Hat die Pionierausbildung mal zu was Gutem genutzt.« Dann prüfte er mit einem kurzen Ruck, ob das Kletterseil die Belastung aushielt.
»Alles OK!« Dem Dicken befahl er, das Sicherungsseil zu nehmen. Die beiden anderen schnallten sich Steigeisen unter die Stiefel. Der Kleine musste als Erster rauf, weil er angeblich das geringere Gewicht hatte. In Wahrheit wollte der Lange die eigene Haut retten und schickte den Kameraden vor, um zu sehen, ob das Seil wirklich halten würde. Wenn nicht, hätte der Kampf um das sozialistische Vaterland wieder einmal ein Opfer mehr gekostet. Hauptsache, er war es nicht.
Der Kleine streifte sich seine Arbeitshandschuhe über, klinkte sich den Karabinerhaken des Sicherungsseils an die Gürtelschnalle, befestigte eine zweite Kralle am Hosenbund und kletterte geschickt die Regenrinne hoch. Der Dicke führte es von unten nach. Oben angelangt, klammerte sich der Kleine an der Regenrinne fest und hangelte sich am Blitzableiter hoch, der von dort schräg bis zur Dachspitze führte. Alles hielt. Gute deutsche Wertarbeit, Genosse Dachdecker, ging es dem Kletterkünstler durch den Kopf.
Schnell erreichte er das Oberlicht. Mit einem kräftigen Tritt zerbrach er die Fensterscheibe. Der Klimaschreiber registrierte sofort einen Temperaturabfall. Um zwei Uhr nachts. Die restlichen Splitter entfernte der Mann mit seinen durch die Handschuhe geschützten Fingern. Dann hakte er die Reservekralle in den Fensterrahmen und führte das Sicherungsseil durch eine Öse. Das alles war für ihn Routine, das war Bestandteil der Pionierausbildung, um in ein feindliches Haus einzudringen.
Doch dieses Mal war es kein feindliches Haus, sondern im Gegenteil ein Kulturerbe des Arbeiter- und Bauernstaates. Aber darüber machte sich der Kleine keine Gedanken. Schließlich hatte er seine Befehle. Und die kamen von allerhöchster Stelle. Geheime Kommandosache. Zum Wohle der Werktätigen, wie man ihm mit geheimnisvoll bedeutsamer Miene erklärte.
Ohne Skrupel schwang er sich in den Raum hinein, schraubte seinen Karabinerhaken los und ließ ihn samt Leine nach unten gleiten: »Der Nächste bitte!«
Für den Langen war es nun ein leichtes, seinem Kumpan zu folgen, nachdem er den Rucksack mit den notwendigen Werkzeugen, Materialien und zusammengewickelten Transporttaschen über die Schulter geworfen hatte. Oben angekommen, faltete der Gruppenführer einen Lageplan auf. »Also. Wir gehen jetzt hier über die Dachkammern zum Wartungsraum. Von dort haben wir direkten Zugang zum Ausstellungssaal.«
»Und die Alarmanlage?«, fragte der Dicke besorgt.
»Dummkopf!«, schnauzte der andere ihn an. »Wenn ich was plane, dann achte ich auf jedes Detail. Ich weiß, dass die neue Alarmanlage erst in drei Tagen aktiviert werden soll.« Er lächelte vor sich hin. »Ich habe mir Rückendeckung von ganz oben verschafft.«
Das Notlicht leuchtete den Museumssaal nur spärlich aus, aber es reichte den beiden, um sich zurechtzufinden. Der Lange packte seinen Rucksack aus und entfaltete die Transportsäcke. Mit Kennerblick zeigte er auf einige Gemälde und kommandierte: »Also nur den da, die beiden dort drüben, den neben der Tür und den da hinten. Auf keinen Fall rührst du ein anderes Bild an, verstanden? Wir wollen die Kuh ja nur melken, nicht schlachten.«
Der Dicke verstand das zwar nicht, aber es war ihm egal. Befehl ist eben Befehl. Wird schon seine Richtigkeit haben. Immerhin war die Aktion Teil des Klassenkampfes, hatte man ihm versichert, da musste man nicht seinen eigenen Kopf bemühen. Er zog ein Teppichmesser aus der Hosentasche und wollte sich zuerst an das ›Selbstbildnis mit Sonnenblume‹ von Anthonis van Dyck heranmachen. Doch die Figur auf dem Gemälde lächelte ihn über die Schulter von der Seite her so entwaffnend an, dass er zögerte, das Messer anzusetzen. Eigentlich nicht übel, das Bild, überlegte der Kleine. Viel zu schade für den Kapitalismus. Könnte auch gut in meinem Schlafzimmer hängen. Susanne würde sich bestimmt freuen. Doch er wurde brutal aus seinen Träumen gerissen.
»Schwachkopf! Weg mit dem Messer! Wir schneiden die Bilder nicht aus, wir nehmen sie samt Rahmen mit.«
»Aber …«
»Schnauze. Ist Befehl. Wir hüllen sie jeweils in einen der Säcke und lassen sie nacheinander nach unten gleiten. Der weitere Abtransport ist schon organisiert.«
Die Aktion dauerte nicht länger als eine halbe Stunde. Nachdem die fünf Gemälde verschwunden waren, warf der Lange eine Rolle Tesafilm und einen Schraubenzieher aus Titan, so wie man ihn nur in der BRD herstellte, auf den Boden. Dann befahl er, auch ein Steigeisen liegenzulassen. ›Made in Solingen‹ stand darauf.
»Damit die Staatssicherheit morgen früh auf die richtige Fährte zum Klassenfeind geführt wird«, erklärte er dem verdutzten Kollegen. »Die sind doch so bescheuert, dass sie alles fressen, was man ihnen vor die Schnauze wirft.«
Der Kleine schwieg. Einen derart lockeren Umgang mit der Stasi war er nicht gewohnt. Besser die Klappe halten, als sich an der höheren Politik die Finger verbrennen, war seine Devise.
Dann begannen sie den Rückzug. Als sie durch den Wartungsraum kamen, bemerkte der Kleine einen Abreißkalender an der Wand. Er zeigte den 13. Dezember an. Als ordnungsliebender Bürger riss er das Blatt ab, denn Mitternacht war längst verstrichen. Das Zitat auf der Rückseite las er mit lauter Stimme vor:
Der Marxismus hat seine weltgeschichtliche Bedeutung als Ideologie des revolutionären Proletariats dadurch erlangt, dass er die wertvollsten Errungenschaften des bürgerlichen Zeitalters keineswegs ablehnte, sondern sich umgekehrt alles, was in der mehr als zweitausendjährigen Entwicklung des menschlichen Denkens und der menschlichen Kultur wertvoll war, aneignete und es verarbeitete.
W. I. Lenin: Über proletarische Kultur. Geschrieben 1920
»Was ich sage«, erwiderte der Lange mit einem sarkastischen Lächeln. »Wir eignen uns die bourgeoise Kunst an, um sie weiterzuverarbeiten. Devisenbeschaffung nennen die da oben so was. – Siehste, Kleiner, selbst bei einem Bruch kannste in der DDR noch was lernen!«
Der Kleine steckte sich das Kalenderblatt in die Brusttasche. Als Souvenir an seine geheime Mission zum Wohle des Arbeiter- und Bauernstaats. Susanne wird stolz auf ihn sein.
Die beiden bedienten sich des Seils, um wieder hinunterzuklettern. Eigentlich hätten sie einfacher die Treppen und die Türen benutzen können, denn es war klar, dass es weder Nachtwächter noch eine funktionierende Alarmanlage gab. Der Gruppenführer fand es jedoch sportlicher, auf gleichem Wege wieder umzukehren.
Die Leine ließen sie einfach hängen. Der Dicke und der Kleine schulterten jeweils zwei der in den Schutzhüllen gegen den Regen gesicherten Kunstwerke. Der Lange schnappte sich das fünfte Bild und die restlichen Utensilien. Sie durchschritten in südlicher Richtung den Rosengarten. Auf der Parkstraße, die den Schlossgarten von den Gleisanlagen beim Schlachthof trennte, war um diese Uhrzeit, zumal bei dem miesen Regenwetter, nichts los. Keine Menschenseele, kein Autoverkehr weit und breit. Vor dem Schlachthof stand ein Planwagen der Volksarmee. Der Lange befahl den beiden anderen, die Transporttaschen mit den Gemälden auf die Pritsche zu legen. Dann nahm er eine vorbereitete Plane und deckte sie über die kostbare Ladung. Zum Schluss legten sich die drei Einbrecher hochrangige Uniformen an, die hinter dem Rücksitz auf sie warteten. Der Lange setzte sich hinters Lenkrad und steuerte den Wagen in Richtung Norden.
Es wurde eine lange Fahrt, quer durch die Republik, bis hoch an die Ostseeküste.
Dort erwartete man sie bereits. Der Lange erkannte seinen Kontaktmann, einen örtlichen Parteifunktionär, sofort wieder, obwohl der sich heute als Fischer getarnt hatte. Gut, dass so spät am Abend kein wirklicher Fischer am Hafen war. Der hätte die Verkleidung sofort durchschaut. Der Mann roch weder nach Fischfang, noch zeichnete er sich durch den typisch wiegenden Gang aus, an dem man einen Hochseefischer schon von Weitem erkannte. Seine Kleidung war eine Spur zu sauber, das Hemd gebügelt, die Hände zu glatt und makellos, weil sie niemals mit schwerer Arbeit in Berührung kamen. Außerdem passte seine Thälmannmütze nicht unbedingt zur Kluft eines Fischers.
Der Mann öffnete eine Schuppentür und befahl: »Rasch, hier herein! Beeilt euch, wir haben nur zehn Minuten Zeit, bis die nächste Kontrolle kommt.«
»Das war aber anders abgesprochen«, erregte sich der Lange.
»Ja, das weiß ich auch«, entgegnete ihm der unechte Fischer. »Aber mit der heutigen Grenzbefreiung ist was schiefgelaufen. Ich kann dir das jetzt nicht lang und breit erklären.«
»Sollen wir die Ware dann nicht besser in der Mühlenbecker Zentrale der Kunst und Antiquitäten GmbH abliefern?«
»Spinnst du? Die können das doch gar nicht verbuchen.« Der Mann lachte kurz auf. »Da kommt nur das Zeug aus dem ›offiziellen‹ Kunstraub hin, nicht das aus einem geheimen Bruch. Dafür gibt es eine Sonderweisung von ganz ganz oben. – Also, nicht lange diskutiert: Schafft das Zeugs nach da hinten in den Schuppen und haut so schnell wie möglich ab! Alles andere kannst du getrost mir überlassen.«
Die Transporttaschen mit den Gemälden verschwanden in einer rückwärtigen Gerätekammer. »Hier, Genosse, quittier mal«, verlangte der Gruppenführer. »Fünf Bilderrahmen unbekannter Herkunft samt Leinwand im Zuge der Aktion Sonnenblume unversehrt übergeben. – Nicht, dass es heißt, wir hätten sie uns unter den Nagel gerissen.«
Eigentlich hatte er jetzt erwartet, sein Gegenüber würde einen mit Geldscheinen prall gefüllten Briefumschlag aus der Jackentasche holen. Stattdessen zückte dieser einen Zehn-Mark-Schein: »Hier, fürs Erste. Wegen eurer Spritkosten. Die Kohle kriegt ihr später, wenn die Operation abgeschlossen ist.«
»Verdammt, was soll das?«, empörte sich der Lange. »Wir halten den Hals hin fürs Vaterland und werden mit Almosen abgespeist?«
Inzwischen hatten auch seine beiden Kumpane mitbekommen, was hier ablief. »Wir haben absolut einwandfrei gearbeitet«, schaltete sich der Kleine ein. »Echte Akrobatik war das, um an das Zeugs heranzukommen!«
»Genau«, ergänzte der Dicke. »Saubere Arbeit. Besser noch, als vor zwei Jahren bei dem Sophienschatz von Dresden! – Damals hat’s für jeden von uns zehn Riesen gebracht, und jetzt sollen wir mit leeren Händen zurückkehren?«
»Klappe!«, pfiff ihn der Lange zurück. »Revolutionäre Disziplin! Erstens weißt du, dass es uns der Genosse vom Bereich ›Kommerzielle Koordinierung‹ verboten hat, auch nur ein Wort darüber zu verlieren, und zweitens solltest du begriffen haben, dass man in der Partei weiß, was man macht!«
»Die Partei, die Partei, die hat immer recht …«, begann der Kleine vor sich hin zu singen.
»Schluss jetzt!«, kommandierte der angebliche Fischer. »Wir stehen hier nicht auf der Bühne eines Schmierentheaters! Das ist Klassenkampf, Genossen – und zwar an vorderster Front, wenn ihr versteht, was ich meine. Verschwindet jetzt, wir sprechen uns später!«
»Schon recht«, antwortete der Lange. »Aber auch Klassenkämpfer brauchen ihren Lohn! – Du weißt ja, wo wir zu erreichen sind.«
Er gab den beiden anderen ein Zeichen, woraufhin sich das Trio mit dem Planwagen der Volksarmee wieder absetzte.
Enttäuscht war der Gruppenführer dennoch. Er konnte nicht ahnen, dass die Gemälde für ein Jahrzehnt in einem geheimen Lagerschuppen verschwanden. Der Transfer über das Meer rüber nach Skandinavien musste aus Gründen, die die drei Einbrecher nie erfuhren, bis auf Weiteres verschoben werden.
Ihren Lohn haben sie nie bekommen. – Gefasst und wegen illegalen Kunstdiebstahls zur Rechenschaft gezogen wurden sie allerdings auch nicht.
*
Aber auch die vierköpfige Familie aus Magdeburg, die ihren Weihnachtsurlaub auf der Insel Poel verbrachte, wurde enttäuscht. Es war ein Scheinurlaub. Sie hatte ihre Republikflucht von langer Hand vorbereitet und fast ihr gesamtes Vermögen geopfert. Nun stand sie mit ihrem kleinen Notgepäck auf dem Friedhof, der die Inselkirche umgab. Niemand kam und holte sie ab, obwohl das bis ins kleinste Detail abgesprochen war. Niemand erklärte ihnen, was schiefgelaufen war. Besonders die beiden kleinen Jungen waren sauer. Ihre Eltern hatten ihnen versprochen, sie würden in den Norden der Insel fahren, nach Gollwitz, zu dem alten Seeräuberhafen, der schon dem wilden Störtebeker als Unterschlupf diente.
Verbittert kehrten sie in ihre Pension zurück und verbrachten den Resturlaub wie gebucht. Wer weiß, vielleicht ergab sich ja später eine bessere Gelegenheit.
Die Familie musste ebenfalls ein Jahrzehnt warten. Aber dann lohnte sich eine illegale Flucht nicht mehr, weil sich die Verhältnisse grundlegend geändert hatten.
*
Wenige Tage später trafen sich zwei Männer auf dem gleichen Friedhof. Der eine war hier gewissermaßen zu Hause, der andere tat, als wollte er das Grab seiner Eltern auf Weihnachten vorbereiten. So fiel ihre Zusammenkunft niemandem auf. Die Stützpunkte der Grenzbrigade waren weit weg, und die sogenannten ›Freiwilligen Grenzhelfer‹, die die Aufgabe hatten, auffällige Bewegungen von Personen, Autos oder Booten zu melden, kamen hier sowieso nie vorbei.
Die beiden setzten sich auf eine der wackeligen Bänke an der Südseite der Kirche. Die Wintersonne stand so tief, dass sie Mühe hatte, den Wall, der einst Bestandteil der Festung Poel war, zu überwinden. Dennoch blendete sie die beiden Männer, ohne sie nennenswert zu wärmen.
Der Ältere senkte den Kopf und zeichnete mit der Schuhspitze ein Kreuz in den Sand.
»Warum ist das dieses Mal schiefgelaufen?«, fragte er in einem leisen, aber bestimmten Ton. »Sie wissen, dass mir das Schicksal meiner Schützlinge mindestens genauso viel wert ist wie Ihnen Ihre Antiquitäten.«
Der andere, ein kräftig gebauter Mann, der auf den ersten Blick wie ein Fischer aussah, rückte seine Thälmannmütze zurecht und schaute rüber zum Kirchsee, der schmalen, langen Bucht, die das Inselzentrum mit der Wismarbucht verbindet. »Genosse Pastor, es ist bedauerlich, aber so etwas kommt vor. Selbst im Sozialismus, wo alles nach Plan geht.«
»Ach, hören Sie doch auf!«, unterbrach ihn der Ältere. »Erstens habe ich Ihnen schon tausend Mal gesagt, dass Sie mich nicht mit Genosse anreden sollen. ›Herr Pastor‹ genügt mir. Und zweitens habe ich den Eindruck, dass eure Pläne so verschlungen sind, dass nicht einmal die Spitze weiß, was an der Basis abläuft.«
»Na«, antwortete der Jüngere mit einem zynischen Lächeln, »da haben Sie es ja auch einfacher. Ihr Chef da oben im Himmel sieht angeblich sowieso alles und weiß alles. – Warum hat er Ihnen denn kein Zeichen gegeben, dass es in jener Nacht oben auf dem Gollwitzer Küstenbeobachtungsturm einen unvorhergesehenen Wachwechsel gab und wir den Neuen nicht rechtzeitig in den Sonderbefehl zur Freischaltung der Grenze einweihen konnten? Den alten Klipphafen durften wir aus Sicherheitsgründen nicht benutzen. Schließlich, und das wissen Sie genauso gut wie ich, haben wir es hier mit einer geheimen Kommandosache zu tun.«
»Ja, und diese Geheimniskrämerei ist leider auch das, was uns beide verbindet. Sie sorgen dafür, dass dem Volk der Anblick bourgeoiser Kunstwerke erspart wird, und ich sorge dafür, dass es Ausreisewillige gibt, die eure Ware sicher in den Westen begleiten.« Der Pastor machte eine kleine Pause und lächelte vor sich hin. »So dienen wir beide dem realen Sozialismus. Sie frischen die Devisenkasse auf und ich befreie Sie von den potentiellen Feinden der Republik. – Sie sehen, der Sozialismus braucht uns beide, also erwarte ich, dass es in Zukunft nie wieder zu solch einer Pleite kommt.«
Der Pastor wendete sich mit einem Ruck zu seinem Nachbarn und blickte ihm mit einer Kälte ins Gesicht, die jener dem Gottesdiener nie zugetraut hätte. »Wenn beim nächsten Mal wieder was schiefläuft, lasse ich Sie hochgehen! Mal sehen, was unsere Bürger dann zu Ihrem realen Sozialismus sagen.«
»Nun beruhigen Sie sich! Ich gebe zu, dass Sie uns in der Hand haben, weil Sie zu viele Details über unsere Operationen wissen. Dafür gestatten wir Ihnen ja auch, dass Sie hin und wieder eines Ihrer Schäfchen in den goldenen Westen bringen.«
Er lachte kurz auf. »Sie haben recht. Gewissermaßen als Begleitpersonal für unsere Devisenbringer. Aber, – was verstehen Sie schon vom Sozialismus! Wer wie wir so nahe neben dem Kapitalismus lebt, muss gelegentlich auch zu unkonventionellen Mitteln greifen, um im globalen Klassenkampf zu überleben.«
Der Mann richtete sich auf und begann zu deklamieren, als wäre er auf einer Parteiveranstaltung. »Der Genosse Schalck-Golodkowski hat klar gesagt, dass es die Aufgabe der Partei ist, das entwickelte gesellschaftliche System des Sozialismus umfassend zu gestalten, und dazu gehört es, durch offizielle und nichtoffizielle Maßnahmen – ich wiederhole, er hat das wörtlich so gesagt: ›und nichtoffizielle Maßnahmen‹! – zusätzliche Devisenquellen zu erschließen. Also eben auch durch die Veräußerung von, wie Sie nicht ganz korrekt sagten, bourgeoiser Kunstwerke. Genauer gesagt handelt es sich dabei um Werke der unteren Kategorie II, das sind Objekte minderer nationaler Bedeutung, und um Objekte der Kategorie III, also Werke von nur lokalem Wert. – Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob Sie als Fluchthelfer das überhaupt verstehen.«
»Vielleicht verstehe ich vom Sozialismus mehr als Sie. Ich meine einen, der ohne Mauern, ohne Schießbefehl, ohne Bürokratie, Bonzentum und Bespitzelung auskommt. Einen, wo die Menschen freiwillig bleiben. Und zwar gern. Einen, wo der Staat dem Volke dient und nicht umgekehrt. Und einen, in dem man das kulturelle Erbe des Volkes würdigt und nicht verscherbelt.«
Der Mann mit der Thälmannmütze stand auf und stellte sich so hin, dass er dem Pastor die Sonne verstellte. »Ihr Kirchenleute seid schon komische Vögel. Eigentlich müsste ich Sie wegen dieser Bemerkung anzeigen, das wissen Sie. Aber ich bin ja auch nur ein Mensch, und schließlich bindet uns unser stillschweigendes Abkommen, das wichtiger ist als alles Persönliche.«
Er schaute kurz in die Runde, um sicher zu sein, dass niemand sie beobachtete, und fügte mit einem spöttischen Unterton hinzu: »Meine Arbeit ruft. Ich kann es mir nicht leisten, hier so viel Zeit zu verplempern, um über Gott und den Sozialismus zu debattieren. – Wissen Sie was? Bei unserer nächsten Aktion werde ich vorher in Ihre Kirche kommen und Ihren Gott um eine Wahrsagung bitten, ob denn auch alles nach Plan gehen wird. Vielleicht funktioniert Ihr Draht ja besser als meiner zur Parteizentrale nach Berlin.«
Kapitel 1 – Der Gaffelschoner
(etwa ein Jahrzehnt später)
Eine starke Windbö zerriss für einen Augenblick den dichten Nebelvorhang und öffnete den Blick in die Weite. War da was oder hatte er sich getäuscht? Dem alten Leuchtturmwärter schien, als glänzte das Segel eines Gaffelschoners am Horizont, dort, jenseits der Nebelfelder, wo die Sonne das noch kalte Wasser des Meeres mühsam zu erwärmen versuchte.
Von hier oben auf dem Leuchtturm hatte er einen guten Überblick. Die ferne Erscheinung wirkte auf ihn fast wie der Vorbote einer neuen Zeit. Irgendetwas lag in der Luft. Nicht nur der Himmel sah nach Veränderung aus. Auch unten bei den Menschen auf der Insel und drüben in der nahen Stadt brodelte es. Im Laufe der Jahre hatte er ein Gefühl dafür bekommen. Die Leute waren unzufrieden. Immer häufiger standen sie in kleinen Gruppen zusammen und diskutierten mit heftigen Gesten. Noch im vergangenen Jahr, wenn sich ein Parteifunktionär näherte – und diese Sorte von Mensch erkannte man schon von Weitem –, lösten sich die Gruppen schnell auf, und man zerstreute sich in alle Himmelsrichtungen. Doch heute war das anders. Auch die Menschen hatten sich verändert. Sie sind mutiger geworden, insbesondere die Inselbewohner, die seit jeher als kantiger, rauer Menschenschlag galten. Heute blieben sie zusammen stehen und zeigten den Bonzen bewusst die kalte Schulter.
Das Land stand am Rand eines gewaltigen Umbruchs, dessen war sich der Leuchtturmwärter sicher. Er beschloss, ein Tagebuch zu führen. Er kramte sich ein altes vergilbtes leeres Schulheft heraus und begann, alles sorgfältig mit seinem Primus Druckkugelschreiber Modell 375 vom VEB Schreibgeräte niederzuschreiben.
Seine Aufzeichnungen begannen mit dem geheimnisvollen Gaffelschoner. Er erinnerte sich. Es war vor etwa 20 Jahren. An jenem Morgen vor dem verheerenden Sturm hatte er ihn das erste Mal weit draußen am Horizont gesichtet. Schoner dieser Art verkehrten seit langer Zeit nicht mehr in den hiesigen Gewässern. Damals erregte er seine Aufmerksamkeit, weil er nur mit einem einzigen Segel, mit dem Außenklüver, der weit vorn über den Bug hinaus ragte, verhältnismäßig schnell vorankam.
In der gleichen Nacht kenterte die ›Robbe‹ im Sturm. Das Fischerehepaar kam dabei ums Leben und hinterließ Christian, ihren einzigen Sohn. Pastor Laurentius hatte damals die Trauerfeier in seiner Kirche abgehalten. Es war das letzte Mal, dass das Gotteshaus mit Leben gefüllt wurde. Vorher war auch das anders. Da kamen die Fischer jeden Sonntag und beteten um guten Fang und glückliche Heimkehr. Doch der Fischerberuf starb aus in der Bucht, und damit das Leben in der Kirche. Laurentius hatte danach das Waisenkind eine Zeit lang betreut, bis es auf eigenen Füßen stehen konnte. Er bekam einen guten Posten in der Stadtverwaltung, der ihm genug Zeit ließ, sich nebenbei seinen literarischen Studien zu widmen.
Der alte Leuchtturmwärter erinnerte sich aber an noch mehr. Die Nacht des Unglücks der ›Robbe‹ war auch an seinem Leben nicht spurlos vorbeigegangen. Er hatte in jener Nacht Dienst. Die Signalanlage spukte zwar schon seit geraumer Zeit, aber er war zu sehr in seinen neuen Kunstkalender vertieft, als dass er den Fehler beachtete. Die ›Robbe‹ war möglicherweise durch das defekte Leuchtsignal abgelenkt worden. So fühlte der Alte eine Mitschuld am Tode des Fischerehepaares.
Während er die Augen zusammenkniff, um Genaueres zu erkennen, tastete seine Hand zum Fernrohr, das wie immer griffbereit auf der Fensterbank lag. Es fühlte sich kalt, doch vertraut an, nicht das neueste Modell. Schon seine Vorgänger hatten es benutzt. Der Alte wusste, das hier konnte nicht lügen. Als er vor ein paar Monaten in der Stadt bei einem Optiker vorbeischaute, ließ er sich die neusten Objektive zeigen. Er richtete sie auf die Schiffe im Hafen, und er erschrak über das, was er da sah. Diese neuen Dinger belogen ihn, da war er sich sicher. Sein altes Fernrohr aber log nicht, meinte er, es zeigte ihm stets die Wahrheit. Trotzdem kaufte er ein neues. Vielleicht mussten sich seine Augen erst an die moderne Technik gewöhnen. Das heißt, er kaufte es nicht wirklich, er tauschte es gegen eines seiner antiken Winkelmesser ein, von denen er ohnehin mehrere besaß.
Der Alte schob seine Brille auf die Stirn, langte sich umständlich ein an den Rändern ausgefranstes leinenes Taschentuch aus der Hosentasche seines dunkelblauen, verwaschenen Arbeitsanzugs, putzte damit liebevoll die Linsen des Fernglases und setzte dies bedächtig vor die Augen. Die Ellenbogen stützte er fest an seinem Oberkörper ab, damit es nicht wackelte. In letzter Zeit musste er das immer häufiger tun, denn seine Hände zitterten ein wenig, als wollten sie ihm nicht mehr so recht gehorchen.
Dann richtete er das Instrument auf die Stelle am Horizont, von der er meinte, etwas gesehen zu haben. Er brauchte nicht zu suchen, schließlich kannte er seine Bucht genau, bei jedem Wetter, auch bei Nacht und Nebel. Doch so sehr er sich bemühte, es gelang ihm nicht, die sich inzwischen längst wieder zusammengezogene Nebelwand zu durchdringen. Er wurde den Eindruck nicht los, als hätte ihm der liebe Gott eines der ausgebleichten, grauweißen Tischtücher, die seit Jahrzehnten in der Aussteuertruhe seiner verstorbenen Gattin ruhten, über das Fernrohr gelegt, damit er nicht die Geheimnisse des Allmächtigen erschauen könnte.
Nur der helle Lichtstrahl des regelmäßig kreisenden Leuchtfeuers unterbrach im festen Takt das graue Einerlei. Enttäuscht legte der Alte das Glas auf die linke Seite der Fensterbank. Dann öffnete er den rechten Fensterflügel. Vielleicht war ja etwas zu hören. Er kannte den Klang seiner Bucht sehr genau und wusste, wenn der Blick einmal versagte, die Dinge dem Gehör nach zu unterscheiden. Über seinem Kopf summte die Drehlinsenoptik, die das weiße Licht der Signallampe alle zwei Minuten zweimal, im Abstand von 15 Sekunden für 13 Sekunden unterbrach, im wohlvertrauten Rhythmus. Für den Alten war es die Musik seines Lebens. Sie begleitete ihn bei Tag und bei Nacht, selbst, wenn er weit draußen allein durch die steinübersäten Strände streifte. Wahrscheinlich hatte sein Herzschlag schon längst den Rhythmus des Leuchtfeuers als den seinigen anerkannt. Er wusste genau, dass er hier überflüssig war. Die Signalanlage wurde schon seit über zehn Jahren von der Verkehrszentrale gesteuert und überwacht.
Als die Zeit reif war, vom manuellen zum automatisierten Betrieb umzusteigen, baute man seine Stelle ab. Da er damals ohnehin kurz vor der Pensionierung stand, ging der Wechsel fast reibungslos vonstatten. Nur als man ihn auch noch aus seiner Dienstwohnung, einem kleinen, an den Turm gelehnten Anbau, verjagen wollte, stellte er sich quer. Nach langem Hin und Her erlaubte ihm der Bezirksrat, sich als Hausmeister der Anlage anzunehmen, vorausgesetzt, er stellte keine extra Gehaltsforderungen. Das hatte der Alte sowieso nicht im Sinn, also durfte er weiterhin über seinem Reich herrschen, auch wenn es wie von Geisterhand ferngesteuert wurde. Immerhin putzte er regelmäßig die Turmfenster und die Spiegeloptik, ölte die Mechanik und säuberte den Rundgang, der auf der obersten Ebene um den Drehkörper herum über den schlanken Turm hinausragte, von Möwenschiet. Überhaupt sah er seine Hauptaufgabe darin, die Vögel vom Leuchtfeuer fernzuhalten, denn er befürchtete, sie könnten den Lichtrhythmus stören und dadurch die Schiffe in der Ferne fehllenken.
Durch das offene Fenster drang feuchtkalte Luft in den runden Raum, der sich im obersten Stockwerk des Leuchtturms direkt unterhalb der Laternenmechanik befand. Der Alte atmete tief durch. Er genoss die Frische und lehnte sich weit zum Fenster hinaus. Draußen herrschte, abgesehen von dem unerbittlichen Rhythmus des Lichtpendels, nur der Klang der Meeresbrandung. Hin und wieder schlug unten in dem kleinen Fischereihafen, der sich zu Füßen des Leuchtturms befand, eine Leine aufpeitschend gegen die Fahnenstange. Der Leuchtturmwärter hatte sich an diesen hohlen Klang gewöhnt, sodass er ihn gar nicht mehr wahrnahm. Die Fischerkutter schaukelten im trüben Licht einer Uferlaterne vor sich hin. Ab und zu rieben sich die Fender quietschend an der Kaimauer. Der Wellengang hielt sich in Grenzen, da die Mole die Hafeneinfahrt vor dem Wind schützte.
Allmählich klumpte sich die Nebeldecke zu mächtigen Gebilden zusammen, die den riesigen Findlingen ähnelten, die am Ufer lagen, um sich von den brechenden Wellen langsam, aber sicher abschleifen zu lassen. Der Rhythmus dieser Brandung bildete einen harmonischen Kontrapunkt zu dem der Drehlinsenoptik.
Von Südwesten zog eine Gewitterfront über das Land auf. Schwere, bizarr geformte Wolken hingen über dem Himmel, als hätten sich sämtliche Luftgeister der Umgebung zu einem unheilvollen Teufelstanz versammelt. Der Alte wusste dieses Naturschauspiel genau zu deuten. Wenn man lange genug auf einem Leuchtturm gelebt hat, erkannte man bereits an der Form des Wellenganges und an der Farbe der Gischt, wie das Wetter wurde. Bei dieser Wetterlage wird sich niemand mit einem Gaffelschoner aufs Meer wagen, dachte sich der Alte, es sei denn, er wollte sich unbedingt den Hals brechen. Das vorhin muss eine Täuschung gewesen sein. Von einem Segelboot nichts zu sehen, nichts zu hören.
Schon wollte er das Fenster wieder schließen, als von weit entfernt Fetzen von Orgeltönen zu ihm mit dem Wind hinaufwehten. Pastor Laurentius übte in seiner Kirche mal wieder Bach-Choräle. Der Alte auf dem Leuchtturm kannte das Stück: ›Wo soll ich fliehen hin‹. Doch weil die Luft des altersschwachen Windwerks nicht mehr hergab und weil die Pedale kaum bespielbar waren, da sie hoffnungslos klemmten, klang das Werk recht gewöhnungsbedürftig. Und weil der Pastor nicht gerade als ein Virtuose auf seinem Instrument bezeichnet werden konnte, perlten die Töne nur langsam durch dessen Finger. Der Leuchtturmwärter musste unwillkürlich schmunzeln. Der spielt so langsam, wie es sich für einen echten Insulaner geziemt, dachte er. Wird Zeit, ihn mit einem Schachspiel von seiner Orgelliteratur abzulenken. Das aber war nur ein Vorwand. Eigentlich ging es dem Alten darum, bei seinem Nachbarn umsonst die Tageszeitung lesen zu können, denn für ein eigenes Abonnement fehlte ihm das Geld.
Er schloss das Turmfenster. Es hatte inzwischen angefangen zu regnen. Er musterte die Widerspiegelung seines Gesichts in der Fensterscheibe. Die Tropfen auf der Außenseite verzerrten sein Ebenbild, als sei er pockennarbig. Der Alte erkannte sich kaum wieder, denn er hatte seit Monaten nicht mehr vorm Spiegel gestanden, um sich zu rasieren. Er erschrak. War er schon so gealtert? Sein schütteres Haar erschien ihm deutlich dünner geworden zu sein. Und grau war es, so grau wie die Nebelbänke am Horizont. Die Augen hatten das geheimnisvolle Leuchten verloren, das ihn einst so jugendlich machte, und die Fettpölsterchen um seinen Mundwinkel herum hingen herab, weil sie sich den Gesetzen der Schwerkraft unterwarfen. War er inzwischen doch der zerknitterte Alte geworden, der er nie in seiner Jugend werden wollte?
Eigentlich hieß er Hans de la Motte Fouqué und stammte aus einem Adelsgeschlecht, das seinen Ursprung in der Normandie hatte, einer Seefahrergeneration von Hugenotten, die aus religiösen Gründen ihre Heimat verlassen musste und teilweise auch in Norddeutschland ansässig wurde. Jetzt, unter den Bedingungen in der DDR, mochte der Alte seinen Namen nicht an die große Glocke hängen. An seiner Haustür stand nur schlicht ›Fouqué‹. Niemand in seiner Umgebung ahnte von seiner Herkunft. Die meisten kannten nicht einmal seinen Namen. Man nannte ihn den ›alten Leuchtturmwärter‹ oder einfach nur ›den Alten‹. Ihm selbst genügte das, denn er meinte, dass man sich in einem sozialistischen Land besser nicht an seine adlige Herkunft erinnerte. Das Einzige, was ihn damit verband, war die umfangreiche Sammlung nautischer Antiquitäten, die das Turmzimmer und Teile seiner Wohnung vollstellte. Es handelte sich größtenteils um Erbstücke. Und, wenn er mal in die Hauptstadt reiste, erstand er dort das eine oder andere Kleinod.
Früher erhielt er noch ab und zu Pakete von seinen Verwandten aus Westdeutschland, Frankreich und Norwegen. Doch als der Zoll anfing, misstrauisch zu werden, brach er alle Kontakte ab. Das hatte ihn damals sehr mürbe gemacht.
Statt sich über seine Vergangenheit zu grämen, gab er sich einen Ruck. Innerlich empfand er sich keineswegs gealtert. Er ließ seinen Blick durch das enge, runde Turmzimmer schweifen. An der Wand hing neben dem Fenster eine längst veraltete Seekarte der Bucht. Generationen hatten darin ihre Kurse mit Bleistiftlinien eingetragen und Anmerkungen hinzugefügt, die inzwischen so verblichen waren, dass man sie nicht mehr entziffern konnte. Ein Fremder hätte den Plan eines Schatzsuchers vermutet. Aber Schätze gab es hier nicht, das wusste der Alte zu gut, schließlich kannte er jeden Zentimeter der Bucht. Er brauchte die Seekarte seit Jahrzehnten nicht. Sie ähnelte einem niederländischen Stillleben, indem auch sie von der Vergänglichkeit des Lebens erzählte.
Die anderen Bilder, die sorgfältig eingerahmt ringsum hingen, berichteten von der Fülle des maritimen Lebens. Alles sogenannte Sailing Cards, also kunstvoll ausgestaltete Werbeplakate, die An- und Abfahrten von Überseeseglern ankündigten, für exotische Seereisen warben oder auf gewinnträchtige Aktien hinwiesen, die man für Charterschiffe erwerben konnte. Der alte Leuchtturmwärter war stolz auf seine Sammlung. Er wusste, dass es die umfangreichste dieser Art im gesamten Ostseeraum war. Wertvolle Stücke hingen hier und unten in seiner Wohnung, unter anderem eine Sailing Card aus dem Jahre 1860, die die Abfahrt des amerikanischen Klippers ›Stars and Stripes‹ unter Kapitän Robert Cleaves ankündigte. Auf dem Sims über der Eingangsluke zu dem Turmzimmer thronte ein aus 16 Delfter Kacheln zusammengesetztes Seefahrermotiv aus dem 17. Jahrhundert, das den Walfang einer holländischen Fangflotte zeigte. Daneben standen nicht weniger kostbare Sanduhren, die den Seefahrern zur Navigation dienten, darunter eine sehr wertvolle Orgelpfeifen-Sanduhr aus dem 16. Jahrhundert, die Viertelstunden, halbe Stunden, Dreiviertelstunden und die Stunde anzeigen konnte. Seine staubempfindlichen Navigationsinstrumente aus Messing, wie die Sextanten und ein Nocturlabium – eine Art Sonnenuhr für die Sterne, die es ermöglichte, die Uhrzeit während der Nacht zu bestimmen – lagerte er unten in seiner Wohnung in Pappkartons. Er wollte seine Schätze nicht gleich jedem Besucher vor Augen führen. Gelegentlich holte er sich das eine oder andere Stück hervor, pflegte es und erfreute sich an seinem Anblick. Manchmal nahm er einen Sextanten mit ans Fenster, um sich in seiner Anwendung zu üben.
Der Alte musterte zufrieden seine Antiquitäten und stieg bedächtig die schmale Wendeltreppe hinunter zum Turmeingang. Unten in seiner Wohnung wandte er sich den Chronometern zu, die auf den niedrigen Schränken und den Fensterbrettern herumstanden. Ihr leises Ticken passte sich genau dem sonoren Rhythmus der Drehlinsenoptik an, bildete gewissermaßen einen feingliedrigen Unterrhythmus.
Er hatte längst mitbekommen, dass sich das alte Uhrwerk seines Großvaters, das auf dem Sims neben der Eingangstür stand, wieder einmal nicht an das Gesetz der Zeit halten wollte. Völlig dissonant behauptete es sich seinen eigenen Zeitschlag. Das durfte der Alte natürlich nicht durchgehen lassen, wenn er jetzt seinen Turm verlassen wollte. Wie einen unartigen Schüler schimpfte er die Standuhr aus, obwohl sie wegen ihrer Altersschwäche ja nichts dafür konnte, und brachte sie mit einer kurzen Drehbewegung seiner linken Hand wieder auf Trapp. Mit der Rechten angelte er sich seinen gelben, ölverschmierten Friesennerz vom Haken. Dann schlüpfte er in seine blauen Gummistiefel, zog sich die Öljacke über, kontrollierte mit einem letzten Rundblick, ob alles in Ordnung war, und trat hinaus.
Es dunkelte bereits. Ein kräftiger Südwestwind empfing ihn, als er die schwergängige Eisentür öffnete. Er musste sie gut festhalten, damit der Wind sie nicht gegen die Mauer drückte. Sorgfältig verschloss er die Tür hinter sich, obwohl das eigentlich genauso überflüssig war wie seine gesamte Existenz hier draußen auf verlorenem Posten. Wer hätte schon Interesse daran, in einen automatisierten Leuchtturm einzubrechen, in dem es – so schien es jedenfalls – nichts zu holen gab außer dem Rhythmus einer verlorenen Zeit?
Er stieg auf sein Fahrrad, band sich die Kapuze seiner Öljacke unterm Kinn zu und trat kräftig in die Pedale. Er bemerkte nicht, dass in dem Moment, als er außer Sichtweite war, ein Mann das kleine Wachgebäude der Grenzübergangsstelle am landseitigen Ende der Nordmole verließ und zielsicher zur Eingangstür des schräg gegenüberliegenden Leuchtturms huschte. Dort hantierte er so geschickt an dem Schloss herum, dass es im Nu aufsprang. Dann verschwand der Mann im Inneren des Gebäudes.
Die Regenmassen prallten dem Radfahrer entgegen, als wollten sie ihn hindern, hinüber zum Pfarrhaus zu kommen. Doch der Alte war sich sicher, dass ihn der Pastor jetzt genauso brauchte, wie er ihn. Den Weg konnte er nur erahnen, weil die schweren Wolken das Gelände verdunkelten.
Nach einer Viertelstunde erkannte er die Kirchturmspitze. Das Orgelspiel hatte schon seit geraumer Zeit aufgehört. Er wusste nun, dass sich der Pastor in sein bescheidenes Pfarrhaus zurückgezogen hatte. Bald sah er das Stubenlicht. Zum Glück lag der Hauseingang auf der Leeseite, sodass sich der Alte in Ruhe das Regenwasser von seinem Ölzeug abschütteln konnte, bevor er die gute Stube des Pastors betrat. Er hatte es sich abgewöhnt, vorher den Türklopfer zu betätigen, denn der klemmte genauso wie die Pedale der Kirchenorgel. Außerdem wusste der Alte, dass der Nachbar seinen Besuch erwartete.
*
»Sauwetter heute.«
»Ungewöhnlich für die Jahreszeit.«
»Jou. War früher nicht so.«
»Waren halt andere Zeiten.«
»Dann wollen wir mal.«
Pastor Laurentius und sein Gast nahmen am Wohnzimmertisch Platz. Noch war es dort kalt, denn der Hausherr hatte den Kamin gerade erst in Gang gesetzt. Die hellen Flammen des Anmachholzes züngelten wild in der Ofenkassette herum. Der Pastor legte ein dickes Holzscheit nach. Langsam beruhigte sich das Feuer. Es entwickelte sich bald eine dunkelrote Glut, die die kleine Stube in gemütliche Wärme tauchte.