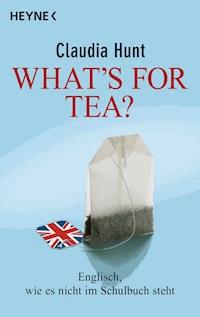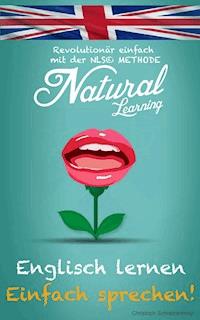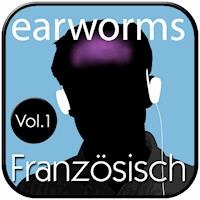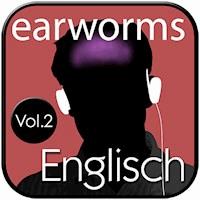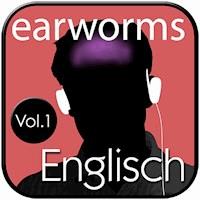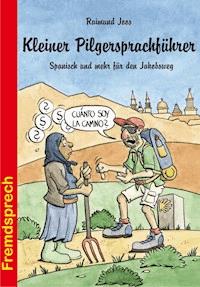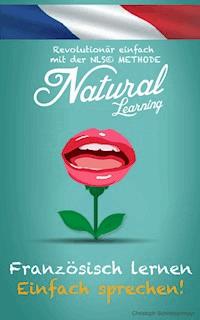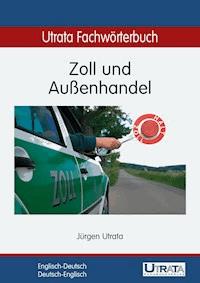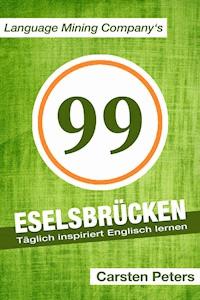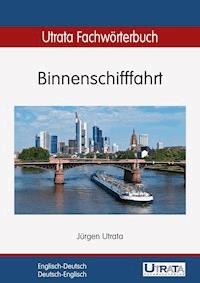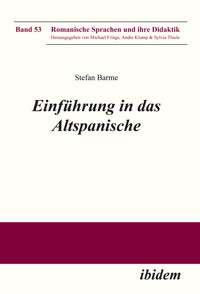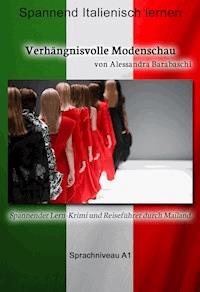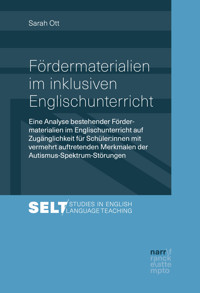
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Fremdsprachen
- Serie: Studies in English Language Teaching /Augsburger Studien zur Englischdidaktik
- Sprache: Deutsch
Der Fokus dieser Forschungsarbeit liegt auf zugänglichen Bildungsmedien für autistische Schüler:innen im inklusiven Englischunterricht, einem in der deutschen Forschungslandschaft trotz hoher Betroffenenquote unerforschten Gebiet, mit dem Ziel, die Forschung zur Individualisierung von Bildungsmedien für autistische Schüler:innen im inklusiven Unterricht durch eine Möglichkeit systematischer Anpassungen von Bildungsmedien voranzutreiben. Hierfür werden auf Grundlage der Erfahrungsberichte von Lehrkräften eine Bedarfsübersicht autistischer Schüler:innen bezüglich eines für sie zugänglichen Bildungsmediums erstellt und anschließend individualisierte Bildungsmedien mithilfe von Fragebögen zur individuellen Zone der nächsten Entwicklung (vgl. Vygotsky 1978) für die jeweiligen autistischen Schüler:innen adaptiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 771
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Augsburger Studien zur Englischdidaktik
Edited by Engelbert Thaler (Augsburg) and Petra Kirchhoff (Augsburg)
Editorial Board:
Sabine Doff (Bremen), Michaela Sambanis (Berlin), Daniela Elsner (Frankfurt am Main), Carola Surkamp (Regensburg), Christiane Lütge (München)
Volume 15
Sarah Ott
Fördermaterialien im inklusiven Englischunterricht
Eine Analyse bestehender Fördermaterialien im Englischunterricht auf Zugänglichkeit für Schüler:innen mit vermehrt auftretenden Merkmalen der Autismus-Spektrum-Störungen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
DOI: https://doi.org/10.24053/9783381143221
© 2025 · Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
Dischingerweg 5 · D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.de
eMail: [email protected]
ISSN 2367-3826
ISBN 978-3-381-14321-4 (Print)
ISBN 978-3-381-14323-8 (ePub)
Inhaltsverzeichnis
1Einleitung und Fragestellung
1.1Einführung in den Problembereich
1.2Zielsetzung der Arbeit
1.3Forschungsfragen und Aufbau der Arbeit
2Grundlagen der Inklusion
2.1Inklusions- und separationsbezogene Gruppentheorien
2.1.1Begriffliche Grundlagen von der Extinktion zur Integration
2.1.2Inklusion
2.1.2.1Zielvorgaben
2.1.2.2Zwischen Bestrebungen und Realisierung von Inklusion
2.1.3Ein historischer Abriss der Behinderten-, Integrations- und Inklusionsbewegung in Deutschland
2.2Inklusion im engeren Sinne
2.2.1Die deutsche Förderquote im Vergleich
2.2.2Definitionen von Behinderung
2.2.2.1Medizinische Aspekte: ‚Schädigung‘
2.2.2.2Sozialrechtliche Aspekte: ‚Beeinträchtigung‘
2.2.2.3Interaktionistische Aspekte: ‚Behinderung‘
2.2.2.4Wechselwirkungen zwischen bio-psycho-sozialen Komponenten bei der ICF
2.2.2.5‚Sonderpädagogischer Förderbedarf‘
2.2.3Ethnische Herkunft in Verbindung mit sonderpädagogischem Förderbedarf
2.2.4Gender und sonderpädagogischer Förderbedarf
2.2.5Arbeitsdefinition Behinderung und Inklusion
2.3Autismus-Spektrum-Störungen
2.3.1Konzeptbestimmungen
2.3.1.1Historische Einordnung
2.3.1.2Klassifikation
2.3.1.3Mögliche Ursachen
2.3.1.4Störungsbild
2.3.1.5Häufigkeit und geschlechtliche Verteilung
2.3.1.6Komorbidität und Sekundärerkrankungen
2.3.2Rechtliche und normative Vorgaben
2.3.3ASS als sonderpädagogischer Förderbedarf
2.3.4Herausforderungen und Bedürfnisse autistischer Menschen
2.3.5Erste Schlussfolgerungen für den inklusiven Englischunterricht
3Theoretische Grundlagen der Englischdidaktik
3.1Ziele des Englischunterrichts
3.1.1Sprachliche Teilkompetenzen
3.1.2GeR und Companion Volume
3.1.3Nationale Bildungsstandards und Lehrpläne
3.2Spracherwerbstheorien
3.2.1Behavioristische Lerntheorien
3.2.2Nativistische Lernansätze
3.2.3Kognitiv-Konstruktivistische Lernansätze
3.2.4Soziokulturelle und Interaktionistische Lernansätze
3.2.4.1Lev Vygotsky
3.2.4.2Reuven Feuerstein
3.2.4.3James Lantolf
3.2.5Bezug zum Forschungsvorhaben
3.3Die Entwicklung des inklusiven Englischunterrichts
3.4Lernendenvariablen
3.4.1Gender
3.4.2Motivation
3.4.3Intelligenz
3.5Differenzierung und Individualisierung
3.6Medien
3.6.1Lehrwerk und Workbook
3.6.1.1Zielsetzung und Einsatz
3.6.1.2Entstehungs- und Entwicklungsprozess
3.6.2Fördermaterialien
3.7Qualitätskontrolle von Bildungsmedien
3.7.1Begriffsbestimmungen
3.7.2Wirkungsforschung zu zugänglichen Schulbüchern, Workbooks und Fördermaterialien bei sonderpädagogischem Förderbedarf
3.7.3Kriterienraster für Zugänglichkeit
3.7.4Zusammenfassung: Forschungsstand der Lehrwerkforschung
3.8Leistungsfeststellung und -bewertung im inklusiven Unterricht
3.9Englischunterricht für autistische Lernende
4Gegenwärtige Praxis des inklusiven Englischunterrichts
4.1Schüler*innen
4.1.1Schüler*innen mit SPF/ASS auf Regelschulen
4.1.1.1Akademische Leistungen
4.1.1.2Soziale Kompetenzen und Selbstkonzept
4.1.2Schüler*innen mit SPF/ASS auf Förderschulen
4.1.3Für Regelschulen geeignete Schüler*innen mit SPF/ASS an Förderschulen
4.1.3.1Akademische Leistungen
4.1.3.2Mechaniken eines Schulwechsels
4.1.4Mitschüler*innen
4.1.5Konsequenzen für den (Englisch-)Unterricht
4.2Curriculare Vorgaben im inklusiven (Englisch-)Unterricht
4.2.1Lehrpläne im inklusiven Englischunterricht
4.2.2Maßnahmen zur Ermöglichung von Teilhabe: Nachteilsausgleich und Notenschutz
4.3Kooperation und Vernetzung im inklusiven (Englisch-)Unterricht
4.3.1Personal
4.3.1.1Regelschullehrkräfte
4.3.1.2Förderlehrkräfte (MSD)
4.3.1.3Schulleitung
4.3.1.4Schulische und außerschulische Unterstützungssysteme
4.3.1.5Schulbegleitung
4.3.2Erziehungsberechtigte
4.3.3Multiprofessionelle Teams
4.3.3.1Lehrertandem
4.3.3.2Assistenzunterricht
4.4Didaktische Entscheidungen im inklusiven Englischunterricht
4.4.1Differenzierung nach Methodenvarianz
4.4.2Differenzierung nach verschiedenen Lernzugängen
4.4.3Differenzierung nach Lernhilfen
4.4.4Differenzierung durch Zusatzangebote (Quantität)
4.4.5Differenzierung durch Niveauunterschiede (Qualität)
4.4.6Differenzierung der Lernphasen
4.5Digitale Ausstattung und Entscheidungen im inklusiven Unterricht
4.6Lehrwerke und digitale Medien
4.7Schlussfolgerungen
5Eigene Datenerhebung und Ergebnisse
5.1Kontextualisierung
5.2Erkenntnisinteresse
5.3Methodik
5.3.1Methodologische Positionierung
5.3.2Leitfadenerstellung
5.3.3Rekrutierung der Teilnehmenden
5.3.4Ablauf der Interviews
5.3.5Auswertung
5.4Ergebnisse
5.4.1Unterrichtsbedingungen
5.4.1.1Schülerschaft
5.4.1.2Personelle Unterstützung
5.4.1.3Technische Unterstützung
5.4.1.4Weitere schulische Rahmenbedingungen
5.4.2Unterrichtsvorbereitung
5.4.2.1Differenzierung
5.4.2.2Aufgabenformate
5.4.3Unterrichtsdurchführung
5.4.3.1Classroom Management
5.4.3.2Arbeitsformen und -methoden
5.4.3.3Lehrwerknutzung
5.4.3.4Lehrwerkevaluation
5.4.3.5Weitere Unterrichtsmedien
5.4.4Nachbereitung
5.4.4.1Schülerschaft
5.4.4.2Lehrkräfte
5.4.5Besprechung der Lehrwerkauszüge
5.4.5.1Lehrwerkauszug 1
5.4.5.2Lehrwerkauszug 2
5.4.5.3Lehrwerkauszug 3
5.4.5.4Lehrwerkauszug 4
5.4.5.5Lehrwerkauszug 5
5.4.5.6Lehrwerkauszug 6
5.4.5.7Lehrwerkauszüge: Zusammenfassung
5.4.6Perspektiven
5.4.6.1Reflexion: Realisierung von Inklusion
5.4.6.2Verbesserungsvorschläge: Allgemein
5.4.6.3Verbesserungsvorschläge: Lehrer*innenausbildung
5.4.6.4Verbesserungsvorschläge: Zugängliche Bildungsmedien
5.5Diskussion der Ergebnisse
5.6Limitationen der Forschungsmethoden und Ergebnisse
5.7Zwischenfazit: Praxisorientierte Realisierung konkreter Vorschläge
6Erstellung zugänglicher Bildungsmedien für den Englischunterricht
6.1Kontextualisierung
6.2Methodisches Vorgehen
6.3Pädagogisches Assessment der Schüler*innen
6.3.1Self-Assessment der autistischen Schüler*innen
6.3.2Unterrichtsbeobachtung durch pädagogische Fachkräfte
6.3.3Assessmentergebnisse
6.4Schüler*innenzentrierte Variablen
6.4.1Methodische Kompetenzen
6.4.2Kognitive Voraussetzungen
6.4.3Sensorische Einflussfaktoren
6.4.4Soziales Lernen
6.4.5Volitionale Einflussfaktoren
6.4.6Zwischenfazit zu den schüler*innenzentrierten Variablen
6.5Bildungsmedienzentrierte Variablen
6.6Zwischenfazit
7Bildungsmedienanalyse und Interpretation der Ergebnisse
7.1Vorbemerkungen
7.2Richtwerte der bildungsmedienzentrierten Skala und methodisches Vorgehen
7.3Forschungskorpus: Ausgewählte Fördermaterialien
7.4Bildungsmedienanalyse
7.4.1Methodische Kompetenzen
7.4.2Kognitive Voraussetzungen
7.4.3Sensorische Einflussfaktoren
7.4.4Soziales Lernen
7.4.5Volitionale Einflussfaktoren
7.5Zusammenfassung zentraler Ergebnisse
7.5.1Bewertung und Einordnung der Befunde
7.5.2Herausforderungen des Kriterienrasters
7.6Bedeutung der Befunde für die weitere Schulbuch- und Unterrichtspraxis sowie -forschung
7.7Fazit der Bildungsmedienanalyse
7.8Ausblick: Software und Künstliche Intelligenz
8Konklusion
8.1Zusammenfassung und Wertung der Ergebnisse
8.2Potenzial und Grenzen der Ergebnisse
8.3Anwendung der Ergebnisse
8.4Ausblick
Danksagung
Literatur
Anhang
Gesprächsleitfaden
Musteranschreiben an Schulen
Transkriptionsköpfe
Datenschutzeinwilligung
Codebuch
Exemplarischer Ausschnitt eines Transkripts
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
In my own community, with many severely handicapped men and women, the greatest source of suffering is not the handicap itself, but the accompanying feelings of being useless, worthless, unappreciated, and unloved. It is much easier to accept the inability to speak, walk, or feed oneself than it is to accept the inability to be of special value to another person. We human beings can suffer immense deprivations with great steadfastness, but when we sense that we no longer have anything to offer to anyone, we quickly lose our grip on life.
Henri Nouwen
1Einleitung und Fragestellung
1.1Einführung in den Problembereich
2016 gründete Elon Musk (SpaceX, Tesla oder Twitter/X) zusammen mit anderen Unternehmern das Startup ‚Neuralink‘ mit der Absicht „[to] [c]reate a generalized brain interface to restore autonomy to those with unmet medical needs today and unlock human potential tomorrow“ (Neuralink, 2023a). Ein von Neuralink 2020 der Presse vorgestellter Chip solle Gehirnfunktionen stimulieren und querschnittgelähmten Menschen ermöglichen, Computer und andere Geräte mithilfe ihrer Gedanken zu steuern (vgl. Neuralink, 2023b). Neben der Steuerung eines Computers mit Gedanken seien u.a. weitere Ziele: Hirnschäden (z.B. Parkinson) auszugleichen, Stimmungsbilder (verursacht von einer unbalancierten Ausschüttung von z.B. Oxytocin oder Serotonin) zu kontrollieren und Menschen sogar zu ermöglichen, direkt über den Chip Musik zu hören (vgl. Cuthbertson, 2020; vgl. Tangermann, 2020). Mithilfe dieses Chips solle auch schwerhörigen Menschen ermöglicht werden, die akustischen Reize der Außenwelt wahrzunehmen, sodass das Cochlea Implantat ersetzt werden könnte. Die von Musk zu Beginn des Projekts getätigte Äußerung, der Chip könne auch Schizophrenie und Autismus-Spektrum-Störungen behandeln, wurde inzwischen zurückgenommen (vgl. Brueck, 2019)1.
Die Forschung und technische Entwicklung zum Ausgleich der Barrieren, denen Menschen mit Diversitätsmerkmalen tagtäglich gegenüberstehen, schreitet zwar rasend voran, dennoch ist es notwendig, Menschen mit Beeinträchtigung schon im frühen Kindesalter neben technischen Hilfsmitteln pädagogisch-didaktische Hilfestellung mitzugeben, um die individuelle Bewältigung ihres Alltags sicherzustellen. Da Chips wie von Neuralink für erwachsene Menschen entwickelt werden, ist es umso notwendiger, nicht allein auf technische Lösungen zu warten bzw. sich auf diese zu verlassen, sondern die Bildung, d.h. den Unterricht für Kinder mit Beeinträchtigungen, wie der Autismus-Spektrum-Störung, weiter zu spezifizieren.
Bislang konzentriert sich vor allem die Sonderpädagogik auf den Unterricht der Autismus-Spektrum-Störung Betroffenen. Obwohl es aber auch zahlreiche hochintelligente Kinder mit Beeinträchtigung gibt, bestehen, trotz Inklusionsbemühung, in der allgemeinen Schulpädagogik oftmals Barrieren. Mithilfe engagierter Lehrkräfte und auch Unterstützungspersonal können diese Barrieren zwar überwunden werden, aber dafür gibt es keine Garantie. Auch wird in der Forschung kritisiert, dass der Inklusionsdiskurs die allgemeine Schulpädagogik oft gar nicht erreiche (vgl. Textor, 2015: 33) und empirische Forschung zu Inklusion und insbesondere der Fremdsprachenerwerb aus der Perspektive von Schüler*innen2 und Lehrkräften in der Forschung zu kurz käme (vgl. Kötter und Trautmann, 2018: 139). Lehrkräfte ebenso wie Schüler*innen der Sekundarstufe äußern Unsicherheit und Kritik an der bisherigen Umsetzung von Inklusion in Deutschland (vgl. Kiel, 2017: 101 f.) sowie beim Umgang mit Inklusionsschüler*innen, denn es gibt keine genauen Vorgaben, wie mit diesen im Unterricht umzugehen ist, wie sie zu fördern und zu fordern sind (vgl. Textor, 2015: 75). Auch zeigen Studien, dass Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, erstens, stärker in Inklusionssettings ausgegrenzt werden (vgl. C. Huber und Wilbert, 2012: 148) und somit ein signifikant niedrigeres Selbstkonzept besitzen (vgl. Liebers und Seifert, 2014b: 37) und, zweitens, dass sie bei tatsächlichen inklusiven Strukturen und vorhandenen politischen Strategien „sowohl akademisch als auch sozial bessere Leistungen […] als Lernende [erbringen], die in separierenden Schulen unterrichtet werden“ (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018: 8).
Vor allem das Forschungsfeld zu autistischen Kindern und Jugendlichen im Unterricht an Regelschulen zeigt sich in der BRD als unzureichend erforscht (vgl. Dose, 2019: 25), während international bereits Arbeiten zu diesem Themenkomplex vorliegen (vgl. z.B. Reppond, 2015 oder Vargas Castillo und Mendioroz Sánchez, 2016). Das Ausbleiben der deutschen Forschung ist unter anderem dadurch begründet, dass die Prävalenzrate an Diagnosen der Autismus-Spektrum-Störungen aufgrund einer hohen Dunkelziffer und fehlender schuladministratorischer Erfassung niedriger angesetzt wird und viele autistische Schüler*innen unbeachtet und ohne autismusspezifische Hilfestellungen ihren Schulalltag bewältigen müssen (vgl. Knorr, 2012: 39). Darüber hinaus werden Autismus-Spektrum-Störungen in vielen Bundesländern nicht als ‚sonderpädagogischer Förderbedarf‘ eingeordnet oder Schüler*innen werden anderen Förderschwerpunkten zugeteilt (vgl. C. Lindmeier u. a., 2020: 489; vgl. Markowetz, 2020a: 113). Aufgrund der komplexen Zuordnung der Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) sowie nach Bundesland variierender eingesetzter Hilfsmittel und oft fehlender schulrechtlicher Unterstützung befasst sich der Forschungsdiskurs nur bedingt mit ASS und der Wirksamkeit des Unterrichts für betroffene Schüler*innen (vgl. C. Lindmeier u. a., 2020: 490).
Daraus ist zu folgern: Auch für die Minderheit der autistischen Schüler*innen müssen didaktische Maßnahmen und Materialien zur Förderung bereitgestellt werden. Zwar wird das Lehrwerk als zentrales Element des Schulunterrichts angesehen (vgl. Bohnensteffen, 2011: 124), doch zeigen sich bezüglich Wirkungsforschung von Lehrwerknutzung im Unterricht große Forschungslücken auf (vgl. D. Neumann, 2015: 62) – insbesondere in Bezug auf Unterrichtsmaterialien für autistische bzw. inkludierte Schüler*innen. Es gibt Fördermaterialien, die aber weder für autistische Lernende entwickelt, noch je bezüglich ihres Nutzens evaluiert wurden (vgl. P. Wendt, 2010: 89). Es fehlt allgemein an praxisbezogenen, differenzierten Bildungsmedien, die eine Anschlussmöglichkeit für Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf schaffen (vgl. Kiel, 2017: 97). Recherchen zeigen, dass zwar Lehrkräfte aktuelle inklusive Englischlehrwerke problematisieren, allerdings nicht ausreichend auf die konkreten Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge insbesondere bei autistischen Lernenden eingehen (vgl. Alter, 2019: 130; vgl. Dose, 2019: 138 f.; vgl. Seifried, 2015: 117). Bisher wurden keine Bildungsmedienanalysen mit standhaften Kriterien für zugängliche Bildungsmedien für autistische Lernende geführt. Alter stellt bezüglich dieser Forschungslücke die Frage:
Wenn es neben den Lehrwerken zahlreiche Unterrichtsmaterialien für den Englischunterricht gibt, die speziell für differenzierendes Unterrichten entworfen werden […], muss gefragt werden, warum es dann zum einen eine defizitäre Praxis der Differenzierung und zum anderen eine hohe Unzufriedenheit der Lehrenden mit diesem Ansatz gibt. […] Es ist zudem zu fragen, wie Lernende individuelle Förderung wahrnehmen und ob sie tatsächlich davon profitieren (Alter, 2019: 133).
Das heißt, die bestehenden Fördermaterialien, die ohnehin keinen Qualitätskriterien durch eine Zulassungskommission genügen müssen (vgl. P. Wendt, 2010: 89), haben zum einen großen Verbesserungsbedarf und müssen zum anderen auf ihre Effektivität für die Nutzungsgruppe geprüft werden.
Aus diesen Forschungslücken entwickelt sich das Forschungsdesiderat dieser Arbeit, wie Grafik 1.1 (s.u.) darstellt. Bisher existiert keine kriteriengestützte Analyse von inklusiven Englischbildungsmedien auf Zugänglichkeit für autistische Schüler*innen. Das zu leisten, nehme ich mir in dieser Arbeit vor. Hierfür bedarf es einerseits des Wissens um die Stärken und Schwächen im Lernverhalten der Schüler*innen und andererseits der Daten zu den Gegebenheiten des Bildungsmediums.
Abb. 1.1: Schnittmengen. Eigene Darstellung
1.2Zielsetzung der Arbeit
Die Ergebnisse dieser Arbeit sollen einen Beitrag leisten, die Forschung zur Individualisierung von Bildungsmedien für autistische Schüler*innen im inklusiven Unterricht durch eine Möglichkeit systematischer Anpassungen von Bildungsmedien voranzutreiben. Hierfür wird auf Grundlage der Erfahrungsberichte von Lehrkräften eine Bedarfsübersicht autistischer Schüler*innen bezüglich eines für sie zugänglichen Bildungsmediums erstellt. Diese gilt dann als Vorlage für die Systematik und soll bei neuen Lehrkräften ein Bewusstsein für eventuelle Barrieren der betroffenen Schüler*innen schaffen. Mithilfe von Fragebögen zur individuellen Zone der nächsten Entwicklung der individuellen Schüler*innen (vgl. Vygotsky, 1978: 86) kann das Raster an die jeweiligen autistischen Schüler*innen angepasst und das Bildungsmedium für sie entsprechend adaptiert werden.
Hierbei handelt es sich um einen weiteren Versuch, Barrieren für autistische Schüler*innen zu reduzieren und um keine endgültige Lösung. Der Schwerpunkt wird auf autistische Menschen gelegt, weil für sie bisher keine Fördermaterialien existieren, während für andere Menschen mit Beeinträchtigungen, wie beispielsweise sonderpädagogischen Förderbedarf Lernen, geistige Entwicklung, Hören oder Sehen bereits eine große Anzahl an Materialien existiert. Der Fokus liegt auf Zugänglichkeit, d.h. auf den Abbau von Barrieren des Bildungsmediums entsprechend der in den Kapiteln 6 und 7 angegebenen Dimensionen, welche den Erwerb sämtlicher Kompetenzen erleichtern sollen.
1.3Forschungsfragen und Aufbau der Arbeit
Aus den angedeuteten Forschungsdiskursen und der Forschungslücke ergeben sich die Fragestellungen dieser Dissertation. In den Kapiteln 2 bis 4 wird der aktuelle Forschungsdiskurs aufgearbeitet. Dabei dient Kapitel 2 der Erarbeitung von theoretischen Grundlagen zu Inklusion und den Autismus-Spektrum-Störungen im Speziellen. In Kapitel 3 werden die Grundlagen der Englischdidaktik bezüglich differenzierten Unterrichts sowie Forschungsstand und -diskurs zu Bildungsmedienforschung herausgearbeitet, während Kapitel 4 einen Einblick in die gegenwärtige Unterrichtspraxis des inklusiven Englischunterrichts in Sekundarstufen bietet. Der Fokus wird dabei auf die am Unterricht beteiligten Personen und Kooperationen gelegt, Praxisbeispiele und Studien zur inklusiven Beschulung autistischer Schüler*innen aus der Forschungsliteratur werden wiedergegeben und didaktische Möglichkeiten der Differenzierung diskutiert.
In Kapitel 5 wird die erste Forschungsfrage mithilfe der generierten Daten einer eigenen qualitativen Studie bearbeitet, die den aktuellen Status im inklusiven Englischunterricht mit autistischen Schüler*innen anvisiert. Die Forschungsfrage lautet:
1.Wie gehen Lehrkräfte mit Schüler*innen mit vermehrt auftretenden Verhaltensmustern der Autismus-Spektrum-Störungen im inklusiven Englischunterricht um?
Anhand von 10 Leitfadeninterviews mit insgesamt 16 Lehrkräften (Regelschullehrkräfte, Sonderschullehrkräfte, Schulpsychologin) werden Erfahrungsberichte zu den Unterrichtsbedingungen, der Unterrichtsvorbereitung, -durchführung und -nachbereitung und zu Perspektiven des inklusiven Englischunterrichts besprochen. Ein besonderes Augenmerk wird der Besprechung der im Unterricht verwendeten Bildungsmedien gewidmet und deren Kompatibilität mit den Bedürfnissen und Verhaltensweisen der autistischen Schüler*innen sowie der Diskussion von sechs exemplarischen Lehrwerkauszügen mit allen Befragten zur besseren Vergleichbarkeit.
Kapitel 5 bildet die Grundlage der eigenen Forschung, auf dessen Basis die in den nachfolgenden Kapiteln 6 und 7 besprochenenen Forschungsfragen zusammen mit den theoretischen Grundlagen aus der bisherigen Forschung (Kapitel 2-4) für barrierefreien Englischunterricht für autistische Schüler*innen beantwortet werden. Die Forschungsfragen lauten:
2.In welchen Bereichen bedarf es bei Fördermaterialien individueller Anpassungen für Schüler*innen mit typischen Verhaltensmustern der Autismus-Spektrum-Störungen und wie könnten diese Anpassungen hergestellt werden?
3.Wie können spezifische Fördermaterialien für den Englischunterricht im Hinblick auf Schüler*innen mit vermehrt auftretenden Merkmalen der Autismus-Spektrum-Störungen gestaltet sein?
Die Ergebnisse der Studie aus Kapitel 5 sind Grundlage eines Kriterienrasters für barrierefreie Bildungsmedien sowie für ein System der Zugänglichkeit für autistische Schüler*innen im Englischunterricht, das in Kapitel 6 vorgestellt wird. In Kapitel 7 veranschauliche ich diese Kriterien exemplarisch anhand der Einordnung von Lehrwerkauszügen (Fördermaterialien) in dieses Raster und arbeite individuelle Möglichkeiten der Anpassung der Bildungsmedien an die Bedürfnisse der Schüler*innen heraus. Auf dieser Arbeit aufbauend können individuell angepasste Bildungsmedien für autistische Schüler*innen erstellt werden.
Möglichkeiten der Anknüpfung zu Standardlehrwerken und regulärem inklusivem Unterricht werden in Kapitel 8 vorgeschlagen, wo auch eine Zusammenfassung der Ergebnisse Platz findet. Diese Arbeit setzt sich somit zum Ziel, Bildungsmedien für autistische Schüler*innen zugänglicher zu gestalten.
1Allerdings könnte das Implantat dazu beitragen, durch die Aufnahme der Gehirndaten mehr über die Beschaffenheit und eventuellen Ursachen dieser Verhaltensvariationen zu erfahren, wie dies bei Epilepsie z.B. mithilfe einer ‚Anti-Epilepsie-Elektrode‘ des Universitätsklinikums Freiburg erforscht und behandelt wird (vgl. Brueck, 2019; vgl. Universitätsklinikum Freiburg, 2019).
2Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet und stattdessen wo möglich Pluralformen, auch mit Gendersternchen, verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen, wenn nicht anders gekennzeichnet, für alle Geschlechter.
2Grundlagen der Inklusion
2.1Inklusions- und separationsbezogene Gruppentheorien
Menschen unterscheiden sich durch ihre Geschlechtszuordnung, Sexualität, Herkunft, Kultur, Nationalität, Sprache, Religion, Sozialstatus, Gesundheit oder Persönlichkeitsmerkmale (vgl. Spies, 2017: 85). Diese Merkmale führen in unterschiedlichen Kulturen zu verschiedenen gesellschaftlichen Reaktionen, wie Absonderungs- oder Integrationsprozessen. So zeigen Studien der WHO, dass Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf weltweit seltener Regelschulen besuchen als Schüler*innen ohne sonderpädagogischen Förderbedarf (vgl. WHO, 2011: 208), obwohl viele von ihnen damit unter ihren intellektuellen Möglichkeiten verbleiben (vgl. Czerwenka, 2017: 43). Aufgrund der im allgemeinen Diskurs und den in den Fachwissenschaften unterschiedlichen Interpretationen von ‚Inklusion‘ und ‚Integration‘, kann nicht von identisch erhobenen und somit vergleichbaren Zahlen ausgegangen werden (vgl. Jaster, 2017: 131; vgl. WHO, 2011: 208), weshalb die Terminologie in ihren jeweiligen Kontexten und historischen Entwicklungen als Grundlage dieser Arbeit besprochen werden1.
2.1.1Begriffliche Grundlagen von der Extinktion zur Integration
Eine eher drastischere Art des Umgangs mit Differenz sind ‚Extinktion‘ (lat. extinguere, dt. auslöschen) und ‚Elimination‘ (lat. eliminare, dt. entfernen, beseitigen) (vgl. Lindemann, 2018: 566). „Dort, wo eine Person, Gruppe oder Gesellschaft feststellt, dass Menschen aufgrund bestimmter Merkmale oder Ereignisse kein Lebensrecht haben sollten, wird sie versuchen, deren Elimination zu legitimieren und durchzuführen“ (ebd.: 566). Tötung kann als finale Form einer Exklusion aufgefasst werden, beispielsweise durch Genozide, die Ermordung behinderter Menschen z.B. während des deutschen Nationalsozialismus (Kinder- und Krankeneuthanasie, Aktion T4, Sterilisierungsgesetze) (vgl. Antor und Bleidick, 2000: 65 ff.) oder heutzutage in Form von Anschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte und Minderheiten (vgl. Lindemann, 2018: 566) oder durch Abtreibung eines behinderten Fötus im Rahmen der Pränataldiagnostik. Diese Ungleichbehandlung wird als ‚Ableismus‘ (engl. ableism bzw. ‚to be able‘, dt. fähig sein) bezeichnet, also eine Diskriminierung aufgrund „einer körperlichen oder psychischen Beeinträchtigung oder aufgrund von Lernschwierigkeiten“ (Universität zu Köln, 2022). Ableismus bezeichnet die Beurteilung eines Menschen auf Grundlage evidenten ‚Behindertseins‘ (vgl. ebd.) und zeigt sich beispielsweise in der Exklusion und Separation von behinderten Menschen.
‚Exklusion‘ (lat. excludere, dt. ausgrenzen, ausschließen) bedeutet, dass bestimmte Individuen einer Mehrheitsgesellschaft meist gegen deren Willen ausgegrenzt werden (vgl. Kolm, 2017). Hier wird den Betroffenen „keine Alternative zur Verfügung [gestellt] – dann wäre es Separation – sondern […] [offen gelassen], wohin sich die aus- oder abgewiesenen Personen dann bewegen, solange sie den schützenswerten Bereich nicht wieder betreten wollen“ (Lindemann, 2018: 565). Beispielhaft stehen hierfür die Schulausschlüsse von autistischen Schüler*innen, denen oftmals keine Ersatzbeschulung durch das Schulamt gestellt wird (vgl. Czerwenka, 2017: 46; vgl. Markowetz, 2021).
Ausgangspunkt von ‚Separation‘ (lat. separatio, dt. Ausschluss, Ausgrenzung) (vgl. Kolm, 2017) bzw. ‚Segregation‘ (lat. segregatio, dt. Trennung) (vgl. Wocken, 2010: 1) „ist die bestehende Mehrheitsgesellschaft mit vielen ähnlichen Individuen. Außerhalb dieser Gesellschaft bestehen weitere Gruppierungen, die von der Mehrheitsgesellschaft abgesondert werden“ (Kolm, 2017). Separation charakterisiert also ein Gruppenphänomen, das entweder individuell freiwillig oder durch äußere Faktoren im Rahmen von Zugangsbeschränkungen bestimmt wird. Eine Separation variiert dabei zwischen Zeiträumen von einigen Minuten bis hin zu Jahrzehnten (vgl. Lindemann, 2018: 566). Separiert werden beispielsweise Sonderschüler*innen, denen damit der direkte Zugang zum ersten Bildungs- und Arbeitsmarkt in den meisten Fällen verwehrt wird (vgl. Blanck, 2018: 31; vgl. Wocken, 2010: 1)2.
„Dort, wo eine Person, Gruppe oder Gesellschaft feststellt, dass Menschen von der Teilhabe ausgeschlossen sind, aber das Recht und die Möglichkeit der Teilhabe haben sollten, wird sie versuchen, Barrieren und Diskriminierung ab[zu]bauen und ihre Teilhabe [zu] ermöglichen“ (Lindemann, 2018: 565). ‚Integration‘ (lat. integratio, dt. Eingliederung, Wiederherstellung) (vgl. Kolm, 2017) bezeichnet also einen Prozess der (Wieder-)Aufnahme von exkludierten Gemeinschaftsmitgliedern (vgl. Lindemann, 2018: 565), beispielsweise von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung3, die vom Bildungssystem vernachlässigt (exkludiert) wurden und im Laufe ihrer Bildungsgeschichte Bildungsmöglichkeiten nach ihrem Unterstützungsbedarf erhalten sollen. Integration entwickelt sich seit 1945 und der Ermordung von Menschen mit Beeinträchtigungen (Extinktion) zur Zeit des Nationalsozialismus weiter und greift die sonderpädagogischen Bestrebungen aus der Weimarer Republik wieder auf. Nun wird gemeinsames Lernen als Werkzeug der Integration angestrebt (vgl. Heimlich, 2019: 35, 42).
Im bildungspolitischen Diskurs wird zwischen bedingter und unbedingter Integration unterschieden. ‚Bedingte Integration‘ kann bedeuten, dass „nicht jeder […] integrierbar [ist], sondern vor dem Hintergrund der jeweiligen individuellen, zeitlichen, räumlichen und personellen Voraussetzungen […] entschieden [wird], ob eine bestimmte Person integriert werden kann oder nicht“ (Textor, 2015: 25). ‚Unbedingte Integration‘ ist nach diesem Verständnis nicht an Vorbedingungen geknüpft, sondern schließt Separation von Beginn an aus (vgl. ebd.). Doch auch bei ‚unbedingter Integration‘ zeigen sich Facetten innerhalb der Realisierung. So können beispielsweise Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Rahmen einer Einzelintegration am Regelschulunterricht im selben Klassenzimmer teilnehmen, werden allerdings von Individualkräften mit Differenzierungsmaterialien, d.h. abweichenden Lernmitteln, beschult und somit sozial isoliert. Integration beschränkt sich im Diskurs nicht allein auf die Beseitigung von Zugangsbeschränkungen, sondern hebt auch die Dimensionen der sozialen, der emotionalen sowie der leistungsorientierten Integration hervor (vgl. Haeberlin u. a., 1989: 12 ff.).
Lindemann beschreibt einen weiteren Gruppenprozess als ‚Habilitation und Rehabilitation‘ (lat. habilitare, dt. geeignet machen, befähigen; lat. rehabilitare, dt. wiederherstellen), der als eine zeitweilige Segregation für spezielle Unterstützung mit dem Ziel einer anschließenden Re-Integration definiert wird (vgl. Lindemann, 2018: 563, 566). Auch auf globaler Ebene, z.B. um Artikel 26 der UN-Behindertenrechtskonvention auf volle Teilhabe in allen Lebensaspekten ermöglichen zu können, werden Programme der Rehabilitation und Habilitation angeboten (vgl. Amirpur, 2016: 26).
2.1.2Inklusion
2.1.2.1Zielvorgaben
‚Inklusion‘ (lat. includere, dt. umfassen, einschließen) (vgl. Lindemann, 2018: 564) wird von Wevelsiep als „erweiterte und vertiefte Integration“ verstanden (Wevelsiep, 2015: 569) und lässt sich als „Abbau von Barrieren für Lernen und Teilhabe aller SchülerInnen“ (Booth u. a., 2003: 10) im Bildungsprozess, wie auch in der Gesellschaft, definieren. Barrieren für eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe sind beispielsweise das Geschlecht, der Migrationshintergrund oder auch sonderpädagogische Förderbedarfe. Diese Merkmale sind selten angeborene Barrieren, sondern entsprechen vielmehr nicht den Erwartungen der Mehrheitsgesellschaft, die mit der Ausgrenzung der Betroffenen hierauf reagiert (vgl. Textor, 2015: 18). In weiteren Diskursen wird Inklusion als Strukturwandel des gesellschaftlichen Systems (vgl. Radtke, 2012: 11) oder etwa als Schaffung von Chancengleichheit (vgl. Wocken, 2011: 216) verstanden4. Es zeigt sich, dass im Forschungsdiskurs das Verständnis von Inklusion variiert und Vorgaben in öffentlichen Beschlüssen, wie der Kultusministerkonferenz vom 20.10.2011, Grundlage für inklusives Handeln schaffen sollen5.
Das Ideal einer demokratischen, inklusiven Gemeinschaft möchte diese Barrieren überwinden und jedes Individuum entsprechend seines möglichen Potentials fördern, sodass es sich selbstbestimmt in die Gesellschaft integrieren kann. Inklusion ist daher die „Vision einer Form des optimalen Zusammenlebens“ (Kolm, 2017). Die Salamanca-Erklärung ortet Behinderung nicht einzelnen Individuen zu, sondern einer behindernden Gesellschaft (vgl. UNESCO, 1994: Einleitung Nr. 3), sodass Inklusion als gesamtgesellschaftliche Aufgabe anzusehen ist (vgl. Heimlich, 2019: 138). Im Gegensatz zu Integration passen sich hier die gesellschaftlichen Strukturen den jeweiligen Bedürfnissen einzelner Menschen an und nicht andersherum (vgl. Kolm, 2017). Die Konzepte ‚Integration‘ und ‚Inklusion‘ bedürfen einer klaren Unterscheidung.
Bei beiden Begriffen wird davon ausgegangen, dass alle Kinder zusammen lernen können, das heißt, dass Kinder mit speziellen Bedarfen mit Kindern ohne spezielle Bedarfe in einem Lernumfeld lernen. Bei der Integration wird jedoch davon ausgegangen, dass die Kinder mit Förderbedarfen ihren Bedarf diagnostiziert bekommen und dann integriert werden, indem sie sich mit Unterstützung an die Kinder ohne spezielle Bedarfe anpassen. […] [Hier] werden ganz spezielle finanzielle oder personelle Ressourcen an das Kind mit dem spezifischen Förderbedarf gebunden, damit das Kind am Unterricht der Regelschule teilnehmen kann (Schlaak, 2014: 2 f.).
D.h. weiterhin gibt eine dominierende Gruppe die Regeln und Vergleichsmaßstäbe vor, während von den Minderheiten Adaption an das System verlangt wird, um in die Mehrheitsgesellschaft integriert zu werden (vgl. Kolm, 2017; vgl. Schlaak, 2014: 3). Aus diesem Grund wird bei Integration auch von einer ‚Zwei-Gruppen-Theorie‘ gesprochen (vgl. Kolm, 2017).
Im Gegensatz dazu ist der inklusive Gedanke jedoch von der Überzeugung geprägt, dass alle Kinder über gleiche Chancen, Teilhabe und Partizipation verfügen (vgl. Diehl, Leisner und Spreer, 2016: 3), gleichermaßen bildungsfähig sind und individuelle Förderbedarfe innehaben, sodass es „keine ‚dominierenden Gruppen‘ […] [gibt]; kein Schüler wird in die Kategorien ‚spezifischer Förderbedarf‘ oder ‚kein spezifischer Förderbedarf‘ einsortiert“ (Schlaak, 2014: 3). Die Frage der Inklusionsfähigkeit stellt sich hier gar nicht erst (vgl. Steudle, 2015: 186). Um Exklusion weitestgehend zu überwinden, plädiert der radikale Inklusionsansatz (‚Full Inclusion‘ bei Kiel, 2017: 103) für die Dekategorisierung von Menschen und ihrer jeweiligen Heterogenitätsfaktoren. Jedes Individuum ist „gleich verschieden“. So werden Vielfalt wertgeschätzt und Ressentiments und Diagnosen vermieden, die zu Stigmatisierung und linear-kausalen Erklärungsmustern sowie „Trivialisierungen als Entdifferenzierung komplexer Realitätsausschnitte“ (Störmer, 2009: 189) z.B. durch eine Medikamentierung bei auffälligem Verhalten (vgl. ebd.: 188 f.), führen könnten. Andersartigkeit wird nach dieser Vorstellung zur Normalität (vgl. Kiel, 2017: 97 ff.) und Differenzmerkmale wie Behinderung und Gender finden keine Anwendung mehr (vgl. Piezunka, 2018: 29). Radikale Inklusionsbefürworter*innen sprechen sich somit auch gegen das selektive und gegliederte deutsche Bildungssystem aus, das Kategorisierungen befürworte (vgl. Schlaak, 2014: 6 f.) und damit den Betroffenen das Recht auf Gemeinschaftszugehörigkeit und Würde verweigere (vgl. Häberlein-Klumpner, 2009: 40). Allerdings kann auch die Diagnose bei der Eigen- und Fremdwahrnehmung unterstützen (vgl. Singer, 2018: 26). Einige Menschen identifizieren sich auch durch ihre Behinderung und eruieren Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu ihren Mitmenschen, um eigene Stärken einzuschätzen und auszubauen. Im Gegensatz zur Integration werden bei der Inklusion auch finanzielle und personelle Ressourcen nicht an einzelne Schüler*innen gebunden, sondern allen Schüler*innen gleichermaßen zugewiesen (vgl. Schlaak, 2014: 4).
Im Gegensatz zur ‚Integration‘ ist ‚Inklusion‘ aufgrund zusätzlicher Rechtsgrundlage in der Umsetzung verbindlich geworden und nicht mehr individuen-, sondern systemorientiert (vgl. Schlaak, 2014: 30). Spätestens seit der Veröffentlichung und Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) (2006 bzw. 2009) gilt Inklusion als Menschenrecht (vgl. Textor, 2015: 26), durch das sich auch die BRD verpflichtet, ein Bildungssystem zu ermöglichen, in dem Kinder und Jugendliche mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf gemeinsam lernen können (vgl. Piezunka, 2018: 28). So „wurde der Begriff in der deutschsprachigen Sonderpädagogik eingeführt, um den bis dahin dominierenden Begriff der Integration zu ersetzen“ (Wevelsiep, 2015: 569)6. An ‚Integration‘ wird in Fachkreisen kritisiert, dass diese zwar die schulorganisatorische Planung betreffe, jedoch der Unterricht selbst nicht zugänglich sei (vgl. Reiser, 2003: 307).
Inklusion kann dabei enger wie auch weiter gefasst werden. Inklusion im engeren Sinne umfasst die „Einbeziehung von Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung bzw. mit Beeinträchtigungen in Allgemeinen Schulen“ (Preuss-Lausitz, 2019: 469), ebenso wie eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft. Inklusion im weiteren Sinne bezieht auch andere Heterogenitätsdimensionen mit ein (vgl. ebd.: 469), die in dieser Arbeit jedoch nicht weiter besprochen werden sollen. Weiter unterscheiden sich die beiden angloamerikanischen Begriffe ‚full inclusion‘ und ‚responsible inclusion‘, die im deutschsprachigen Raum häufig synonym unter dem Begriff ‚Inklusion‘ subsumiert werden (vgl. Heimlich, 2019: 210 f.). ‚Full inclusion‘ bezeichnet ein Bildungssystem, in dem Schüler*innen an einer Gesamtschule an einem gemeinsamen Gegenstand lernen (vgl. Kiel, 2017: 103). ‚Full inclusion‘ ist aufgrund der Gliederung des Schulsystems nach leistungsbezogenen Zugangsvoraussetzungen in Deutschland nicht möglich, sodass ‚responsible inclusion‘, bedingt von den situativen Möglichkeiten der jeweiligen Schulen, eingesetzt wird (vgl. Heimlich, 2019: 210 f.).
2.1.2.2Zwischen Bestrebungen und Realisierung von Inklusion
Inklusion ist ein stark umstrittenes Thema, bei dem oftmals soziale Erwünschtheit, eigene Berührungspunkte mit der Thematik und der Wunsch nach einem eigenen Beitrag zu mehr Toleranz und Teilhabe innerhalb der Gesellschaft eine Rolle spielen (vgl. Schlaak, 2014: 7). Schulische Inklusion bietet viele Vorteile, wie etwa die Förderung der sozialen und kommunikativen Kompetenzen, häufige Leistungssteigerungen und eine wohnortnahe Beschulung, wodurch auch öfter soziale Bindungen außerhalb der Unterrichtszeiten ausgebaut und aufrecht erhalten werden können (vgl. Lindner, 2007: 43). Bei rechtlichen Vorgaben zur Inklusion, wie z.B. der UN-BRK (2006), ist jedoch problematisch, dass diese normative Geltung besitzen und somit Pflichten festlegen. Dabei wird häufig übersehen, dass die äußeren Rahmenbedingungen (personell, räumlich, zeitlich etc.) sowie die inneren Einstellungen und Haltungen der Beteiligten das Gelingen einer inklusiven Beschulung jeder Art von Grund auf bestimmen. Erfahrungsberichte zeugen nur selten von tatsächlich gelungener sozialer Integration und Inklusion (vgl. ebd.: 51). Dennoch verweisen Studien auch darauf, dass inklusive Bildung und Erziehung die „Chancen auf Interaktionen zwischen Gleichaltrigen und die Entstehung enger Freundschaften zwischen Lernenden mit und ohne Behinderungen“ erhöhen (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018: 7). Hierbei bleibt allerdings zu beachten, dass die soziale Eingliederung aufgrund von Rahmenstrukturen erschwert wird (vgl. ebd.: 7 f.). Der Index für Inklusion möchte eben diese „inklusive[n] Werte verankern“ (Booth u. a., 2003: 17), übersieht allerdings, dass Gefühle und Wahrnehmungen weder vorgeschrieben noch antrainiert werden können, sondern zuerst immer innermenschliche Prozesse sind.
Ebenso eröffnen sich weitere Spannungsfelder: Obwohl inkludierten Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf viele Partizipationsmöglichkeiten an der Regelschule gegeben werden können, grenzt diese in manchen Fällen dennoch behinderte Kinder aus und bietet ihnen nicht den nötigen „Schutzraum“ oder die Ausbildung lebenspraktischer Kompetenzen (vgl. Backhaus, 2019: 25; vgl. Kolm, 2017; vgl. Singer, 2018: 25). Befürworter*innen von Sonderschulen und Inklusionsgegner*innen betonen, dass Lehrkräfte und Schulen speziell für die Bedürfnisse ihrer Schüler*innen, zum Beispiel für stark hörgeschädigte, ausgebildet sind und über entsprechende Ressourcen verfügen (vgl. WHO, 2011: 211). Sonderschulpädagog*innen äußern des Weiteren, dass Sonderschulen eine „optimale Persönlichkeitsentwicklung“ (Budka, 2006: 42) für die Schüler*innen garantieren können und somit Sonderschulen als Wahrung der Menschenrechte weiterhin legitimiert seien. Dem setzen Inklusionsvertreter*innen entgegen, dass die isolierenden Maßnahmen des Systems Sonderschule eher persönlichkeitshemmend anstatt -fördernd wirken und die Sonderschüler*innen stigmatisieren würden, denn der Sonderschulabschluss führt auf dem Arbeitsmarkt zu schlechteren Berufsmöglichkeiten (vgl. ebd.: 42 f.).
[D]as Schulsystem [ist] darauf ausgerichtet, Bildung zu vermitteln, aber nicht darauf, Zugang zu Bildung zu schaffen. Der Arbeitsmarkt selektiert das für bestimmte wirtschaftliche Produktziele benötigte Personal, ist aber nicht darauf ausgerichtet, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit einzubeziehen und Arbeitsplätze an individuelle Beeinträchtigungen anzupassen (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2016: 19 f.).
Kritisiert wird ebenfalls, dass der Inklusionsdiskurs oft nicht die allgemeine Schulpädagogik erreiche (vgl. Textor, 2015: 33) und auch empirische Forschung zu Inklusion und insbesondere auch Fremdsprachenerwerb aus den Perspektiven von Lehrkräften und Schüler*innen zu kurz käme (vgl. Kötter und Trautmann, 2018: 139).
Da die UN-BRK zwar die Ideale von Inklusion beschreibt, allerdings nicht deren praktische Umsetzung, wird Inklusion im schulpraktischen Kontext weiterhin unterschiedlich aufgefasst: Aktuell wird in manchen deutschen Schulklassen den Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf ein Sonderstatus zugeschrieben. Sie werden oft in der sogenannten ‚Pull-Out‘-Phase aus dem Gemeinschaftsraum genommen, um in separaten Klassenzimmern einzeln oder in Kleingruppen besonders gefördert und unterrichtet zu werden. In anderen Schulklassen werden alle Schüler*innen konsequent in einer Klasse unterrichtet und differenziert gefördert (vgl. Piezunka, 2018: 28)7.
Es bedarf somit dringend inklusiver Unterrichtsmodelle, „welche Differenzierung und Individualisierung als selbstverständliche Kennzeichen für sich beanspruchen“ (Steudle, 2015: 186). Hierbei ist ein Spagat zu bewerkstelligen: „Unterricht muss den persönlichen Voraussetzungen des Individuums entsprechen und gleichzeitig so weit wie möglich dazu beitragen, die gesellschaftlichen Erwartungen zu erfüllen“ (ebd.: 187). Auch Springob warnt vor einer übereilten Inklusion:
Ohne die entsprechenden Ressourcen (u.a. ausreichend Lehrkräfte, Differenzierungsraum, Doppelbesetzung, Teamzeiten, Unterstützung durch Sonderpädagogen) und den Einsatz von motivierten Kolleginnen und Kollegen kann ein für alle Seiten gewinnbringender Unterricht nicht bzw. kaum gelingen. Gleichzeitig muss für jede Schülerin und jeden Schüler individuell geschaut werden, welche Schulform für sie oder ihn die richtige ist. Ein „Inklusionszwang“ unter dem Deckmantel der Gleichberechtigung bzw. der individuellen Förderung ist gefährlich und nutzt vor allem einer Gruppe nicht: den SuS selbst. Inklusion ist nicht realisiert, wenn einfach möglichst viele SuS eine Regelschule besuchen. Inklusion bedeutet, für jeden Menschen eine möglichst optimale Schule zu finden; für einzelne SuS kann das nach wie vor eine Förderschule sein (Springob, 2015: 52).
Letztendlich kann man sagen, dass Inklusion das Selbstbestimmungsrecht aller Menschen anstrebt. So verfügen Menschen mit Beeinträchtigung ebenfalls über das Recht, sich gerade nicht inkludieren zu lassen, sollten sie dies bevorzugen. Aus diesem Grund ist das Prinzip der Freiwilligkeit für Heimlich unabdingbar für die Nachhaltigkeit einer dauerhaften Inklusionsentwicklung (vgl. Heimlich, 2019: 6).
Die Umsetzung von Inklusion lässt sich als Weiterentwicklung des Integrationsgedankens verstehen, die jedoch abhängig ist von den Herausforderungen der Rahmenbedingungen. Somit bedarf es neuer Rahmenbedingungen, um sich besser auf autistische Schüler*innen einlassen zu können. Zu betonen ist hier, dass Inklusion, Integration und andere Prozesse ineinander übergehen und auch zeitlich parallel stattfinden können (vgl. Lindemann, 2018: 563).
2.1.3Ein historischer Abriss der Behinderten-, Integrations- und Inklusionsbewegung in Deutschland
Bis in das 20. Jahrhundert hinein wird der Begriff ‚Behinderung‘ im deutschsprachigen Raum vor allem abwertend konnotiert (vgl. Schmuhl, 2010:21 ff., 53, 88 ff.). Bereits im 19. Jahrhundert werden insbesondere aus sozialen und karitativen Beweggründen erste Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft für Jungen und Mädchen mit starker Behinderung eingerichtet, was den Beginn der Sonderpädagogik einläutet (vgl. Häberlein-Klumpner, 2009: 36; vgl. Lelgemann, Singer und Walter-Klose, 2015: 25). Mit dem Wandel in die Moderne ab Ende des 19. Jahrhunderts und der damit folgenden zunehmenden Industrialisierung, Modernisierung, Globalisierung und des Ökonomiedenkens, dem damit verbundenen Aufkommen der Sozialen Frage und dem neuen Wirtschafts- und Leistungsdruck werden Menschen verstärkt unter ihrem Nützlichkeitsaspekt betrachtet und Menschen mit Behinderung als „Störfaktoren“ im zunehmend ökonomischen Weltbild angesehen. Der Sozialdarwinismus ab der Mitte des 19. Jahrhunderts resultiert in der Abschiebung von geistig behinderten Menschen auf Hilfsschulen (vgl. Häberlein-Klumpner, 2009: 36 f.). In der Weimarer Republik etabliert sich der Begriff der ‚Körperbehinderten‘, der im Dritten Reich auch im Rahmen der Eugenik und Euthanasie noch weiter differenziert wird in ‚legitim‘ Körperbehinderte, beispielsweise Kriegsversehrte, und ‚illegitim‘ Behinderte mit einer beispielsweise genetisch vererbten Behinderung. „Erbkranke“ Schüler*innen werden zu der Zeit aufgrund rassenhygienischer Bestrebungen Sonderschulen zugeordnet oder als geringqualifizierte Arbeitskräfte eingesetzt (vgl. Kastl, 2017: 36; vgl. Steinmetz u. a., 2021: 60)8.
In der Mitte der 1950er Jahre wird der Begriff ‚Behinderung‘ weiter untergliedert in ‚Körperbehinderung‘, ‚Geistige Behinderung‘ und ‚Seelische Behinderung‘. Die Differenzierung wird 1961 in das Bundessozialhilfegesetz übertragen (vgl. Schmuhl, 2010: 87). In der Kultusministerkonferenz 1960 finden Sonderschulen erstmals ihre Legitimation mit dem Anspruch eine angemessene Bildung und Erziehung der jeweiligen Schüler*innen ermöglichen zu können (vgl. Häberlein-Klumpner, 2009: 38). Zwischen 1960 und 1973 verdreifacht sich infolgedessen die Anzahl der Kinder, die an Sonderschulen unterrichtet werden (vgl. Muth, 1982: 9 f.; vgl. Steinmetz u. a., 2021: 61).
Dabei war im Zuge der Expansion der Sonderschulen eine karitative Motivation zu erkennen. Die Einrichtung von Schulen für geistig Behinderte seien [sic!] ein Fortschritt in der Anerkennung der Bildungsfähigkeit, sie seien [sic!] exemplarisch als letzte große Maßnahme der Sonderbeschulung zu sehen, die dieser am schwierigsten geltenden Gruppe den Zugang zur Bildung ermöglichte. Noch in den 60er Jahren wurde die mit der Einweisung in die Sonderschule verbundene Isolation als „absolut unvermeidbar“ angesehen (Häberlein-Klumpner, 2009: 39).
Das Studium der Sonderschulpädagogik wird in den 60er und 70er Jahren breit ausgebaut und in verschiedene Pädagogiken (Gehörlosenpädagogik, Blinden- und Sehbehindertenpädagogik, Körperbehindertenpädagogik, Geistigbehindertenpädagogik, Sprachheilpädagogik, Verhaltenspädagogik etc.) aufgeteilt (vgl. Textor, 2015: 44). Erste Forderungen nach Integration werden in den 1970er Jahren lauter, die ein Neugestalten der konservativen Bildungseinstellung und das Ende der Abschiebung auf Hilfs-/Sonderschulen und somit Chancengleichheit verlangen (vgl. Häberlein-Klumpner, 2009: 39). Die Empfehlung des Bildungsrates 1973, in der für einen gemeinsamen Unterricht plädiert wird, stellt hier einen Meilenstein dar (vgl. Steinmetz u. a., 2021: 62). Im Jahr 1975 werden erste Pilotversuche der Integration in Kindergärten und Schulen durchgeführt9, beschränken sich jedoch nur auf lokale, ab 1986 schulgesetzlich legalisierte, Parallelangebote zur traditionellen Sonderbeschulung (vgl. Moser und Lütje-Klose, 2016: 7; vgl. Textor, 2015: 45). Auch besteht die KMK im Positionspapier 1983 darauf, die Sonderbeschulung beizubehalten bis eine adäquate Förderung der Schüler*innen in Regelschulen gewährleistet werden kann (vgl. Steinmetz u. a., 2021: 62). Der internationale, insbesondere italienische Integrationsdiskurs der 1980er und 90er Jahre beeinflusst die deutsche Integrations- bzw. Inklusionsdebatte, die vor allem durch die Salamanca-Erklärung (1994) neuen Antrieb findet und somit auch in der BRD zusammen mit weiteren Empfehlungen, wie z.B. den „Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung in den Schulen der Bundesrepublik Deutschland“ (KMK 1994) gesetzlich verankert wird (vgl. Moser und Lütje-Klose, 2016: 7). Ab den 2000er Jahren werden immer mehr Schüler*innen an Regelschulen inkludiert (vgl. Lelgemann, Singer und Walter-Klose, 2015: 27). Rechtliche Vorgaben wie z.B. die UN-BRK forcieren die inklusive Beschulung weiter (vgl. Gerlach u. a., 2021: 3 ff.; vgl. Preuss-Lausitz, 2019: 468 ff.).
2.2Inklusion im engeren Sinne
2.2.1Die deutsche Förderquote im Vergleich
Laut der WHO weisen 15 % der Weltbevölkerung (d.h. mehr als eine Milliarde Menschen) eine Behinderung auf. Nach dieser Statistik haben zwischen 110 Millionen und 190 Millionen Erwachsene signifikante Funktionseinschränkungen. Zudem steigt die Anzahl der Menschen mit Behinderung aufgrund der verstärkten Alterung der Population und dem daraus resultierenden Wachstum chronischer Erkrankungen und daraus oftmals resultierender Behinderungen (vgl. WHO, 2018). Der Vergleich von internationalen Länderstatistiken zeigt Diskrepanzen. In der BRD werden vergleichsweise deutlich häufiger Schwerbehinderungen dokumentiert als beispielsweise in Frankreich oder Italien (vgl. Statistisches Bundesamt, 2017: 60). Diese hohe Anzahl lässt sich damit erklären, dass es in Deutschland ein anderes Meldesystem gibt. Auch werden aufgrund der besseren medizinischen Diagnostik und Versorgung, des höheren Lebensstandards und der besseren Absicherung in Sozial- bzw. Krankenversicherungen mehr Behinderungen erkannt. So zeigen verschiedene Studien, dass die Auffassungen und Methoden zur Messung von Behinderung zwischen Studiensteller*innen und den Ländern stark differieren. Jedes Land definiert Normabweichungen und ‚Behinderung‘ ebenso wie deren Tragweite (körperliche Schädigung, Leistungsminderung, verminderte gesellschaftliche Teilhabe) anders (vgl. Kastl, 2017: 37; vgl. WHO, 2018).
Deutschland verfügt im Jahr 2010 im Vergleich zu anderen europäischen Ländern über die höchste Sonderschulbesuchsquote (vgl. Schöler, Merz-Atalik und Dorrance, 2010: 26 ff.; vgl. Steinmetz u. a., 2021: 19)10. Im Schuljahr 2017/2018 besitzen in Deutschland insgesamt 6,8 % aller Schüler*innen die Diagnose eines sonderpädagogischen Förderbedarfes. Hiervon besuchen 4,2 % eine Förderschule und 2,6 % werden an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen integrativ unterrichtet. Auffällig ist hier die starke Varianz der Quoten je nach Bundesland, wie die Tabelle 2.1 aus dem Statistischen Jahrbuch 2019 zeigt (siehe unten).
Während in Mecklenburg-Vorpommern 9,7 % aller Schüler*innen einen sonderpädagogischen Förderbedarf besitzen und hiervon 6,1 % an Förderschulen und 3,6 % integrativ unterrichtet werden, gibt es zu diesem Erhebungszeitpunkt in Bayern eine Förderquote von 4,7 % mit einer sehr geringen Integrationsquote von 0,1 %. In Bremen werden 6,3 % der 7,2 % Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf integrativ unterrichtet, während in Baden-Württemberg nur 2,7 % der 7,4 % eine allgemeine oder berufliche Schule besuchen. In Niedersachsen beträgt die Förderquote 3,2 %. Eine Integrationsquote wird hier, ebenso wie im Saarland, nicht angegeben. Da erst im Jahr 2013 die inklusive Schule in Niedersachen eingeführt wird, sind die Zahlen aus dem Schuljahr 2017/2018 wohl noch nicht repräsentativ. Im Saarland setzen zu dem Erhebungszeitpunkt nur Pilotschulen Inklusion um. Diese abweichenden Angaben lassen sich nicht auf unterschiedliche Schüler*innenpopulationen, sondern eher auf verschiedene Definitionen und Einteilungen von ‚sonderpädagogischem Förderbedarf‘ und ‚Behinderung‘ sowie variierende bildungspolitische Schwerpunktsetzungen und institutionelle Möglichkeiten (personelle, räumliche, finanzielle Ressourcen) zurückführen (vgl. Lange, 2015: 8 ff.; vgl. Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2014: 5 ff.; vgl. Textor, 2015: 17). Dies zeigt sich auch in den unterschiedlichen Einschränkungen, die in verschiedenen Bundesländern als Behinderung bzw. sonderpädagogischer Förderbedarf gelten.
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
insgesamt
Förderschüler |1
Integrationsschüler |2
davon
Förderquote insgesamt
Förderschulbesuchsquote
Integrationsquote |1
Anzahl
%
Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . .
474 463
306 431
168 032
6,8
4,2
2,6
Baden-Württemberg . . . . . . . . . . . . . . . .
73 639
47 177
26 462
7,4
4,7
2,7
Bayern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 276
52 545
731
4,7
4,6
0,1
Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 847
7 427
16 420
7,9
2,5
5,4
Brandenburg . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 826
8 728
8 098
8,0
4,1
3,8
Bremen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 145
514
3 631
7,2
0,9
6,3
Hamburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 162
4 512
8 650
8,5
2,9
5,6
Hessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 590
19 559
9 031
5,3
3,6
1,7
Mecklenburg-Vorpommern . . .
12 753
7 966
4 787
9,7
6,1
3,6
Niedersachsen . . . . . . . . . . . . . . . .
24 333
24 333
–
3,2
3,2
–
Nordrhein-Westfalen . . . . . . . . .
128 495
74 650
53 845
7,7
4,5
3,2
Rheinland-Pfalz . . . . . . . . . . . . . . .
20 388
14 660
5 728
5,7
4,1
1,6
Saarland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 066
3 066
–
3,8
3,8
–
Sachsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 055
18 919
9 136
8,4
5,7
2,7
Sachsen-Anhalt . . . . . . . . . . . . . . .
15 723
10 451
5 272
9,0
6,0
3,0
Schleswig-Holstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 915
5 364
11 551
6,6
2,1
4,5
Thüringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 250
6 560
4 690
6,5
3,8
2,7
Ergebnisse der Statistik der allgemeinbildenden Schulen.
1 Ohne Kranke.
2 Ohne Niedersachsen und Saarland.
Abb. 2.1: Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf nach Ländern im Schuljahr 2017/18. Quelle: Statistisches Bundesamt, 2019: 98
2.2.2Definitionen von Behinderung
Der Begriff ‚Behinderung‘ wird 2001 nach der WHO unterteilt in: ‚Schädigung‘, ‚Leistungsminderung‘ bzw. ‚Beeinträchtigung der Aktivität‘ und ‚Behinderung‘ bzw. ‚Beeinträchtigung der Teilhabe‘ (vgl. Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information DIMDI und WHO-Kooperationszentrum für das System Internationaler Klassifikationen, 2002: 4 f., 17 ff.). „In den Unterschieden dieser Begriffe kommen zum Ausdruck die Unterschiede zwischen der biologisch-defektologischen Seite, der Fähigkeitsentwicklung und -entäußerung als Ausdruck der psychologisch-subjektiven Seite und schließlich der Seite der sozial gegebenen Tätigkeitsmöglichkeiten“ (Jantzen, 1987: 16). Zusätzlich wird in den 1990er Jahren in der BRD der Terminus ‚sonderpädagogischer Förderbedarf‘ eingeführt (vgl. Heimlich, 2019: 195).
2.2.2.1Medizinische Aspekte: ‚Schädigung‘
Der Schwerpunkt des medizinisch geprägten Auffassungs- und Erklärungsmodelles liegt auf dem ‚Körpersubjekt‘, bei dem eine für die Betroffenen ursächlich verantwortliche Schädigung festgestellt wird (vgl. Weisser, 2005: 27). Eine ‚Schädigung‘ ist nach der WHO als eine „dauernde oder vorübergehende psychologische, physiologische oder anatomische Einbuße und/oder Anomalie“ (WHO 1981 aus Jantzen, 1987: 16) definiert. Der Fokus liegt hier somit auf einer gesundheitlichen Einschränkung (Krankheit, Schädigung oder Funktionsbeeinträchtigung) – Englisch ‚impairment‘ –, die einer betroffenen Person zum Hindernis in der Lebensführung werden und eine Minderung in der Leistungsfähigkeit bewirken kann (vgl. Textor, 2015: 17 f.).
Eine Schädigung kann vorübergehend sein, denn Ziel der Medizin ist es, gesundheitliche Defizite zu heilen, zum Beispiel durch chirurgische Operationen, oder therapeutisch zu kompensieren, beispielsweise durch Psychotherapie. Textor verweist darauf, dass die medizinische Definition nur scheinbar unabhängig von gesellschaftlichen Bedingungen ist (vgl. Textor, 2015: 18). Die medizinische Definition von Schädigung bzw. Behinderung versucht, das geschädigte Individuum mit rein naturwissenschaftlich fassbaren Kriterien der psychologischen, physiologischen oder anatomischen Einbußen zu betrachten und somit dem gesellschaftlichen Einfluss zu entziehen (vgl. Kastl, 2017: 47). Nicht zwangsläufig muss aber eine vorliegende Schädigung zu Beeinträchtigungen in Fähigkeiten und Fertigkeiten und somit dem sozialen Leben der Betroffenen führen (vgl. Heimlich, 2019: 197).
2.2.2.2Sozialrechtliche Aspekte: ‚Beeinträchtigung‘
Das medizinische Erklärungsmodell setzt Behinderung mit Krankheit gleich, ein Ansatz, der in der Fachdiskussion allerdings als überwunden gilt (vgl. Heimlich, 2019: 27). Ziel des sozialrechtlichen Erklärungsansatzes ist es, „Behinderung so zu beschreiben, dass eine Verständigung über Rehabilitation sowie Gleichstellung und Nachteilsausgleich ermöglicht wird. Dementsprechend handelt es sich hierbei nicht um eine wissenschaftliche Definition, sondern um eine juristische“ (Textor, 2015: 19). Das deutsche Sozialrecht definiert im SGB IX ‚Behinderung‘ wie folgt:
1.Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können.
2.Eine Beeinträchtigung nach Satz 1 liegt vor, wenn der Körper- und Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht.
3.Menschen sind von Behinderung bedroht, wenn eine Beeinträchtigung nach Satz 1 zu erwarten ist. […] Menschen sind im Sinne des Teils 3 schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 vorliegt und sie ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre Beschäftigung auf einem Arbeitsplatz im Sinne des § 156 rechtmäßig im Geltungsbereich dieses Gesetzbuches haben (Parlamentsbeschluss, 2016: 8).
So muss zuerst eine Behinderung bzw. Leistungsminderung diagnostiziert werden, um vom deutschen Staat Unterstützung bei der selbstbestimmten Teilhabe an der Gesellschaft zu erhalten. Um eine Abweichung vom „typischen Zustand“ für das jeweilige Lebensalter festzustellen, wird die eigene Leistung mit der des sozialen Umfeldes verglichen. Auffallend ist hier, dass Behinderung (‚disabilty‘) als ‚Beeinträchtigung‘ (activity limitations) definiert wird. Gilt der Verlust eines Beines aus dem medizinischen Blickwinkel als Schädigung, so lässt sich das hieraus resultierende erschwerte Gehvermögen als Beeinträchtigung im sozialrechtlichen Sinne bezeichnen.
In Deutschland dienen 55 Kategorien der Erfassung der Beeinträchtigungsart. Hierbei liegt der primäre Fokus nicht auf der ursächlichen Krankheitsdiagnose (z.B. Multiple Sklerose), sondern der Erscheinungsform und Funktionseinschränkung durch die Krankheit (z.B. funktionelle Veränderung an den Gliedmaßen) (vgl. Statistisches Bundesamt, 2017: 8). Anzumerken ist, dass bei der Erfassung des Beeinträchtigungsgrades nur die schwerste Beeinträchtigung zählt, denn daraus folgt, dass Mehrfachbehinderungen nicht erfasst werden11. Insgesamt haben am 31.12.2017 in Deutschland beinahe die Hälfte aller Menschen mit Beeinträchtigung eine oder weitere Beeinträchtigungen (vgl. ebd.: 54).
2.2.2.3Interaktionistische Aspekte: ‚Behinderung‘
Menschen mit Behinderung erfahren Ungerechtigkeiten, beispielsweise wenn ihnen der gleichberechtigte Zugang zum Gesundheitssystem, der Bildung, der Arbeit oder politischen Teilhabe aufgrund ihrer Behinderung (‚participation restrictions‘) verwehrt wird. Aufgrund ihrer Behinderung sind sie häufig Gewalt, Missbrauch, Respektlosigkeit oder Vorurteilen ausgesetzt. Ihre Selbstständigkeit und Mündigkeit wird oft übergangen, wenn sie zum Beispiel gegen ihren Willen sterilisiert oder in Pflegeheimen untergebracht werden (vgl. WHO, 2011: 9). Es finden sich häufig negative Einstellungen zu Behinderung vor, welche den Umgang mit behinderten Menschen beeinflussen können. Das Resultat dieser Erfahrungen ist oft ein niedriges Selbstwertgefühl und eine erschwerte Teilhabe an der Gesellschaft (vgl. Kastl, 2017: 174 ff.; vgl. Singer, 2018: 11 ff.; vgl. WHO, 2011: 6). Präventive Maßnahmen und Gesundheitsvorsorge werden seltener bei Menschen mit Behinderung vorgenommen, so wird laut WHO die Krebsvorsorge bei behinderten Frauen beispielsweise seltener durchführt als bei Frauen ohne Behinderung. Dies lässt sich dadurch erklären, dass die Ärzt*innen hierfür nicht ausgebildet sind oder über keine angemessenen Untersuchungsgeräte verfügen. Auch physikalische Barrieren (z.B. fehlende Rampen) können den Arztbesuch be- bzw. verhindern. Zudem erhalten Menschen mit Behinderung seltener Sexualerziehung und werden auch nicht im Nationalen Krebsplan berücksichtigt, sodass ein Bewusstsein für den Umgang mit dem eigenen Körper reduziert sein kann (vgl. Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen, 2022: 32; vgl. WHO, 2018).
Unterschieden wird zwischen den drei Teilprozessen und Begriffen ‚Schädigung‘, ‚Beeinträchtigung‘ und ‚Behinderung‘. Während ‚Schädigung‘ medizinisch geprägt als gesundheitliche Einschränkung verstanden wird (vgl. Textor, 2015: 17 f.), bezieht sich ‚Beeinträchtigung‘ aus juristischer Sicht auf konkrete Einschränkungen in unterschiedlichen Lebensbereichen (vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2016: 14; vgl. Textor, 2015: 19). ‚Behinderung‘ begründet sich wiederum mit der sozialen Dimension (d.h. es gibt Barrieren in der Umwelt, die eine Teilhabe an der Gesellschaft behindern). Gleichsetzen lassen sich ‚Behinderung‘ und ‚Krankheit‘ nicht, da eine Krankheit heilbar bzw. vorübergehend ist und eine Behinderung als permanent und unheilbar definiert wird. Da in der Internationalen Klassifikation der Schädigungen, Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen (ICIDH) von 1980 noch der Fokus auf dem Defizit, d.h. ‚impairment‘, ‚disability‘ und ‚handicap‘ liegt, werden diese Begriffe 1997 von der WHO in ‚impairment‘, ‚activity‘ und ‚participation‘ umformuliert mit Konzentration auf der Ermöglichung eines selbstbestimmten Lebens (vgl. Heimlich, 2019: 198).
Die Ursachen von Behinderung sind zu vielfältig, um sie hauptsächlich auf genetische Defizite zurückzuführen. Insbesondere exogene bzw. soziale Risikofaktoren führen zu Behinderungen12, die oft erst in der Schulzeit und durch den Vergleich mit Bildungsstandards und sozialen Kontrollgruppen und deren Entwicklung erkannt werden (vgl. Kapitel 2.2.3 und 2.2.4). Auf Behinderung wird nicht nur sozial „reagiert“, sondern die Behinderung wird sozial „konstruiert“ (vgl. Kastl, 2017: 108).
‚Behinderung‘ stellt das Pendant zu ‚Nichtbehinderung‘ dar und wird auch dementsprechend definiert. Ein behinderter Mensch unterscheidet sich von einem nichtbehinderten Menschen durch die eigene Behinderung (vgl. Weisser, 2005: 17). Behinderung fällt immer als „anderes“ Verhalten im Vergleich zu einer Gesellschaft auf und hängt somit von sozialen Maßstäben ab (vgl. Kastl, 2017: 155 f.). Allerdings ist es „keineswegs eindeutig […], welche Normabweichungen in einer Gesellschaft zu Problemen führen“ (Textor, 2015: 18). Wird eine Lernbehinderung in der deutschen Gesellschaft als erschwertes Erlernen der Kulturtechniken Lesen und Schreiben definiert, so fällt dies in einem Land mit einer geringen Alphabetisierungsrate weniger ins Gewicht und gilt eher als „normal“ und im alltäglichen Leben als geringe Einschränkung. Die Einordnung in eine Behinderung hängt somit stark von den jeweiligen gesellschaftlichen Werten und Normen ab (vgl. ebd.).
Sowohl die Sichtbarkeit einer Behinderung wie auch die (eingeschränkten) Funktionsleistungen durch eine Behinderung, ebenso wie der Schweregrad und der bereits bestehende Kontakt mit behinderten Menschen sind Faktoren, die Einfluss darauf nehmen, wie auf einen Menschen mit Behinderung reagiert wird (vgl. Steiner, 2008: 24). Somit ist es hauptsächlich die Gesellschaft selbst, welche die Definitionen von ‚Behinderung‘ nach eigenen länder- und situationsabhängigen Kriterien erschafft. Befürworter*innen der Inklusion und der Abschaffung von Sonderschulen argumentieren, dass diese Separierung durch Sonderschulen durch Labeling und Stigmatisierung erst Behinderungen schaffe (vgl. Kastl, 2017: 183 f.). Des Weiteren führe permanente Abhängigkeit von Bezugspersonen zu der Überzeugung, den eigenen Alltag alleine nicht mehr meistern zu können. Aus dieser ‚erlernten Hilflosigkeit‘ können Depressionen entstehen (vgl. Seligman, 1999: 10, 33 ff., 125 ff.).
2.2.2.4Wechselwirkungen zwischen bio-psycho-sozialen Komponenten bei der ICF
Die 2001 von der WHO herausgegebene International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)13, die in Deutschland eine große Rolle für die Beantragung von Fördermaßnahmen, Unterstützung sowie Interventionen spielt (vgl. Bernasconi, 2020: 125), definiert Behinderung als Zusammenspiel von ‚Schädigung‘ (impairment), ‚Beeinträchtigung‘ (activity limitations) und ‚Behinderung‘ (participation restrictions) (vgl. WHO, 2018).
Der Behinderungsbegriff der ICF schließt alle Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeiten ein und ist damit umfassender als der Behinderungsbegriff des SGB IX (vgl. Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information DIMDI und WHO-Kooperationszentrum für das System Internationaler Klassifikationen, 2002: 4 f.). Das Modell der ICF betrachtet Behinderung nicht aus einem einzigen Blickwinkel, sondern aus mehreren, so dass man hier von einem bio-psycho-sozialen Modell spricht, welches das „Zusammenspiel von körperlichen, psychologischen und sozial-gesellschaftlichen Faktoren“ berücksichtigt (Bernasconi, 2020: 127). Letztendlich ist es zum größten Teil die Beschaffenheit der Umwelt, die für die Funktionsfähigkeit eines Menschen verantwortlich ist (vgl. ebd.).
Somit lässt sich der Stand der Teilhabe an der Gesellschaft daran bemessen, inwiefern Menschen mit Beeinträchtigungen Zugang zu den einzelnen Teilbereichen (Bildungssystem, Arbeitsmarkt, Gesundheitssystem, Wohnungsmarkt etc.) haben. Dabei lässt sich Teilhabe bzw. Inklusion zum einen im Kontrast zu Ausgrenzung bzw. Exklusion beschreiben (z.B. Teilhabe am Arbeitsleben oder nicht) und zum andern als Grad der Teilhabe (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2016: 19).
Laut der ICF können „alle Menschen im Laufe ihres Lebens mit Partizipationseinschränkungen aufgrund von gesundheitlichen Problemstellungen und/oder einem nicht zu ihren Bedürfnissen passenden Umfeld konfrontiert sein“ (Bernasconi, 2020: 127). Das Schaubild 2.2 (s.u.) soll die Komponenten von Behinderung laut der ICF darstellen.
Der Abbildung ist die komplexe Beziehung zwischen den verschiedenen Faktoren zu entnehmen, die zur Funktionsfähigkeit eines Menschen beitragen und sich gegenseitig dynamisch beeinflussen (vgl. Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information DIMDI und WHO-Kooperationszentrum für das System Internationaler Klassifikationen, 2002: 23 f.). Aus der ICF geht hervor, dass das medizinische und das interaktionistische Modell von Behinderung keine Gegensätze bedeuten, sondern sich vielmehr ergänzen. Durch den Fokus auf Aktivität, Teilhabe und Umwelt rückt das Modell die*den Betroffene*n als Ganzes in den Vordergrund. Auch für den schulischen Inklusionsbereich ist diese Fokusverschiebung von wesentlicher Bedeutung, da hierdurch mehrfaktorielle Ursachensuche und eine Übertragung in den Alltag betrieben wird, anstatt einzelne Schwachstellen oberflächlich und isoliert zu fördern (vgl. Bernasconi, 2020: 128). Dies bedeutet ebenso, dass der Abbau von Barrieren förderlich für die Leistungsfähigkeit und Teilhabe an der Gesellschaft ist.
Abb. 2.2: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF. Quelle: Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information DIMDI und WHO-Kooperationszentrum für das System Internationaler Klassifikationen, 2002: 23
2.2.2.5‚Sonderpädagogischer Förderbedarf‘
Mitte der 1990er Jahre kommt in der Bundesrepublik Deutschland der Begriff ‚sonderpädagogischer Förderbedarf‘ für die schulische Arbeit auf (vgl. Heimlich, 2019: 195). Der Begriff ‚special educational needs‘ stammt bereits aus den USA der 1970er Jahre und wird 1994 von der Kultusministerkonferenz der BRD in ihren Empfehlungen der sonderpädagogischen Förderung in den Schulen in der Bundesrepublik Deutschland als ‚sonderpädagogischer Förderbedarf‘ eingeführt, um den Begriff ‚Behinderung‘ im inklusiven Kontext abzulösen (vgl. ebd.: 199). Vergleichbar mit der Behinderungsauffassung der ICF beruht auch diese Auffassung auf der Annahme, dass die Ursachen einer Behinderung sowohl auf gesellschaftliche wie auch auf Umweltfaktoren zurückzuführen sind (vgl. Textor, 2015: 22 f.). Von medizinischen Aspekten unabhängig ist diese Auffassung von Behinderung jedoch nicht, insofern sich Mediziner*innen maßgeblich an der Feststellung von Behinderung nach dem Sozialgesetzbuch IXX beteiligen und oft durch eine Diagnose zum Förderort oder Bildungsweg einer*s jungen Patient*in beitragen (vgl. Heimlich, 2019: 27). ‚Sonderpädagogischer Förderbedarf‘ löst den bis 1994 verwendeten Begriff ‚Sonderschulbedürftigkeit‘ ab mit dem Ziel, weniger defizitorientiert zu sein, einen kleineren Teil der Gesamtpersönlichkeit auszumachen und den Ort der Beschulung offener zu lassen (vgl. Textor, 2015: 22). Der Blickwinkel wechselt „von der individuellen Schädigung hin zum besonderen Bedarf an Erziehung und Förderung“ (Heimlich, 2019: 199). Allerdings bleibt die Beschulung von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf weiterhin eher einer Integration zugeordnet, da Ressourcen (personell, finanziell etc.) durch Etikettierungsprozesse, d.h. die Feststellung eines Förderbedarfs, zugeschrieben werden, was auch als ‚Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma‘ bekannt ist. „Dieses Phänomen wird aus inklusionspädagogischer Perspektive als Widerspruch zu einem inklusiven Wandel betrachtet, da Inkluson immer mit dem Versuch der De- oder Entkategorisierung und der Vermeidung von Etikettierungen einhergeht“ (vgl. C. Huber und Hennemann, 2013: 4).
‚Sonderpädagogischer Förderbedarf‘ ist im Forschungsdiskurs breiter als die vorherigen Begrifflichkeiten angelegt und wird nach der OECD und UNESCO in drei Kategorien eingeteilt:
1.Schüler*innen mit ‚Behinderung‘ (Disabilities), d.h. mit medizinisch definierten Schädigungen körperlicher oder geistiger Art sowie der Sinnesorgane,
2.Schüler*innen mit ‚Lernschwierigkeiten‘ (Learning Difficulties), d.h. mit Verhaltens-, Lern- oder Sprachschwierigkeiten,
3.die Gruppe derjeniger mit ‚Benachteiligungen‘ (Disadvantages), d.h. Schüler*innen, die aufgrund ihres Geschlechts, ihrer sozioökonomischen, ihrer kulturellen Herkunft u.ä. benachteiligt sind (vgl. Textor, 2015: 22 f.).
Die KMK unterteilt 1994 ‚sonderpädagogischen Förderbedarf‘ in die folgenden Schwerpunkte: Lern- und Leistungsverhalten, Sprechen, emotionale und soziale Entwicklung, geistige Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung, Hören, Sehen sowie die ‚körperliche und seelische Verfassung‘, worunter chronische Krankheiten zu verstehen sind, und empfiehlt hierzu mögliche Fördermaßnahmen (vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, 1994: 6 f.). Im Jahr 2000 fügt die KMK den Bereich Autismus hinzu (vgl. Heimlich 2019: 200). In der Empfehlung verweist die KMK noch einmal explizit darauf, dass behinderte Schüler*innen „nicht nur unter dem Blickwinkel ihrer Behinderung gesehen werden [dürfen]; eine Behinderung stellt immer nur einen Aspekt der Gesamtpersönlichkeit des Kindes bzw. des Jugendlichen dar; Anknüpfungspunkte für die Förderung sind ihre jeweils bereits entwickelten Fähigkeiten“ (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, 1994: 7). Hier wird somit eine Grundlage geschaffen, die die Beschulung und Förderung von Schüler*innen nicht mehr an den Ort der Sonderschule festzumacht, sondern die gemeinsame Beschulung aller Schüler*innen ermöglichen soll (vgl. ebd.: 2 ff.).
Problematisch an den Empfehlungen der KMK von 1994 ist, dass bis heute nicht genau definiert wurde, inwiefern die Behinderungen eine Rolle bei der Einteilung von Schwere, Umfang und Dauer der Fördermaßnahmen spielen und wie sie gewogen werden. Exakt definiert ist ‚sonderpädagogischer Förderbedarf‘ bis heute nicht14, was eine adäquate Förderung erschwert (vgl. Heimlich, 2019: 200). Ein Definitionsversuch lässt sich beim Statistischen Bundesamt finden:
Von einem sonderpädagogischen Förderbedarf wird ausgegangen, wenn Kinder und Jugendliche in ihren Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten so beeinträchtigt sind, dass sie für ein erfolgreiches schulisches Lernen auf eine sonderpädagogische Förderung angewiesen sind. Integrationsschüler/-innen werden integrativ an allgemeinbildenden Schulen unterrichtet. Förderschüler/-innen dagegen nehmen ausschließlich am Unterricht in Förderschulen teil. […] Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden nach Förderschwerpunkten nachgewiesen. Bei mehreren Förderschwerpunkten ist derjenige maßgebend, der den größten zeitlichen Anteil bei der sonderpädagogischen Förderung ausmacht (Statistisches Bundesamt, 2019: 98).
Wichtig ist bei dieser Definition, dass die verschiedenen Begrifflichkeiten (Integrationsschüler*in, Förderschüler*in, Schüler*in mit sonderpädagogischem Förderbedarf) differenziert definiert werden bezüglich ihrer Beschulung und Unterstützung mit der Zielsetzung des Lernerfolgs. Grundvoraussetzung sind hier die jeweiligen Diagnosen, die nach Schwere priorisiert werden.
Für den didaktischen Anspruch der wirkungsvollen gezielten Förderung der Schüler*innen ist die Erstellung eines individuellen Förderplans notwendig. Dabei wird ausgehend von einem Ist-Zustand auf einen Soll-Zustand abgezielt, der mithilfe kleinschrittiger Förderziele erreicht werden soll. War Förderplanarbeit ursprünglich den Sonderschullehrkräften überlassen, wird der Plan aufgrund der Inklusionsbestrebungen zunehmend in multiprofessionellen Teams erstellt. Diese Teams setzen sich aus unterschiedlichen sozialen Fachrichtungen zusammen. Divergierende Auffassungen von ‚Behinderung‘, Einschränkung und fachlichen Erwartungen sowie Schwerpunktsetzungen in der Förderung müssen dann zu Gunsten des*der zu Fördernden in Übereinstimmung gebracht werden. Insbesondere Schwierigkeiten bei den Kontextfaktoren und Umweltbedingungen sollen von Seiten der pädagogischen Förderung so weit wie möglich abgebaut werden (vgl. Bernasconi, 2020: 126).
2.2.3Ethnische Herkunft in Verbindung mit sonderpädagogischem Förderbedarf
Wie oben angedeutet, führen bestimmte Kennzeichen und Unterschiede zwischen Menschen zu Exklusion oder Inklusion. Beispiele für solche Heterogenitätsmerkmale sind Geschlecht, (soziale) Herkunft oder auch Migrations- und Fluchterfahrungen (vgl. Preuss-Lausitz, 2019: 469; vgl. Schildmann, 2016: 77). Diese der Inklusion im weiteren Sinne zugeordneten Merkmale15 werden in dieser Arbeit nicht weiter thematisiert, da der Fokus auf sonderpädagogischem Förderbedarf und Autismus-Spektrum-Störungen liegen soll. Von großer Bedeutung sind an dieser Stelle Geschlecht und ethnische Herkunft in Verbindung mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Diese Merkmale werden jedoch in der UN-BRK nicht weiter kommentiert.
Durch die Verbindung von Geschlecht oder Migrationshintergrund mit sonderpädagogischem Förderbedarf entwickeln sich weitere Umstände. So zeigen etwa Studien, dass der relative Anteil an Schüler*innen mit Migrationshintergrund an Förderschulen deutlich höher ist als der von Menschen ohne Migrationshintergrund (vgl. Wocken, 2011: 228). Die zwei Heterogenitätsmerkmale Geschlecht und ethnische Herkunft werden im Folgenden kurz aufgegriffen und deren Zusammenhänge geklärt, da auch sie einen Einfluss auf die Diagnose und den Umgang von Autismus-Spektrum-Störungen haben können16. Diese beiden Merkmale in Verbindung mit sonderpädagogischem Förderbedarf lassen sich nach Prengels Pädagogik der Vielfalt als Vormodell der (erweiterten) Inklusion einstufen (vgl. Prengel, 2018: 35).
Auch Menschen mit Einwanderungsgeschichte17 werden in eine Gesellschaft inkludiert oder aus dieser ausgegrenzt. Weil sich ihre Teilhabechancen oft stark von denen anderer unterscheiden, soll auf dieses Differenzmerkmal und den Zusammenhang mit einer Förderbedarfsdiagnose knapp eingegangen werden.
Bei Migration (lat. migratio, dt. Wanderung) wird von dem Ab- und Auswandern (der Emigration) bzw. Zu- und Einwandern (der Immigration) aus einem und in ein anderes Land ausgegangen. Unterschieden werden muss aber zwischen Binnenwanderungen, d.h. Umzügen innerhalb eines Landes, und internationalen Migrationen. Eine Migration kann zeitlich begrenzt oder dauerhaft (vgl. Halfmann, 2012: 9) und freiwillig, z.B. in Form von Arbeitsmigration, oder erzwungen sein, z.B. aufgrund von Krieg (vgl. Hedderich und Lescow, 2015: 318). Migration gehört zur Kulturgeschichte der Menschheit und zeigt sich beispielsweise im demografischen Wandel der zunehmenden Industrialisierung und Globalisierung (vgl. Halfmann, 2012: 9). Die globale und soziale Ungleichheit nimmt immer mehr zu (vgl. Houngbo, 2023: 3; vgl. Mecheril, 2017: 10; vgl. OECD, 2015: 3). Auch ändern sich die Möglichkeiten der Migration über die Jahrhunderte: „Noch nie waren weltweit so viele Menschen bereit, aufgrund von Umweltkatastrophen, (Bürger-)Kriegen und anderen Bedrohungen gezwungen und aufgrund der technologisch bedingten Veränderung von Raum und Zeit in der Lage, ihren Arbeits- oder Lebensmittelpunkt auch über große Distanzen hin zu verändern“ (Mecheril, 2017: 9).
Die United Nations geht im Jahr 2020 von 281 Millionen internationalen Immigrant*innen aus (vgl. International Organization for Migration, 2021: 3), dazu zählt 2022 auch die Zuwanderung aufgrund des Ukraine-Kriegs (vgl. Pressestelle der Beauftragten der Bundesregierung für Migration Flüchtlinge und Integration, 2022). Eine Konsequenz hieraus ist der wachsende Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund, die deutsche Schulen besuchen. Laut dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus wird von einem Migrationshintergrund der Schüler*innen gesprochen, wenn mindestens eines der folgenden Merkmale in nichtdeutscher Ausprägung vorliegt: Verkehrssprache in der Familie bzw. Muttersprache, Geburtsland oder Staatsangehörigkeit (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2018a: 59). Deutschland scheint sich weiterhin hauptsächlich mit der Inklusion von behinderten Schüler*innen und nicht mit Mehrfachdifferenzmerkmalen zu befassen (vgl. Amirpur, 2016: 19). Folglich werden Schüler*innen mit mangelnden Deutschkenntnissen oder aus Migrationshintergründen vermehrt an Sonderschulen verwiesen (vgl. Schöler, Merz-Atalik und Dorrance, 2010: 27; vgl. Wocken, 2011: 228). Zwar wird Migration in den Humanwissenschaften bewusst behandelt, jedoch gibt es im Bereich der Heil- und Sonderpädagogik kaum Forschungsarbeiten (vgl. Halfmann, 2012: 2), auch enthält die UN-BRK keinen eigenen Artikel zu der Kategorie ‚Migration‘ (vgl. Amirpur, 2016: 24).
Migrationshintergrund und sonderpädagogischer Förderbedarf sind in unterschiedlichen intersektionalen Kontexten von Bedeutung. Intersektionalität meint, dass sich mehrere Diskriminierungsmerkmale überschneiden können. „Dabei wird die Benachteiligung durch die Merkmale aber nicht lediglich addiert, sondern das Zusammenwirken unterschiedlicher sozialer Ungleichheiten führt zu spezifischen Diskriminierungsformen“ (Denninger und Grüber, 2017: 5).
Im Jahr 2014 haben 8,4 % der 7,3 Millionen Schüler*innen eine nichtdeutsche Staatsangehörigkeit. An den Förderschulen besitzen jedoch 10,1 % der insgesamt 335.000 Schüler*innen eine nichtdeutsche Staatsangehörigkeit, ein deutlich höherer relativer Anteil. Die Zuwanderung der Familien mit behinderten Kindern aus anderen Ländern zum Zweck in ein besser ausgebautes Sonderschul- und Sozialsystem zu ziehen, kann als ein Grund genannt werden (vgl. Amirpur, 2016: 51; vgl. Dworschak, 2016: 36 ff.; vgl. Halfmann, 2012: 18 ff.)18. Aufgrund traditioneller Eheschließungen zwischen engen Blutsverwandten, die bei manchen ethnischen Gruppen vermehrt auftreten, erhöht sich jedoch auch das Risiko von Erbkrankheiten (vgl. Merten, 2018), was wiederum ein Grund für die Überrepräsentanz an Schüler*innen mit Migrationshintergrund und sonderpädagogischem Förderbedarf sein könnte. Dessen ungeachtet ist die Zahl der Schüler*innen mit Migrationshintergrund und sonderpädagogischem Förderbedarf an Förderschulen sinkend, was sich u. A. durch eine inklusive Beschulung wie auch „durch die zunehmend deutsche Staatsangehörigkeit der in Deutschland geborenen Kinder ausländischer Eltern“ erklären lässt (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2016: 463). Während 2005 91 % der Schüler*innen mit sowohl Migrationhintergrund als auch sonderpädagogischem Förderbedarf an Sonderschulen unterrichtet werden, veringert sich bis 2014 der Anteil auf 73 %, d.h. es werden mehr Schüler*innen an Regelschulen inkludiert (vgl. ebd.: 461). „[A]ber im Vergleich zu den Schüler/innen mit sonderpädagogischer Förderung in Förderschulen insgesamt (66%) ist der Anteil der ausländischen Schülerinnen und Schüler auch im Jahr 2014 überproportional hoch“ (ebd.). Daraus lässt sich also folgern, dass Schüler*innen mit sowohl Migrationshintergrund als auch sonderpädagogischem Förderbedarf seltener an Regelschulen inkludiert werden als ihre Vergleichsgruppen ohne Migrationshintergrund und sonderpädagogischen Förderbedarf (vgl. ebd.: 462).