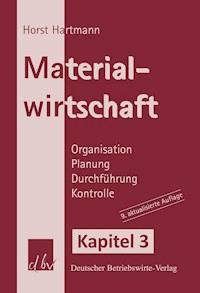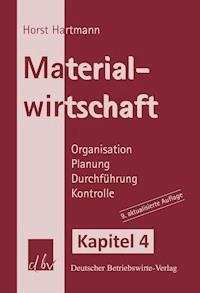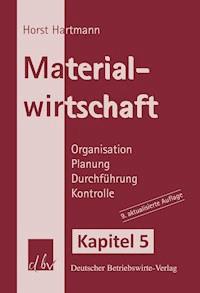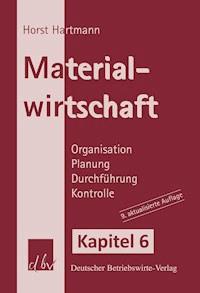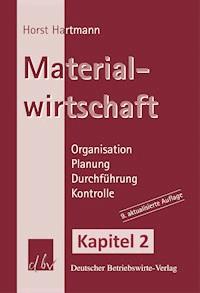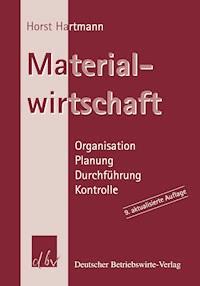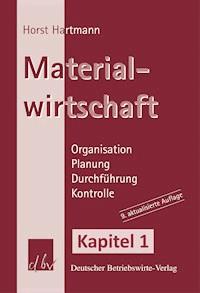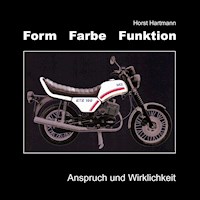
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Form Farbe Funktion - Anspruch und Wirklichkeit - zeichnet Stationen eines Lebens als Produktgestalter in der DDR nach und gibt Einblicke in persönliche und berufliche Erfahrungen in einem diktatorischen System der Unfreiheit und der Verfolgung. Horst Hartmann verfolgt seine Wegstrecken als Designer, vom Studium an der HfG Halle, Burg Giebichstein, über sein Wirken als Produktgestalter in der DDR bis zu Produktentwicklungen und Kunstwerken für den "Öffentlichen Bereich". Das aufschlussreiche Buch ist Zeugnis eines reichen Designerlebens als Produkt- und Objektgestalter in zwei Gesellschaften.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 49
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkungen
Gesellschaftliche Entwicklung
Berufsziel – Studium an der Burg Giebichenstein Halle
Praktikum
Bewertung eines Fahrzeuges (Wartburg 353)
Designstudium
Berufsbeginn und Herausforderung
Neuer Anfang und Designaufgaben
Neue Gesetze des AiF
Ein administratives „Monster“
Zusammenarbeit mit den Gremien der BRD
Neues Gesetz über die Honorierung
Schreiben an den Verbandspräsidenten Willi Sitte vom 17.7.1979
Ausblick
Die Entscheidung
Der Neubeginn und die Spuren der Vergangenheit
Widerstand oder Anpassung…….
Abschlussbemerkungen
Ausblick und mein Schreiben an den Präsidenten des VBK-DDR
Resümee
Persönliche Anmerkungen zur IM - Verfolgung
Ausstellung im Schauspielhaus Chemnitz 1996
Designübersicht
Autobiografisches
Vorbemerkungen
26 Jahre nach dem Mauerfall melden sich erneut die Protagonisten des DDR Regimes zu Wort und geben in Sprache und Schrift der Öffentlichkeit zur Kenntnis, dass sie eigentlich „Verfolgte“ des sozialistischen Staates gewesen, oder sie nach ihren Aussagen „redliche“ Mitbürger mit „guten“ Absichten, waren.
Wer will es Ihnen verdenken, da Gegenwehr nicht in Sicht ist und ein Aufbegehren erst recht nicht. Plötzlich waren sie alle Widerständler und Kritiker des totalitären Staates gewesen, sind diesem Regime „entgegen getreten“ und haben sich für die Entfaltung des Individuums sowie für dessen Freiheit eingesetzt?
Es fällt auf, dass aus der „Verursacherrolle“ nun plötzlich bedeutende „Protagonisten“ des Fortschrittes und der Kreativität wurden. Sie verstehen es, ihre Handlungen in einem positiven Licht erscheinen zu lassen und werden dabei von diversen Presseorganen und einschlägigen Publikationen unterstützt.
In mehreren Büchern zum sogenannten „DDR-Design“ haben sich ehemalige SEDFunktionäre zu Wort gemeldet und erheben nun den Anspruch, die wirklichen und einzigen Designer, oder wie es in Ostdeutschland hieß, „Formgestalter“, von Sachsen und Berlin gewesen zu sein. Diese selbsternannten Spitzenkräfte des DDRDesigns scheuen auch nicht davor zurück, sich selbst und die eigenen Leistungen als einzigartig zu bezeichnen und verdrängen bewusst das übrige Spektrum gestalterischer Ergebnisse anderer Designer.
Einige Designjournalisten haben sich des Erbes und der Hinterlassenschaften des sozialistischen Designs angenommen und dafür gesorgt, dass diese für die Öffentlichkeit zugänglich werden. Dabei ist anzumerken, dass die Beiträge vorwiegend aus dem Fundus des staatlich geführten „Amt für industrielle Formgestaltung“ (AiF) Berlin stammen, deren Herkunft zumeist von angestellten, oder von systemtreuen Designern erbracht wurden. Eine objektive Berichterstattung über das gesamte DDR-Design war bisher nicht gewollt. Die Fachzeitschrift form + zweck, als Zentralorgan des AiF, veröffentlichte vorwiegend Ergebnisse systemtreuer Außenstellen, wie dem VEB „Designprojekt“, sowie Entwicklungen von Gestaltern volkseigener Betriebe. Freiberufliche Aktivitäten wurden zumeist ignoriert und von einer Veröffentlichung ferngehalten.
Das erklärt auch, weshalb nur wenige Produktentwürfe aus der Arbeit freischaffender Gestalter bekannt wurden. Dies lag nicht im Interesse der Verantwortlichen des AiF und auch nicht in der Absicht der gesellschaftlichen Auftraggeber.
Außerdem gab es keine Urheberbenennung auf Produkten, in Werbeunterlagen und bei öffentlichen Präsentationen. Die Designer blieben unbekannt und anonym.
Gesellschaftliche Entwicklung
Die sogenannte „Vollendung des Sozialismus“ in der DDR in den siebziger Jahren führte dazu, dass Privatunternehmen und Handwerksbetriebe, eigentümergeführte Firmen und Genossenschaften, verstaatlicht und die Inhaber enteignet wurden. An ihre Stelle sind Parteifunktionäre eingesetzt worden, deren Qualifikation in den wenigsten Fällen den Führungsanforderungen der Industrie gerecht wurden. Dies hatte zur Folge, dass ganze Bereiche der Gebrauchs- und Konsumgüterherstellung ausgeblieben sind und neue Entwicklungen nicht in Sicht waren.
Fortan wurden Großbetriebe verpflichtet, die Lücke mit artfremder Produktion auszufüllen, was bedeutete, dass äußerst makabere Entscheidungen getroffen wurden. So musste ein Berliner Großbetrieb der Elektrobranche Brennöfen für die Einrichtung einer Keramikwerkstatt anschaffen, worin angelernte Töpfer Vasen und Übertöpfe produzierten. Erstaunlich ist dabei, dass es bei den Mitarbeitern des Betriebes fortan nur noch ein Thema gab, nämlich, wie komme ich an eine Keramikvase heran? Die Beispiele ließen sich in vielfältiger Weise fortführen. Firmen des Maschinenbaus bekamen beispielsweise den Auftrag, Möbelteile oder Handwerkszeuge zu produzieren. Welch eine irrige Politik! Es wurden dabei Entwicklungskapazitäten gebunden, welche wiederum an anderer Stelle fehlten.
Das „Amt für industrielle Formgestaltung“, unter der Leitung des Staatsekretär Martin Kelm, war dieser Entwicklung nicht abgeneigt, im Gegenteil, man beeilte sich, Regeln für die Schaffensformen der Designer aufzustellen. Ziel war es, die freien Gestalter zu reglementieren und unter staatliche Kontrolle zu bringen. Mit einem Gesetz über die „Anleitung und Kontrolle auf dem Gebiet der Formgestaltung industrieller Erzeugnisse in der Volkswirtschaft der DDR“ wurde verfügt, dass die Rahmenverträge zwischen Betrieben und formgestalterischen Einrichtungen sowie freiberuflich tätigen Gestaltern bis zum 31.Dezember 1973 gekündigt werden mussten. Außerdem trat die bisherige Anordnung über die „Honorierung im Bereich der Erzeugnisgestaltung“ außer Kraft. Des Weiteren wurde verfügt, dass frei- und nebenberuflich tätige Designer (z.B. Industrieformgestalter, Keramik-, Glas-, Metall-, Spielzeug und Textilgestalter) eine Zulassung beim Amt für industrielle Formgestaltung (AiF) beantragen und genehmigen lassen mussten. Voraussetzung dafür war ein Hochschulabschluss, eine dreijährige Berufserfahrung in der ausgeübten Tätigkeit sowie eine Leistungsbestätigung durch den „Verband Bildender Künstler der Deutschen Demokratischen Republik“ (VBK-DDR). Dieses Gesetz wurde am 2. August 1973 vom Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik, unter dem Vorsitzenden Willi Stoph, verabschiedet.
Für eine zusätzliche Entmündigung der Designer sorgte die Tatsache, dass Gestaltungsergebnisse künftig dem AiF zur Begutachtung und Bewertung vorgestellt werden mussten, um ein Zertifikat für die Umsetzung in die Serie zu erhalten. Jeder Radioentwurf, jedes Elektrogerät und andere Produktentwürfe, mussten diese Prüfung durchlaufen, zumeist in Berlin, was einen enormen Aufwand zur Folge hatte. Auch die regionalen Designzentren des „AiF“ waren verpflichtet, als dessen Kontrollorgan tätig zu werden. Gestalter und Betriebe wurden aufgefordert, Einblicke in die Entwicklungsvorhaben zu gewähren, um den Segen dieser Institution zu erhalten. Ein unerträglicher Zustand für die Designer und der Anfang für weitere Gängelungen. Der tausendfache „Wasserkopf“ war geboren, eigene Entwicklungen blieben aus, das Amt vollführte nur noch administrative Handlungen. Die Ausgrenzung freiberuflicher Gestalter und der Entzug der Arbeitsgrundlagen, schaffte eine unbeschreibliche Verunsicherung bei den betrieblichen Entwicklungsstellen und in erster Linie unter den Designern selbst. Es überwog das Gefühl der Ratlosigkeit und des Verdrusses gegenüber einer allmächtigen Administration, dem AiF. Kleinere Gestaltungsaufgaben, wie Kinderfederballschläger oder Kunststoffübertöpfe für Pflanzen sollten von nun an die profilierten Designer übernehmen, was sie aus gutem Grund ablehnten.