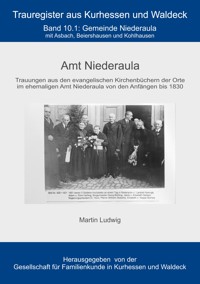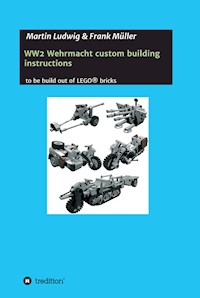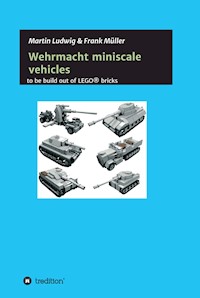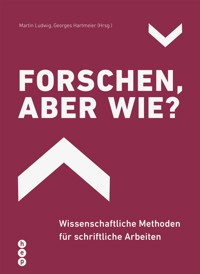
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: hep verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Dieses E-Book enthält komplexe Grafiken und Tabellen, welche nur auf E-Readern gut lesbar sind, auf denen sich Bilder vergrössern lassen. Sie sind Schülerin oder Schüler am Gymnasium, an der Berufsmaturitätsschule oder an der Fachmittelschule und Ihnen steht demnächst eine wissenschaftliche Arbeit bevor? Sie wissen nicht, wie vorgehen, und der Gedanke an die Arbeit stresst Sie? Dieses Buch hilft Ihnen dabei, diese Herausforderung erfolgreich zu meistern. Es führt Sie von der Ideensuche über die Fragestellung und Wahl der richtigen Methode zur Anwendung und zur Auswertung. Folgende elf Methoden werden in diesem Buch in je einem Kapitel beschrieben: Fachliteratur finden und Quellen auswählen, Datenerhebung im Gelände, verhaltensbiologische Beobachtung, naturwissenschaftliche Experimente, statistische Auswertung von Daten, sozialwissenschaftliche Methoden, Meinungsbefragung, Interview, Oral History, Filmanalyse, Textanalyse. Sie können jedes Kapitel einzeln bearbeiten und Ihr neues Wissen laufend in kurzen Aufgaben überprüfen und anwenden. Durch dieses Buch gewinnt Ihre wissenschaftliche Arbeit an Struktur und Systematik - und Sie an Sicherheit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin Ludwig, Georges Hartmeier (Hrsg.)
Thomas Clemens, Brigitta Geissmann, Yves Hänggi, Georges Hartmeier, Alexander Käslin, Hansruedi Künsch, Martin Ludwig, Christian Marty, Edith Matt, Konstanze Mez, Helene Mühlestein, Stefan Mundwiler, Peter Neumann, Susanne Portmann, Armin Schmidt, Amadeus Spirig, Klaus Stalder, Annemarie Stoffel, Katharina Weissenbacher
Forschen, aber wie?
Wissenschaftliche Methoden für schriftliche Arbeiten
ISBN Print: 978-3-0355-1214-4
ISBN E-Book: 978-3-0355-1599-2
1. Auflage 2019
Alle Rechte vorbehalten
© 2019 hep verlag ag, Bern
www.hep-verlag.ch
Zusatzmaterialien und -angebote zu diesem Buch:http://mehr.hep-verlag.ch/forschen-aber-wie
Vorwort
Eine eigenständige Arbeit zu verfassen, ist eine kreative, höchst spannende Aufgabe und gehört zum Lernreichsten im Gymnasium, in der Fach- und Berufsmittelschule und später im Studium an einer (Fach-)Hochschule. Besonders gross sind die Herausforderungen, wenn die Arbeit den Anspruch einer wissenschaftlichen Vorgehensweise erfüllen soll, wie dies bei einer schriftlichen Arbeit in der Regel der Fall ist. Die Anforderungen mögen zu Beginn sogar als zu gross und als kaum zu bewältigen erscheinen. Auch erfahrene Forscherinnen und Forscher stehen mit jeder neuen Studie zunächst vor einer Hürde, die es zu überwinden gilt. Wissenschaftliche Tätigkeit ist anstrengende Arbeit, aber sie lohnt sich. Man erwirbt sich dabei eine einzigartige Expertise, die auch über Jahre hinweg erhalten bleibt.
Warum hat eine Maturaarbeit wissenschaftlichen Ansprüchen zu genügen?
Die Matura soll zu einem Hochschulstudium befähigen. Studierfähig zu sein, bedeutet, sich in ein Fachgebiet einarbeiten zu können und Kenntnis zu haben, was wissenschaftliches Arbeiten ausmacht. Die Maturaarbeit bietet die Chance, Erfahrungen mit wissenschaftlichem Vorgehen zu sammeln. Später im Studium lässt sich auf diesen Erfahrungen aufbauen, wenn es darum geht, sich vertiefter mit wissenschaftlichen Theorien und Arbeitsweisen des Studienfaches auseinanderzusetzen.
In einer Lehrveranstaltung an der Universität Zürich zu fächerübergreifendem Unterricht liessen wir jeweils die Studierenden, die aus verschiedensten Studienrichtungen kamen, beschreiben, wie ihr Fach wissenschaftsmethodisch arbeitet. So sollten sie zum Beispiel charakterisieren, mit welchen Methoden ein Sprachwissenschaftler zu wissenschaftlichen Erkenntnissen gelangt oder wodurch sich die wissenschaftliche Arbeitsweise einer Chemikerin auszeichnet. Es fiel den meisten Studierenden zu Beginn schwer, das Besondere ihres Faches, auch in Abgrenzung zu anderen Fächern, herauszuschälen. Wenn dann aber die Präsentationen nebeneinander standen und miteinander verglichen werden konnten, ging jeweils ein erstauntes «Aha» durch die Reihen. Den Studierenden waren die wissenschaftlichen Grundlagen und die methodischen Werkzeuge in ihrem Fach bewusst geworden. Und es entstanden auch angeregte Diskussionen darüber, warum man nicht viel früher, zu Beginn des Studiums und bereits im Gymnasium, wissenschaftliches Arbeiten und wissenschaftstheoretische Fragen kennengelernt habe.
Die Tatsache, dass selbst Hochschulstudierende im fortgeschrittenen Studium Mühe bekunden, die fachwissenschaftliche Arbeit zu charakterisieren, zeigt, dass Lehren über Wissenschaft nicht dasselbe ist wie Lernen durch wissenschaftliches Tun. Erst dann, wenn man sich in allen Phasen des eigenen Forschens Rechenschaft darüber geben muss, warum man auf welche Weise vorgeht, kann man nachvollziehen, was wissenschaftliches Arbeiten bedeutet.
Wissenschaftlich zu arbeiten, heisst zunächst einmal, sich mit einem Untersuchungsfeld vertraut zu machen: sich einzulesen, Gespräche mit Fachleuten zu führen, den Stand des Wissens in Erfahrung zu bringen, aktuelle Fragestellungen kennenzulernen. Es geht also darum, die theoretische Basis zu erarbeiten, um darin das eigene Forschungsinteresse zu verankern und die genaue Fragestellung einzugrenzen. Erst dann folgen Überlegungen, wie die Fragestellung bearbeitet und neues Wissen gewonnen werden kann, mit welchen Methoden Daten gesammelt und ausgewertet werden sollen. Mit Daten sind dabei keineswegs ausschliesslich Messdaten gemeint, auch Interviewtranskripte, Gesprächsprotokolle, Bilder, Texte usw. gehören dazu, sofern sie auf die Fragestellung bezogen systematisch ausgewählt und ausgewertet werden. Und schliesslich geht es darum, die gewonnenen Ergebnisse zu interpretieren und kritisch zu hinterfragen. Die Diskussion von neuen Befunden und der intersubjektive Austausch gehören wesentlich zu den Charakteristika wissenschaftlichen Arbeitens.
Fundiertes, wissenschaftliches Arbeiten ist anspruchsvoll. Genau darum wurde dieses Lehrbuch geschaffen. Es begleitet die Leserinnen und Leser Schritt für Schritt in die Welt des wissenschaftlichen Arbeitens. Auch Lehrpersonen und Studierende an Hochschulen werden das Buch mit Gewinn zur Hand nehmen. Es bietet Grundlagen zum wissenschaftlichen Arbeiten und beschreibt zahlreiche methodische Vorgehensweisen und Auswertungsverfahren anhand von Beispielen. Sie regen an, systematische Überlegungen in einem gewählten Fachgebiet anzustellen und sich allmählich in einem konkreten Projekt vorzutasten.
Wer sich auf das Studium dieses Lehrbuchs einlässt, wird erleben, wie aufregend und inspirierend die wissenschaftliche Tätigkeit ist. Wenn bei der abschliessenden Präsentation der Arbeit in der Öffentlichkeit ein Funken der Begeisterung auf das Publikum überspringt, ist dies der schönste Erfolg.
Regula Kyburz-Graber
Prof. Dr., emeritierte Professorin am Institut für Erziehungswissenschaft, Abteilung Lehrerinnen- und Lehrerbildung Maturitätsschulen, Universität Zürich
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Von der Idee zur Wahl der Methode
1.1 Einleitung
1.2 Von der Idee zur Fragestellung
1.3 Die passende Methode finden
1.3.1 Sich vorbereiten: recherchieren, bewerten und vernetzen
1.3.2 Ortsgebundene Daten erheben – beobachten – experimentieren
1.3.3 Erhobene Daten mittels Statistik auswerten
1.3.4 Unsere Mitmenschen beobachten und befragen
1.3.5 Zeitzeuginnen und Zeitzeugen befragen
1.3.6 Kulturelle Werke analysieren
1.4 Wissenschaftliches Arbeiten
1.4.1 Wissenschaftliches Argumentieren
1.4.2 Wissenschaftliches Schreiben
1.4.3 Wissenschaftliche Standards erfüllen
1.5 Literatur
2 Fachliteratur und andere Quellen
2.1 Literatur und andere Quellen finden
2.1.1 Wie verschaffe ich mir einen Überblick?
2.1.2 Wo suche ich nach den gewünschten Quellen?
2.1.3 Wie gehe ich bei der Suche vor?
2.1.4 Wie bewerte ich die gefundenen Quellen?
2.1.5 Wie verwalte ich die gefundenen Informationen?
2.2 Die ausgewählten Materialien verarbeiten
2.3 Mit Quellentexten korrekt umgehen
2.3.1 Den wissenschaftlichen Ehrenkodex einhalten
2.3.2 Richtig zitieren und verweisen
2.3.3 Quellenverzeichnis/Literaturverzeichnis erstellen
2.4 Literatur
Lösungen
3 Datenerhebung im Gelände
3.1 Daten mit Raumbezug
3.2 Planen der Geländearbeit
3.3 Ortsbezogene Informationen sammeln – aber wo genau?
3.3.1 Gezielte Auswahl der Standorte
3.3.2 Zufällige Auswahl der Standorte
3.4 Durchführung der Geländearbeit
3.5 Kartieren – Darstellung von Raumdaten
3.6 Interpretation
3.7 Arbeitsschritte im Überblick
Lösungen
4 Verhaltensbiologische Beobachtung
4.1 Einleitung
4.2 Fragestellung und Forschungshypothese
4.3 Planung und Vorbereitung von Beobachtungen
4.3.1 Vermeidung von Störungen bei Tierbeobachtungen
4.3.2 Auswahl und Identifizierung der beobachteten Individuen
4.3.3 Zeitpunkt und Dauer Ihrer Beobachtungen
4.4 Durchführung
4.4.1 Schnappschuss- oder Scan-Beobachtung
4.4.2 Fokusbeobachtung
4.4.3 Nächster-Nachbar-Beobachtung
4.4.4 Sequenz-Beobachtung
4.4.5 Soziometrische Matrix
4.4.6 Erstellen eines Beobachtungsprotokolls
4.5 Zuverlässigkeit von Daten und Datenmenge
4.6 Wissenschaftliche Skepsis
4.7 Darstellung und Auswertung der Daten
4.8 Beispiel aus der Verhaltensbiologie
4.8.1 Vorbemerkungen
4.8.2 Abklärungen rund um die Forschungsfrage
4.8.3 Festlegung der messbaren Indikatoren
4.8.4 Korrelation und Kausalbeziehung
4.8.5 Planung der Beobachtung
4.8.6 Auswertung
4.9 Arbeitsschritte im Überblick
4.10 Literatur
Lösungen
5 Naturwissenschaftliche Experimente
5.1 Einleitung
5.2 Von der Idee zum Experiment
5.3 Hypothesenbasiert oder produktorientiert?
5.4 Das Verfahren bestimmen
5.5 Vorbereitungen für ein Experiment
5.6 Durchführung des Experiments
5.6.1 Versuchsanleitung und Versuchsprotokoll
5.6.2 Reproduzierbarkeit der Resultate, Präzision und Richtigkeit
5.6.3 Kalibrierung und Messgenauigkeit
5.6.4 Blindwert und Blindprobe
5.6.5 Bedeutung und Änderung von Einflussgrössen
5.7 Auswertung hypothesenbasierter Arbeiten
5.8 Auswertung produktorientierter Arbeiten
5.9 Diskussion der Ergebnisse
5.10 Beispiel aus der Physik
5.11 Arbeitsschritte im Überblick
5.12 Literatur
Lösungen
6 Statistische Auswertung von Daten
Vorbemerkung zur Verwendung von Software
6.1 Grundbegriffe
6.2 Beschreibende Statistik
6.2.1 Univariate metrische Daten
6.2.2 Univariate kategoriale Daten
6.2.3 Multivariate metrische Daten
6.2.4 Zusammenhänge zwischen kategorialen Merkmalen
6.2.5 Mehr als zwei Merkmale
6.3 Schliessende Statistik
6.3.1 Genauigkeit von relativen Häufigkeiten
6.3.2 Genauigkeit des arithmetischen Mittels
6.3.3 Zufallsstichproben
6.3.4 Die Grundbegriffe von Hypothesentests
6.3.5 Hypothesentests und Vertrauensintervalle für andere Lagemasse
6.3.6 Schliessende Statistik für zwei Grundgesamtheiten
6.3.7 Schliessende Statistik für Zusammenhangsmasse
6.3.8 Fehlerrechnung
6.3.9 Überlegungen zum Stichprobenumfang
6.4 Fallbeispiele
6.4.1 Atmungshäufigkeit von Goldfischen, Abschnitt 4.7
6.4.2 Auswirkungen der Frühkastration, Abschnitt 4.8
6.4.3 Antibakterielle Wirkung von Nikotin, Abschnitt 5.7
6.4.4 Späterer Schulbeginn, Abschnitt 8.3
6.4.5 Einen Aktivschultag einführen, Abschnitt 8.4
6.5 Das Statistikprogramm R
6.6 Literatur
Lösungen
7 Sozialwissenschaftliche Methoden
7.1 Systematisches Beobachten
7.1.1 Eine Beobachtung planen
7.1.2 Einen Beobachtungsbogen erstellen
7.1.3 Auswertung von Beobachtungsdaten
7.2 Befragung mittels Fragebogen
7.2.1 Einen Fragebogen erstellen
7.2.2 Fragebogenitems formulieren
7.2.3 Besonderheiten der Online-Befragung
7.2.4 Auswertung von Fragebogendaten
7.3 Sozialwissenschaftliches Experiment
7.3.1 Die Planung
7.3.2 Die Umsetzung an einem konkreten Beispiel
7.4 Literatur
Lösungen
8 Methode «Meinungsbefragung»
8.1 Einführung in die Fachbegriffe
8.2 Merkmale beeinflussen unsere Meinung
8.3 Vorbereitung auf eine Meinungsbefragung
8.3.1 Gründlich recherchieren
8.3.2 Grundgesamtheit und Zufallsstichprobe bestimmen
8.3.3 Hypothesen bilden
8.3.4 Fragebogen korrekt aufbauen
8.3.5 Grundlegende Regeln der Fragebogenkonstruktion
8.3.6 Pretest und Auswertung
8.4 Bearbeitung einer komplexen Befragung
8.4.1 Beispiel «Ein Tag pro Woche Aktivschule»
8.4.2 Anzahl Ausprägungen und Hypothesen festlegen
8.4.3 Grundgesamtheit definieren
8.4.4 Stichprobenauswahlen
8.5 Online-Befragung
8.5.1 Empfehlungen
8.5.2 Beispiel einer Online-Meinungsbefragung: Zivildienst light für junge Frauen?
8.5.3 Auswertung des Pretests
8.5.4 Stolpersteine vermeiden – Erfolg haben
8.6 Arbeitsschritte im Überblick
8.7 Literatur
Lösungen
9 Interview
9.1 Einleitung
9.2 Interviewformen
9.3 Geeignete Personen für ein Interview finden
9.4 Inhaltliche Vorbereitung des Interviews
9.5 Durchführung des Interviews
9.6 Auswertung des Interviews
9.7 Literatur
Lösungen
10 Oral History
10.1 Einleitung
10.2 Anforderungen an die Themenauswahl
10.3 Vorbereitung
10.4 Ablauf eines Oral-History-Interviews
10.5 Transkription
10.6 Rekonstruktion von Geschichte
10.7 Die Kunst des Oral-History-Interviews
10.8 Ein gemeinsames Werk
10.9 Literatur
Lösungen
11 Filmanalyse
11.1 Einleitung
11.2 Geschichte im Film – einige Beispiele
11.2.1 Auswahl der Beispielfilme
11.2.2 Vergleich von historischen Spielfilmen und historischer «Wahrheit»
11.3 Filme als historische Quellen
11.3.1 Geschichtlicher Wandel an Originalschauplätzen
11.3.2 Filme sind Ausdruck des Zeitgeists
11.3.3 Filme als Spiegelbilder der Gesellschaft
11.3.4 Filme als Wunsch- und Traumbilder der Gesellschaft
11.3.5 Filme als Zeugnisse vorherrschender Mythen und Ideologien
11.4 Methoden der Filmanalyse
11.4.1 Die filmische Gestaltungsweise
11.4.2 Dramaturgie
11.4.3 Inszenierung
11.4.4 Montage
11.4.5 Kameraeinstellungen
11.4.6 Licht
11.4.7 Ton
11.5 Beispiel einer Filmanalyse
11.5.1 Erzählstruktur/Dramaturgie («Storystruktur» und «Storydesign»)
11.5.2 Die filmische Gestaltung
11.5.3 Das filmische Umfeld
11.5.4 Zusammenfassend
11.6 Literatur
Lösungen
12 Textanalyse
12.1 Ideen zur Arbeit mit Texten
12.2 Text erschliessen
12.3 Fragen an den Text stellen
12.4 Verschiedene methodische Zugänge
12.4.1 Wo? – Topografische Räume und Bedeutungsräume
12.4.2 Was? – Elemente von Texten
12.4.3 Wie? – Zuordnung zu einer Gattung
12.4.4 Wie? – Erzählweise
12.4.5 Wie? – Rhetorische Form
12.4.6 Wie? – Intertextualität
12.4.7 Wie? – Poetische Form
12.4.8 Wie? – Kommunikation
12.4.9 Wann? – Literarische Epoche
12.4.10 Wann? – Historische Epoche
12.5 Nachbardisziplinen
12.6 Methodische Grundsätze
12.6.1 Aktuelle Theorie
12.6.2 Nachvollziehbarkeit
12.6.3 Zitierfähige Primärtexte
12.7 Literatur
Weiterführende Literatur
Lösungen
Anhang
Beispiele von Themen für schriftliche Arbeiten
Autorinnen und Autoren
Dank
Bildnachweis
Von der Idee zur Wahl der Methode
1
Thomas Clemens, Georges Hartmeier, Martin Ludwig
Worum geht es?
Sie suchen eine überzeugende Idee für Ihre Projekt- oder Maturaarbeit an der Berufsmaturitätsschule, der Fachmittelschule oder am Gymnasium. Sie formulieren Ihre Idee zuerst als Thema und fokussieren – falls Sie sich eine Untersuchung vornehmen – auf eine sehr enge Fragestellung. Eine mögliche Antwort auf Ihre Fragestellung nehmen Sie schon vorweg, indem Sie bereits zu Anfang eine Behauptung in der Form einer These oder Hypothese aufstellen. Die Hauptaufgabe Ihrer Arbeit besteht darin, diese Ausgangsbehauptung mithilfe der geeigneten Methoden zu untermauern, entweder mit Argumenten oder mit Daten, die Ihnen zur Verfügung stehen oder die Sie aus Experimenten gewinnen. Falls Ihr Ziel eine technische Produktion ist, experimentieren Sie, bevor Sie Essenzen extrahieren oder kostbares Material verbauen.
Mit Ihrer Abschlussarbeit, die wir in diesem Buch Maturaarbeit nennen, bereiten Sie sich auf das wissenschaftliche Arbeiten vor. Sie argumentieren schlüssig und überprüfbar, Sie bedienen sich einer präzisen Sprache, und Sie befolgen bezüglich des methodischen Vorgehens Empfehlungen, die in diesem Kapitel ausgeführt werden. Sie entwickeln eine klare Haltung zur korrekten Quellenangabe und kommentieren Ihre Erkenntnisse kritisch. Das Wort «wissenschaftlich» umschreibt also eine Zielvorstellung, an der sich Ihre Arbeit orientiert. Wie nahe Sie an dieses Ziel herankommen, wird von Ihrem Engagement und Ihrer Zusammenarbeit mit der betreuenden Lehrperson bestimmt.
Inhalt
1.1 Einleitung
1.2 Von der Idee zur Fragestellung
1.3 Die passende Methode finden
1.4 Wissenschaftliches Arbeiten
1.5 Literatur
1.1 Einleitung
Ihre Maturaarbeit ist wahrscheinlich das erste Projekt, an dem Sie mehrere Monate selbstständig arbeiten werden. Das vorliegende Kapitel begleitet Sie von der Ideenfindung hin zur Fragestellung und bis zur Wahl der für Ihr Projekt geeigneten Methode(n). Es beschreibt, was wissenschaftliches Arbeiten heisst, und stellt Ihnen zwei unterschiedliche Vorgehensweisen vor, anhand deren neue Erkenntnisse gewonnen werden können. Vielleicht haben Sie die Entscheidung über den Typus Ihrer Maturaarbeit schon getroffen.[1]
Sie planen eine Untersuchung. Beispielsweise untersuchen Sie mit einem Experiment, ob ein starkes elektromagnetisches Feld das Wachstum bestimmter Pflanzen beeinflusst. Oder Sie untersuchen den Roman «Ruhm» von Daniel Kehlmann, um die Frage zu beantworten: Wie sind die neun Geschichten über ihre Figuren, Motive und Themen verknüpft? Eine Untersuchung gibt Antworten auf eine präzise Fragestellung. Das Ziel Ihrer Untersuchung ist die Erforschung eines bestimmten, sehr eng begrenzten Ausschnitts unserer gesellschaftlichen, kulturellen oder physischen Welt. Wenn Sie dabei die wissenschaftlichen Methoden, die in diesem Buch vorgestellt werden, anwenden und sich bemühen, während des ganzen Prozesses wissenschaftlichen Anforderungen zu genügen, dann werden Sie einen Mosaikstein zum Wissensstand beitragen.
Vielleicht steht Ihnen der Sinn eher nach einem technischen Produkt. Sie wollen etwas erschaffen, eine Substanz aus anderen gewinnen oder etwas konstruieren oder programmieren. Wer beispielsweise einen Duftstoff extrahiert, ein spezielles Papier, eine Schaltung oder ein Messgerät herstellt, macht vorher diverse Studien zur genauen Analyse des Sachverhalts. Am Anfang eines technischen Produkts steht häufig eine Beobachtung (Beispiel: Ich beobachte, dass in zahlreichen Privatgärten Neophyten wachsen, deren Samen die heimische Fauna bedrohen[2] → Ich erstelle eine Beratungswebseite) oder – weit häufiger – ein Experiment, also eine Analyse (Können bei einer gemischten Farbe die einzelnen Farbanteile von einem Programm erkannt werden? → Ich programmiere eine Farbanalysesoftware). Das eigentliche Ziel Ihrer technischen Produktion ist jedoch eine Synthese, das Zusammenfügen Ihrer Erkenntnisse zu einem Produkt.
1.2 Von der Idee zur Fragestellung
Wie kommen Sie zu Ideen? Das ist die grosse Frage. Am besten beginnen Sie bei sich selbst: Was interessiert Sie besonders? Worüber möchten Sie mehr erfahren? Welche Fertigkeiten möchten Sie in die Tat umsetzen?
Verwenden Sie zur Ideensuche Kreativitätstechniken wie Brainstorming, Mindmapping, Clustering, Strukturbaum und Analogierad (vgl. Esselborn-Krumbiegel 2017, S. 37 f.[3]). Nützliche Hinweise bieten auch die Webseite maturaarbeit.net (Corthay et al.[4] 2018) und der Online-Leitfaden von Amnesty International, Greenpeace und Helvetas, der für Berufsfachschulen konzipiert wurde (2018).
Nehmen wir an, mithilfe der einen oder anderen Kreativitätstechnik sei bei Ihnen ein Thema in den Vordergrund gerückt, zum Beispiel das folgende: Auch in der Schweiz gab es früher verbotene Stadtteile, allerdings nicht wie die kaiserliche Residenzstadt in Peking, sondern riesige eingezäunte Industrieanlagen wie in Winterthur, Zürich, Baden und in vielen anderen Städten. Das Areal der Maschinenfabrik Sulzer AG Winterthur war abgeriegelt und nur für Angestellte zugänglich.
Daraus könnte zum Beispiel das Thema «Der Wandel von der umzäunten Industrieanlage zum trendigen Stadtquartier» gewählt werden, falls Sie diese Entwicklung interessiert. Dieses Thema ist aber sehr weitläufig, und deshalb muss es eingegrenzt werden.
Abbildung 1.1: Sulzer-Areal aus 100 Meter Höhe, 1934, Foto Walter Mittelholzer (1894–1937)
Alle betreuenden Lehrpersonen verlangen eine Eingrenzung des Themas. Von Ihnen wird das vielleicht eher als schmerzlicher Prozess erlebt. Die Notwendigkeit zur Konzentration auf eine eng begrenzte Fragestellung hat zum einen damit zu tun, dass Sie limitierte Ressourcen haben – zeitlich und finanziell.[5] Und zum andern möchte die Lehrperson Sie in eine echte Forschungssituation hineinführen. Denn wenn es Ihnen gelingt, auf eine spezifische Fragestellung zu fokussieren, dann ist die Chance gross, dass Sie erstens einen Prozess durchmachen, wie er sich in der «echten» Forschung ergibt, und dass Sie zweitens einen Mosaikstein zum Wissen und Verstehen innerhalb des gewählten Themas beitragen können.
Eine gute Zwischenstation bei der Themenfindung ist die Beantwortung von einigen «W-Fragen»: Was genau möchte ich machen? Wo möchte ich in die Tiefe gehen, wo möchte ich etwas ausloten? Warum tue ich es genau so und nicht anders? Je nach Forschungsgegenstand helfen weitere W-Fragen, das Thema einzugrenzen: Wann? (untersuchter historischer Zeitraum); Wie? (Methode, fachliches Verfahren) (vgl. ebenda[6], S. 63).
Die Fragen nach dem «Was?» und dem «Wann?» drängen im Beispiel «neues Stadtquartier» zur Entscheidung, ob der Niedergang der Maschinenindustrie oder die ersten Schritte zum Aufbau eines neuen Stadtteils im Zentrum stehen.
Mit der Antwort auf die Frage nach dem «Wo?» bestimmen Sie, ob zum Beispiel Sulzer in Winterthur, Escher-Wyss in Zürich oder Brown, Boveri & Cie. in Baden zum Gegenstand der Untersuchung gemacht werden soll. Wenn Ihr Wohnsitz in einer dieser Städte liegt oder in einer Stadt, die ähnliche Grossindustrieanlagen hatte, dann wird die Entscheidung leichter, denn je näher Sie sich an den Wissensquellen zu Ihrer Fragestellung befinden, desto einfacher kommen Sie an Informationen heran (Untersuchungsgegenstand, Archive, Personen und so weiter).
Das Thema in die Nähe rücken
Ihre Chancen, zu nützlichen Informationen zu kommen, sind grösser, wenn Sie lokale oder personelle Bezüge knüpfen können. Klären Sie ab, ob Ressourcen wie Archive, Laborräumlichkeiten oder Expertinnen und Experten zugänglich sind.
Im Bereich der Naturwissenschaften gibt es manchmal noch eine weitere Möglichkeit, ein komplexes Thema zu erarbeiten.
In vielen Entwicklungsländern wird den Menschen empfohlen, das mikrobakteriell verschmutzte Wasser, das ihnen häufig als einziges Trinkwasser zur Verfügung steht, in PET-Flaschen abzufüllen und diese Flaschen auf einem heissen Wellblechdach einige Stunden an die pralle Sonne zu legen (vgl. Wikipedia, Stichwort «SODIS»).[7] In diesem Zusammenhang könnte es für Sie vielleicht interessant sein, die antibakterielle Wirkung der UV-Bestrahlung auf einen bestimmten Krankheitserreger zu untersuchen.
Das Thema «Wasserreinigung durch UV-Bestrahlung» durchläuft anschliessend den gleichen Prozess der thematischen Fokussierung durch die «W-Fragen». Bei der Frage nach dem «Wie?» liegt es auf der Hand, dass Sie als Erstes mit Ihrer Biologielehrperson in Erfahrung bringen, ob ein derartiges Untersuchungsvorhaben mit den Mitteln, die Ihnen in der Schule zur Verfügung stehen, überhaupt durchführbar ist. Weiter gilt es abzuklären, ob Sie eine Chance haben, von einem speziellen Forschungsinstitut unterstützt zu werden, beispielsweise von der eawag aquatic research.[8]
Betreuende Lehrperson und Forschungsinstitute anfragen
Gemeinsam mit der betreuenden Lehrperson finden Sie die passende Kombination der anzuwendenden Verfahren, und vielleicht kann sie Ihnen − falls gewisse Untersuchungen nicht im Schullabor durchgeführt werden können − den Weg zu einem Forschungsinstitut ebnen.
Noch bevor Sie die genaue Fragestellung formulieren oder das Ziel festlegen, das Sie mit Ihrer technischen Produktion erreichen möchten, empfiehlt es sich, den Blick nochmals zu weiten. Das wird anhand des folgenden Beispiels erklärt.
Die Sängerin Joan Baez setzt sich in ihren Liedern und in ihren politischen Aktivitäten pointiert gegen die Rassendiskriminierung und für den Pazifismus ein (vgl. ihre Webseite: www.joanbaez.com und die Anleitung im Literaturverzeichnis unter Baez, Joan).
Falls Sie nun als Maturaarbeit einige ihrer Lieder auf pazifistische Aussagen hin analysieren wollen, dann müssten Sie sich die Frage stellen, ob Sie die Haltung von Joan Baez zuerst breit zu erfassen versuchen, damit Ihnen kein wichtiger Aspekt entgeht, oder ob Sie schon gezielt auf einige Songs eingehen wollen. Eine anfängliche Breite und eine Fokussierung erst im zweiten Schritt ist in den meisten Fällen vorzuziehen.
Abbildung 1.2: Joan Baez 2018
Sie gehen vom Kern Ihrer Idee aus und fragen sich, welche Bereiche Sie unbedingt einbeziehen müssen und welche Sie vorerst weglassen können. Dieses sorgfältige Abwägen des Untersuchungsbereichs bewahrt Sie einerseits davor, etwas zu vergessen, das unabdingbar zu Ihrer Idee gehört, und andererseits davor, sich in Nebenthemen zu verlieren.
Nach dieser Ausweitung und der anschliessenden Eingrenzung kommt nun eine zweite Fokussierung, in der Sie die Fragestellung formulieren. Die Fragestellung ist Ihr Kompass während der ganzen Arbeit. So wie Sie sich auf einer Trekkingtour nur mit Kompass oder GPS ausgerüstet in ein grosses Waldgebiet hineinwagen, brauchen Sie auch für Ihre Forschungsarbeit eine zentrale Fragestellung, damit Sie nie vom Weg abkommen und das Ziel sicher erreichen (vgl. Alagöz-Bakan, Knorr & Krüsemann 2015, S. 74).
Arbeiten des Typs «Untersuchung» haben immer eine Fragestellung. Bei Arbeiten des Typs «technische Produktion» übernimmt ein Anforderungskatalog diese Funktion.
Nun geht es darum, die Fragestellung in einer These oder Hypothese zu konkretisieren. In den Wissenschaften, in denen Erfahrungen der Menschen und ihre Werke im Zentrum stehen, beispielsweise in der Geschichts-, Literatur- und Kunstwissenschaft, spricht man von einer These im Sinn einer Ausgangsbehauptung, die im Verlauf der Forschungsarbeit untermauert wird. In den Sozialwissenschaften wie Psychologie, Soziologie und Pädagogik wird – je nach Ansatz – der Begriff «These» oder auch «Hypothese» verwendet, in den Naturwissenschaften spricht man durchwegs von einer Hypothese.
Nach dem Abschluss dieses Konkretisierungsschritts unterziehen Sie Ihr bisheriges Gerüst einer SMART-Analyse. Die Abkürzung umfasst die fünf folgenden Ansprüche (vgl. Umbach 2014, S. 8, und Wikipedia, Stichwort «SMART»).
Spezifisch
Sind Ihre Fragestellung und Ihre (Hypo-)These (Maturaarbeitstyp «Untersuchung») oder Ihr Ziel (Maturaarbeitstyp «Technische Produktion») präzise und eindeutig formuliert?
Messbar
Können Sie am Schluss eindeutig feststellen, ob Ihre Fragestellung beantwortet ist, ob Ihre (Hypo-)These zutrifft oder verworfen werden muss oder ob Sie mit Ihrem Produkt das Ziel erreicht haben?
Akzeptiert/Ansprechend
Wird Ihr Konzept von der betreuenden Lehrperson akzeptiert? Halten Sie das Thema für wissenschaftlich interessant, und liegt es Ihnen wirklich am Herzen? Erreichen Sie das Bestmögliche, indem Sie die Anforderungen der Schule, Ihr persönliches Interesse und Ihre Leistungsbereitschaft miteinander kombinieren?
Realistisch
Sind Sie realistisch, und haben Sie Ihre Zielsetzung Ihren Fähigkeiten, Ihrer Ausrüstung und Ihrem Zeitrahmen entsprechend gewählt?
Terminiert
Haben Sie den Erstellungsprozess der ganzen Arbeit vom Abgabetermin her rückwärts geplant und sich Meilensteine (Zwischenziele) gesetzt?
1.3 Die passende Methode finden
Sie haben sich Vorwissen zu Ihrem Thema verschafft, es eingegrenzt, eine Fragestellung entwickelt und sie in einer (Hypo-)These konkretisiert beziehungsweise einen Anforderungskatalog definiert. Mit der SMART-Analyse haben Sie überprüft, ob Sie die von der Schule geforderten Rahmenbedingungen einhalten und ob sie mit Ihren eigenen Zielen in Einklang zu bringen sind. Nun geht es darum, die notwendigen Vorbereitungen zu treffen und dann die geeignete Methode für Ihr Vorhaben zu finden.
1.3.1 Sich vorbereiten: recherchieren, bewerten und vernetzen
Durch Ihre Vorträge, Projekt- und Semesterarbeiten sind Sie im Recherchieren und im Umgang mit Quellen schon geübt. Kapitel 2 gibt Ihnen weitere Inputs. Es werden Fragen besprochen wie «Wo suchen?» (im Metabibliothekskatalog, in Datenbanken, in Zeitschriften); «Wie suchen?» (mit Platzhaltern, mit Operatoren); «Wie bewerten?» (Glaubwürdigkeit und Aktualität von Internetseiten); «Wie erstelle ich ein Rechercheprotokoll?» und «Soll ich ein Literaturverwaltungsprogramm einsetzen?».
Weiter sollten Sie sich vergewissern, ob Sie den Umgang mit Quellen korrekt und dem wissenschaftlichen Standard entsprechend handhaben: Sie betten Ihre Arbeit in den wissenschaftlichen Kontext ein und sorgen durch Quellenverweise für Nachvollziehbarkeit und Transparenz. Sie beachten den wissenschaftlichen Ehrenkodex, Sie kennen den Unterschied zwischen direktem und indirektem Zitieren, und Sie können ein Literaturverzeichnis erstellen.
Sorgen Sie durch das Durcharbeiten von Kapitel 2 dafür, dass Sie im Suchen von Informationen, in deren Bewertung und deren Integration in Ihren Text auf dem neuesten Stand sind und den Kopf frei haben für die Bearbeitung Ihres Themas. Durch die Vernetzung mit der Welt der Wissenschaften schaffen Sie die Voraussetzungen, damit Sie in Ihrem Projekt etwas Neues herausfinden und dadurch Ihre Fähigkeiten in Bezug auf wissenschaftliches Arbeiten unter Beweis stellen können.
1.3.2 Ortsgebundene Daten erheben – beobachten – experimentieren
Die drei Methoden «Datenerhebung im Gelände», «verhaltensbiologische Beobachtung» und «naturwissenschaftliche Experimente» lassen sich anhand des Beispiels der Rothirsche erklären. Alle drei Methoden legen eine statistische Auswertung nahe.
Das Rotwild verursacht durch den sogenannten Wildverbiss enorme Schäden im Wald. Bevorzugte Bäume werden durch die Rothirsche auf der Höhe ihres Geweihs fast komplett geschält (vgl. Amt für Landschaft und Natur 2017). Wenn Sie solche Schäden fotografieren wollen, dann sollten Sie auch die Koordinaten festhalten, denn jeder Schaden tritt an einem bestimmten Ort auf.
Abbildung 1.3: Schälschäden durch Rotwild im Białowieża-Nationalpark, Polen
Ortsgebundene Daten werden nicht nur in ihrer Anzahl oder in ihrem Ausmass festgehalten, sondern häufig auch auf einer Karte eingezeichnet. Diese Darstellung erlaubt es Ihnen, räumliche Muster zu erkennen. In einer Langzeitstudie mit den kartografisch festgehaltenen Schäden wäre es möglich, die Veränderung der Flora durch den Wildverbiss zu erforschen – wegen des ausgedehnten Zeitraums allerdings kein Maturaarbeitsthema. Mit der Methode der Datenerhebung im Gelände können Sie noch vielerlei andere Zusammenhänge kartografisch und – statistisch ausgewertet – in Diagrammen darstellen und so sichtbar machen.
Im Herbst ist das Röhren der Hirschstiere von Weitem zu hören, was es möglich macht, sich gute Beobachtungsposten für die Untersuchung des Brunftverhaltens der Rothirsche auszusuchen. Die einzelnen Elemente des Brunftverhaltens – das Schieben, Vorrücken, seitliche Abdrängen und so weiter – gehen allerdings manchmal so schnell, dass es ratsam ist, zuerst ein Beobachtungsprotokoll anhand eines Films über das Brunftverhalten zu erstellen und die brunftspezifischen Bewegungen mit Buchstaben zu codieren.[9]
Abbildung 1.4: Kämpfe der Hirschstiere in der Brunftzeit
Dann kann man vor Ort mit dem Feldstecher das Geschehen beobachten und die Codes mit Zeitangabe auf dem Beobachtungsprotokoll notieren. Es ist ratsam, nur so nahe heranzugehen, wie die Stiere die beobachtende Person weder riechen noch sehen können, denn sonst wird das Geschehen auf unvorhersehbare Weise beeinflusst, was bei einer Beobachtung nach Möglichkeit zu vermeiden ist.
In manchen Wäldern sind die Rothirsche so zahlreich, dass der Wildverbiss zu grossen Waldschäden führt. Die betroffenen Gemeinden müssen Strategien entwickeln, um ihren Jungwald zu schützen. Hirschsichere Zäune müssen allerdings zwei Meter hoch sein, und sie sind entsprechend teuer (vgl. Nemestothy 2016). In Zusammenarbeit mit dem Forstbetrieb einer betroffenen Gemeinde könnten Sie ein Experiment durchführen: Eines der Jungwaldgehege wird in den Winterwochen, in denen die Hirsche wegen einer dichten Schneedecke wenig Futter finden und die Einzäunung des Jungwalds zu wenig hoch aus der Schneedecke herausragt, mit geeigneten Massnahmen (Erhöhung der Zäune, Bewegungsmelder mit Pfeiftönen oder anderes) geschützt, das andere nicht. Durch diese Einflussnahme wird Ihre Beobachtung mittels Fotofallen zu einem Experiment, denn Sie greifen ins Geschehen ein und verändern eine Bedingung. Mit solchen Experimenten, bei denen jeweils nur ein einziger Faktor verändert wird, kann man Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge erforschen.
1.3.3 Erhobene Daten mittels Statistik auswerten
Bei den meisten Projekten, die einen Sachverhalt quantitativ untersuchen, werden die erhobenen Daten statistisch ausgewertet. Mit den Mitteln der beschreibenden Statistik verschaffen Sie sich Einsicht in die Struktur der Daten (Welche Werte kommen am häufigsten vor? Wie gross sind die Abweichungen vom Mittelwert? und so weiter) und stellen sie in Diagrammen zusammenfassend dar. Die schliessende Statistik verhilft Ihnen dazu, die Unsicherheit bei einem Schluss von einer kleinen Stichprobe auf eine grosse Menge von Merkmalsträgern mittels der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu beziffern, sodass Sie Ihre Hypothese mit einer berechenbaren Sicherheit verwerfen oder bestätigen können.
In den Kapiteln 4, 5 und 8, in denen Methoden zur Erhebung von statistisch auswertbaren Daten erklärt werden, verweisen wir auf die entsprechenden Abschnitte des Statistik-Kapitels 6. Die eigentliche Auswertung der Beispiele aus den genannten Kapiteln, meist in der Form von Hypothesentests, sind im Statistik-Kapitel unter «Fallbeispiele» angefügt. Und das Besondere ist, dass Sie die komplexen Berechnungen nicht selbst durchführen müssen, denn Sie lernen, mit einem Statistikprogramm umzugehen.
1.3.4 Unsere Mitmenschen beobachten und befragen
Das Verhalten und Erleben von Menschen zu erforschen, erfordert eigene Methoden und hat mit besonderer Umsicht zu geschehen. Kapitel 7 zeigt Ihnen drei mögliche methodische Zugänge auf: Sie können Menschen beobachten, Sie können sie befragen, oder Sie können sie – in eine Kontrollgruppe und eine Experimentalgruppe eingeteilt – dazu anregen, einen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang zu erforschen.
Sie spielen zum Beispiel in einer Volleyballmannschaft mit und interessieren sich dafür, wie die Mannschaft als Ganzes oder einzelne Teammitglieder Niederlagen verarbeiten. Mittels einer systematischen Beobachtung, am besten gleich nach dem verlorenen Spiel, erfassen Sie, welche Verarbeitungsmechanismen von der Mannschaft angewandt werden. Wenn Sie hingegen in Erfahrung bringen wollen, welche Verhaltensweisen die einzelnen Spielerinnen oder Spieler als förderlich respektive hinderlich für den weiteren Erfolg der Mannschaft einschätzen, dann führen Sie eine Befragung mit einem Fragebogen durch.
Eine dritte Möglichkeit ist ein sozialwissenschaftliches Experiment: Sie überzeugen eine Mannschaft davon, anerkannte sportpsychologische Elemente im Sinn eines Mentaltrainings anzuwenden, die helfen, eine Niederlage wegzustecken. Eine zweite Mannschaft, die sogenannte Kontrollgruppe, erhält diese Informationen nicht. Der Vergleich der beiden Mannschaften erlaubt gewisse Rückschlüsse auf die Wirksamkeit des angewandten Mentaltrainings.
Das Experimentieren mit Menschen ist an hohe ethische Standards geknüpft. Wenn Sie die einhalten, haben Sie die Voraussetzungen für ein interessantes und ethisch korrektes Experiment geschaffen. Allerdings haben die Versuchspersonen ein Anrecht darauf zu wissen, was Sie machen und warum Sie das machen. Manchmal können Sie es ihnen jedoch erst im Nachhinein sagen, um die Situation nicht zu verfälschen.
Bei einer Meinungsbefragung wird eine relativ kleine Stichprobe von Personen mittels Fragebogen zu verschiedenen Themen befragt – online oder in persönlichen Interviews. Anhand der ausgewerteten Resultate der Stichprobe kann auf die ganze Personengruppe geschlossen werden, dies aber nur unter bestimmten Bedingungen. Eine Befragung, zum Beispiel zum Thema «Wie müsste der Informatikunterricht an den Mittelschulen ausgebaut werden?», ergibt nur dann brauchbare Resultate, wenn die Stichprobe aus Personen mit den gleichen Merkmalen besteht, wie sie in der Gesamtgruppe vorkommen. Wenn Sie diese Gesetzmässigkeit beachten, können Sie von der Meinung von beispielsweise 60 befragten Mittelschülerinnen und -schülern auf die Meinung aller 800 Schülerinnen und Schüler Ihres Schulhauses schliessen, und dies mit einer erstaunlich tiefen Fehlerquote.
Sie fragen sich beispielsweise, welche Auswirkungen die Einführung von künstlicher Intelligenz auf Bankangestellte haben wird. Allerdings finden Sie dazu kaum Fachliteratur. Sie führen deshalb mit einer Person aus dem höheren Kader ein sogenanntes Experteninterview durch. Damit kommen Sie zu Hintergrundwissen und erhalten eine Einschätzung der derzeitigen Situation. Eine andere Zielsetzung verfolgen Sie, wenn Sie zu dieser Fragestellung Interviews mit den Betroffenen, den Bankangestellten, durchführen. Es geht dann vielleicht vor allem um deren Zukunftsängste. Entsprechend führen Sie die Interviews auf eine ganz andere Art durch.
1.3.5 Zeitzeuginnen und Zeitzeugen befragen
Eine andere Interviewtechnik wenden Sie an, wenn Sie Zeitzeuginnen und -zeugen befragen. Bei dieser Technik geht es − im Gegensatz zur herkömmlichen Interviewtechnik − nicht darum, die Zügel fest in der Hand zu halten, sondern vor allem darum, aufmerksam und einfühlsam zuzuhören. Sie probieren, Ihr Gegenüber in einen Erzählfluss zu bringen. Die Erlebnisse, für die Sie sich interessieren, liegen oft Jahrzehnte zurück. Durch geschickte Erzählanstösse versuchen Sie, einen Erinnerungsprozess in Gang zu bringen. Das kann durch Fotos geschehen oder indem Sie gemeinsam die Orte der Erinnerung besuchen.
1.3.6 Kulturelle Werke analysieren
Dokumentar- und Spielfilme können als Kunstwerke betrachtet und nach ästhetisch-formalen Gesichtspunkten analysiert werden. Sie können aber auch als zeitgeschichtliche Quellen interpretiert werden. Beispielsweise fällt bei einem Vergleich verschiedener Verfilmungen des «Heidi»-Romans von Johanna Spyri auf, dass jede Verfilmung den Zeitgeist ihres Entstehungsjahrs spiegelt. Dass Heidi im späteren Leben noch Schriftstellerin wird, wäre bei der ersten deutschsprachigen Verfilmung in den Fünfzigerjahren mit dem damaligen Frauenbild undenkbar gewesen.
Als «Text» wird heute in der Literaturwissenschaft sehr vieles bezeichnet, von der kurzen Werbebotschaft bis zum langen Roman. Entsprechend vielfältig sind auch die Fragestellungen und die Methoden, mit denen Texte untersucht werden können. Zum Beispiel erinnern Werbetexte manchmal an Texte der konkreten Poesie aus den Fünfzigerjahren des letzten Jahrhunderts. Untersuchen liesse sich, welche poetischen Verfahren übernommen, wie sie weiterentwickelt und welche Wirkungen damit erzielt werden. Denn Textanalyse ist offen für alle Aspekte des Mediums Text: von seiner Struktur bis zu seiner Funktion in verschiedenen kommunikativen Situationen.
Sie haben nun elf Methoden kennengelernt, die bei Maturaarbeiten üblicherweise vorkommen. Häufig verlangt ein bestimmter Untersuchungsgegenstand die Anwendung einer zweiten Methode oder die Abwandlung einer der genannten Methoden. Wenn Sie Ihren Bildungsweg an einer Hochschule fortsetzen, werden Sie die gleichen Forschungsmethoden wieder antreffen.
Die Zielsetzung einer wissenschaftlichen Tätigkeit in der Forschung ist das Gewinnen von neuen Erkenntnissen. Das streben Sie auch bei Ihrer Maturaarbeit an. Wahrscheinlich sind von den Erkenntnissen, die Sie mit Ihrer Maturaarbeit gewinnen, nur kleine Ausschnitte neu. Das Prinzip bleibt jedoch dasselbe: Sie arbeiten nach einer wissenschaftlichen Methode, Sie stellen eine Behauptung an den Anfang (These/Hypothese), Sie sammeln Argumente und untermauern sie mit Fakten, Sie dokumentieren in präziser Sprache und sind sich der erwarteten Qualitätsstandards immer bewusst, kurz: Sie arbeiten wissenschaftlich.
1.4 Wissenschaftliches Arbeiten
Am Anfang des wissenschaftlichen Denkens steht die Neugier: Man möchte wissen, was die Welt – so lässt es Goethe 1808 seinen Wissenschaftler Faust sagen – «[i]m Innersten zusammenhält» (Goethe 1986, Vers 383).
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler formulieren ganz konkrete Fragen oder einen Anforderungskatalog. Um Antworten und Ergebnisse zu finden, verwenden sie eine oder mehrere Vorgehensweisen, die unter dem Begriff «wissenschaftliche Methoden» zusammengefasst werden. Und wenn sie eine These respektive Hypothese begründen wollen, nutzen sie eine Struktur, die man am besten mit dem Begriff der Argumentation beschreiben kann.
1.4.1 Wissenschaftliches Argumentieren
Typische Begrifflichkeiten, die in den Wissenschaften verwendet werden, sind die Begriffe «Aussage», «Definition», «These», «Hypothese», «Argument» und «Schlussfolgerung».
Eine Aussage drückt einen Sachverhalt aus. Ein Aussagesatz kann – anders als ein Ausrufe- oder ein Fragesatz – wahr oder falsch sein. Aussagen über Sachverhalte unserer Erfahrungswelt (die uns umgebende Natur und Kultur) sollen immer auch zeitlich und örtlich definiert werden. Aussagen über Sachverhalte, die aufgrund von Beobachtungen, Experimenten und Befragungen gewonnen wurden, können verifiziert (für wahr erklärt) oder falsifiziert (für falsch erklärt) werden (vgl. Wörterbuch der Philosophie, Stichwort «Aussage», und Prechtl & Burkhard 1999, S. 53).[10]
Eine Definition ist der Form nach eine Aussage. Definitionen erklären einen Begriff (Ausdruck, Terminus) mit einer Kombination von bereits bekannten Begriffen (vgl. Sandberg 2017, S. 22). Definitionen sind beim wissenschaftlichen Arbeiten sehr wichtig, denn oft muss ein Terminus in einen Kontext gestellt werden, damit allen klar wird, was damit gemeint ist. Der Begriff «Freiheit» zum Beispiel kann – situiert in einer bestimmten geschichtlichen Situation – als «Unabhängigkeit von Zwang oder Bevormundung» definiert werden (Wahrig-Burfeind 2005, S. 498). Aber man kann unter Freiheit auch ein «Privileg» verstehen (ebd.), was dann einem deutlich anderen Verständnis entspräche. Es empfiehlt sich deshalb, Schlüsselbegriffe in einer wissenschaftlichen Arbeit zu definieren und diese Definitionen als solche kenntlich zu machen (vgl. Sandberg 2017, S. 23).
Eine These ist eine Behauptung, deren Wahrheitsgehalt es zu beweisen gilt. Der Form nach ist eine These eine Aussage, aber eine spezielle, denn sie bildet den Ausgangspunkt für eine strittige Argumentation (vgl. ebd.). Beispielsweise stellt Andreas Pfister in seiner Dissertation die These auf, dass der Roman «Das Parfum» von Patrick Süskind ein Künstlerroman sei (vgl. Pfister 2005). Pfister begründet diese These, indem er am Text zeigt, dass der Roman zentral zum Konzept des Künstlers als Genie Stellung bezieht (siehe Abschnitt 12.4.3).
Eine Hypothese (wörtlich «Unterstellung») ist der Funktion nach sehr ähnlich wie eine These. Hypothesen sind Annahmen über einen Sachverhalt, den sie zu klären versuchen. Sie beschreiben nicht nur einen Einzelfall, sondern sind generalisierbar. Da sich die meisten Hypothesen auf eine Vermutung über einen irgendwie gearteten Zusammenhang zwischen zwei Ereignissen oder Zuständen beziehen, werden sie in der Form eines Bedingungssatzes formuliert: «Wenn …, dann …» (vgl. Voss 2017, S. 36 f.).
Die meisten Forschungsvorhaben im Bereich der Naturwissenschaften, die sich den zu untersuchenden Phänomenen messend oder zählend annähern, also quantitativ arbeiten, sind sehr aufwendig. Um den Aufwand in Grenzen zu halten, untersucht man eine überschaubare Stichprobe. Beispielsweise stellen Sie folgende Hypothese zu einer Untersuchung über Schmetterlinge auf: «Wenn eine Wiese gemäss einer Definition aus der Literatur als Magerwiese gilt, dann halten sich in ihr deutlich mehr Schmetterlinge auf als in einer Fettwiese.» Nun wählen Sie zwei Stichproben aus, das heisst, je eine Fläche von 16 Quadratmetern Magerwiese respektive Fettwiese, die Sie markieren. Sie setzen sich auf eine Bockleiter ausserhalb des Quadrats und machen während einer definierten Beobachtungszeit in regelmässigen Zeitabständen Fotos. Die auf den Fotos ausgezählten Schmetterlinge bestätigen oder widerlegen Ihre Hypothese.
Auch in jenen Wissenschaften, die mehrheitlich nicht mit Zählen und Messen arbeiten, können Hypothesen gute Dienste leisten (vgl. Voss 2017, S. 37). So könnte beispielsweise die Hypothese: «Je weiter Grenouille, die Hauptfigur im Roman ‹Das Parfum› von Patrick Süskind, von der menschlichen Zivilisation entfernt ist, desto wohler fühlt er sich», mit zahlreichen Textstellen aus dem Roman belegt werden (siehe Abschnitt 12.4.1).
Thesen und Hypothesen müssen in einer wissenschaftlichen Arbeit aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet und breit diskutiert werden. Die meisten Forschenden setzen sich zum Ziel, die Gültigkeit ihrer Behauptungen, in welcher Form sie auch immer formuliert seien, unter Beweis zu stellen. Das heisst, sie versuchen in einem sehr eng begrenzten Bereich etwas herauszufinden, was wahr ist.
In der Disziplin der Wissenschafts- und Erkenntnistheorie wird seit Jahrhunderten diskutiert, ob die Wissenschaft überhaupt «die Wahrheit» finden kann (vgl. Voss 2017, S. 30). Spätestens seit den Ausführungen des Philosophen Karl Popper (1902–1994) hat sich in der Wissenschaftswelt die Vorstellung durchgesetzt, man könne nicht davon ausgehen, dass wissenschaftliche Theorien wahr seien, das heisst, dass sie die Welt so beschreiben würden, wie sie wirklich sei.
Im Bestreben, einen Prüfstein für die Unterscheidung zwischen wissenschaftlichen und nicht wissenschaftlichen Theorien zu finden, stellte Karl Popper die Forderung auf, eine Theorie sei nur dann wissenschaftlich, wenn sie Voraussagen mache, die empirisch überprüft werden könnten. Wenn ein Fall auftrete, welcher der Theorie widerspreche, dann verliere die Theorie ihre Gültigkeit. Eine solche Widerlegung einer Theorie durch ein Gegenbeispiel nennt man «Falsifikation» (vgl. Prechtl & Burkard 1999, S. 175). Die Falsifizierbarkeit ist laut Popper das wesentliche Kriterium dafür, ob eine Theorie wissenschaftlich ist. Oder in seinen eigenen Worten: «Ein empirisch-wissenschaftliches System muss an der Erfahrung scheitern können» (Popper 2005, S. 17). Dieses Scheiternkönnen ist überhaupt nicht negativ zu verstehen, denn das Scheitern ermöglicht gerade das, was in der Wissenschaft so eminent wichtig ist: den Fortschritt.
Eine Theorie ist also dann wissenschaftlich, wenn folgende Frage beantwortet werden kann: Was muss eintreten, damit die Theorie verworfen wird? Diese Frage kann beispielsweise eine astrologische Theorie nicht beantworten.
Die beiden folgenden Beispiele berichten von zwei Theorien, die zum Zeitpunkt ihrer Ausformulierung zwar nicht überprüft werden konnten, bei denen aber angegeben werden konnte, unter welchen Umständen sie scheitern würden.
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts formulierte Galileo Galilei (1564–1642) mit seinen Fallgesetzen eine neue Theorie der Schwerkraft. Sie ersetzte die bis dahin gültige Theorie von Aristoteles (viertes Jahrhundert vor Christus), dass schwere Objekte schneller zu Boden fallen als leichte. Gemäss Galileis neuer Theorie würden im luftleeren Raum alle Objekte den Boden gleich schnell erreichen. Da zur Zeit von Galilei noch keine luftleeren Glasröhren herstellbar waren, konnte er dieses Experiment zwar nicht durchführen, er hatte damit aber eine Möglichkeit der Falsifikation angegeben. Das Experiment konnte erst nach seinem Tod durchgeführt und die Theorie damit verifiziert werden (vgl. Stillwaggon 2015, S. 347 f.).
Albert Einstein beschrieb in seiner Allgemeinen Relativitätstheorie, die er im November 1915 veröffentlichte, dass das Gravitationsfeld der Sonne das Licht von weit entfernten Sternen ablenkt. Dieses abgelenkte Licht konnte allerdings nicht beobachtet werden, weil es vom Sonnenlicht «überstrahlt» wird. Einstein hatte aber so eine Möglichkeit angegeben, seine Theorie zu falsifizieren. Die Theorie kam im Jahr 1919 auf den Prüfstand, als eine totale Sonnenfinsternis die Beobachtung ermöglichte: Licht wird tatsächlich von der Sonne abgelenkt, und zwar genau in dem Ausmass, wie es Einstein berechnet hatte (vgl. ebd., S. 340 f.).
Die Theorien von Galilei und Einstein waren beide auf ihre Gültigkeit überprüfbar und entsprachen somit der Forderung Poppers nach der Falsifikationsmöglichkeit.
Auch eine Maturaarbeit kann einen Mosaikstein zum wissenschaftlichen Fortschritt beitragen, besonders dann, wenn die Fragestellung sehr eng gefasst ist. Mit welcher Methode auch immer Sie arbeiten und ob Sie Ihrer Untersuchung mit einer These oder einer Hypothese die Richtung vorgeben, das zentrale Moment des wissenschaftlichen Arbeitens ist das Argument.
Ein Argument ist eine Aussage, die eine Behauptung (These oder Hypothese) begründet oder widerlegt. Ein Argument besteht aus einer oder mehreren Prämissen (Voraussetzungen, Annahmen) und aus einer Schlussfolgerung (Konklusion) (vgl. Prechtl & Burkard 1999, S. 92). Wenn die Prämissen wahr sind und ein gültiges Schlussverfahren verwendet wird, dann ist auch die Konklusion wahr. Eine Verknüpfung von mehreren Argumenten nennt man eine Argumentation (vgl. ebd., S. 43).
Wie gut es Ihnen gelingt, die Leserinnen und Leser von einem Argument zum nächsten zu führen und so eine Argumentationskette aufzubauen, hängt nicht nur von der Hieb- und Stichfestigkeit Ihrer Aussagen ab, sondern auch von ihrer formalen Verknüpfung.
1.4.2 Wissenschaftliches Schreiben
Betrachten Sie das Niederschreiben der Forschungsresultate als Prozess und räumen Sie ihm entsprechend Zeit ein. Das fortwährende Niederschreiben der gewonnenen Erkenntnisse bewirkt, dass Sie Ihre Gedanken präzise erfassen, prüfen und miteinander in Beziehung bringen. Erst zu Papier gebrachte Gedanken können überblickt, neu geordnet und mit Brücken von einem Gedanken zum anderen versehen werden (vgl. Kruse 2015, S. 59).
Die Maturaarbeiten richten sich nicht an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einer universitären Disziplin, sondern der Adressat ist ein Publikum mit guter Allgemeinbildung. Beim Schreiben dürfen Sie den Stand des Allgemeinwissens voraussetzen, den Ihre Klassenkameradinnen und -kameraden im Lauf der Schulzeit erlangt haben. Fachbegriffe und Konzepte, die über dieses Wissen hinausgehen, sollten erklärt werden.
Das Überarbeiten der Texte ist ein zentrales Merkmal des wissenschaftlichen Schreibens. Falls Sie – wie empfohlen – Ihre Gedanken fortwährend festhalten, ergibt sich das mehrmalige Überarbeiten von selbst, denn Sie wissen ja im Lauf Ihres Forschungsprozesses immer mehr und immer Genaueres (vgl. ebd., S. 60). Zusätzlich sollten Sie Ihre Textteile während des Entstehungsprozesses von anderen Personen (Mitschülerinnen, Betreuern) gegenlesen lassen. Nutzen Sie die Feedbacks dazu, den Text klarer, verständlicher und übersichtlicher zu machen.
In wissenschaftlichen Publikationen liest man anstatt «ich, mein, mir» folgende oder ähnliche Wendungen: «Die Analyse ergibt»; «Das Ergebnis unterstreicht»; «Man kann vermuten»; «Es lässt sich zeigen» und Passivkonstruktionen wie «Es wurde weiter oben dargelegt» (vgl. ebd., S. 143). Damit stellen die Schreibenden die Sache ins Zentrum und nicht sich selbst. Sie vermeiden es, ins Persönliche abzugleiten. Entscheidend ist aber nicht, ob Sie in Ihrem Text das Pronomen «Ich» verwenden, sondern wie Sie es verwenden. Sie dürfen die Leserin oder den Leser im eigenen Namen auf etwas hinweisen wie «Im nächsten Kapitel werde ich auf diese Ergebnisse eingehen» oder eine methodische Anmerkung machen wie «Daher wählte ich dieses Vorgehen». Es darf im Text aber nie um Ihre persönlichen Erfahrungen und Gefühle gehen, beispielsweise «Nach langem Kopfzerbrechen und einigen Gesprächen mit meiner Betreuerin fühlte ich mich mit dieser Methode am wohlsten».
Wenn Sie wissenschaftlich schreiben, nehmen Sie auch Bezug auf andere Texte. Sie bemühen sich, die gewählte Quelle möglichst genau zu verstehen, Sie geben deren Aussage korrekt wieder, und Sie legen ihre Bedeutung für die eigene Arbeit dar. Wie Sie Fachliteratur und andere Quellen ausweisen und korrekt in Ihren Text einbauen, erfahren Sie in Abschnitt 2.3.
1.4.3 Wissenschaftliche Standards erfüllen
Nun haben Sie gelernt, was wissenschaftliches Argumentieren heisst, Sie haben die Grundzüge von Forschung als Wahrheitssuche und Falsifizierbarkeit als Abgrenzungskriterium für wissenschaftliche Theorien kennengelernt, und Sie haben Tipps erhalten, wie Sie Ihre Gedanken in einer angemessenen Sprache ausdrücken.
Eines bleibt noch zu klären: An der Kick-off-Veranstaltung für Maturaarbeiten wurde höchstwahrscheinlich erwähnt, dass Sie eine eng gefasste Fragestellung einreichen sollen, denn je stärker Sie Ihre Untersuchung fokussieren, desto eher sei es möglich, nach wissenschaftlichen Prinzipien vorzugehen und dabei etwas Neues herauszufinden oder etwas Ungewöhnliches zu konstruieren.
Die Maturaarbeit ist eine Übung auf ansprechendem Niveau, die auf das wissenschaftliche Arbeiten vorbereitet. Es ist dabei erwünscht, dass Sie sich innerhalb der Leitlinien der Wissenschaftlichkeit bewegen. Die folgenden Ausführungen zeigen, dass dies durchaus machbar ist.
Objektivität: Die forschende Person nimmt eine kritische, analysierende Position zum Forschungsgegenstand ein. Sie macht durch sprachliche Mittel klar, welches ihre eigenen Forschungsresultate sind, welche Aussagen sie von anderen Forschenden referiert und welche Schlüsse sie daraus zieht. Subjektive und persönliche Urteile sollen klar als solche erkennbar sein (vgl. Voss 2017, S. 33). Übertragen auf meine Maturaarbeit: Ich stehe meinem Untersuchungsgegenstand kritisch gegenüber (SMART-Analyse, hier), mache, wenn ich fremde Gedanken übernehme, konsequent einen Quellenverweis und trenne klar zwischen den erarbeiteten Fakten und meiner Meinung.
Intersubjektivität: Forschungsresultate sind für die anderen Forschenden erfassbar, sie sind wiederholbar, und die Schlussfolgerungen, die aus dem Sachverhalt abgeleitet werden, sind nachvollziehbar (vgl. Sandberg 2017, S. 15). Die von mir erhobenen Daten, Berechnungen, Argumentationsketten oder technischen Konstruktionen sind für die Leserinnen und Leser verständlich. Ich führe ein Arbeitsjournal und gegebenenfalls ein Versuchs- oder Beobachtungsprotokoll und dokumentiere alle Vorfälle sorgfältig, auch die Misserfolge.
Methodisch begründetes Vorgehen: Die Methode, mit der die Erkenntnisse gewonnen wurden, ist detailliert beschrieben. Es soll klar werden, warum die Methode gewählt und wie sie angewendet wurde (vgl. Kruse 2010, S. 58). Ich erläutere die von mir angewendeten Methoden detailliert und begründe, warum ich welches Verfahren gewählt habe.
Systematik: Jede Wissenschaftsdisziplin hat ihre eigene Systematik. Die eigene Forschung muss an die Wissenssystematik des Fachs angebunden und im Kontext des vorhandenen Wissens dargestellt und eingeordnet werden (vgl. ebd.). Nach einer ausgedehnten Literaturrecherche lese ich mich ins Thema ein. Die Fachwörter, die ich bei der Lektüre antreffe, verwende ich auch in meiner Arbeit, allerdings nicht, ohne sie zu erklären und gegebenenfalls zu definieren.
Die Forderung nach einer klaren Grundhaltung, welche die Forschenden einnehmen sollten, fasste der amerikanische Soziologe Robert K. Merton in einem Fünf-Punkte-Kriterienkatalog für Wissenschaftsethik zusammen. Diese Forderungen seien an den Schluss des Kapitels gestellt – im Wissen, dass sie im heutigen Forschungsbetrieb häufig nicht eingehalten werden.
Merton stellte in den Dreissigerjahren mit einiger Beunruhigung fest, dass viele deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bereit waren, sich in den Dienst des nationalsozialistischen Regimes zu stellen. Deshalb entwickelte er grundlegende Normen wissenschaftlicher Forschung, die – nach ihren Anfangsbuchstaben benannt – als CUDOS-Kriterien berühmt wurden und die Diskussion in der Wissenschaftsethik bis heute prägen (vgl. Sandberg 2017, S. 16).
Communitarism (hier etwa mit Gemeinschaftssinn zu übersetzen): Alle wissenschaftlichen Erkenntnisse gehören allen. Sie sollen mit der Gemeinschaft der Forschenden und der Öffentlichkeit geteilt werden.
Universalism (Universalität): Forschungsergebnisse müssen unabhängig von der Person, ihrem Geschlecht, ihrer Volkszugehörigkeit, ihrer Nationalität oder ihrer Religion geprüft und bewertet werden.
Desinterestedness (Uneigennützigkeit): Antriebsfeder für das Forschen soll nicht eigennütziges Interesse sein, sondern die Leidenschaft für die Wahrheitssuche.
Originality (Originalität): Wissenschaft soll einen Erkenntnisgewinn bringen, indem etwa ein neuer methodischer Zugang erarbeitet oder eine neue Theorie entwickelt wird.
Scepticism (Skeptizismus): Alle Erkenntnisse und ihre dazugehörigen Beweise sind einer kritischen Prüfung zu unterziehen, bevor sie anerkannt werden.
Eine weitere unabdingbare Vorbereitung auf Ihre erste wissenschaftliche Arbeit ist die Informationsrecherche. Wir empfehlen Ihnen dringend, Kapitel 2 zu lesen, bevor Sie sich in die Arbeit stürzen.
1.5 Literatur
Alagöz-Bakan, Özlem; Knorr, Dagmar; Krüsemann, Kerstin (Hrsg.): Akademisches Schreiben, Sprache zum Schreiben – zum Denken – zum Beraten. Universitätskolleg-Schriften, Bd. 14. Hamburg: Universität Hamburg 2015.
Amnesty International, Greenpeace, Helvetas (Hrsg.): Learning for the Planet. Online: http://learning-for-the-planet.org/ [Abrufdatum: 14.08.2018].
Amt für Landschaft und Natur: Rotwildkonzept Kanton Zürich (2017). Online: https://aln.zh.ch/internet/baudirektion/aln/de/aktuell/mitteilungen/2017/rotwildkonzept-kanton-zuerich/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/746_1513760484284.spooler.download.1513752504493.pdf/ALN_Fischerei%26Jagd_Rotwildkonzept_def.pdf [Abrufdatum: 14.08.2018].
Baez, Joan: Ihre persönliche Webseite: www.joan.baez.com. Dort weiter zu «Discography», dann «Joan Baez Lyrics», oder direkt: www.joanbaez.com/discography/ [Abrufdatum: 14.08.2018]. Bemerkung: Der Link reagiert sehr langsam, und der ganze Text der Songs wird erst durch das Hinunterschieben eines gelben Scrollbalkens sichtbar, der erscheint, wenn der Text angeklickt wird.
Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft; Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft; Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft; Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (Hrsg.): waldwissen.net. Information für die Forstpraxis. Online: www.waldwissen.net [Abrufdatum: 22.08.2018].
Bonati, Peter; Hadorn, Rudolf: Matura- und andere selbständige Arbeiten betreuen. Bern: hep 2009.
Corthay, Thérèse; Felchlin, Irene; Glötzner, Fabian; Wechsler, Josua: maturaarbeit. Online: www.maturaarbeit.net/0-home/home_d.htm [Abrufdatum: 14.08.2018].
Esselborn-Krumbiegel, Helga: Von der Idee zum Text. Eine Anleitung zum wissenschaftlichen Schreiben. Paderborn: Schöningh, 5., aktualisierte Auflage 2017.
Goethe, Johann Wolfgang: Faust. Der Tragödie Erster Teil. Stuttgart: Reclam 1986.
Kruse, Otto: Lesen und Schreiben. Der richtige Umgang mit Texten im Studium. Konstanz: UVK, 2., überarbeitete Auflage 2015.
Nemestothy, Nikolaus: Der Bau von Wildzäunen muss gelernt sein (2016). Online: www.waldwissen.net/wald/wild/management/bfw_wildzaeune_bau/index_DE und ebenda, www.waldwissen.net/waldwirtschaft/fuehrung/rechnung/fva_hb6_kostenrechnung/index_DE [Abrufdatum: 14.08.2018].
Pfister, Andreas: Der Autor in der Postmoderne. Mit einer Fallstudie zu Patrick Süskind. rérodoc. Digitale Bibliothek (2005). Online: https://doc.rero.ch/record/5329/files/1_PfisterA.pdf [Abrufdatum: 10.03.2018).
Popper, Karl R.: Logik der Forschung. Serie: Gesammelte Werke in deutscher Sprache / Karl Popper, Bd. 3, hrsg. von Herbert Keuth. Tübingen: Mohr Siebeck, 11. Auflage 2005.
Prechtl, Peter; Burkard, Franz-Peter (Hrsg.): Metzler-Philosophie-Lexikon. Begriffe und Definitionen. Stuttgart/Weimar: J. B. Metzler 1999.
Sandberg, Berit: Wissenschaftliches Arbeiten von Abbildung bis Zitat. Berlin/Boston: de Gruyter, 3., durchgesehene und erweiterte Auflage 2017.
Stillwaggon Swan, Liz: Galileo Galileis Argument der fallenden Körper. Und Stillwaggon Swan, Liz: Karl Poppers Abgrenzungsproblem. Beide in: Bruce, Michael; Barbone, Steven: Die 100 wichtigsten philosophischen Argumente. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2015.
Umbach, Günter: Erfolgreich als Medical Advisor und Medical Science Liaison Manager. Wie Sie effektiv wissenschaftliche Daten kommunizieren und mit Experten kooperieren. Wiesbaden: Springer Gabler 2014.
Voss, Rödiger: Wissenschaftliches Arbeiten … leicht verständlich. Konstanz: UVK, 5. Auflage 2017.
Wahrig-Burfeind, Renate (Hrsg.): Deutsches Wörterbuch. Gütersloh: Bertelsmann Lexikon Verlag, 7., neu bearbeitete Auflage 2005.
Wörterbuch der Philosophie. Online-Version des Handwörterbuchs Philosophie. Ein Kooperationsprojekt des Verlags Vandenhoeck & Ruprecht und der utb GmbH. Online: www.philosophie-woerterbuch.de/ [Abrufdatum: 01.03.2018]. Information: Am 09.04.2018 wurde diese Online-Version vom Netz genommen, die Printversion ist ebenfalls vergriffen.
Fachliteratur und andere Quellen
2
Edith Matt, Susanne Portmann, Annemarie Stoffel
Worum geht es?
Am Anfang jeder grösseren Arbeit verschaffen Sie sich eine Übersicht: Wie ist der aktuelle Wissens- und Forschungsstand zu Ihrem Thema, welchen Platz hat Ihre Fragestellung darin, und bei welchem Unterthema setzt sie an?
Um diese Fragen zu beantworten, suchen Sie geeignete Quellen. Darunter versteht man Texte, Filme, allgemein Dokumente, aus denen Sie Informationen für Ihre Arbeit entnehmen können. Sie bearbeiten diese Quellen und fassen mit dem Blick auf Ihre Fragestellung die wichtigsten Fakten zusammen. Damit schaffen Sie die Grundlage für Ihre eigenen Untersuchungen.
In diesem Kapitel erfahren Sie:
• wo und wie Sie die Informationen finden, die Sie zur Bearbeitung Ihrer Fragestellung benötigen,
• wie Sie Ihre Suche effizient gestalten,
• wie Sie am besten mit komplexen Sachtexten umgehen,
• wie Sie Zitate in Ihren eigenen Text einbauen können,
• wie Sie korrekt auf Ihre Quellen hinweisen,
• wie Sie ein Quellen- oder Literaturverzeichnis erstellen.
Inhalt
2.1 Literatur und andere Quellen finden
2.2 Die ausgewählten Materialien verarbeiten
2.3 Mit Quellentexten korrekt umgehen
2.4 Literatur
Lösungen
2.1 Literatur und andere Quellen finden
Beim Erstellen einer Literatur- oder Quellenübersicht stellen sich Ihnen die folgenden Fragen:
• Wie verschaffe ich mir einen Überblick?
• Wo suche ich nach den gewünschten Quellen?
• Wie gehe ich bei der Suche vor?
• Wie bewerte ich die gefundenen Quellen?
• Wie verwalte ich die gefundenen Informationen?
2.1.1 Wie verschaffe ich mir einen Überblick?
Bevor Sie mit der eigentlichen Quellen- und Literatursuche beginnen, ist es wichtig, dass Sie sich mit den verschiedenen Aspekten des von Ihnen gewählten Themas auseinandersetzen. Als Einstieg für eine genauere Beschäftigung mit dem Thema eignen sich das Internet sowie Sachbücher, Fachwörterbücher oder Lehrmittel, die in Bibliotheken konsultiert werden können. Ergänzende Informationen finden Sie im Internet über Online-Lexika wie beispielsweise «Spektrum der Wissenschaft», «Wissen digital» oder «Wikipedia». Studieren Sie in Büchern immer zuerst das Inhaltsverzeichnis, klären Sie Fachbegriffe, die Sie nicht verstehen, und prüfen Sie das Schlagwortverzeichnis, die Fussnoten und das Literaturverzeichnis sowie weiterführende Links. Überlegen Sie sich, welche Aspekte zum Gegenstand Ihrer Recherche gehören.
2.1.2 Wo suche ich nach den gewünschten Quellen?
Je nachdem, welche Art von Quellen (Texte, Bilder, Filme) Sie benötigen, stehen Ihnen für Ihre Suche verschiedene Orte zur Verfügung:
• In Bibliothekskatalogen und Metabibliothekskatalogen[1] wie «Swissbib» oder «Karlsruher Virtueller Katalog» suchen Sie hauptsächlich nach Fachbüchern[2]. Beachten Sie dabei, dass die einzelnen Artikel der Fachzeitschriften in der Regel nicht im Online-Katalog aufgeführt sind.
• In Ihrer Schulbibliothek und in öffentlichen Bibliotheken erhalten Sie professionelle Unterstützung bei der Recherche.
• Bei kommerziellen Medienanbietern (zum Beispiel Buchhandelskataloge wie «buch.ch») können Sie Bücher kaufen, die Sie während der ganzen Arbeit brauchen und bearbeiten wollen.
• Die Suchmaschinen im Internet geben Ihnen einen ersten Überblick.
• Von den gängigen Datenbanken und Fachportalen stehen Ihnen für detaillierte Recherchen einige über «www.digithek.ch» zur Verfügung, andere konsultieren Sie in den öffentlichen Bibliotheken.
• In Zeitungs- und Zeitschriftenarchiven suchen Sie nach Artikeln zum Thema.
• Verlassen Sie sich bei der Suche nach Filmmaterial nicht nur auf YouTube, sondern suchen Sie auch in Online-Lexika und in Filmarchiven.
• Für spezielle Informationen können Sie sich auch an Stadtarchive, amtliche Stellen, Museen, Vereine, Berufsvereinigungen, Fachorganisationen oder Fachpersonen wenden.
2.1.3 Wie gehe ich bei der Suche vor?
Suchbegriffe sammeln: Gewisse Stichwörter zum Thema eignen sich als Suchbegriffe, andere müssen einer gezielten Suche angepasst werden. Formulieren Sie, ausgehend von Stichwörtern, die Sie zu Ihrem Thema zusammengestellt haben, eine Liste von Suchbegriffen. Verwenden Sie die Wörter im Singular und kombinieren Sie geeignete Begriffe. Denken Sie daran, dass lediglich orthografisch ähnliche Begriffe, nicht aber sinnverwandte Bezeichnungen beim Suchlauf berücksichtigt werden. Oft lässt sich die Suche durch Synonyme und Unterbegriffe präzisieren (zum Beispiel Völkermord – Genozid).
Stichwort
Suchbegriffe
Territorial
Territorialkonflikt, Bosnien, Grenze
Religiöse Wurzeln
Religion, muslimisch, katholisch, orthodox
Staatsform
Vielvölkerstaat, Kommunismus, Demokratie
Innerstaatlich
Ethnie
Rassismus
Rassismus, Diskriminierung
Falls Sie das Gewünschte nicht finden, modulieren Sie die verwendeten Stichwörter. Hier ein Beispiel zum Vorgehen für den ursprünglichen Suchbegriff muslimisch:
Synonyme: mohammedanisch
Oberbegriff: Islam
Unterbegriff: schiitisch, sunnitisch
Tipps zur Verwendung von Suchbegriffen
• Listen Sie nur aussagekräftige Begriffe auf.
• Listen Sie nicht alle denkbaren Synonyme auf, das könnte Ihre Recherche aufblähen.
• Lösen Sie Abkürzungen auf.
• Bedenken Sie alternative Schreibweisen, vermeiden Sie Suchbegriffe mit mehrdeutiger Orthografie (Umlaute, Eszett) oder verwenden Sie Platzhalter (* oder % oder ?).
• Suchen Sie standardmässig im Singular. Pluralformen können Sie durch Platzhalter (* oder % oder ?) am Wortende einbeziehen.
Tipps zur Suche mit Suchmaschinen
Suchbegriffe können miteinander kombiniert werden. Dazu setzen Sie einen der Operatoren UND, ODER, NICHT (AND, OR, NOT) zwischen die gewählten Suchbegriffe.
•UND zeigt Treffer an, die beide Begriffe enthalten.
•ODER zeigt Treffer an mit einem oder beiden Suchbegriffen.
•NICHT verhindert die Anzeige von Seiten mit dem betreffenden Begriff.
•Anführungszeichen am Anfang und Ende einer Wortfolge zeigen Treffer mit genau dieser Wortfolge an.
Ohne weitere Angaben wird in den meisten Suchmaschinen zwischen mehreren Suchbegriffen eine UND-Verknüpfung hergestellt.
In der Regel erhalten Sie nicht zu wenige, sondern zu viele Treffer, die Sie nach weiteren Kriterien (Zeitraum, Land, Sprache, Quelle) filtern können.
Aufgabe 1 Einsatz von Operatoren
Sie möchten möglichst viele Treffer zu den Suchbegriffen Bienensterben, Krankheitserreger, Pflege, Medikamente, Zucht.
• Formulieren Sie die Suchanfrage mithilfe der Operatoren.
• In einem nächsten Schritt möchten Sie, dass alle Treffer zu diesen Suchbegriffen auch wirklich mit Bienen zu tun haben. Wie formulieren Sie die Suchanfrage nun?
• Zuletzt möchten Sie, dass die Informationen die Schweiz betreffen und nicht älter als sechs Monate sind. Wie gehen Sie vor?
2.1.4 Wie bewerte ich die gefundenen Quellen?
Die folgenden drei Kriterien müssen die gefundenen Materialien auf jeden Fall erfüllen:
•Glaubwürdigkeit und Gültigkeit: Die Suchresultate sind aktuell und glaubwürdig.
•Relevanz: Die gefundenen Informationen sind von Interesse und praktischem Nutzen für die Arbeit.
•Verständlichkeit: Die Informationen sind für Sie verständlich und nachvollziehbar.
Kürzlich erschienene wissenschaftliche Publikationen erfüllen das Kriterium der Glaubwürdigkeit am besten. Am schwierigsten sind Quellen im Internet einzuschätzen.
Glaubwürdigkeit und Aktualität von Internetquellen prüfen
Bei der Suche im Web genügen wenige Klicks, um eine Riesenauswahl an Treffern zu erhalten. Allerdings ist es aufwendig zu prüfen, ob die gefundenen Quellen vertrauenswürdig sind. Folgende Kriterien können hierzu erste Anhaltspunkte bieten (vgl. Sandberg 2017, S. 73−79):
Ist der Autor oder die Autorin der Quelle bekannt?
Finden sich zum Beispiel im Impressum oder in der Rubrik «Über uns» Kontaktangaben (Adresse, Telefon, E-Mail)? Funktionieren entsprechende Links?
Handelt es sich um Expertinnen und/oder Experten aus dem akademischen Umfeld oder um Laienbeiträge? Sind andere Werke dieser Autorinnen und Autoren zum gleichen Thema veröffentlicht worden?
Wer betreibt die Webseite?
Die URL kann verraten, wer eine Webseite verantwortet. Handelt es sich um eine Universität (zum Beispiel «unibe.ch»), um ein öffentliches Amt, um eine Regierungsseite (zum Beispiel «admin.ch», «gouv.fr») oder um eine private Seite?
Welches sind die Absichten der Autorin oder des Autors?
Will sie oder er informieren, unterhalten, die persönliche Meinung kundtun, Werbung machen, politisch beeinflussen oder helfen ohne kommerzielles Interesse dahinter? Äussert sie oder er sich nicht explizit dazu, hilft die Art der Webseite weiter: Ist es zum Beispiel eine Firma, die etwas verkaufen will, oder ein Politiker, dessen Angaben in den Kontext seiner politischen Ansichten gestellt werden müssen? Oder handelt es sich um eine Umweltschutzorganisation?
Beispiele zum Begriff «Wolf»: Stammen die Auskünfte über dieses Tier von einem bekannten Naturforscher, von einer Zoodirektorin, von einem Umweltaktivisten, von einer Wirtschaftspolitikerin, von einem Schafzüchter oder aus esoterischen Kreisen?
Gibt die Autorin oder der Autor Quellen an?
Legt die Seite ihre Informationsquellen über weiterführende Links offen, oder sind die Angaben anderweitig überprüfbar (zum Beispiel über Bücher)? Handelt es sich um glaubhafte Quellen? Wird umgekehrt auch von anderen Webseiten auf diejenige der Autorin oder des Autors verlinkt? Wie ist die Qualität dieser Seiten? Gibt es ernst zu nehmende Kommentare oder Bewertungen von Benutzenden?
Wie aktuell ist die Seite?
Sind Erstellungs- und/oder Aktualisierungsdatum ersichtlich? Funktionieren die aufgeführten Links?
Ohne Abgleich mit anderen Quellen ist «Wikipedia» nicht in jedem Fall zuverlässig (vgl. Landeszentrale für Medien und Kommunikation [LMK] Rheinland-Pfalz 2016). Da jede und jeder dort Beiträge verfassen kann, wissen wir nicht, wer einen Artikel verfasst hat. Auch können Artikel aus politischen oder persönlichen Gründen geändert oder «geschönt» sein. Es empfiehlt sich, eine zweite Quelle beizuziehen, zum Beispiel die «Encyclopedia Britannica».
Weitere Hinweise zu Internetrecherche und Beurteilung von Internetseiten finden Sie in den Broschüren und Netzbeiträgen der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (vgl. Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen 2016), insbesondere in den Broschüren «Suchen, finden, weitergeben» (vgl. Machill et al. 2014) oder «Der Info-Kompass: Orientierung für den kompetenten Umgang mit Informationen» (vgl. Machill et al. 2012).
Relevanz prüfen
Um herauszufinden, ob die gefundenen Materialien fürs Beantworten Ihrer Fragestellung interessant und nützlich sind, suchen Sie die Inhalts- und Stichwortverzeichnisse ab. Auch in Dokumenten, die eine andere Fragestellung verfolgen, können Sie wichtige Informationen finden.
Aufgabe 2 Auswählen von Dokumenten
Sie verfolgen in einem Unterkapitel Ihrer Arbeit folgende Fragestellung: Sieht das Pariser Übereinkommen von 2015 in Sachen Reduktion des Treibhausgasausstosses für Schwellen- und Entwicklungsländer das Gleiche vor wie für die Industriestaaten? Sie haben in einem Zeitungsarchiv und mit Google bereits einige Dokumente gefunden, die zu dieser Fragestellung Abschnitte und Kapitel enthalten könnten. Lesen Sie die folgende Titelliste. Entscheiden Sie, welche der Dokumente Sie genauer anschauen wollen.
a) Nur noch kurz die Welt retten. Beim Klimagipfel in Paris steht viel auf dem Spiel. Wie gross ist die Bereitschaft für Kompromisse? Online: http://news.rtl2.de/weltweit/un-klimagipfel-in-paris-weltweit/ [Abrufdatum: 25.03.2018].
Lead: Die Mission ist klar, allein die Umsetzung gestaltet sich schwierig. 150 Staats- und Regierungschefs ringen von nun an in Paris um ein neues Klimaabkommen.
b) Manchen Korallen hilft der Klimawandel. In: Tages-Anzeiger, 18.08.2016. Der Klimawandel schadet Korallenriffen, so die allgemeine Annahme. Zumindest an einigen Korallenriffen könnte der mit dem Klimawandel einhergehende Meeresspiegelanstieg die Lebensbedingungen jedoch deutlich verbessern.
c) Hofmann, Markus: Alle Länder beim Klima gefordert. In: Neue Zürcher Zeitung, 14.12.2015.
Lead: Das Pariser Abkommen legt die Grundlage für eine klimaneutrale Wirtschaft. Der erste Vertrag, der alle Staaten zu Klimaschutzmassnahmen verpflichtet, ist das Ergebnis vieler Kompromisse. Das Pariser Abkommen ermöglicht es, die Anstrengungen aller Länder mit der Zeit zu erhöhen.
d) Armut durch Klimawandel. In: Neue Zürcher Zeitung, 19.06.2013.
Lead: Die ärmsten Regionen Afrikas und Asiens sind vom globalen Klimawandel in besonderem Mass betroffen. Eine Studie der Weltbank prognostiziert unter gleichbleibenden Bedingungen eine Zuspitzung der Armut und Unterernährung. Online: www.nzz.ch/armut-durch-klimawandel-1.18101924 [Abrufdatum: 14.08.2018].
e) Klimawandel: Auch Schwellenländer verantwortlich. Online: www.blick.ch/news/klimawandel-auch-schwellenlaender-verantwortlich-id1461952.html 04.12.2007 [Abrufdatum: 03.03.2017].
Lead: Auch Schwellenländer verantwortlich. WASHINGTON − Die Gefahren des Klimawandels können gemäss einer Studie nicht von …
f) Neue Partnerschaft für Klimaschutz: Entwicklungsländer stärker unterstützen. Online: www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2016/07/2016-07-04-petersberger-klimadialog.html [Abrufdatum: 24.03.2018].
Lead: Die Bundesregierung will Entwicklungsländern dabei helfen, die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen. Zum Auftakt des Petersberger Klimadialogs stellten Entwicklungsminister Müller und Bundesumweltministerin Hendricks dazu Pläne für eine Partnerschaft vor.
g) Massnahmen gegen den Klimawandel in Afrika. Online: www.gesichter-afrikas.de/klima/klimawandel/massnahmen.html [Abrufdatum: 24.03.2018].
2.1.5 Wie verwalte ich die gefundenen Informationen?
Rechercheprotokoll
Um auch zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu können, wonach Sie bereits gesucht haben, ist es gut, wenn Sie Ihre Suchbegriffe notieren und Ihren Rechercheweg protokollieren. Dafür eignet sich eine tabellarische Darstellung. In den ersten beiden Spalten führen Sie die Quelle sowie die verwendeten Suchbegriffe an, in der dritten die URL der Treffer. Unabdingbar ist auch das Datum des Abrufs. Und mit der Bewertung des Ergebnisses (Spalte 4) ersparen Sie sich Wiederholungen.
Quelle
Suchbegriffe
Ergebnisse (Treffer)
Einschätzung
Datum
Bosnien Territorialkonflikt
https://de.wikipedia.org/wiki/Bosnienkrieg
Brauchbarer Überblick
15.03.18
Schweizerisches Zeitungsarchiv «swissdox.ch»
Bosnien Vielvölkerstaat
Bosniens steiniger Weg aus der Sackgasse. NZZ, 20. Nov. 2015.
Aktuelle politische Einordnung
15.03.18
Katalog Schweizer Hochschulbibliotheken «swissbib.ch»
Bosnien Rassismus
Dorin, A. 2010: Srebrenica – Geschichte eines salonfähigen Rassismus. Kai Homilius Verlag.
Tief greifende Analyse
15.03.18