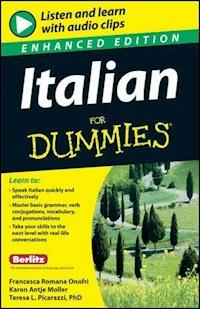Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: hep verlag
- Kategorie: Bildung
- Serie: Geschichtsdidaktik heute
- Sprache: Deutsch
Dieses E-Book enthält komplexe Grafiken und Tabellen, welche nur auf E-Readern gut lesbar sind, auf denen sich Bilder vergrössern lassen. Der Band "Forschungswerkstatt Geschichtsdidaktik 17" versammelt verschiedene Beiträge der sechsten Ausgabe der Tagung "geschichtsdidaktik empirisch". Sie decken einerseits die drei Themenfelder ab, mit der sich die empirische Geschichtsdidaktik intensiv befasst. Im Blick sind die historischen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler und deren Messung, Fragen der Lehrerprofessionalität sowie das Verstehen von Lehr-Lern-Vorgängen im geschichtskulturellen Kontext. Darüber hinaus führen die Beiträge die Diskussionen über einen virulenten Forschungsaspekt weiter, der an der Tagung im Rahmen der Keynotes aufgegriffen wurde: die "Übersetzung" zwischen Theorie und Empirie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Reihe »Geschichtsdidaktik heute«, Band 11
Monika Waldis, Béatrice Ziegler (Hrsg.)Forschungswerkstatt Geschichtsdidaktik 17Beiträge zur Tagung »geschichtsdidaktik empirisch 17«ISBN 978-3-0355-1393-6
Coverfoto: JoãoSilas/Unsplash
1. Auflage 2019Alle Rechte vorbehalten© 2019 hep verlag ag, Bern
www.hep-verlag.com
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Monika Waldis und Béatrice Ziegler
Translation II
Translation: Von der Theorie zur Empirie und zurück – Drei Vorschläge für den Weg
Michele Barricelli
Geschichtslehrpersonen
Die Lehrkraft als Faktor der Schulbuchnutzung – Nutzertypen eines kompetenzorientierten und digitalen Schulbuchs am Beispiel des »mBook Belgien«
Tobias Langguth, Waltraud Schreiber und Michael Werner
Geschichtslehrer/-in werden – Berufswahlmotivation über Portfolio/-Reflexion erfahren
Sebastian Barsch und Nina Glutsch
Beobachtungen und Beurteilungen von angehenden Geschichtslehrpersonen bei der Arbeit mit Unterrichtsvideos
Philipp Marti und Monika Waldis
»Also, ich hoffe, es wird irgendwann« – Fach- und Selbstkonzepte von Geschichtslehrpersonen in der Berufseinstiegsphase
Jennifer Lahmer-Gebauer und Dirk Urbach
Fachwissen und geschichtsdidaktisches Wissen und Können bei Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern zu Beginn der zweiten Ausbildungsphase
Mario Resch und Christian Heuer
Domänen(un)spezifisch – Empirische Befunde zum Kompetenzverständnis von Geschichtslehrpersonen
Roland Bernhard und Christoph Kühberger
Kooperationsseminare zwischen Fachwissenschaft und Fachdidaktik im Lehramtsstudium – Orientierungen eines Lehrendentandems
Daniel Münch
Geschichtslehrkräfte beurteilen schriftliche Klassenarbeiten – Das Beispiel Quellenzusammenfassung
Inga Kahlcke
Geschichtsunterricht
Der Kalte Krieg im Geschichtsunterricht oder die schwindende Selbstverständlichkeit kultureller Rahmungen
Barbara Christophe
Geschichtsklitterung oder »alternative Fakten«? – Urteilsbildung im Geschichtsunterricht im viel beschworenen »postfaktischen Zeitalter« am Beispiel eines videografierten Unterrichtssettings zu NS-Propaganda
Andrea Kolpatzik
Historische Kompetenzen
Ein Diagnoseraster für die De-Konstruktionskompetenz nach dem FUER-Modell
Jan Scheller
Vier Jahre Unterricht mit dem »mBook Belgien« – Zu den Kompetenz- und Interessenverläufen der Lernenden von der neunten bis zur zwölften Klasse
Christiane Bertram, Wolfgang Wagner, Michael Werner, Ulrich Trautwein und Waltraud Schreiber
Schreibprozesse in Geschichte
Kristine Gollin und Martin Nitsche
Abstracts
Biografische Angaben
Einleitung
Monika Waldis und Béatrice Ziegler
Im Rahmen von »geschichtsdidaktik empirisch 15« fanden unter dem Titel »Translations« zwei Key Panels statt, die Übersetzbarkeit und Integration von zentralen deutschsprachigen geschichtsdidaktischen Konzepten in englische bzw. französische Theorieansätze beleuchteten. Dem Anliegen wurde von Peter Gautschi und Nadine Fink sowie von Peter Seixas und Andreas Körber Folge geleistet, wobei das erste Team einen Vergleich zwischen dem französisch- und dem deutschsprachigen geschichtsdidaktischen Forschungsdiskurs vornahm, das zweite Team die Begriffsfelder »Geschichtsbewusstsein«, »Quelle«, »Darstellung«, »Triftigkeit« und ihre Übersetzbarkeit bzw. die Begriffe historical consciousness, source, evidence, trace, account, plausibility diskutierten. Die Tagung »geschichtsdidaktik empirisch 17« knüpfte an diese Diskussion an und griff mit dem Titel »Translation II« einen zweiten virulenten Aspekt auf, der Übersetzungsleistungen erfordert: jenen zwischen Theorie und Empirie.
1Empirische Forschung in der Geschichtsdidaktik
Tatsache ist, dass geschichtsdidaktische Forschung seit den 1970er-Jahren zu einem wichtigen Teil empirische Forschung ist. Zeugnis davon legen im deutschsprachigen Raum u. a. Forschungsüberblicke (Barricelli & Sauer, 2015; Beilner, 2003; Gautschi, 2013; Günther-Arndt & Sauer, 2006; Hasberg, 2001; Köster, Thünemann & Zülsdorf-Kersting, 2014; Waldis & Ziegler, 2018), vorgelegte Dissertationen (»Beihefte zur Zeitschrift für Geschichtsdidaktik«, »Geschichtsdidaktik heute«), der »Zwischenhalt« in der kompetenzorientierten Forschung (Schreiber, Ziegler & Kühberger, 2019) sowie eine rege Publikationstätigkeit u. a. in der »Zeitschrift für Geschichtsdidaktik«, in der »Zeitschrift für die Didaktik der Gesellschaftswissenschaften« und in den Tagungsbänden der vorliegenden Reihe »Forschungswerkstatt Geschichtsdidaktik« ab. Deutlich wird im Rückblick, dass empirisch arbeitenden Geschichtsdidaktikerinnen und -didaktikern kein genuin geschichtsdidaktisches Forschungsinstrumentarium zur Verfügung steht. Da es im Kern um Aneignungsweisen bzw. Umgangsweisen von Menschen mit Geschichte und demzufolge um seelische Zustände, Verhalten, Erleben, Interaktionen bis hin zu Manifestationen menschlichen Handelns geht, stellen Forschungszugänge und Methoden der empirischen Sozialforschung und der Psychologie vorrangige Herangehensweisen dar; diese Wissenschaften fungieren als Bezugsdisziplinen, wobei hier zukünftig Erweiterungen zu denken sind, u. a. durch die Computerwissenschaft. Ziel aller geschichtsdidaktischen Forschungsbemühungen ist es, menschliche Begegnung und Auseinandersetzung mit Vergangenheit und Geschichte wissenschaftlich zu untersuchen und auf diese Weise zu möglichst gesicherten Erkenntnissen über diese Art von Weltaneignung zu gelangen. Der dabei resultierende wissenschaftliche Erkenntnisgewinn zur je individuellen Aneignung von und Befassung mit dem Historischen ist an sich und für die Geschichtsdidaktik als wissenschaftliche Disziplin als wertvoll einzuschätzen. Des Weiteren besteht der Anspruch, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Lösung praktischer Probleme beitragen, beispielsweise als Legitimations- und Entscheidungsgrundlage für die zukünftige Gestaltung historischen Lehrens und Lernens oder als Basis für die Weiterentwicklung zukünftiger institutionell arrangierter Begegnungen mit Vergangenheit und Geschichte. In einer zunehmend ausdifferenzierten Wissensgesellschaft wird dabei auf wissenschaftlich produziertes Wissen zurückgegriffen, auch wenn auf anderen Wegen unser Verständnis von sozialer Wirklichkeit geprägt wird. Das so entstehende Erfahrungswissen kann sich im Alltag und im Einzelfall als durchaus nützlich erweisen. Dessen Übertragbarkeit auf eine größere Gruppe von Individuen ist allerdings mit erheblichen Problemen behaftet. Oft stehen sich widersprüchliche Aussagen gegenüber, geprägt von Fehlkonzepten, Mythen, Verzerrungen, vom Glauben an Autoritäten, von anekdotischer Evidenz, Vorurteilen oder Wunschdenken. Logisch scheinende Herleitungen können überdecken, dass Menschen und Organisationen in sozialen Zusammenhängen oft nicht logisch oder rational handeln, oder sie lassen entscheidende Einflussfaktoren übersehen. »Ziel des Erkenntnisgewinns auf der Basis sozialwissenschaftlicher Forschung ist es, die Probleme nicht-wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns zu überwinden und in systematischer, nachvollziehbarer und überprüfbarer Weise auf der Basis empirischer Daten zu (vorläufig) gültigen Ergebnissen zu Fragen oder Annahmen über soziale Sachverhalte zu kommen« (Döring & Bortz, 2016, 7).
2Wissenschaftstheoretische und methodische Überlegungen
Innerhalb der Sozialwissenschaften existieren unterschiedliche wissenschaftstheoretische Paradigmen, die Vorannahmen über die Erkennbarkeit der Erfahrungswirklichkeit beschreiben. Im quantitativen Paradigma wird davon ausgegangen, dass soziale Sachverhalte beschrieben, erklärt und verstanden werden können, indem Sachverhalte der Erfahrungswelt strukturiert und theoriebasiert erfasst und in ihren Relationen zueinander systematisch geprüft werden. Der Forschungsprozess verläuft in der Regel linear, beginnt mit Theoriearbeit und der Ableitung von Hypothesen, führt über standardisierte Erhebungsinstrumente zur Generierung numerischer Daten in möglichst repräsentativen Stichproben, die mittels statistischer Verfahren zum Zweck der Hypothesenprüfung analysiert werden. Im qualitativen Paradigma wird hingegen davon ausgegangen, dass ein bewusst wenig strukturiertes Vorgehen mithilfe nicht- oder teilstandardisierter Erhebungsverfahren anhand von Einzelfällen oder kleinen Stichproben durch interpretierende Methoden zur ganzheitlichen Erfassung des Untersuchungsgegenstandes führen kann und darauf aufbauend schrittweise neue Hypothesen und Theorien generiert werden können. In jüngerer Zeit zeichnet sich die Tendenz ab, die beiden Paradigmen nicht mehr so stark in einem Konkurrenzverhältnis, sondern eher in einem Ergänzungsverhältnis zueinander zu betrachten (Döring & Bortz, 2016, 9). Dies schlägt sich in Diskussionen um einen dritten Ansatz, den sogenannten Mixed-Methods-Ansatz (Kelle, 2008; Kuckartz, 2014), nieder. Dies ist etwa dann der Fall, wenn in Teilstudien qualitative oder quantitative Verfahren eingesetzt werden. Bereits diese kurzen Beschreibungen zeigen, dass die Funktion von Theorie im quantitativen und qualitativen Paradigma eine unterschiedliche ist.
Viele Forschungsarbeiten in der aktuellen geschichtsdidaktischen Forschung folgen dem qualitativen Paradigma, das in der Tradition der Geisteswissenschaften steht. Es zielt auf die verstehend-interpretative Rekonstruktion sozialer Phänomene in ihrem jeweiligen Kontext, wobei es vor allem auf Sichtweisen und Sinngebungen der Beteiligten ankommt. Unabhängig von methodischen Ausdifferenzierungen stehen im Forschungsprozess folgende Prinzipien im Vordergrund (vgl. Breuer, 2010, 37 f.; Kruse, 2013; Lamnek, 2010):
1.Alltags- bzw. lebensweltliche Phänomene, Probleme und Prozesse sowie deren Ausdruck in den Sichtweisen, Aushandlungs- und Präsentationsformen der involvierten Akteure stehen im Fokus des Forschungsinteresses.
2.Ganzheitliche und rekonstruktive Untersuchung lebensweltlicher Phänomene.
3.Reflektierte theoretische Offenheit zwecks Bildung neuer Theorien, im Bewusstsein, dass Erkenntnis immer auf apriorische Strukturen angewiesen ist.
4.Zirkularität und Flexibilität des Forschungsprozesses zwecks Annäherung an den Gegenstand.
5.Forschung als Kommunikation und Kooperation zwischen Forschenden und Beforschten; die Interaktion spielt im gesamten Forschungsprozess eine wichtige erkenntnisbezogene Rolle.
6.Selbstreflexion der Subjektivität und Perspektivität der Forschenden; die in (berufs-)biografischer und alltagsweltlicher Sozialisation erworbenen Kompetenzen der Forschenden fließen in bewusster Fokussierung und mit einer selbstreflexiven Haltung ein.
Hervorzuheben ist, dass im qualitativen Paradigma der Entdeckungszusammenhang, nicht der Begründungszusammenhang im Vordergrund steht. Die vielen wissenschaftstheoretischen Ansätze innerhalb der qualitativen Sozialforschung stimmen miteinander überein, dass es beim wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn vor allem um die Bildung neuer Hypothesen und Theorien geht. Die Denkfigur, die dabei zur Anwendung kommt, ist jene von »der Transzendenz des Besonderen/Empirischen hin zum Allgemeinen/Theoretischen« (Breuer, 2010, 39). Es geht demgemäß um Induktion, d. h., die Geschehensbeobachtung lässt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vermuten, es könnte sich in einem nächsten und einem übernächsten Fall ebenso verhalten. Mit Breuer ist zu betonen, dass eine Wiederkehr von Konstellationen beobachteter Phänomene lediglich als Anstoß für eine »Regelhaftigkeitserwartung« verstanden werden kann, eine logischargumentativ untermauerte Begründung kommt auf diese Weise nicht zustande. Wird der Umgang mit Theorie betrachtet, so zeigt sich in der Forschungspraxis häufig das Bild, dass Forschende sich erstens der theoretischen Offenheit gewahr sind und zweitens die eigenen Forschungsergebnisse durchaus als theoriegenerierend verstehen. Jedoch kann in der anschließenden Weiterverarbeitung in der geschichtsdidaktischen Community nicht selten eine vorschnelle Transformation dieser Forschungsergebnisse hin zur Verallgemeinerung im Sinne von empirisch erhärteten Befunden beobachtet werden. So wurde beispielsweise das Ergebnis einer Fallanalyse, die beschrieb, wie eine Geschichtslehrperson in Abhängigkeit der eigenen beruflichen Sozialisation die Vermittlungsabsicht von Geschichtslehrmitteln – von akteursbezogener zu strukturgeschichtlicher Perspektive – unterlaufen kann (Sperisen & Schär, 2013), in Forschungsüberblicken als empirisches Faktum gehandelt. Und die Quellenarbeit im Geschichtsunterricht gilt seit der Arbeit von Spieß (2014) generell als »entwicklungsbedürftig«, was u. a. auch daran liegt, dass die schiere Menge von 41 videografierten Geschichtslektionen aus alltagstheoretischer Sicht Fakten schafft und die Ergebnisse zudem mit – mehr oder weniger empirisch erhärteten – Beobachtungen anderer Geschichtsdidaktikerinnen und -didaktiker einhergeht. Spieß selbst jedoch reflektiert die Limitationen seiner Studie, indem er auf die Struktur des Samples und die darin gefundene Homogenität hinweist (Spieß, 2014, 232), die einer methodisch kontrollierten Typenbildung und Generalisierung durch komparative Analysen (Bohnsack, Fritzsche & Wagner-Willi, 2015, 30) zuwiderlief. Dennoch vorgenommene Verallgemeinerungen erscheinen aus wissenschaftstheoretischer Sicht problematisch, wie im nachfolgenden Abschnitt zu zeigen ist.
Im quantitativen Paradigma, dessen wissenschaftstheoretische Grundlage der kritische Rationalismus (Popper) darstellt, wird davon ausgegangen, dass die durch den menschlichen Verstand (Ratio) formulierten Theorien den Startpunkt wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns darstellen. Theorien werden als Vermutungen über die Realität formuliert, können niemals zweifelsfrei bestätigt, aber durch die Ableitung einer empirisch überprüfbaren Hypothese und deren Konfrontation mit Daten widerlegt werden. Damit widerspricht der kritische Rationalismus den Annahmen des Empirismus bzw. Positivismus, dass im Zuge der Sammlung empirischer Daten durch Induktionsschluss gesicherte allgemeine Theorien abgeleitet und bestätigt werden können (Beispiel: Die allgemeine Aussage »Alle Schwäne sind weiß« kann mittels Nachweis eines einzigen nicht weißen Schwans eindeutig widerlegt werden). Der Erkenntnisgewinn besteht im quantitativen Paradigma also darin, »durch Falsifikation die ungültigen Theorien auszusondern« (Döring & Bortz, 2016, 37). Eine Theorie, die einen Falsifikationsversuch übersteht, gilt als vorläufig bestätigt, eine Theorie, die viele Falsifikationsversuche überstanden hat, wird als »bewährt« bezeichnet. Dabei gilt: Einzelergebnisse reichen für die Falsifikation einer Theorie nicht aus. Wenn Daten einer Theorie widersprechen, so kann dies sowohl an der Fehlerhaftigkeit der Theorie als auch an der Fehlerhaftigkeit der Daten oder der verwendeten Messinstrumente liegen. Demzufolge umfasst die Prüfung von Hypothesen immer auch eine kritische Betrachtung der Voraussetzungen der Datengewinnung sowie eine kritische Auseinandersetzung mit konkurrierenden Hypothesen und Theorien. Festzuhalten ist, dass die Theorien und daraus abgeleiteten Hypothesen nicht deterministisch (d. h. für jeden Einzelfall), sondern probabilistisch (d. h. für einen großen Teil der Fälle) gültig sind. In der Forschungspraxis arbeiten Studien oft mit einzelnen theoretischen Hypothesen bzw. Theoremen, die wissenschaftstheoretisch nicht den Stand einer vollwertigen Theorie haben, etwa weil sie kein in sich abgeschlossenes konsistentes Aussagensystem bilden, eine geringe kausale Erklärungskraft aufweisen oder einen sehr geringen empirischen Bewährungsgrad besitzen. Häufig wird in diesem Fall von einem theoretischen Modell, einem Theorierahmen bzw. einem theoretischen Analyserahmen gesprochen. Aus Sicht des kritischen Rationalismus trägt die einmalige Prüfung von Hypothesen, die aus einem selbst entwickelten Theorierahmen abgeleitet wurden, im Vergleich zur wiederholten Prüfung einer etablierten Theorie, in geringerem Maße zum theoretischen Erkenntnisgewinn bei, da durch die jeweils einmalige Prüfung immer wieder neu konstruierter Modelle es an ausreichenden Falsifikationsversuchen fehlt, um den Bewährungsgrad einer Theorie bewerten zu können (vgl. Döring & Bortz, 2016, 57). Als genuin geschichtsdidaktische Theorien können bisher die Konstrukte »Geschichtsbewusstsein«, Modelle historischer Kompetenz, Rüsens Sinnbildungsmuster oder im angloamerikanischen Raum das Modell des historical reasoning gelten, obschon zu den ersten beiden mehrere und teils widersprechende Definitionen vorliegen. Wird nach dem Stand von Theorie und empirischer Absicherung gefragt, so kommt hier häufig eine dritte – unseres Erachtens fachdidaktikeigene – Komponente ins Spiel: der Bekanntheitsgrad einer Theorie in der (Unterrichts-)Praxis bzw. deren (normative) Umsetzung in der Form von Lernzielen und Methoden. Häufig sind dort, wo Theorien eingeführt sind und ein gezieltes Training in Richtung der zu erwartenden Denk- und Handlungsweisen stattfinden konnte, Falsifikationen weniger häufig anzutreffen. So beschreibt beispielsweise Schreiber (2016, 133 f.) die erfolgreiche Einführung des theoretisch erarbeiteten Kompetenzansatzes in Praxisformate wie Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsprojekte und museumspädagogische Maßnahmen, wobei sie und ihr Team bei der empirischen Überprüfung der Wirksamkeit der theoriefundierten Maßnahmen Kompetenzentwicklungen nicht nur in Bezug auf stärker subjektbezogene Kompetenzbereiche (historische Frage- und Orientierungskompetenz), sondern insbesondere auch in Bezug auf unterschiedliche Dimensionen der Sachkompetenz nachweisen konnten. Die Hypothese, dass kompetenzorientierte Ansätze des Lehrens bei Individuen Kompetenzentwicklung anzuregen vermögen, ist damit vorläufig bestätigt. Allerdings ist der Gültigkeitsbereich dieses empirischen Datums vorerst noch als eingeschränkt zu betrachten, denn in den Studien, die Schreiber anführt, wurde die Durchführung durch Praxis- oder Theorieexperten geleitet, da Lehrpersonen und Museumspädagoginnen und -pädagogen eine zu große Unsicherheit im Umgang mit ungeplanten Situationen im Lehr-Lern-Prozess verspürten bzw. ihnen solche Unsicherheit attestiert wurde. Ganz ähnlich gingen Stoel, van Drie und van Boxtel (2017) in ihrer – im renommierten »Journal of Educational Psychology« veröffentlichten – Studie vor, in der sie die Wirksamkeit expliziter Lehrstrategien wie das Kennenlernen von und den Umgang mit abstrakten Begriffen (z. B. Nationalismus, Imperialismus), die Erarbeitung vielfältiger Ursachen und das Konstruieren kausaler Erklärungen auf die Fähigkeit von Gymnasialschülerinnen und -schülern (11. Klasse), in Geschichte kausal zu argumentieren, nachweisen konnten. Auch in dieser experimentellen Studie wurde der Unterricht von zwei erfahrenen und forschungsaffinen Geschichtslehrpersonen durchgeführt, wobei diese viel Zeit in die Unterrichtsplanung investierten. Beide Beispiele zeigen sehr schön das Dilemma der fachdidaktischen Forschung auf, die mit der Situation konfrontiert ist, als Gestaltungswissenschaft Innovationen im Bildungsbereich zu implementieren und gleichzeitig deren Wirksamkeit empirisch zu überprüfen. Streng genommen, können sowohl Schreiber und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch Stoel und Mitautorinnen mit der gewählten Vorgehensweise nur die Wirksamkeit für einen bestimmten Fall, den kompetenzförderlichen Unterricht durch forschungsaffine Geschichtsdidaktik-Expertinnen und -Experten, als »nicht falsifiziert« ausweisen. Bei der Implementation des Kompetenzansatzes in die Schulpraxis könnte es allerdings zu weiteren, teils unvorhergesehenen Komplikationen kommen, die die Umsetzbarkeit der Theorie in der Unterrichtspraxis infrage stellen.
Als vielversprechender Ansatz im Umgang mit dieser Situation hat sich in jüngerer Zeit in verschiedenen Fachdidaktiken der Ansatz des »Design-based-Research« (DBR) etabliert (Hußmann, Thiele, Hinz, Prediger & Ralle, 2013; Reinmann, 2005). Ziel dieses Ansatzes ist es, dass Forschende in Zusammenarbeit mit Praktikerinnen und Praktikern in lokalen Kontexten Lernumgebungen unter der Nutzung von Lerntheorien und didaktischen Theorien gestalten. Deren Wirksamkeit wird im konkreten Kontext geprüft, und die Lernumgebungen werden davon ausgehend weiterentwickelt. Die grundlegenden Merkmale und Prinzipien des DBR-Ansatzes sind zum einen, dass der Entwicklungsprozess der Innovation zum Forschungsgegenstand wird und im praktischen Kontext unter der Beteiligung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Praktikerinnen und Praktikern1 von Beginn an bearbeitet wird, und zum anderen das zyklische, iterative Vorgehen der Untersuchung. Dabei wird, ausgehend von einer Frage zu Lernprozessen, die systematische Gestaltung von Lernaufgaben bis hin zu ganzen Lernumgebungen vorgenommen. Es folgt die Beobachtung von Lernprozessen und die Überprüfung von Lernergebnissen und, auf diesen empirischen Ergebnissen aufbauend, das Redesign von Aufgaben bis hin zu größeren Lehreinheiten der Designlösung mit dem Ziel der Lösung des zu Beginn der Innovation umrissenen Bildungsproblems. So identifizierten beispielsweise Klees und Tillmann (2015) in ihrer Studie zum Einsatz von externen Schülerlaboren im Biologieunterricht die vorgängige Vorbereitung im Unterricht als zentral, gleichzeitig stellte sich die Frage, wie die Anbindung an den Unterricht gewährleistet werden kann. In der Folge nutzten sie technische und gestalterische Potenziale digitaler Medien, um Informationen zum Lernort und Lernmaterialien inklusive Animationen vor dem Laborbesuch zur Verfügung zu stellen. Die fachliche Vorbereitung wurde in drei Zyklen zunächst mittels Lehrpersonenbefragung und schließlich mittels Lehrpersonen- und Schülerinnen- und Schülerbefragungen auf deren Praxistauglichkeit hin überprüft, wobei auch Entwicklungswünsche der Lehrkräfte umgesetzt werden konnten. Im vierten Zyklus wurde die Wirkung von Vorbereitung und Laborbesuch auf den Wissenserwerb und das Flow-Erleben der beteiligten Schülerinnen und Schüler getestet. Die Leistung solcher Studien im Modus des Design-based-Research-Ansatzes ist darin zu sehen, dass von »lokalen Theorien« des Lehrens und Lernens ausgegangen wird und kontextuelle Gegebenheiten im Forschungsprozess Beachtung finden. In einem experimentellen Setting werden zunächst lokal Hypothesen getestet, wobei die Realität nach einem theoriegestützten Plan manipuliert wird. Im weiteren Verlauf des Beobachtens, Evaluierens und Redesigns findet eine Verschränkung von Verstehen (Beschreibung/descriptives) und Anpassung der Lehr-Lern-Situation statt, die einer weiteren Überprüfung unterzogen wird. Idealerweise resultieren mittels dieses zyklischen Verfahrens Erkenntnisse auf drei unterschiedlichen Ebenen: erstens kontextualisierte Theorien zum Lehren und Lernen eines spezifischen Gegenstands, zweitens vertieftes Wissen zum Designprozess selbst (z. B. Aufgabenentwicklung und Adaption auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Lernenden) und schließlich drittens Verbesserung und Innovation von konkreten Lernumgebungen und Lernaufgaben für die Unterrichtspraxis (Reinmann, 2005, 61 f.). In der geschichtsdidaktischen Forschung hat der DBR-Ansatz bisher noch kaum Fuß gefasst. Es ist abzuwarten, ob die in ihn gesetzten Erwartungen eingelöst werden können. Sicherlich nicht trivial sind die Herausforderungen an theoretische Klarheit und Stringenz sowie die Anforderungen an methodische Herangehensweisen und Forschungsinstrumente mit dem Ziel, kontextuell geprägten Phänomenen im Forschungsprozess gerecht zu werden. Nicht zuletzt werden Fördergelder darüber entscheiden, ob sich der Ansatz in der fachdidaktischen Forschung etablieren wird.
3Der Tagungsband und seine Beiträge
Mit dem vorliegenden Band wird zum sechsten Mal in Folge die Tagung »geschichtsdidaktik empirisch« dokumentiert. Die Tagung hat am 7. und 8. September 2017 traditionsgemäß in den Räumlichkeiten der alten Universität Basel stattgefunden. Sie startete mit einigen Impulsen zum Theorie-Empirie-Verhältnis der Erstautorin dieser Einleitung, aus denen die hier dargelegten Überlegungen hervorgegangen sind. Es folgte die Analyse des Theorie-Empirie-Verhältnisses in der Keynote von Michele Barricelli, der in launiger Art und Weise den Sprachgebrauch der empirischen Geschichtsdidaktikforschung reflektierte. Mit der Niederschrift seines Referats dürfte er zukünftig zur verstärkten Reflexion der Fachsprache unter den empirisch Forschenden anregen. Carla van Boxtel präsentierte anderntags in ihrer Keynote die beeindruckende Verzahnung und enge Verschränkung von Theorie, Empirie und Praxis zum historical reasoning in den Niederlanden.
Eine erste Gruppe der hier vertretenen Beiträge widmete sich – wie schon in der Vorgängertagung – den (angehenden) Geschichtslehrpersonen. Dabei wurden verschiedene Kompetenzaspekte sowie Einstellungen und Überzeugungen in den Blick genommen. Die Studien basierten einerseits auf dem Modell der professionellen Kompetenz von Lehrpersonen (Kunter et al., 2011) und zogen andererseits weitere theoretische Grundlagen heran.
Tobias Langguth, Waltraud Schreiber und Michael Werner erkundeten – ausgehend von Informationen zu Nutzungsdaten zum digitalen und multimodalen Schulbuch »mBook Belgien« – in Lehrerinterviews den Umgang mit und die Einstellungen zu diesem Lernmaterial. Dabei fanden sie drei unterschiedliche Schulbuchnutzertypen, die je spezifisch mit der Einstellung zu und dem Verständnis von Multimedialität/Digitalität sowie mit Kompetenzorientierung zusammenhingen.
Sebastian Barsch und Nina Glutsch untersuchten im Rahmen ihres Forschungsprojekts zur Reflexionsfähigkeit von Geschichtslehrerstudierenden die Berufswahlmotive von Lehramtsanwärterinnen und -anwärtern der Universität Kiel. Die Datengrundlage bildeten schriftliche Portfoliotexte zur Dokumentation und Reflexion eigener Entwicklungsprozesse sowie problemzentrierte Interviews. Die Ergebnisse verweisen auf den Einfluss von Vorbildern und eigenen Unterrichtserfahrungen auf die Berufswahlmotivation sowie die Dominanz intrinsischer Faktoren. In den vertiefenden Interviews kristallisierten sich tiefere Verbindungen zu geschichtstheoretischen Einstellungen heraus.
Philipp Marti und Monika Waldis analysierten anhand von Gruppengesprächen zu einer ausgewählten Videosequenz aus dem Videosurvey der »VisuHist«-Studie Interaktionen von Schweizer Geschichtslehrerstudierenden zu beobachtbaren Aspekten des Lehrens und Lernens sowie Merkmalen »guten« Geschichtsunterrichts. Die Resultate verweisen auf ein Vorwiegen allgemeiner, nicht genuin geschichtsdidaktischer Merkmale, auf die in den Gruppengesprächen eingegangen wurde. Gleichzeitig deutet sich eine Zugewandtheit zu Überlegungen der kognitiven Aktivierung im Unterricht an, ohne dass dabei bereits explizit fachdidaktische Begründungen zum Ausdruck kommen.
Jennifer Lahmer-Gebauer und Dirk Urbach untersuchten Fach- und Selbstkonzepte von Geschichtslehrpersonen der Berufseinstiegsphase, u. a. die von ihnen verfolgten Unterrichtsziele, die Organisation und Planung historischer Lernprozesse sowie die Überzeugungen hinsichtlich ihrer eigenen Funktion, Fähigkeiten und Wirksamkeit als Lehrperson. Dabei zeigte sich, dass Geschichte als Orientierungsrahmen für die Gegenwart verstanden wird sowie die Dominanz eines Unterrichtsmusters, das mit einer historischen Fragestellung beginnt und von Gruppenarbeitsformaten zu Quellen und Darstellungen fortgesetzt wird. Hinsichtlich der eigenen Rolle favorisieren Berufseinsteigerinnen und -einsteiger die Rolle des Moderators/der Moderatorin mit einer moderaten Lenkung durch die Lehrperson.
Mario Resch und Christian Heuer entwickelten auf der Grundlage des Heidelberger Geschichtslehrerkompetenzmodells einen Vignettentest zur Erfassung geschichtsdidaktischen Wissens und Könnens und setzten diesen zusammen mit einem umfangreichen Fachwissenstest und Selbsteinschätzungsskalen zu pädagogischen und fachlichen Berufswahlmotiven bei angehenden Geschichtslehrpersonen ein. Es ergaben sich signifikante Zusammenhänge. Darüber hinaus berichteten die beiden Autoren über Herausforderungen bei der Entwicklung von geschichtsdidaktisch profilierten Aufgaben für Testinstrumente und die Erfassung der Unterrichtspraxis.
Roland Bernhard und Christoph Kühberger vertieften auf der Basis von qualitativen Interviews mit österreichischen Geschichtslehrpersonen das Thema der Kompetenzorientierung und der Medienverwendung im Unterricht. Dabei zeigte sich ein eher fachunspezifisches Kompetenzverständnis bei Geschichtslehrpersonen.
Daniel Münch beschrieb, basierend auf seiner vertiefenden Analyse von Interviews mit einem/-r Fachwissenschaftler/-in und einem/-r Fachdidaktiker/-in, die Zusammenarbeit dieser beiden Hochschullehrpersonen in einem Kooperationsseminar an der Universität Jena. Die mittels dokumentarischer Methode rekonstruierten Orientierungen zeigen, dass beide gemeinsam Verantwortung für das Seminar übernehmen.
Inga Kahlcke stellte erste Ergebnisse einer qualitativen Studie vor, in der erhoben wurde, wie Geschichtslehrkräfte verschiedener Erfahrungsstufen schriftliche Klassenarbeiten von Schülerinnen und Schülern der 10. Klasse beurteilen. Die vertiefende Analyse der Aussagen einer erfahrenen Lehrperson und eines Referendars ergaben deutlich verschiedene Kriterien. Während die erfahrene Lehrperson vor allem auf die Beachtung der Perspektive und sprachliche Distanzierung achtete, nahm der Berufseinsteiger eher fachunspezifische Aspekte wie eine genaue Textlektüre und eine korrekte Orthografie in den Blick.
Die zweite Gruppe widmete sich dem Geschichtsunterricht und den darin beobachtbaren Interaktions- bzw. Lernprozessen. Dabei kamen fachliche Dimensionen und die Dimension der Urteilsbildung in den Blick.
Barbara Christophe untersuchte je zwei Unterrichtsstunden zum Kalten Krieg in Deutschland und in der Schweiz. Die dargebotenen Deutungen erschienen in den Unterrichtslektionen monoperspektivisch, und die explizite Auslassung der politischen Dimension wurde nicht transparent gemacht. Die Autorin kam zum Schluss, dass die Transparenz und Reflexivität im Umgang mit der politischen Dimension allen historischen Erzählens nicht nur ein Gebot der erinnerungskulturellen Fairness in pluralen Gesellschaften ist, sondern auch eine Voraussetzung für Verstehen darstellt.
Andrea Kolpatzik nahm mit ihrem Beitrag die Urteilsbildung im Geschichtsunterricht in den Blick. In ihrer Fallstudie untersuchte sie ein mehrere Lektionen umfassendes Unterrichtssetting zur NS-Propaganda und fokussierte darin auf die sprachliche Verfasstheit von Werturteilen und deren diskursive Begründung. Dabei zeigte sich, dass den Schülerinnen und Schülern für die (selbst-)reflektierte Urteilsbildung nebst dem notwendigen (bildungs-)sprachlichen Wortschatz auch das Verständnis für die mit den Arbeitsaufträgen verknüpften domänenspezifischen Denkleistungen fehlte.
Die dritte Gruppe von Beiträgen befasste sich mit historischen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern sowie mit Grundlagen von deren Diagnose.
Jan Scheller entwickelte, ausgehend vom FUER-Kompetenzstrukturmodell, ein Analyseraster für die Feststellung und Diagnose der De-Konstruktionskompetenz bei Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden. Die deduktiv hergeleiteten Analysekategorien schlüsselte er anhand von verschiedenen Medien feingliedrig auf.
Christiane Bertram, Wolfgang Wagner, Michael Werner, Ulrich Trautwein und Waltraud Schreiber untersuchten in einer Längsschnittstudie die Kompetenz- und Interessenentwicklung von Schülerinnen und Schülern der 9. bis 12. Klasse in deutschsprachigen Schulen in Belgien, die mit dem »mBook« arbeiteten. Sie stellten fest, dass das Interesse am Fach Geschichte ab der 10. Klasse zunahm. Hinsichtlich der Kompetenzentwicklung konnte in den ersten drei Jahren ein beachtlicher Zuwachs festgestellt werden, der sich im letzten Jahr abschwächte.
Kristine Gollin und Martin Nitsche nahmen die Struktur historischer Schreibprozesse von Deutschschweizer Schülerinnen und Schülern der 10. und 11. Gymnasialstufe in den Blick. Im Rahmen der Aufgabenentwicklung in Cognitive Labs wurden die bei der Aufgabenlösung beobachtbaren Operationen narrativer Kompetenz erfasst und kategorisiert sowie weitere damit verbundene Lese- und Schreibtätigkeiten herausgearbeitet.
Der vorliegende Tagungsband vermag wiederum einen substanziellen Einblick in derzeitige empirische Forschungsprojekte der deutschsprachigen Geschichtsdidaktik zu geben. Diese Zusammenschau wurde unter anderem ermöglicht durch finanzielle Zuschüsse des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung sowie der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften. Ein großes Dankeschön gebührt den Reviewerinnen und Reviewern aus dem geschichtsdidaktischen Kreis, die sich an der Review der Abstracts vorgängig zur Tagung sowie bei der Review der eingegangenen Buchbeiträge beteiligten. Zum Schluss geht der Dank an Manuel Hubacher, der uns mit sehr viel Umsicht bei der Organisation der Tagung unterstützte und federführend die Erstellung des Manuskripts voranbrachte.
Literatur
Barricelli, Michael & Sauer, Michael. (2015). Empirische Lehr-Lernforschung im Fach Geschichte. In Georg Weißeno & Carla Schelle (Hrsg.), Empirische Forschung in gesellschaftswissenschaftlichen Fachdidaktiken. Ergebnisse und Perspektiven (S. 185–200). Wiesbaden: Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-06191-3\_13.
Beilner, Helmut. (2003). Empirische Forschung in der Geschichtsdidaktik. Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, 54(5/6), 284–302.
Bohnsack, Ralf/Fritzsche, Bettina & Wagner-Willi, Monika. (2015). Dokumentarische Video- und Filminterpretation. In Ralf Bohnsack, Bettina Fritzsche & Monika Wagner-Willi (Hrsg.), Dokumentarische Video- und Filminterpretation (S. 11–43). Opladen: Barbara Budrich.
Breuer, Franz. (2010). Wissenschaftstheoretische Grundlagen qualitativer Methodik in der Psychologie. In Günter Mey & Katja Mruck (Hrsg.), Handbuch Qualitative Forschung in derPsychologie (S. 35–49). Wiesbaden: Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-531-92052-8_2.
Döring, Nicola & Bortz, Jürgen. (2016). Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften (5. Aufl.). Berlin/Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-41089-5.
Gautschi, Peter. (2013). Erkenntnisse und Perspektiven geschichtsdidaktischer Unterrichtsforschung. In Marko Demantowksy & Bettina Zurstrassen (Hrsg.), Forschungsmethoden und Forschungsstand in den Didaktiken der kulturwissenschaftlichen Fächer (S. 203–244). Bochum: Projektverlag.
Günther-Arndt, Hilke & Sauer, Michael. (2006). Einführung: Empirische Forschung in der Geschichtsdidaktik. Fragestellungen – Methoden – Erträge. In Hilke Günther-Arndt & Michael Sauer (Hrsg.), Geschichtsdidaktik empirisch. Untersuchungen zum historischen Denken und Lernen (S. 7–27). Berlin: Lit.
Hasberg, Wolfgang. (2001). Empirische Forschung in der Fachdidaktik. Nutzen und Nachteil für den Unterricht. 2 Bd. Neuried: UniPress.
Hußmann, Stephan/Thiele, Jörg/Hinz, Renate/Prediger, Susanne & Ralle, Bernd. (2013). Gegenstandsorientierte Unterrichtsdesigns entwickeln und erforschen – Fachdidaktische Entwicklungsforschung im Dortmunder Modell. In Michael Komorek & Susanne Prediger (Hrsg.), Der lange Weg zum Unterrichtsdesign: Zur Begründung und Umsetzung genuin fachdidaktischer Forschungs- und Entwicklungsprogramme (S. 25–42). Münster: Waxmann.
Kelle, Udo. (2008). Die Integration qualitativer und quantitativer Methoden in der empirischen Sozialforschung: Theoretische Grundlagen und methodologische Konzepte (2. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-91174-8.
Klees, Guido & Tillmann, Alexander. (2015). Design-Based Research als Forschungsansatz in der Fachdidaktik Biologie – Entwicklung, Implementierung und Wirkung einer multimedialen Lernumgebung im Biologieunterricht zur Optimierung von Lernprozessen im Schülerlabor. Journal für Didaktik der Biowissenschaften, (F)6, 91–108.
Köster, Manuel/Thünemann, Holger & Zülsdorf-Kesting, Meik (Hrsg.). (2014). Researching history education. International perspectives and disciplinary traditions. Schwalbach/Ts.: Wochenschau.
Kruse, Jan. (2013). Qualitative Sozialforschung. In Markus Antonius Wirtz (Hrsg.), Dorsch – Lexikon der Psychologie (16. Aufl., S. 1279–1280). Bern: Huber.
Kuckartz, Udo. (2014). Mixed Methods: Methodologie, Forschungsdesigns und Analyseverfahren. Wiesbaden: Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-531-93267-5.
Kunter, Mareike/Baumert, Jürgen/Blum, Werner/Klusmann, Uta/Krauss, Stefan & Neubrand, Michael (Hrsg.). (2011). Professionelle Kompetenz von Lehrkräften. Ergebnisse des Forschungsprogramms COACTIV. Münster: Waxmann.
Lamnek, Siegfried. (2010). Qualitative Sozialforschung (5. Aufl.). Weinheim: Beltz.
Reinmann, Gabi. (2005). Innovation ohne Forschung? Ein Plädoyer für den Design-Based Research-Ansatz in der Lehr-Lernforschung. Unterrichtswissenschaft, 33(1), 52–69.
Schreiber, Waltraud. (2016). Historische Kompetenzen in Theorie, Empirie und Pragmatik. In Wolfgang Hasberg & Holger Thünemann (Hrsg.), Geschichtsdidaktik in der Diskussion. Grundlagen und Perspektiven (S. 113–152). Frankfurt am Main: Peter Lang.
Schreiber, Waltraud/Ziegler, Béatrice & Kühberger, Christoph (Hrsg.). (2019). Geschichtsdidaktischer Zwischenhalt. Beiträge aus der Tagung »Kompetent machen für ein Leben in, mit und durch Geschichte« in Eichstätt vom November 2017. Münster: Waxmann.
Sperisen, Vera & Schär, Bernhard. (2013). Akteure versus Strukturen – Zum Spannungsverhältnis zwischen Lehrbuch- und Lehrpersonenkonzepten im Geschichtsunterricht. Das Schweizer Beispiel »Hinschauen und Nachfragen«. In Susanne Popp, Michael Sauer, Bettina Alavi, Marko Demantowsky & Alfons Kenkmann (Hrsg.), Zur Professionalisierung von Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrern. Nationale und internationale Perspektiven (S. 187–202). Göttingen: V&R unipress.
Spieß, Christian (2014). Quellenarbeit im Geschichtsunterricht. Die empirische Rekonstruktion von Kompetenzerwerb im Umgang mit Quellen. Göttingen: V&R unipress.
Stoel, Gerhard L./Drie, Jannet van & Boxtel, Carla van (2017). The effects of explicit teaching of strategies, second-order concepts, and epistemological underpinnings on students’ ability to reason causally in history. Journal of Educational Psychology, 109(3), 321–337. https://doi.org/10.1037/edu0000143.
Waldis, Monika & Ziegler, Béatrice. (2018). Geschichtsdidaktik. In Georg Weißeno, Reinhold Nickolaus, Monika Oberle & Susan Seeber (Hrsg.), Gesellschaftswissenschaftliche Fachdidaktiken, Theorien, empirische Fundierungen und Perspektive (S. 39–59). Wiesbaden: Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-18892-4_3.
Translation II
Translation: Von der Theorie zur Empirie und zurück
Drei Vorschläge für den Weg
Michele Barricelli
Mit Fug und Recht lässt sich heute sagen, die Geschichtsdidaktik habe eine Periode des relativen Mangels an empirischer Forschung hinter sich gelassen.2 Ertragreiche Projekte gibt es in steigender Zahl, die Fragestellungen sind interdisziplinär anschlussfähig geworden, der Gebrauch von Erhebungs- und Auswertungsmethoden gelingt zunehmend sicher. Die Schweizer Tagungsreihe »geschichtsdidaktik empirisch« der FHNW (mit ihren entweder tiefstapelnden oder verwegenen Minuskeln) hat nicht wenig zu diesem glücklichen Umstand beigetragen. Dafür gebührt den Ideengebern, spiritus rectoribus, Organisatoren, auch den Förderern großer Dank.
Entsprechend der Fortentwicklung von Aufgabenbereichen, methodischen Zugängen und Auskunftsmöglichkeiten gibt es nun bereits eine Vielzahl von Überblicken zum Stand der empirischen Forschung in der Geschichtsdidaktik. Diese sind, ob in Aufsatzform, Sammelbänden oder Monografien, oft eher auf die methodische Seite der Forschung konzentriert wie zuletzt der Band von Holger Thünemann und Meik Zülsdorf-Kersting (2016), dem hier manche beispielhaften Anregungen entnommen werden. Rarer, wiewohl ebenso zu finden sind allgemeine Überlegungen dazu, wie die neu hinzutretende Betonung des empirischen Zugriffs die Denkroutinen und Arbeitsweisen in der Disziplin Geschichtsdidaktik verändert hat. Bei Letzterer herrschen naturgemäß gewisse pragmatische Hinsichten vor, die um Empfehlungen für eine gute, zuverlässige und nützliche Forschung sozusagen im Dienste des Kunden (der Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte, einer an Geschichte und Erinnerung interessierten Öffentlichkeit, der Bildungspolitik) gruppiert sind.3 Dass sich zugleich der Charakter der Geschichtsdidaktik als Wissenschaft überhaupt wandelt, gerät dagegen noch recht wenig in den Blick. Denn diese ist nun ja nicht mehr länger (oder will oder darf es nicht sein) eine dominant hermeneutisch arbeitende Instanz, deren Ausübende einer scholarship im Sinne etwa eines Hans Ulrich Gumbrecht huldigen, die einst (nur) zu Kontemplation, langer gedanklicher Verweildauer und schier unendlichem Austausch jeweils nur fein modifizierter Argumente im behaglichen Diskurs innerhalb eines geschützten Raumes verpflichtete. Stattdessen orientiert man sich unter der Parole von Messbarkeit an einer Idee der Verwertbarkeit von Ergebnissen und stellt sich zudem in vielen auch nichtakademischen Räumen, zum Beispiel in Beiräten und Fachkommissionen von Museen, Gedenkstiftungen oder Anstalten öffentlicher Erinnerung, drängenden Nachfragen, mahnenden Ansprüchen und ungeduldig vorgebrachten Auskunftsersuchen nach dem Muster »Was kann Bildung zum Abbau von Fundamentalismen und Extremismen beitragen?«, »Wie hilft Geschichte bei der Sicherung des gesellschaftlichen Zusammenhalts?«, »Ist unsere liberale Demokratie zu retten?«. Soll heißen: Statt dass die Geschichtsdidaktik Zeit erhält zu er- und begründen, was »Fundamentalismus« und »Extremismus«, »Gesellschaft«, »Pluralität« und »Demokratie« in ihrer jeweils historischen Dimension bedeuten und wie man solch verwickelte Konzepte lehren kann, um sich möglicherweise zu aus ihnen erwachsenden Bedürfnissen zu verhalten, werden nunmehr – auch, aber beileibe nicht ausschließlich unter dem Paradigma der Kompetenzbasierung von allgemeinbildendem Fachunterricht – standardmäßige Formulierungen zu graduierten Leistungsniveaus auf den Feldern etwa der Gesellschaftsstärkung oder Demokratiesicherung (eher sogar noch der Abwehr von nicht gewünschten Erscheinungen der Verwerfung, des Auseinanderbrechens, der Desintegration) gefordert. Die einen nennen dies einen willkommenen Bedeutungszuwachs der Fachdidaktiken und hier der Geschichtsdidaktik durchaus im Besonderen; die anderen beklagen einen Verlust an Autonomie und konstatieren eine neue Getriebenheit im Allgemeinen, von der das auf empirische Forschung ausgerichtete Drittmittelwesen ja nur der Ausdruck, nicht der Grund ist (vgl. dazu Barricelli, 2014).
In dieser Zeit, da die Geschichtsdidaktik also das empirische Wagnis in beiderlei Gestalt, der methodischen Anverwandlung wie der facheigenen Profilierung, auf sich genommen hat, sollte die theoretische Rückversicherung stete Begleiterscheinung sein. Diese wird hier diesmal von der Feststellung ausgehen, wie sehr wir angesichts des Booms der evidenzbasierten Lehr-Lern-Forschung als Forscherinnen und Forscher nicht nur, aber eben auch bei der Konzeption von Empirie in einer Zwangsjacke stecken. Denn die Ursituation aller empirischen Forschung in den nach wie vor »verstehenden« Geisteswissenschaften stellt sich dar, wie Ludwig Wittgenstein sie einmal beschrieb:
»Es ist für unsere Untersuchung wesentlich, dass wir nichts Neues mit ihr lernen wollen. Wir wollen etwas verstehen, was schon offen vor unseren Augen liegt. Denn das scheinen wir, in irgendeinem Sinn, nicht zu verstehen.«(Wittgenstein zusf. zit. nach Wrabel, 1998, 65 f., Hervorhebungen im Original)
Richtig betrachtet, liegt darin die Crux oder die Herausforderung unseres Strebens: nicht die passenden Fragen zu stellen, Methoden zu beherrschen, nach Resultat, Anschluss und Transfer zu suchen – das ist alles auch von Belang, kommt aber später. Zuerst geht es um die Ideologien der Untersuchung, das heißt um das Verhältnis unseres forschenden Tuns zu uns selbst (und eben nicht zu den anderen, die wir vom Erfolg der Forschung erst überzeugen wollen). Es geht darum, einen Bedingungszusammenhang zwischen Mentalität und Messung ehrlich zu erzählen. Drei der dafür nötigen Grundeinstellungen, Marken auf dem Weg zu valider Erkenntnis, sollen im Folgenden benannt werden. Sie seien wie folgt überschrieben:
1.Maß halten,
2.reflexiv bleiben,
3.nützlich sein.
1Maß halten
Geschichtslernen sei schwerer als Mathematik. – So lauteten Aussagen von Schülerinnen und Schülern sowie auch Meldungen von Zeitschriften, als in den 1990er-Jahren in Großbritannien das National Curriculum for History mit einiger Konsequenz und dem ganzen Zubehör auf ein narratives Verständnis von Geschichte umgestellt wurde. Denis Shemilt beschrieb, wenn man recht liest, fast genussvoll, wie die jungen Lernenden, bisher an die Verkündung und Wiederholung feststehender historischer Wahrheiten gewöhnt, sich von nun an abstrampeln konnten, wie sie wollten: Nie würden sie gemäß den geänderten Voraussetzungen ein hinreichendes Lernergebnis erreichen:
»First we say that there is no single right answer to the really significant questions in history and that pupils must work out for themselves. Then we say: ›But not any answer will do. Some answers are indefensible even if no one answer is clearly right! And some admissible answers are not as good as other admissible answers.‹ Pupils then spend considerable time and effort learning how to determine which answers and accounts are better than others. If they succeed we say: ›But even though some accounts are better because more valid or coherent or parsimonious than others, there is no one best account, since we find it useful to vary questions, assumptions and perspectives.« (Shemilt, 2000, 98)
Ob unter solchen Bedingungen Ranke, Nipperdey, die Mommsens hätten Historiker werden wollen? Denn in der Tat: Heute gehen wir mit einiger Leichtigkeit davon aus, dass bereits Siebt-, ja Fünftklässler »Geschichte« als »sprachlich verfasste« »Konstruktion« oder, im Lautwert geheimnisvoller noch, »Konstrukt« in einer Art durchschauen sollen, wie dies vor fünfzig, geschweige vor hundertfünfzig Jahren noch kaum einem Fachmann geläufig gewesen ist: Dass ein Unterschied zwischen Quelle und Darstellung gemacht werden soll, ist als Erkenntnisprinzip abseits von frühen Außenseitern wie Droysen noch kaum ein halbes Jahrhundert alt. Die Standortgebundenheit von Geschichtsschreibung als conditio sine qua non wurde die längste Zeit eben nicht, wie heute, entweder resigniert oder aber stolz (an-)erkannt, sondern als durch Kritik auszumerzender Mangel eingestuft. Dass schließlich Geschichtsschreiberinnen und Geschichtsschreiber Erzählerinnen und Erzähler von möglichst vielen Geschichten sind oder sein sollten, von Geschichten mit argumentativen und diskursiven Anteilen, noch dazu well-written narratives, ist zumindest in Deutschland immer noch gar nicht Konsens. Es soll aber, zumal unter dem Leitstern der narrativen Kompetenz, das Maß historischen Lernens in der Schule sein. Freilich führt zur empirischen Erforschung dieser Grundeinstellung kein direkter Weg.
Eher gilt weiterhin die Bedingtheit, Beschränktheit und Kleinigkeit der in den entsprechenden fachlichen Studien verfolgten Fragen bzw. der verwertbaren Resultate. Jedoch ist Häme in Nachfolge alter, jetzt sprichwörtlich gewordener Abqualifizierungen etwa eines »Fingerhuts« von Erkenntnis durch »Fliegenbeinzählen« ganz fehl am Platze. Denn liest man die in den oben erwähnten Überblickswerken aufmarschierenden Studien chronologisch, synoptisch und im Zusammenhang, scheint es tatsächlich so, dass die eingeschlagene Richtung die eines Strebens nach immer größerer Systematisierung, nach Anschlussfähigkeit zu möglichst vielen Seiten, nach Komplettierung eines Bildes ist. Insofern überrascht nicht, dass häufig Fachtagungen unter überaus allgemeinen Titeln veranstaltet werden wie »Geschichtsdidaktik empirisch«, oder »Geschichtsunterricht« und dass das sogar – cum grano salis – funktioniert. Größe entsteht hier also durch Addition und Summen, nicht unbedingt den ausschweifenden Entwurf oder das visionäre Programm.
Letzteres gibt es jedoch auch. Es kann so überbordend sein, dass das eigentliche Schulfach sogar überschritten und historisches Denken bzw. Lernen nicht nur im Unterricht, sondern überall in der Gesellschaft abgebildet bzw. modelliert werden mag. Damit sind diese Konzepte noch größer als das ohnehin ja schon große PISA-Projekt, das sich freilich bislang nicht auf das Fach Geschichte erstreckt und das, bei allem, was man ihm an Gigantomanie vorwerfen kann – die gerade zu jener Schieflage geführt hat, welche im Namen antizipiert wurde –, dem Grundsatz nach nur auf Messungen von dem beruhen sollte, was üblicherweise Schulstoff in den betreffenden Fächern ist. Selbstverständlich kann an dieser Stelle die HiTCH-Studie (»Historical Thinking – Competencies in History«, Trautwein et al., 2017),4 ein veritables large-scale assessment, nicht außer Acht gelassen werden. In ihrem Umfang, ihrem Anspruch – eng verknüpft mit dem Kompetenzstrukturmodell der FUER-Gruppe unter Waltraud Schreiber – ist sie imponierend. Ihr methodischer Aufbau (Design, mehrfache Qualitätskontrolle, Pilotierung, Haupterhebung usw.) ist schlechterdings unangreifbar. Die nach Subgruppen differenzierten Befunde müssen wie stets noch weiter geprüft und gewogen werden, wobei allerdings das Urteil nur auf einem Indizienprozess beruhen kann (die entwickelten Testaufgaben bzw. Items werden nur exemplarisch veröffentlicht). An dem umfangreichen Projektbericht stimmt indessen nachdenklich, dass die Entwicklung dieses Instruments für die Validierung eines historischen Kompetenztests auf die Konstruktion eines, bei aller behaupteten Zuverlässigkeit der »dahinter stehenden Theorie« (Trautwein et al., 2017, 117), recht ominösen »Generalfaktors« historische Kompetenz angewiesen ist, der aufgrund seiner nicht mehr steigerbaren Verallgemeinerung womöglich nur noch wenig Erklärungs- oder Bezeichnungskraft besitzt (Trautwein et al., 2017, 95).5 Diese stupende Grundsätzlichkeit des Zugriffs, wo es doch eigentlich, wie gesagt, um eine eng umgrenzte intellektuelle Operation, noch dazu in einem beschränkten öffentlichen Raum (Schule), geht bzw. gehen sollte, wirft Fragen auf, denn er ist ja gepaart mit der praktischen Notwendigkeit, einen nicht zu langen, nicht zu umfangreichen Fragebogen (hier »Testheft«) für die Erprobung eben jener »Generalkompetenz« zu entwerfen. Das passt nur schwer zusammen. – Was den Menschen im Grundsatz, gänzlich oder in mental basierten Teilbereichen wie der Fähigkeit, zu lieben, zu streben, zu gestalten oder zu trauern, ausmacht, haben Schriftstellerinnen und Schriftsteller seit Generationen im dichterischen Experiment zu ergründen versucht; gelungen ist dies bisher nicht, was begrüßt werden soll, da sonst ja die Produktion von Literatur, Theater, Film einzustellen wäre. Wie aber soll man nach einem noch so variantenreichen und durch mutmaßlich »raffinierte« (vgl. oben von Borries) Item-Formulierung ausgezeichneten standardisierten Test, der, schon durch die Körperkräfte beschränkt, kaum länger als einen Schultag dauert, sagen können oder sagen können wollen, wie ein junger Mensch, gegebenenfalls infolge geeigneter Schulung, »historisch denkt«?
Trotz aller Unwahrscheinlichkeit des Strebens in der Praxis bleiben die Einsicht in den Konstruktcharakter der Geschichte, in Standortgebundenheit und Perspektivität der historischen Narration, die Anerkennung von Multiperspektivität und Vorläufigkeit, das Abwägen von Gütekriterien innerhalb einer argumentierenden Erzählung wichtige Ziele von Geschichtsunterricht und historischem Lernen über die gesamte Schulzeit hinweg. Die Suche nach dem single best narrative ist schon um dieser Prinzipien willen zu verwerfen. Das Set an gemäß Shemilt unermüdlich erhobenen und in empirischen Studien getesteten Forderungen – nicht aufhören zu denken, nachzufragen, zu zweifeln, wieder von vorn zu beginnen – behält jedoch (lediglich?) idealen bzw. regulativen, jedenfalls nicht realistischen Wert. Denn so funktioniert die Lebenswelt der jungen Lernenden einfach nicht, nicht die sie umgebende Geschichtskultur oder Vergangenheitspolitik – dies zu bezeugen, muss man derzeit nicht erst nach Polen oder Ungarn schauen – und, man sei ehrlich, schon gar nicht die Produktion von aktuell gültigem Wissen zum Beispiel auf Historikertagen. Auf eine zumindest auf den ersten Blick widersprüchliche Art schafft unsere angeblich so diverse Gegenwart nämlich eine Pflicht zu Zuordnung und Bekenntnis. Dabei geht es freilich nicht, wie noch zu Zeiten einer nationalapologetischen Geschichtsschreibung, um Einheitlichkeit, sondern um Eindeutigkeit: Ich wähle einen Standpunkt, wofür ich Gründe benennen soll und den zu verteidigen ich bereit bin. Die Position mag im Laufe der Zeit wechseln; sie muss jedoch, zum Beispiel, im Augenblick des Stimmzetteleinwurfs in der Wahlkabine, beim Einkauf von mithilfe von Kinderarbeit erstellten Kleidungsstücken oder wenn jemand in der U-Bahn fordert, bestimmte Fahrgäste sollten dahin zurückgehen, woher sie kommen, klar sein. Dies sind fürwahr sämtlich kompetenzbasierte Aktionen bzw. Reaktionen.
Bodo von Borries hat wiederholt darüber nachgedacht, was genau eigentlich das Aus der Lernzielorientierung zugunsten des neuen, noch gewaltiger scheinenden Kompetenzparadigmas bewirkt hat (von Borries, 2004). Gewiss war dafür die nicht zu kontrollierende Beliebigkeit der taxonomisch obersten Lernzielebenen ein Grund. Die umfassenden sogenannten Fern- und Richtziele waren einfach auf Dauer nicht konsensfähig zu formulieren. Sehr ähnlich hielt von Borries seit jeher »Geschichtsbewusstsein« für ein viel zu komplexes mentales Konstrukt, um es als Ganzes oder auch nur in seinen wesentlichen Teilen empirisch regelrecht zu erforschen. Es hat ein wenig gedauert, bis die Geschichtsdidaktik daraus den richtigen Schluss zog, dass es mithin vielversprechender sei, statt, einer typisch deutschen Tradition folgend, in die Blackbox des Bewusstseins schauen zu wollen, sich, sozusagen im Sinne eines amerikanischen Pragmatismus, auf das zu beziehen, was als Äußerung und Handeln tatsächlich beobachtbar und damit zu messen, wägen und beschreiben ist. In die Theorie von den Kompetenzen immerhin wurde dieser empirische Zugriff durch das Konstrukt der »Performanz« von vornherein eingebaut. Nur gibt es eben bisher nicht den geringsten Konsens darüber, was eigentlich einen geschichtsbewussten Menschen praktisch ausmacht, wodurch er als solcher handelnd in Erscheinung tritt. Durchaus vermag man einen umwelt- oder gesundheitsbewussten Zeitgenossen erkennen – aber was prägt das Bild eines Jugendlichen, der Geschichtsbewusstsein besitzt? Jeder Geschichtsdidaktiker und jede Geschichtsdidaktikerin dürfte hier recht eigene Vorstellungen besitzen: Ist damit die Nachhaltigkeit von memorierbarem und in sensiblen Momenten