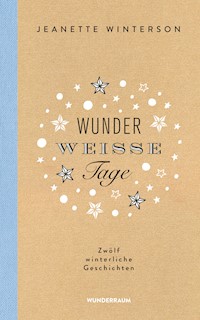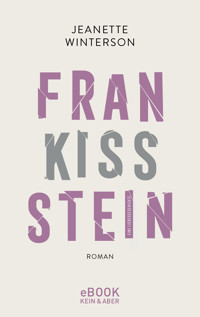
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1816 schreibt Mary Shelley Frankenstein in den Schweizer Bergen. Zweihundert Jahre später, im heutigen Großbritannien, begegnen wir dem transgender Arzt Ry Shelley, der sich in Victor Stein, einen renommierten wie unergründlichen Experten für künstliche Intelligenz verliebt.
Klug und mit unvergleichlichem Witz verbindet Winterson diese beiden Erzählstränge zu einer höchst originellen Geschichte, in der die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit, zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz und zwischen biologischer und sexueller Identität verschwinden – eine Geschichte über die Liebe und das Menschsein selbst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks der Autorin
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Jeanette Winterson, 1959 in Manchester geboren und in Lancashire bei evangelikalen Adoptiveltern aufgewachsen, veröffentlichte mit fünfundzwanzig Jahren ihren preisgekrönten Debütroman Orangen sind nicht die einzige Frucht. Es folgten zahlreiche weitere Bücher, mit denen sie zu einer der angesehensten Autorinnen Großbritanniens avancierte. Sie ist mit zwei Romanen auf der Liste der »100 Greatest British Novels« vertreten und wurde 2006 von der Queen zum Officer und 2018 zum Commander of the Order of the British Empire ernannt. 2019 wurde Frankissstein für den Booker Prize nominiert. Jeanette Winterson schreibt regelmäßig für den Guardian und lebt in den Cotswolds und in London.
ÜBER DAS BUCH
1816 schreibt Mary Shelley Frankenstein in den Schweizer Bergen. Zweihundert Jahre später, im heutigen Großbritannien, begegnen wir dem transgender Arzt Ry Shelley, der sich in Victor Stein, einen renommierten wie unergründlichen Experten für künstliche Intelligenz verliebt. Klug und mit unvergleichlichem Witz verbindet Winterson diese beiden Erzählstränge zu einer höchst originellen Geschichte, in der die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit, zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz und zwischen biologischer und sexueller Identität verschwinden – eine Geschichte über die Liebe und das Menschsein selbst.
We may lose and we may win though we will never be here again.
Eagles, Take It Easy
Genfer See, 1816
Realität ist wasserlöslich.
Was wir sehen konnten, die Felsen, das Ufer, die Bäume, die Boote auf dem See, hatte seine übliche Schärfe verloren und war mit dem langen Grau einer ganzen Woche voller Regen verschwommen. Selbst das Haus, das den Anschein erweckte, aus Stein zu sein, waberte inmitten des dichten Nebels, aus dem gelegentlich eine Tür oder ein Fenster auftauchte wie ein Traumbild.
Alles Solide hatte sich in sein wässriges Pendant verwandelt.
Unsere Kleider trockneten nicht mehr. Wenn wir ins Haus zurückkamen, was wir mussten, weil wir nicht immer nur drinbleiben konnten, brachten wir das Wetter mit. Durchweichtes Leder. Wolle, die nach Schaf stank.
Meine Unterwäsche schimmelt.
Heute Morgen kam ich auf die Idee, einfach nackt zu gehen. Welchen Nutzen haben völlig durchnässte Kleider? Stoffbezogene Knöpfe, die in den Knopflöchern derart aufquellen, dass ich gestern aus meinem Kleid herausgeschnitten werden musste?
An diesem Morgen war mein Bett so nass, als hätte ich die ganze Nacht geschwitzt. Die Fenster waren von meinem eigenen Atem beschlagen. Wo das Feuer im Kamin überhaupt noch brannte, zischte das Holz wie Darmwinde. Ich ließ dich schlafen und tappte leise, auf nassen Füßen, die feuchtklamme Treppe hinunter.
Nackt.
Ich öffnete die Haustür. Der Regen fiel immer noch, beständig und gleichgültig. Er fiel nun schon seit sieben Tagen, nicht schneller, nicht langsamer, nicht stärker, nicht schwächer. Die Erde konnte ihn nicht mehr aufnehmen, der ganze Boden war schwammig – die Schotterwege trieften vor Nässe, und im ordentlichen Garten hatten sich mehrere Rinnsale gebildet und schwemmten die Erde weg, die sich als zähe schwarze Pfütze vor unserem Tor sammelte.
Aber an diesem Morgen ging ich hinter dem Haus den Hang hinauf, in der Hoffnung auf eine Lücke in den Wolken, durch die ich den See sehen könnte, der unter uns lag.
Beim Hinaufgehen dachte ich darüber nach, wie sich unsere Vorfahren gefühlt haben mussten, die ohne Feuer, oft ohne Schutz, durch die Natur streiften, so schön und so freigiebig, aber auch so erbarmungslos in dem, was sie mit sich brachte. Ich dachte, dass ohne Sprache, oder vor der Sprache, sich der Geist nicht selbst trösten kann.
Und doch ist es die Sprache unserer Gedanken, die uns mehr quält als alle Exzesse oder Härten, die die Natur uns auferlegt.
Wie es wohl wäre – nein, wie wäre es – in dieser Frage gibt es kein »wohl« – wie wäre es, ein Wesen ohne Sprache zu sein – kein Tier, sondern etwas mir selbst Ähnlicheres?
Hier also bin ich, in meinem zitternden, mit Gänsehaut überzogenen Körper. Eine wahrhaft armselige Kreatur, ohne die Spürnase eines Hundes, ohne die Schnelligkeit eines Pferdes, ohne die Flügel der unsichtbaren Bussarde, die ich über mir schreien höre wie verlorene Seelen, und ohne Flossen oder auch nur einen Meerjungfrauenschwanz für dieses Wetter zum Auswringen. Ich bin nicht einmal so gut gerüstet wie die Haselmaus, die gerade in einem Felsspalt verschwindet. Ich bin eine wahrhaft armselige Kreatur, außer dass ich denken kann.
In London war ich nicht so zufrieden wie hier am See und in den Alpen, wo der Geist Einsamkeit finden kann. London ist immerwährend; eine stetig strömende Gegenwart, die auf eine zurückweichende Zukunft zuhastet. Hier, wo die Zeit weder prall gefüllt noch knapp ist, könnte, wie ich mir vorstelle, alles geschehen, wäre alles möglich.
Die Welt steht am Beginn von etwas Neuem. Wir sind die Gestalter unseres Schicksals. Ich mag keine Erfinderin von Maschinen sein, aber ich bin die Erfinderin von Träumen.
Dennoch wünschte ich, ich hätte eine Katze.
Ich befinde mich jetzt oberhalb der Dachlinie des Hauses, die Schornsteine ragen durch den feuchten Stoff des dampfenden Regens wie die Ohren eines gigantischen Tieres. Meine Haut ist überzogen von klaren Tropfen, als sei ich mit Wasser bestickt worden. Es liegt etwas Schönes in meiner geschmückten Nacktheit. Meine Brustwarzen sind wie die Zitzen einer Regengöttin. Meine Schamhaare, immer dicht, wirken wie eine dunkle Untiefe. Der Regen nimmt beständig zu, steigert sich zu einem Wasserfall, und ich mittendrin. Meine Lider sind nass. Ich reibe mir die Augen mit den Fäusten.
Ich muss an Shakespeare denken. Welches Stück war es noch einmal? Ein Sommernachtstraum.
Zerdrück dies Kraut dann auf Lysanders Augen:
Die Zauberkräfte seines Saftes taugen,
Von allem Wahn sie wieder zu befrein
Und den gewohnten Blick ihm zu verleihn.
Dann sehe ich es. Ich glaube, es zu sehen. Was scheine ich zu sehen?
Eine Gestalt, gigantisch, zerlumpt, die sich schnell über die Felsen über mir bewegt, von mir weg nach oben steigt, den Rücken mir zugewandt, die Bewegungen sicher, gleichzeitig aber auch stockend, wie die eines jungen Hundes, dessen Pfoten zu groß für ihn sind.
Ich überlegte, ob ich ihn rufen sollte, gestehe aber, dass ich Angst hatte.
Dann war die Vision verschwunden.
Wenn es, dachte ich, ein Wanderer ist, der sich verirrt hat, wird er unser Haus finden. Aber er bewegte sich davon fort, als hätte er es gesehen und wäre achtlos daran vorbeigegangen.
Beunruhigt darüber, eine Gestalt gesehen zu haben, und gleichermaßen beunruhigt, ich hätte sie mir vielleicht nur eingebildet, kehrte ich zum Haus zurück. Ich schlich mich hinein, dieses Mal durch eine Seitentür, und ging vor Kälte zitternd die geschwungene Treppe hinauf.
Mein Mann stand auf dem Absatz. Ich ging auf ihn zu, nackt, wie ich war, und sah, wie seine Männlichkeit sich unter seinem Hemdzipfel regte.
Ich habe einen Spaziergang gemacht, sagte ich.
Nackt?, fragte er.
Ja, sagte ich.
Er streckte die Hand aus und berührte mein Gesicht.
Was ist dein Stoff? Woraus bestehst du,
Dass Scharen fremder Schatten dich umschweben?
An diesem Abend saßen wir am Feuer, das Zimmer eher Schatten denn Licht, denn wir hatten nur wenige Kerzen, und solange das Wetter nicht besser wurde, konnten keine beschafft werden.
Ist dieses Leben ein verworrener Traum? Ist die äußere Welt der Schatten, während wir die Substanz nicht sehen, berühren oder hören, aber dennoch wahrnehmen können?
Wieso ist dieser Traum von Leben so albtraumartig? Fiebrig? Schweißig?
Oder liegt es daran, dass wir weder tot noch lebendig sind?
Ein Wesen, das weder tot noch lebendig ist.
Mein ganzes Leben lang habe ich einen solchen Zustand gefürchtet, und daher schien es mir besser, so zu leben, wie ich leben kann, und den Tod nicht zu fürchten.
Und so ging ich mit siebzehn mit ihm fort, und diese beiden Jahre waren für mich Leben.
Im Sommer 1816 mieteten die Dichter Shelley und Byron, Byrons Arzt Polidori, Mary Shelley und ihre Stiefschwester Claire Clairmont, zu diesem Zeitpunkt Byrons Geliebte, zwei Häuser am Genfer See in der Schweiz. Byron bewohnte die größere Villa Diodati, während die Shelleys ein kleineres, charmanteres, etwas tiefer am Hang gelegenes Haus bezogen.
Die beiden Haushalte standen in einem derart schlechten Ruf, dass ein Hotel auf der anderen Seeseite ein Fernrohr aufstellte, damit seine Gäste beobachten konnten, was die angeblichen Satanisten und Sexualisten, die sich ihre Frauen teilten, so trieben.
Zwar stimmt, dass Polidori in Mary Shelley verliebt war, aber sie weigerte sich, mit ihm zu schlafen. Byron hätte vielleicht mit Percy Shelley geschlafen, hätte dieser derartige Neigungen verspürt, worauf es aber keine Hinweise gibt. Claire Clairmont hätte mit jedem geschlafen – bei dieser Gelegenheit schlief sie nur mit Byron. Die beiden Haushalte verbrachten die ganze Zeit miteinander. Dann fing es an zu regnen.
Mein Mann verehrt Byron. Jeden Tag fahren sie mit einem Boot auf den See hinaus, um über Dichtung und Freiheit zu reden, während ich Claire meide, die über nichts reden kann. Ich meide auch Polidori, er ist ein liebeskrankes Tier.
Aber dann kam der Regen, und diese Wolkenbruchtage ließen keine Ausflüge auf den See zu.
Zumindest verhinderte das Wetter, dass wir vom anderen Ufer angestarrt wurden. Im Ort hörte ich das Gerücht, ein Gast hätte ein halbes Dutzend zum Trocknen auf Byrons Terrasse ausgebreitete Unterröcke erspäht. In Wahrheit waren es Bettlaken. Byron ist Dichter, liebt aber Sauberkeit.
Nun werden wir von unzähligen Wärtern gefangen gehalten, jeder gebildet von einem Wassertropfen. Polidori hat zu seiner Unterhaltung ein Mädchen aus dem Dorf mitgebracht, und wir tun in unseren klammen Betten, was wir können, aber der Geist muss ebenso geübt werden wie der Körper.
An jenem Abend saßen wir um das dampfende Feuer herum und sprachen über das Übernatürliche.
Shelley ist fasziniert von mondhellen Nächten und dem überraschenden Anblick von Ruinen. Er glaubt, dass jedes Gebäude einen Abdruck der Vergangenheit in sich trägt wie eine Erinnerung, oder Erinnerungen, und dass diese freigesetzt werden können, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Aber welches ist der richtige Zeitpunkt?, fragte ich ihn, und er überlegte, ob die Zeit selbst vielleicht von jenen abhängt, die sich in ihr befinden. Wenn die Zeit uns als Kanäle in die Vergangenheit benutzt – ja, so muss es sein, sagte er, da manche Leute mit den Toten sprechen können.
Polidori ist anderer Meinung. Die Toten sind nicht mehr. Falls wir Seelen haben, kehren sie nicht zurück. Der Leichnam auf dem Seziertisch hat keine Hoffnung auf Wiederkehr – weder in dieser Welt noch in der nächsten.
Byron ist Atheist und glaubt nicht an ein Leben nach dem Tod. Wir werden von uns selbst heimgesucht, sagt er, und das sollte jedem genug sein.
Claire sagte nichts, weil sie nichts zu sagen hat.
Der Diener brachte uns Wein. Es ist eine Erleichterung, eine Flüssigkeit vor sich zu haben, die kein Wasser ist.
Wir sind wie Ertrunkene, sagte Shelley.
Wir tranken den Wein. Die Schatten malten Welten an die Wände.
Das hier ist unsere Arche, sagte ich. Bloß von Menschen bevölkert, schwimmend, darauf wartend, dass die Wasser zurückweichen.
Was meinst du, worüber sie auf der Arche geredet haben?, fragte Byron. Zusammengepfercht im heißen Gestank der Tiere? Glaubten sie, die gesamte Erde stecke in einer wässrigen Hülle, wie der Fötus im Mutterleib?
Polidori unterbrach ihn aufgeregt (er liebt aufgeregte Unterbrechungen). An der Universität hatten wir eine ganze Reihe genau solcher Föten, in verschiedenen Stadien der Entwicklung, alles Abtreibungen; Finger und Zehen gegen das Unvermeidliche eingezogen, die Augen gegen das Licht geschlossen, das sie nie sehen sollten.
Sie sehen das Licht, sagte ich, die Haut der Mutter, die sich über das heranwachsende Kind spannt, lässt Licht durch. Sie wenden sich freudig der Sonne zu.
Shelley lächelte mich an. Als ich mit William schwanger war, kniete er oft vor mir, wenn ich auf der Bettkante saß, und umfing meinen Bauch mit den Händen wie ein seltenes Buch, das er noch nicht gelesen hatte.
Das hier ist die Welt in klein, sagte er. Und an jenem Morgen, oh, ich erinnere mich, saßen wir nebeneinander in der Sonne, und ich spürte die freudigen Tritte meines Babys.
Aber Polidori ist Arzt, nicht Mutter. Er sieht die Dinge anders.
Ich wollte sagen, fuhr er fort, ein wenig pikiert über die Unterbrechung (was notorische Unterbrecher oft sind). Ich wollte sagen, dass der Augenblick des Bewusstwerdens ein Mysterium ist, ganz gleich, ob es eine Seele gibt oder nicht. Wo ist das Bewusstsein im Mutterleib?
Männliche Kinder erlangen diesen Zustand früher als weibliche, sagte Byron. Ich fragte ihn, was ihn zu dieser Ansicht brächte. Er antwortete: Das männliche Prinzip ist bereiter und aktiver als das weibliche. Das können wir im Leben beobachten.
Dort können wir beobachten, dass Männer Frauen unterdrücken, entgegnete ich.
Ich habe schließlich selbst eine Tochter, gab Byron zurück. Sie ist fügsam und passiv.
Ada ist erst sechs Monate alt! Und du hast sie seit kurz nach ihrer Geburt kein einziges Mal gesehen! Welches Kind, ganz gleich ob männlich oder weiblich, tut kurz nach der Geburt etwas anderes als schlafen und trinken? Das hat nichts mit Geschlecht zu tun, sondern mit Biologie!
Ah. Ich dachte, sie würde ein glorreicher Junge werden. Aber wenn ich schon eine Tochter zeugen muss, vertraue ich zumindest darauf, dass sie sich gut verheiraten wird.
Gibt es im Leben denn nicht mehr als Heirat?, fragte ich.
Für eine Frau? Keineswegs. Für einen Mann gehört die Liebe zum Leben, als etwas Gesondertes. Für eine Frau ist sie die Existenz.
Meine Mutter, Mary Wollstonecraft, würde dir widersprechen, sagte ich.
Und doch hat sie versucht, sich aus Liebe umzubringen.
Gilbert Imlay. Ein Charmeur. Ein Opportunist. Ein auf seinen Vorteil bedachter, berechnender und in seinem Verhalten berechenbarer Mann (wieso ist das so oft der Fall?). Meine Mutter sprang in London von einer Brücke, wobei ihre Röcke einen Fallschirm für ihren herabstürzenden Körper bildeten. Sie starb nicht. Nein, sie starb nicht.
Das kam erst später. Als sie mich zur Welt brachte.
Shelley sah meinen Schmerz und mein Unbehagen. Als ich das Buch deiner Mutter las, sagte er, den Blick auf Byron, nicht auf mich gerichtet, hat sie mich überzeugt.
Dafür liebte ich ihn – damals und jetzt –, zum ersten Mal sagte er es zu mir, als ich ein sechzehnjähriges Mädchen war, die stolze Tochter von Mary Wollstonecraft und William Godwin.
Mary Wollstonecraft: Eine Verteidigung der Rechte der Frau. 1792.
Das Werk deiner Mutter, sagte Shelley, zurückhaltend und überzeugt auf die ihm eigene Art, ist bemerkenswert.
Ich wäre froh, ich könnte etwas tun, sagte ich, um mich ihrer würdig zu erweisen.
Wie kommt es, dass wir immer Zeichen hinterlassen wollen?, fragte Byron. Aus Eitelkeit?
Nein, sagte ich. Aus Hoffnung. Der Hoffnung, dass es eines Tages eine gerechte Gesellschaft geben wird.
Das wird nie geschehen, ließ Polidori verlauten. Nicht, solange nicht jedes menschliche Wesen ausgelöscht wurde und wir ganz von vorn anfangen.
Jedes menschliche Wesen auslöschen, sagte Byron; ja, wieso nicht? Womit wir wieder bei unserer schwimmenden Arche wären. Gott hatte die richtige Idee. Von vorn anfangen.
Aber er rettete acht, sagte Shelley, denn die Welt muss bevölkert sein.
Dann sind wir hier eine Art Halb-Arche, nicht wahr?, bemerkte Byron. Wir vier in unserer Wasserwelt.
Fünf, sagte Claire.
Oh, ich vergaß, sagte Byron.
Es wird in England eine Revolution geben, sagte Shelley, so wie in Amerika und in Frankreich, und dann werden wir von vorn anfangen.
Und wie wollen wir verhindern, was auf Revolutionen folgt? Wir selbst waren doch zu unseren Lebzeiten Zeugen des französischen Problems. Erst die Schreckensherrschaft, in der jeder seinen Nachbarn ausspionierte. Dann der Tyrann. Napoleon Bonaparte – ist er einem König vorzuziehen?
Die Französische Revolution hat den einfachen Menschen nichts eingebracht, sagte Shelley – daher hoffen sie auf einen starken Mann, der den Anspruch erhebt, ihnen zu geben, was sie nicht haben. Niemand kann frei sein, solange er nichts zu essen hat.
Glaubst du etwa, wenn alle Menschen genug Geld hätten, genug Arbeit, genug Muße, genug Bildung, wenn sie nicht von denen über ihnen unterdrückt würden oder vor denen unter ihnen Angst hätten, wäre die Menschheit perfekt? Byron stellte diese Frage in seinem negativen, schleppenden Tonfall, sich unserer Reaktion sicher. Daher machte ich mich daran, ihn zu verstimmen.
Ich schon!, sagte ich.
Ich nicht!, erwiderte Byron. Die menschliche Rasse sucht den eigenen Tod. Wir hasten auf das zu, was wir am meisten fürchten.
Ich schüttelte den Kopf, bewegte mich in dieser unserer Arche auf sicherem Boden. Es sind die Männer, die den Tod suchen, sagte ich. Wenn auch nur einer von euch neun Monate lang Leben in sich tragen würde, nur um zu sehen, wie dieses Kind als Baby oder Kleinkind stirbt oder durch Hunger, Krankheit und später Krieg zugrunde geht, würdet ihr den Tod nicht auf die gleiche Weise suchen, wie ihr es tut.
Und doch ist der Tod heroisch, sagte Byron. Und das Leben ist es nicht.
Ich habe gehört, unterbrach Polidori, ich habe gehört, dass manche von uns nicht sterben, sondern ein Leben nach dem anderen leben, vom Blut anderer. Kürzlich hat man in Albanien ein Grab geöffnet, und obwohl der Leichnam hundert Jahre alt war, einhundert Jahre (er legte eine Pause ein, damit wir darüber staunen konnten), war er perfekt erhalten, mit frischem Blut im Mundwinkel.
Schreib die Geschichte nieder, sagte Byron, stand auf und schenkte aus dem Krug Wein nach. Sein Hinken ist bei Feuchtigkeit ausgeprägter. Sein fein geschnittenes Gesicht wirkte lebhaft. Ich habe eine Idee, sagte er. Wenn wir schon hier eingepfercht sind wie die Bewohner einer Arche, lasst uns doch alle eine Geschichte schreiben, die das Übernatürliche zum Thema hat. Deine, Polidori, soll von den Untoten handeln. Shelley! Du glaubst an Geister …
Mein Mann nickte – ich habe welche gesehen, das ja. Aber was ist beängstigender? Ein Besuch der Toten oder der Untoten?
Mary? Was sagst du? (Byron lächelte mich an.)
Was ich sage?
Aber die Herren schenkten bereits mehr Wein nach.
Was ich sage? (Zu mir selbst sage ich …) Ich habe meine Mutter nicht gekannt. Sie starb kurz nach meiner Geburt, und ihr Verlust war so absolut, dass ich ihn nicht fühlte. Es war kein Verlust außerhalb von mir – so wie wenn man jemanden verliert, den man kennt. Dann geht es um zwei Personen. Eine, die man selbst ist, und eine, die nicht man selbst ist. Aber bei der Geburt gibt es kein man selbst/nicht man selbst. Der Verlust war in meinem Inneren, so wie ich in ihrem Inneren gewesen war. Ich verlor etwas von mir selbst.
Mein Vater tat sein Bestes, um für das mutterlose Kind zu sorgen, das ich war. Und er tat das, indem er meinen Geist mit allem überhäufte, was er meinem Herzen nicht geben konnte. Er ist kein kalter Mann; er ist ein Mann.
Trotz all ihrer Brillanz war meine Mutter der Herd seines Herzens. Sie war der Ort, an dem die Flammen sein Gesicht wärmten. Sie legte die Leidenschaft und das einer Frau so natürliche Mitempfinden nie ab, und er erzählte mir viele Male, wenn er der Welt müde gewesen sei, seien ihre Arme, die ihn umfingen, besser gewesen als jedes Buch, das je geschrieben wurde. Das glaube ich ebenso inbrünstig, wie ich an Bücher glaube, die noch geschrieben werden müssen, und ich verwehre mich dagegen, zwischen Verstand und Herz wählen zu müssen.
Mein Mann empfindet ähnlich. Byron dagegen ist der Meinung, dass die Frau aus dem Manne geboren wurde – aus seiner Rippe, aus dem Erdenkloß, aus dem er gemacht ist – und ich finde das verwunderlich bei einem so intelligenten Mann wie ihm. Ich frage ihn: Findest du es nicht merkwürdig, dass du die Schöpfungsgeschichte akzeptierst, die wir aus der Bibel kennen, obwohl du nicht an Gott glaubst? Er lächelt, zuckt mit den Schultern und erklärt, sie sei eine Metapher für die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, und wendet sich in der Annahme ab, dass ich verstanden hätte und dies das Ende der Angelegenheit sei. Aber ich beharre und rufe ihn, der wie ein griechischer Gott davonhinkt, zurück. Sollten wir an dieser Stelle nicht Doktor Polidori konsultieren, der als Arzt wissen muss, dass seit der Schöpfungsgeschichte kein lebender Mann etwas Lebendes zur Welt gebracht hat? Ihr, meine Herren, seid es, die aus uns gemacht sind.
Die Herren lachten nachsichtig über mich. Sie respektieren mich, bis zu einem gewissen Punkt. Nun sind wir an diesem Punkt angelangt.
Wir sprechen über das Prinzip des Lebens, sagte Byron, langsam und geduldig, als spreche er zu einem Kind. Nicht von Lehm, nicht vom Bett, nicht vom Behältnis. Vom Lebensfunken. Der Lebensfunke ist männlich.
Ganz meine Meinung!, sagte Polidori, und wenn zwei Herren einer Meinung sind, muss das jeder Frau als Ende der Angelegenheit genügen.
Dennoch wünschte ich, ich hätte eine Katze.
Vermicelli, sagte Shelley später, als er mit mir im Bett lag. Jemand hat eine Fadennudel zum Leben erweckt. Bist du jetzt neidisch?
Ich streichelte seine langen, dünnen Arme, legte meine Beine über seine langen, dünnen Beine. Er meinte Doktor Erasmus Darwin, der, wie es scheint, Anzeichen einer willkürlichen Bewegung einer Fadennudel wahrgenommen hat.
Du willst mich auf den Arm nehmen, sagte ich – ein zweizinkiger Zweibeiner, der hier am Zusammentreffen von Stamm und Gabelung eine gewisse unwillkürliche Regung an den Tag zu legen scheint.
Was ist das bloß?, fragte er weich und küsste meinen Kopf. Ich kenne seine Stimme, wenn sie beginnt, auf diese Weise zu brechen.
Dein Schwanz, sagte ich, die Hand daraufgelegt, als er zu Leben erwachte.
Das hier ist besser als Galvanismus, sagte er. Und ich wünschte, er hätte es nicht getan, weil ich dadurch abgelenkt wurde und an Galvani und seine Elektroden und seine hüpfenden Frösche denken musste.
Wieso hörst du auf?, fragte mein Mann.
Wie hieß er noch mal? Galvanis Neffe? Der mit dem Buch, das du zu Hause hast?
Shelley seufzte. Dabei ist er ein überaus geduldiger Mann: Bericht über die jüngsten Verbesserungen auf dem Gebiet des Galvanismus, einschließlich einer Reihe eigenartiger und interessanter Experimente, durchgeführt vor den Kommissaren des Französischen Institut National, kürzlich in Londoner Anatomischen Theatern wiederholt. Angefügt ein Anhang mit den Experimenten des Verfassers, vorgenommen am Leichnam eines in Newgate hingerichteten Missetäters …1803.
Ja, den meine ich, sagte ich und nahm meine Aktivitäten wieder auf, obwohl meine Glut nach oben in mein Hirn gestiegen war.
Mit einer zarten Bewegung rollte Shelley mich auf den Rücken und drang sanft in mich ein; ein Vergnügen, gegen das ich keine Einwände erhob.
Wir können, sagte er, alles menschliche Leben ganz wie wir wollen aus unseren Körpern und unserer Liebe erschaffen. Was sollen wir mit Fröschen und Fadennudeln? Mit grimassierenden, zuckenden Leichen und elektrischen Strömungen?
Hieß es in dem Buch nicht, dass sich seine Augen öffneten? Die des Kriminellen?
Mein Mann schloss seine Augen, spannte die Muskeln an und verspritzte seine Halbwelten, damit sie sich mit den meinen vereinen konnten, und ich drehte den Kopf und sah aus dem Fenster, wo der Mond wie eine Lampe an einem vergänglich klaren Himmel hing.
Was ist dein Stoff? Woraus bestehst du,
Dass Scharen fremder Schatten dich umschweben?
Sonett 54, sagte Shelley.
53, erwiderte ich.
Er war erschöpft. Wir lagen da und blickten aus dem Fenster auf die dahinjagenden Wolken, die am Mond vorbeirasten.
Du einzelner kannst jeden Schatten geben.
Der Körper des Geliebten der Welt aufgeprägt. Die Welt dem Körper des Geliebten aufgeprägt.
Auf der anderen Seite der Wand die Geräusche Lord Byrons, der Claire Clairmont aufspießte.
Was für eine Nacht aus Mond und Sternen. Der Regen hatte uns dieser Anblicke beraubt, und nun schienen sie umso wundervoller. Das Licht fiel auf Shelleys Gesicht. Wie blass er ist!
Glaubst du an Geister?, fragte ich ihn. Wirklich?
Ja, antwortete er, denn wie könnte der Körper Herr über den Geist sein? Unser Mut, unsere Heldenhaftigkeit, selbst unser Hass, alles, was wir tun, um die Welt zu formen – ist das der Körper oder der Geist? Es ist der Geist.
Ich dachte darüber nach und antwortete: Wenn es einem Menschen je gelänge, einen Toten wiederzubeleben, durch Galvanismus oder sonst eine bislang noch unentdeckte Methode, würde der Geist dann zurückkehren?
Das glaube ich nicht, meinte Shelley. Der Körper scheidet dahin und verfällt. Aber der Körper ist nicht die Wahrheit dessen, was wir sind. Der Geist würde nicht in ein ruiniertes Haus zurückkehren.
Wie sollte ich dich lieben, mein wundervoller Mann, hättest du keinen Körper?
Ist es denn mein Körper, den du liebst?
Und wie könnte ich ihm sagen, dass ich dasitze und ihn beobachte, wenn er schläft, wenn sein Geist ruht und seine Lippen stumm sind, und dass ich ihn wegen des Körpers küsse, den ich liebe?
Ich kann dich nicht aufteilen, sagte ich.
Er schlang seine langen Arme um mich und wiegte mich in unserem klammen Bett. Wenn mein Körper dahinscheidet, sagte er, würde ich, wenn ich könnte, meinen Geist in einen Felsen, einen Bach oder eine Wolke versetzen. Mein Geist ist unsterblich – das fühle ich.
Deine Gedichte, sagte ich. Sie sind unsterblich.
Vielleicht, antwortete er. Aber noch etwas anderes. Wie könnte ich sterben? Das ist unmöglich. Und doch werde ich sterben.
Wie warm er sich in meinen Armen anfühlt. Wie weit entfernt vom Tod.
Hast du dir schon eine Geschichte ausgedacht?, fragte er.
Nichts kommt, wenn es gerufen wird. Und mir fehlt die Vorstellungskraft.
Tote oder Untote? Geist oder Vampir? Wofür wirst du dich entscheiden?
Was würde dich am meisten ängstigen?
Er dachte einen Augenblick darüber nach und stützte sich auf einen Ellbogen, um mich anzusehen, sein Gesicht meinem so nah, dass ich ihn einatmen konnte. Ein Geist, so grauenhaft oder grässlich seine Erscheinung auch sein mag, so beängstigend seine Äußerungen, würde mir Ehrfurcht einflößen, mich aber nicht entsetzen, denn er hat einst gelebt, so wie ich, und ist in den Geist übergegangen, so wie ich es tun werde, und seine körperliche Substanz existiert nicht mehr. Ein Vampir dagegen ist etwas Unreines, ein Ding, das seinen verrottenden Körper von den lebenden Körpern anderer nährt. Sein Fleisch ist kälter als der Tod, und er kennt kein Mitleid, nur Gier.
Dann also die Untoten, sagte ich, und während ich mit offenen Augen dalag und nachdachte, schlief er ein.
Unser erstes Kind starb kurz nach der Geburt. Kalt und winzig hielt ich meinen kleinen Sohn in den Armen. Kurz darauf träumte ich, er sei nicht tot, und wir hätten ihn mit Brandy abgerieben und vor den Kamin gelegt, und er sei ins Leben zurückgekehrt.
Ich wollte seinen kleinen Körper berühren. Ich hätte ihm mein eigenes Blut gegeben, um ihn ins Leben zurückzuholen; er war von meinem Blut gewesen, ein Vampir, der sich neun dunkle Monate in seinem Versteck nährte. Die Toten. Die Untoten. Ach, ich bin an den Tod gewöhnt, und ich hasse ihn.
Ich stand auf, zu unruhig, um schlafen zu können, deckte meinen Mann zu, hüllte mich in ein Tuch, trat ans Fenster und blickte auf die dunklen Schatten der Hügel und den glitzernden See.
Vielleicht würde es morgen schön werden.
Mein Vater schickte mich eine Weile weg, um bei einer Cousine in Dundee zu leben, deren Gesellschaft, wie er hoffte, meiner Einsamkeit abhelfen würde. Aber in mir steckt etwas von einem Leuchtturmwärter, und ich habe keine Angst vor dem Alleinsein, auch nicht vor der Natur in ihrer Wildheit.
In jenen Tagen stellte ich fest, dass ich mich am glücklichsten fühlte, wenn ich draußen und allein war und mir Geschichten aller Art ausdenken konnte, so weit von meinen tatsächlichen Lebensumständen entfernt wie nur möglich. Ich wurde zu meiner eigenen Leiter und Falltür in andere Welten. Ich war meine eigene Verkleidung. Der Anblick einer fernen Gestalt, die ihrem Ziel zustrebte, reichte aus, um meine Fantasie aufflammen und sich Tragödien oder Wunder ausmalen zu lassen.
Ich langweilte mich nie, außer in Gesellschaft anderer.
Zu Hause erlaubte mir mein Vater, der sich kaum dafür interessierte, was für ein junges, mutterloses Mädchen angemessen war oder nicht, unsichtbar und stumm dabei zu sein, wenn er seine Freunde empfing und sie über Politik, Gerechtigkeit und noch andere Dinge sprachen, die weit darüber hinausgingen.
Der Dichter Coleridge war ein regelmäßiger Besucher unseres Hauses. Eines Abends las er uns sein neues Gedicht vor. Es hieß Ballade vom alten Seemann und beginnt – wie gut ich mich erinnere – mit
Ein Seemann mit grauem Bart
hält einen von drei Gästen an:
Bei deinen funkelnden Augen,
was willst du von mir, Mann?
Ich, noch ein Mädchen, kauerte hinter dem Sofa, begierig darauf, die Geschichte zu hören, die dem Hochzeitsgast erzählt wurde, und mir im Geist jene schreckliche Seereise vorzustellen.
Der Seemann steht unter einem Fluch, weil er den freundlichen Albatros tötete, der dem Schiff in besseren Tagen folgte.
In einer überaus schrecklichen Szene ist das Schiff mit seinen zerschlissenen Segeln und seinem verrottenden Deck bemannt von seinen eigenen Toten, von gefürchteter Macht wiederbelebt, unselig und verstümmelt, während das Schiff auf Schnee und Nebel zuhält.
Er hat dem Leben Gewalt angetan und den Tod gebracht, dachte ich, damals und heute. Aber was ist der Tod? Der leblose Körper? Der zerstörte Geist? Der Verfall der Natur? Der Tod ist natürlich. Verfall unumgänglich. Es gibt kein neues Leben ohne Tod. Es kann keinen Tod geben, solange es kein Leben gibt.
Die Toten. Die Untoten.
Der Mond war inzwischen wieder verhangen. Regenwolken kehrten schnell in den klaren Himmel zurück.
Wenn ein Leichnam ins Leben zurückkehrte, wäre er dann lebendig?
Wenn sich die Türen des Leichenhauses öffneten und wir Toten erwachten … dann …
Meine Gedanken sind fiebrig. Ich weiß heute Abend kaum, wo mir der Sinn steht.
Es geht etwas in meiner Seele vor, was ich nicht verstehe.
Was fürchte ich am meisten? Die Toten, die Untoten, oder, ein noch fremderer Gedanke … das, was nie gelebt hat?
Ich drehte mich um, um ihn, der schlief, zu betrachten. Reglos, aber lebendig. Der schlafende Körper ist ein Trost, obwohl er den Tod nachahmt. Wäre er tot, wie sollte ich leben?
Auch Shelley war ein Besucher unseres Hauses; so lernte ich ihn kennen. Ich war sechzehn, er einundzwanzig. Ein verheirateter Mann.
Es war keine glückliche Ehe. Über seine Frau, Harriet, schrieb er: Ich hatte das Gefühl, als ob man einen toten und einen lebendigen Körper in einer widerlichen Gemeinschaft miteinander verbunden hätte.
In einer Nacht, in der er vierzig Meilen zu Fuß zum Haus seines Vaters ging – in jener Nacht und jener traumartigen Trance glaubte er, er sei bereits der Frau begegnet, die bestimmt war, die meine zu werden.
Nicht lange darauf lernten wir uns kennen.
Wenn meine häuslichen Pflichten erledigt waren, stahl ich mich oft davon und suchte das Grab meiner Mutter auf dem Friedhof von St Pancras auf. Dort widmete ich mich, gegen ihren Grabstein gelehnt, meiner Lektüre. Bald fing Shelley an, mich heimlich zu treffen; und ich glaube, wir besaßen den Segen meiner Mutter, wenn wir zu beiden Seiten ihres Grabes saßen und über Gedichte und Revolution sprachen. Dichter sind die unerkannten Gesetzgeber des Lebens, sagte er.
Ich dachte oft an sie, die in ihrem Sarg unter uns lag. Und ich dachte nie an sie als verwest. Für mich war sie so lebendig, wie sie es in den Bleistiftzeichnungen von ihr ist, und noch lebendiger ist sie in ihren Schriften. Trotzdem wollte ich in der Nähe ihres Körpers sein. Ihres armen Körpers, der ihr nun nicht mehr von Nutzen war. Ich fühlte, und ich bin sicher, auch Shelley fühlte es, dass wir alle drei dort waren, am Grab. Es lag Trost darin, nicht von Gott oder vom Himmel gegeben, sondern weil sie für uns lebendig war.
Ich liebte ihn dafür, dass er sie mir zurückbrachte. Er war weder morbid noch sentimental. Letzte Ruhestätte. Er ist meine Ruhestätte.
Mir war bewusst, dass mein Vater ihre sterblichen Überreste gegen die Grabräuber und -schänder gesichert hatte, die jeden Leichnam stehlen, dessen sie habhaft werden können, um ihn für schnelles Geld zu verkaufen, was durchaus vernünftig ist – welchen Nutzen hat ein Körper, wenn er keinen Nutzen mehr hat?
In Seziersälen in ganz London gibt es Körper von Müttern, Körper von Ehemännern, Körper von Kindern, Körper wie meinen, die wegen ihrer Leber und Milz gestohlen werden, oder um den Schädel zu zertrümmern, die Knochen zu zersägen, die geheimen Meilen der Gedärme zu entwirren.
Die Totheit der Toten, sagte Polidori, ist nicht das, was wir fürchten. Vielmehr fürchten wir, dass sie nicht tot sind, wenn wir sie zur letzten Ruhe betten. Dass sie in Dunkelheit und Luftlosigkeit erwachen und unter Qualen sterben. Ich habe diese Qualen auf den Gesichtern mancher frisch Beerdigter gesehen, die uns zum Sezieren gebracht wurden.
Hast du kein schlechtes Gewissen?, fragte ich. Keine Skrupel?
Hast du kein Interesse an der Zukunft?, fragte er zurück. Das Licht der Wissenschaft brennt an einem blutgetränkten Docht am hellsten.
Der Himmel über mir wurde von zuckendem Licht aufgerissen. Eine Sekunde lang wirkte der elektrisierte Körper eines Mannes hell erleuchtet, dann war es wieder dunkel. Donner über dem See, dann, erneut, das gelbe Zickzack elektrischer Kräfte. Vom Fenster aus sah ich einen mächtigen Schatten umstürzen wie ein gefällter Krieger. Die Wucht des Aufschlags ließ das Fenster erbeben. Ja. Ich sehe es. Ein vom Blitz getroffener Baum.
Dann wieder der Regen, wie eine Million winziger trommelnder Trommler.
Mein Mann rührte sich, wurde aber nicht wach. In der Ferne zuckte das Hotel auf, verlassen, mit leeren Fenstern, weiß, wie ein Palast der Toten.
Dass Scharen fremder Schatten dich umschweben …
Ich muss wieder zu Bett gegangen sein, denn ich erwachte erneut, aufrecht, mit offenen Haaren, die Hände in den Bettvorhang gekrallt.
Ich hatte geträumt. Hatte ich geträumt?
Ich sah den bleichen Jünger einer unseligen Kunst neben dem Ding knien, das er zusammengesetzt hatte. Ich sah das grässliche Trugbild eines Mannes ausgestreckt liegen, und dann, auf die Arbeit einer mächtigen Maschine hin, Lebenszeichen von sich geben und sich mit einer ungelenken, kaum lebensähnlichen Bewegung regen.
Ein solcher Erfolg würde den Künstler entsetzen; er würde, von Grauen gepackt, vor dem abscheulichen Werk seiner Hände fliehen. Er würde hoffen, der winzige Lebensfunke, den er ihm eingegeben hatte, würde, sich selbst überlassen, wieder erlöschen; dass das Ding, das eine derart unvollkommene Belebung erfahren hatte, wieder zu toter Materie zerfiele und er in dem Glauben einschlafen könne, das Schweigen des Grabes würde für immer die vergängliche Existenz des grässlichen Leichnams auslöschen, den er als Wiege des Lebens angesehen hatte. Er schläft, wird dann jedoch geweckt; öffnet die Augen und siehe da, das grässliche Wesen steht neben seinem Bett, schlägt die Vorhänge zurück und betrachtet ihn mit gelben, wässrigen, aber berechnenden Augen.
Erschreckt öffnete ich meine.
Am folgenden Morgen verkündete ich, mir sei eine Geschichte eingefallen.
Erzählung:
Eine Abfolge miteinander verbundener realer
oder fiktiver Ereignisse. Fiktiv oder real.
FIKTIV
UND
REAL
Realität verbiegt sich bei Hitze.
Durch flimmernde Hitze blicke ich auf Gebäude, deren solide Gewissheiten vibrieren wie Klangwellen.
Das Flugzeug landet. Auf einer Anschlagtafel steht:
Willkommen in Memphis, Tennessee.
Ich bin auf dem Weg zur internationalen Robo-Tech-Expo.
Name?
Ry Shelley.
Aussteller? Demonstrator? Käufer?
Presse.
Habe Sie, Mr Shelley.
Dr. Shelley. Wellcome Trust.
Sind Sie Arzt?
Bin ich. Und ich bin hier, um der Frage nachzugehen, welche Auswirkungen Roboter auf unsere psychische und physische Gesundheit haben können.
Gute Frage, Dr. Shelley. Aber lassen Sie uns die Seele nicht vergessen.
Ich bin mir nicht sicher, ob das in mein Fachgebiet f–
Wir alle haben eine Seele. Halleluja. Wen möchten Sie interviewen?
Ron Lord.
(Kurze Pause, während die Datenbank nach Ron Lord sucht.)
Habe ihn. Aussteller Klasse A. Mr Lord erwartet Sie im Raum Zukunft-für-Erwachsene. Hier ein Übersichtsplan. Ich bin übrigens Claire, ich bin heute Ihre Kontaktperson.
Claire ist groß, schwarz, schön und gut gekleidet – maßgeschneiderter dunkelgrüner Rock und hellgrüne Seidenbluse. Ich bin froh, dass sie heute meine Kontaktperson ist.
Sie beschriftet mein Namensschild mit energischer, manikürter Hand. Mit der Hand beschriften – eine eigenartig altmodische und rührende Methode der Identifizierung auf einer futuristischen Tech-Expo.
Entschuldigen Sie, Claire – aber es heißt nicht Ryan, sondern einfach nur Ry.
Tut mir leid, Dr. Shelley. Ich kenne mich mit englischen Namen nicht so gut aus – Sie sind doch Engländer?
Ja, bin ich.
Niedlicher Akzent. (Ich lächle. Sie lächelt.)
Sind Sie das erste Mal in Memphis?
Ja, bin ich.
Mögen Sie B. B. King? Johnny Cash? Den King?
Martin Luther?
Eigentlich meinte ich Elvis, Sir, aber jetzt, wo Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben, fällt mir auf, dass es bei uns anscheinend eine Menge Kings gibt – vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass die Stadt Memphis heißt; wenn man einen Ort nach der ägyptischen Hauptstadt benennt, muss man vermutlich damit rechnen, einen Haufen Pharaonen zu Gesicht zu bekommen, was meinen Sie?
Etwas zu benennen bedeutet Macht, sage ich zu ihr.
Da haben Sie recht. Es war Adams Aufgabe im Garten Eden.
Oh ja. Ein jegliches nach seiner Art zu benennen. Sexbot …
Wie bitte, Sir?
Meinen Sie, Adam wäre daraufgekommen? Hund, Katze, Schlange, Feigenbaum, Sexbot?
Ich bin dankbar, dass er das nicht musste, Dr. Shelley.
Sicher haben Sie recht, Claire. Aber würden Sie mir verraten, wieso diese Stadt Memphis genannt wurde?
Sie meinen damals, 1819? Als sie gegründet wurde?
Während sie spricht, sehe ich vor meinem inneren Auge eine junge Frau, die durch ein regennasses Fenster auf einen See hinausblickt.
Ich sage zu Claire: Ja, 1819. Frankenstein war damals ein Jahr alt.
Sie runzelt die Stirn. Ich kann Ihnen nicht folgen, Sir.
Der Roman. Frankenstein. Er wurde 1818 veröffentlicht.
Über den Typ mit dem Bolzen im Hals?
Mehr oder weniger …
Ich habe die Fernsehserie gesehen.
Aus diesem Grund sind wir heute hier. (Ein verständnisloser Ausdruck auf Claires Gesicht, als ich das sage, also erkläre ich.) Ich meine nicht das existenzielle »Wieso sind wir hier?«. Ich meine, wieso die Tech-Expo hier in Memphis stattfindet. Organisatoren lieben Verbindungen zwischen einer Stadt und einer Idee. Memphis und Frankenstein sind beide zweihundert Jahre alt.
Worauf wollen Sie hinaus?
Technologie. Künstliche Intelligenz. KI. Frankenstein war eine Vision, wie Leben geschaffen werden könnte – die erste nicht menschliche Intelligenz.
Und was ist mit den Engeln? (Claire sieht mich ernst und überzeugt an. Ich zögere … Was meint sie?)
Mit den Engeln?
Richtig. Engel sind nicht menschliche Intelligenz.
Oh, verstehe. Ich meinte, die erste nicht menschliche, von einem Menschen geschaffene Intelligenz.
Ich wurde von einem Engel aufgesucht, Dr. Shelley.
Das ist wundervoll, Claire.
Ich halte nichts davon, dass Menschen Gott spielen.
Verstehe. Ich hoffe, ich bin Ihnen nicht zu nahe getreten, Claire?
Sie schüttelt den Kopf mit den glänzenden Haaren und deutet auf einen Stadtplan. Sie haben gefragt, wieso sie die Stadt damals Memphis nannten. Die Antwort lautet: Weil wir an einem Fluss liegen, dem Mississippi, und das alte Memphis lag am Nil – haben Sie Elizabeth Taylor als Kleopatra gesehen?
Ja, habe ich.
Wussten Sie, dass sie ihren eigenen Schmuck trug? Können Sie sich das vorstellen?
(Ich stelle es mir vor.)
Ja, alles ihr eigener Schmuck, den meisten davon hatte sie von Richard Burton. Er war auch Engländer.
Waliser.
Wo liegt Wales?
In Großbritannien, aber es ist nicht England.
Klingt verwirrend.
Das Vereinigte Königreich: Das Vereinigte Königreich besteht aus England, Schottland, einem Stück Irland und Wales.
Ich verstehe … Okay. Da ich jedoch nicht vorhabe, in absehbarer Zeit hinzufahren, brauche ich mir darüber keine Gedanken zu machen. Aber sehen Sie, hier auf der Karte, hier, wo wir im Augenblick sind? Es ist ein Flussdelta, so wie am Nil rund um das erste Memphis.
Waren Sie schon einmal in Ägypten?
Nein, aber in Vegas. Sehr lebensecht. Sehr ägyptisch.
Ich habe gehört, dass es dort eine animatronische Sphinx gibt?
Stimmt.
Die könnte man als Roboter bezeichnen.
Sie vielleicht. Ich nicht.
Wissen Sie alles über diese Stadt? Über Ihr Memphis?
Ich hoffe es zumindest, Dr. Shelley. Wenn Sie sich für Martin Luther King interessieren, sollten sie das National Civil Rights Museum besuchen. Das Lorraine Motel, wo er erschossen wurde, gehört ebenfalls dazu. Waren Sie schon da?
Nein, noch nicht.
Aber Sie waren schon in Graceland?
Noch nicht.
In der Beale Street? Der Heimat des Memphis Blues?
Noch nicht.
Es scheint eine Menge Noch-Nicht in Ihrem Leben zu geben, Dr. Shelley.
Sie hat recht. Ich befinde mich auf einer Art Schwelle, an einem Wendepunkt, in einem Zwischenstadium, im Aufbruch, unentschlossen, übergangsweise, probehalber. Ein Neustarter (oder Spätzünder?) in meinem eigenen Leben.
Ich sagte: Ein Leben ist nicht genug …
Sie nickte. Hm! Wie wahr. Und es ist wahr. Aber nicht verzweifeln. Im Jenseits ist das Leben endlos.
Claire blickt in eine mittlere Ferne, ein Leuchten der Gewissheit in den Augen, und fragt, ob ich vielleicht Lust hätte, am Sonntag mit ihr in die Kirche zu gehen. Eine richtige Kirche, sagt sie, keine auf Schön getrimmte für Weiße.
Ein Piepen in ihrem Kopfhörer kündigt eine verknisterte Mitteilung an, die ich nicht verstehen kann. Claire wendet sich von mir ab, um über Lautsprecher eine Durchsage zu machen.
Meine Gedanken beschäftigen sich beiläufig mit dem Unterschied zwischen dem Wunsch nach einem Leben ohne Ende und dem Wunsch nach mehr als einem Leben, beziehungsweise nach mehr als einem, aber simultan gelebten Leben.