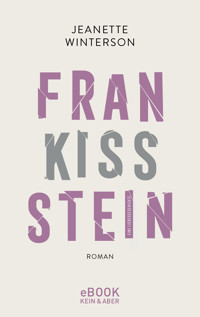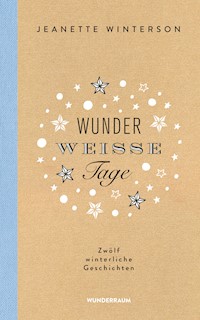
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wunderraum
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Weihnachtszeit und die Tage »zwischen den Jahren« sind eine Zeit des Zusammenkommens, eine Zeit des Feierns, Schenkens und Teilens. Und was eignet sich dafür besser als eine gute Geschichte? Jeanette Wintersons Winter- und Weihnachtsgeschichten laden dazu ein, am Kamin gelesen zu werden, zusammen oder allein, im Schnee oder auf dem Weg nach Hause. Sie wollen mit Freunden geteilt oder, hübsch verpackt, an einen geliebten Menschen verschenkt werden. Zu jeder der zwölf Geschichten hat die Autorin ein Rezept ausgewählt, mit dem sie Anekdoten undlieb gewonnene kulinarische Traditionen an ihre Leser weitergibt.
Weitere berührende Wunderraum-Geschichten finden Sie in unserem kostenlosen aktuellen Leseproben-E-Book »Einkuscheln und loslesen – Bücher für kurze Tage und lange Nächte«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Die Weihnachtszeit und die Tage »zwischen den Jahren« sind eine Zeit des Zusammenkommens, eine Zeit des Feierns, Schenkens und Teilens. Und was eignet sich dafür besser als eine gute Geschichte? Jeanette Wintersons Winter- und Weihnachtsgeschichten laden dazu ein, am Kamin gelesen zu werden, zusammen oder allein, im Schnee oder auf dem Weg nach Hause. Sie wollen mit Freunden geteilt oder, hübsch verpackt, an einen geliebten Menschen verschenkt werden. Und weil ein Festessen mit Freunden für Winterson zum Schönsten gehört, was die Feiertage zu bieten haben, hat sie zu jeder der zwölf Geschichten ein Rezept ausgewählt, das für sie mit persönlichen Erinnerungen verbunden ist.
Zwölf winterliche Geschichten
Aus dem Englischen übersetzt vonRegina Rawlinson
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »Christmas Days. 12 Stories and 12 Feasts for 12 Days« bei Jonathan Cape, an imprint of Vintage Publishing, part of the Penguin Random House group.
Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Wunderraum-Bücher erscheinen im
Wilhelm Goldmann Verlag, München,
einem Unternehmen der Random House GmbH.
Copyright © der Originalausgabe
2016 by Jeanette Winterson
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung und Konzeption: buxdesign | München
Unter Verwendung von Motiven und Illustrationen von Carla Nagel
Redaktion: Ute Rupprecht
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-20464-8V003
www.wunderraum-verlag.de
Den geliebten Menschen in meinem Leben, die tatsächlich kochen können.
Für meine Frau Susie Orbach und meine Freundinnen
Beeban Kidron und Nigella Lawson.
Es geht doch nichts über ein jüdisches Weihnachtsfest.
Inhalt
Weihnachtszeit
Der Geist der Weihnacht
Mrs Wintersons Mince Pies
Die SchneeMama
Ruth Rendells Rotkohl
Dunkle Weihnacht
Kathy Ackers New Yorker Custard
Weihnachten in New York
Mein Heiligabend-Räucherlachs mit Champagner
Die Mistelbraut
Susies Graved Lachs für Heiligabend
O’Briens erstes Weihnachtsfest
Dads Sherry Trifle
Das zweitbeste Bett
Chinesische Teigtaschen von Shakespeare and Company
Das Weihnachtsknallbonbon
Mein Glühwein
Eine Gespenstergeschichte
Kamila Shamsies Truthahn-Biryani
Der silberne Frosch
Meine Silvester-Käsekräcker
Der Löwe, das Einhorn und ich
Mein Neujahrs-Steaksandwich
Das Leuchtherz
Meine Dreikönigs-Fischfrikadellen
Weihnachtsgrüße der Autorin
Danksagung
Zitatnachweise
Weihnachtszeit
Drei weise Männer ziehen durch die Wüste, sie folgen einem Stern. Des Nachts auf den Feldern die Hirten mit ihren Herden. Ein Engel, flink wie ein Gedanke und hell wie die Hoffnung, der die Ewigkeit in Zeit verwandelt.
Schnell! Ein Kind wird geboren!
Diese Geschichte kennen Gläubige wie Nichtgläubige.
Wer kennt sie nicht?
Eine Herberge. Ein Stall. Ein Esel. Maria. Josef. Gold. Weihrauch. Myrrhe.
Und im Herzen der Geschichte Mutter und Kind.
Bis zur Reformation im 16. Jahrhundert war die Madonna mit Kind ein Bild, das die Menschen in Europa tagtäglich zu sehen bekamen, ob auf Kirchenfenstern, als Statue, Ölgemälde, Schnitzerei oder im häuslichen Herrgottswinkel.
Man stelle sich vor: Die meisten Menschen können weder lesen noch schreiben, doch ihre Gedanken sind voll von Geschichten und Bildern. Bilder sind mehr als die Illustration einer Geschichte – sie sind die Geschichte.
Wenn wir heutzutage eine alte Kirche in Italien, Frankreich oder Spanien besuchen, können wir weder die zahllosen Decken- und Wandfresken noch die gerahmten Gemälde deuten. Unsere Vorfahren konnten das. Wir blättern in unseren Reiseführern, weil wir von ihnen Auskunft erhoffen, sie legten den Kopf in den Nacken und erblickten das Geheimnis der Welt.
Ich liebe das geschriebene Wort – in diesem Augenblick schreibe ich es, lese es –, aber in einer analphabetischen Gesellschaft, die kulturell lebendig ist, sind das Bild und das gesprochene oder gesungene Wort alles. Es ist eine andere Ausprägung geistiger Vitalität.
Mit dem Aufkommen des Protestantismus wurde Maria, die bis dahin wie der vierte Teil der Gottheit behandelt worden war, degradiert. Die Reformation bedeutete für Frauen sowieso nichts Gutes; überall in Europa kündigten sich bereits die Hexenverbrennungen an, und natürlich waren auch die Pilgerväter, die 1620 am Plymouth Rock an Land gingen, Puritaner der allerstrengsten Sorte – man denke nur an die Hexenprozesse von Salem in den 1690er Jahren.
1659 untersagten die Puritaner in Neuengland das Feiern des Weihnachtsfests, ein Gesetz, das bis 1681 galt. In England unter Cromwell wurde Weihnachten schon 1647 verboten, ein Verbot, das erst 1660 wieder aufgehoben wurde.
Warum? Das Fest war, wie wir später noch sehen werden, zu heidnisch in seinen Ursprüngen, zu ausgelassen, zu freudig (warum froh statt einfach nur kreuzunglücklich?). Und es war zu gefährlich, Maria wieder aus der Küche zu lassen und ihr die Hauptrolle zurückzugeben.
Was den einfachen Menschen nach dem Bruch mit dem Katholizismus am meisten fehlte, war die Verehrung Marias.
Bis heute entfaltet der Marienkult – das Mysterium der Jungfrauengeburt, die Einheit von Mutter und Kind – in den katholischen Ländern Europas und auch im heutigen Lateinamerika eine enorme Wirkungskraft. Jedes Mal wenn eine Frau ein Kind zur Welt bringt, wird die Erinnerung an das Heiligste aller Ereignisse wach. Dieses Bild vereint das Alltägliche mit dem Religiösen.
Und es ist älter als das Christentum.
Beim Blick in die griechische und römische Geschichte sehen wir, dass sowohl die Götter als auch die sterblichen Sagengestalten in der Regel ein göttliches und ein menschliches Elternteil besaßen. Herkules’ Vater war Zeus, der auch die schöne Helena zeugte. Es gab immer Streit um sie, aber bei einer schönen Frau, die etwas Göttliches an sich hat, kennt man das nicht anders.
Romulus und Remus, die Gründer von Rom, behaupteten, Mars sei ihr Vater.
Jesus kam im Römischen Reich zur Welt. Das Neue Testament wurde auf Griechisch verfasst. Die Evangelisten wollten ihren Messias in die Liste der Superhelden mit Götterpapa einreihen.
Doch warum musste Maria eine Jungfrau sein?
Jesus war Jude. Weil im Judentum nicht die väterliche, sondern die mütterliche Abstammungslinie entscheidend ist, stehen Reinheit und sexuelle Enthaltsamkeit der Frau erwartungsgemäß hoch im Kurs, sind sie doch die beste Methode, um zu steuern, wer wer ist.
Wenn Maria Jungfrau ist, kann an Jesu göttlicher Abstammung kein Zweifel bestehen.
So weit, so sinnvoll, doch das ist längst nicht alles. Blicken wir nämlich noch weiter hinter diese Geschichte zurück, stoßen wir auf die Macht der Großen Göttin.
In der Antike spielte bei der Verehrung von Göttinnen die Keuschheit als Tugend keine Rolle. Sogar die Vestalinnen durften nach dem Ende ihrer Dienstzeit heiraten. Tempelprostitution war normal, und die Göttin war ein Symbol für Fruchtbarkeit und Fortpflanzung. Aber vor allem gehörte sie nie einem Mann.
Im Marienmythos verbinden sich also auf geniale Weise die Kräfte zweier magnetischer Gegenpole: Die neue Religion, das Christentum, enthält die Geschichte einer göttlichen Geburt, der Menschwerdung eines Gottes. Wie eine Gestalt in einer Heldensage ist Maria etwas Besonderes, eine Auserwählte. Ihre Schwangerschaft ist nicht Folge eines alltäglichen Geschehens innerhalb der Familie – ein Gott ist über sie gekommen.
Gleichzeitig kann die neue Religion Marias Reinheit und ihren Gehorsam nutzen, um sich von den zügellosen heidnischen Sexkulten und Fruchtbarkeitsriten zu distanzieren, die den Juden so verhasst waren.
Vom ersten Tag an hatte das Christentum den Dreh raus, wie es sich zentrale Elemente anderer Religionen und Kulte einverleiben konnte. Es warf die problematischen Elemente über Bord und erzählte die Geschichte einfach neu. Auch das trug zu seiner globalen Erfolgsstory bei.
Und die spektakulärste Erfolgsstory ist Weihnachten.
Die Geburt Jesu kommt nur im Matthäus- und im Lukasevangelium vor, in unterschiedlichen Versionen. Bei Markus und Johannes taucht sie überhaupt nicht auf. Der 25. Dezember wird in der ganzen Bibel nicht erwähnt.
Woher also stammt unser Weihnachten?
Ein Bestandteil sind die römischen Saturnalien, ein typisches Fest zur Wintersonnenwende (der kürzeste Tag des Jahres ist der 21. Dezember). Der heidnische Kaiser Aurelian erklärte den 25. Dezember zum Natalis Solis Invicti – zum Tag der Geburt des unbesiegbaren Sonnengottes. Zu den Feierlichkeiten gehörten Geschenke, Partys, lustige Hüte und Alkohol, brennende Kerzen und lodernde Feuer als Sonnensymbole sowie das Schmücken öffentlicher Straßen und Plätze mit immergrünen Pflanzen. Auf diese Lustbarkeiten folgten schon bald die Kalenden – denen wir das Wort »Kalender« verdanken. In der guten alten Zeit nahm man die Feste eben, wie sie fielen.
Im keltischen Britannien begannen die winterlichen Feste mit dem Totenfest Samhain am heutigen Halloweenabend, am Tag vor Allerheiligen. Wie Germanen und Skandinavier begingen auch die Kelten die Wintersonnenwende mit Freudenfeuern und Vergnügungen. Dieser Zeit, in den nordischen Sprachen Jul oder Jol genannt, verdanken wir die Worte Julfest und Jolly (man denke an den »good fellow«!). Stechpalme und Efeu, Embleme für immerwährendes Leben, wurden nicht nur für dekorative, sondern auch für religiöse Zwecke verwendet.
Bei den germanischen Stämmen zog während der Julzeit der weißbärtige Odin über das Land, den man mit kleinen Gaben, die nachts vor die Tür gelegt wurden, gnädig stimmte.
Die Kirche stellte sich auf den vernünftigen Standpunkt »Der Erfolg heiligt die Mittel« und verleibte Weihnachten all die Elemente ein, an denen die Menschen am meisten hingen – das Singen und Feiern, die immergrünen Pflanzen, das Schenken. Und natürlich die Jahreszeit.
Der 25. Dezember eignete sich wunderbar als Tag von Christi Geburt, weil Jesus demnach am 25. März von Maria empfangen worden sein musste – im Kirchenkalender Mariä Verkündigung, das Fest der Verkündigung des Herrn. So konnte die Kirche am 21. März den Frühlingsbeginn begehen, ohne allzu heidnisch zu werden. Außerdem ergab sich durch Jesu Empfängnis und seine Kreuzigung (Ostern) eine hübsche Symmetrie.
Der Weihnachtsmann ist eine der vielen widersprüchlichen Botschaften des Weihnachtsfestes.
Nikolaus war ein türkischer Bischof in der Stadt Myra, geboren ungefähr zweihundertfünfzig Jahre nach Christi Tod. Er war reich und schenkte den Bedürftigen Geld. Die beste Geschichte über ihn: Als er eines Nachts einen Beutel Gold in ein Haus werfen wollte, war das Fenster zu, und er musste aufs Dach klettern und ihn durch den Schornstein fallen lassen.
Kann sein, kann aber auch nicht sein. Auf jeden Fall entstand um ihn der übliche Heiligenkult, vor allem bei Seeleuten, die ihn auf ihren Fahrten verbreiteten. Auf dem Weg nach Norden vermischte sich der spendable bärtige Türke mit dem bärtigen Gott Odin, der ihm gegenüber allerdings den Vorteil hatte, beim Reisen ein fliegendes Ross benutzen zu können – und auch noch eins mit acht Beinen.
Sankt Nikolaus heißt bei den Holländern Sinterklaas. Und es waren die Holländer, die ihn nach Amerika brachten.
Neu-Amsterdam (Nieuw Amsterdam), das heutige New York City, war eine holländische Siedlung. Allen Bemühungen der Nachfahren puritanischer Neuengländer zum Trotz flog der Weihnachtsmann bereits 1809 in Diedrich Knickerbockers humoristischer Geschichte der Stadt New York von Washington Irving in einem Wagen über die Baumwipfel.
1822 verhalf ihm dann ein weiterer Amerikaner, Clement Moore, mit seinem Gedicht »A Visit from St Nicholas / Als der Nikolaus kam« endgültig zum Durchbruch. Die berühmten ersten Zeilen – hier in der Übersetzung von Erich Kästner – kennt jeder: »In der Nacht vor dem Christfest, da regte im Haus / sich niemand und nichts, nicht mal eine Maus.«
Von da an besaß der Weihnachtsmann auch Rentiere.
Aber noch trug er Grün – seine Farbe als vorchristlicher Fruchtbarkeitsgott.
Und nun kommt Coca-Cola ins Spiel.
1931 beauftragte die Coca-Cola-Company den Grafiker Haddon Sundblom damit, dem Weihnachtsmann eine Verschönerungskur zu verpassen. Und zwar in Rot, das musste sein. Seitdem kennt man ihn im roten Kostüm, der Werbepower von Coca-Cola sei Dank.
Der Weihnachtsbaum ist ein uraltes Symbol dafür, dass das Leben auch im tiefen Winter weitergeht. Was dachten unsere Vorfahren, wenn sie durch einen finsteren, kahlen Laubwald stapften und plötzlich auf einen immergrünen Baum stießen?
Eine wie das erste moderne Promifoto anmutende Abbildung zeigt Königin Viktoria und Prinz Albert, wie sie 1848 auf Schloss Windsor vor ihrem Weihnachtsbaum posieren.
Tatsächlich handelt es sich aber um einen Holzschnitt aus der Illustrated London News. Nach dem Erscheinen des Bildes wollte plötzlich jeder einen Weihnachtsbaum haben.
Prinz Albert war Deutscher, und die ersten schriftlichen Belege dafür, dass zur Wintersonnenwende ein Baum ins Haus geholt wurde, stammen aus dem Schwarzwald.
Vom Reformator Martin Luther erzählt man sich, er habe seinen Weihnachtsbaum mit Kerzen geschmückt, welche die Abermillionen Sterne an Gottes Himmel repräsentierten.
Bäume gelten ohnehin als heilig. Man denke an den Apfelbaum im Garten Eden, die Weltesche Yggdrasil aus der nordischen und germanischen Mythologie oder die Druideneiche. In James Camerons Avatar ist die Göttin ein Baum, und in den Tolkien-Sagas werden die Ents – Bäume, die gehen und sprechen können – von Saruman und den Orks, Feinden des heiligen Waldes, brutal niedergehackt.
Christus stirbt wie andere geopferte Götter an einem Baum.
So überspannt der Baum als Symbol die Jahrhunderte und die Kulturen, wobei der immergrüne Baum für die Macht des Lebens steht.
Bei allem Hass der Puritaner aus Massachusetts auf solche heidnischen Bezüge konnten auch sie nicht verhindern, dass 1851 zwei Schlittenladungen Bäume aus den Catskills nach New York City gebracht wurden – die ersten für den Einzelhandel bestimmten Christbäume der Vereinigten Staaten.
Erst im 19. Jahrhundert wurde Weihnachten zu dem Fest, wie wir es heute feiern: mit Christbaum, Weihnachtskarten, Frieden unter den Menschen, Geschenken, Rotkehlchen, gutem Essen, guten Taten, Schnee und übernatürlichen Erscheinungen – seien es Geister, Visionen oder ein geheimnisvoller Stern.
Im 19. Jahrhundert wurden die beliebtesten Weihnachtslieder geschrieben, das 19. Jahrhundert erfand die Weihnachtskarte.
Henry Cole von der Londoner Post erkannte, dass die Penny Post, die Briefzustellung zum Einheitspreis, eine großartige Methode war, um einfache Grüße zu versenden. 1843 ließ er sich von einem Freund einige Motive zeichnen, und bevor man auch nur Plumpudding sagen konnte, hatte die Weihnachtskarte ihren Siegeszug angetreten.
Bis sich die Weihnachtskarte auch in Amerika durchsetzen konnte, dauerte es allerdings noch mehr als dreißig Jahre. Kann man das den Puritanern in die Schuhe schieben? Ich schon.
Karten, Lieder und das Viktorianischste von allem: die weihnachtliche Gespenstergeschichte.
Die Tradition, sich am Feuer Geschichten zu erzählen, ist so alt wie die Sprache. Ein Feuer braucht man, wenn es dunkel und/oder kalt ist, weshalb sich ein langer Winterabend ideal zum Geschichtenerzählen eignet.
Aber die Gespenstergeschichte ist ebenfalls ein Phänomen des 19. Jahrhunderts. Es gibt die Theorie, dass sich die zahlreichen Berichte jener Zeit von Geistern und Spukgestalten auf eine leichte Kohlenmonoxidvergiftung durch die Gaslampen zurückführen lassen (Kohlenmonoxid kann Übelkeit, Schwindel und Bewusstseinstrübungen hervorrufen). Nimmt man dann noch den dichten Nebel und jede Menge Gin hinzu, rundet sich allmählich das Bild.
Doch das Ganze hat auch eine psychologische Seite. Das 19. Jahrhundert war sich selbst nicht geheuer. Die Industrialisierung schien wahre Höllenkräfte entfesselt zu haben, Besucher Manchesters beschrieben die Stadt als Inferno. Die englische Schriftstellerin Mrs Gaskell schrieb über die Besichtigung einer Baumwollspinnerei: »Ich habe die Hölle gesehen, und sie ist weiß …«
Und die neuen Armen, die Fabriksklaven, die Kellerlochbewohner, die Ausgebeuteten, die Eisen, Hitze, Dreck und Entwürdigung erdulden mussten, wirkten wie Schemen, dünn, gelb, zerlumpt, nicht ganz menschlich, halb tot.
Es ist kein Zufall, dass das 19. Jahrhundert auch das Jahrhundert der Philanthropie und der organisierten Wohltätigkeit war. Genauso wenig kann es verwundern, dass es das »weihnachtlichste« und sentimentalste Weihnachten hervorgebracht hat. Weihnachten wurde zum magischen Kreis: Diejenigen, die von der mechanisierten Verelendung ihrer Mitmenschen am meisten profitierten, konnten Wiedergutmachung leisten und etwas für ihr Seelenheil tun.
Deshalb beginnt die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens damit, dass Scrooge sich weigert, den Armen Geld zu geben: »Ja, gibt es denn nicht genügend Armenhäuser?«
Scrooge, des Weihnachtsmanns eiskaltes Gegenstück, kann und will nichts verschenken. Und dann wird er von drei Geistern heimgesucht und auch noch von dem seines verstorbenen Teilhabers Jacob Marley.
Es ist eine Geschichte von Herzen aus Stein und einer zweiten Chance. Von den Tagen zwischen den Jahren, in denen die normale Ordnung auf den Kopf gestellt ist, in der die Uhren anders gehen und schlagen – ein ganzes Leben geschieht in einer einzigen Nacht. Von einer gebratenen Gans und einem Weihnachtspudding, von Feuer und Kerzen, dampfendem Punsch, einer dicken Schneedecke, unter der die Stadt schläft, und von »Fröhliche Weihnachten allen Menschen … Gott segne uns alle und jedermann!«.
Diese Geschichte hat so viel Kraft, dass ihr nicht einmal die Muppets etwas anhaben können.
In Amerika wurde Weihnachten erst 1870 zum landesweiten Feiertag erklärt – nach dem Bürgerkrieg, um die Nord- und die Südstaaten in einer gemeinsamen Tradition zu vereinen.
Doch trotz aller Bestrebungen der Puritaner und trotz der Tatsache, dass Weihnachten definitiv ein christliches und kein jüdisches Fest ist, haben die Amerikaner und auch die amerikanischen Juden genauso viel zur Weihnachtsfolklore beigetragen wie jeder Stern, Hirte, Weihnachtsmann oder Engel.
»Ist das Leben nicht schön?«, »Das Wunder von Manhattan«, »Meet Me in St. Louis«, »Der Polarexpress«, »Der Grinch«, »Die Glücksritter«, »Die Geister, die ich rief …«, »Kevin – Allein in New York«, »Weiße Weihnachten« – die Liste der Filme wird länger und länger.
Und wenn Sie »White Christmas« singen, »Rudolph the Red-Nosed Reindeer«, »Santa Baby«, »Winter Wonderland« oder »Let it snow«, wenn Sie das Lied vom Kastanienrösten am offenen Kamin vor sich hin summen, dann erheben Sie Ihr Glas auf die jüdischen Komponisten, die uns, ganz nach dem Motto »Man muss die Feste feiern, wie sie fallen«, die Klassiker geschenkt haben, die wir so lieben.
Von den Puritanern in England und Amerika wurde Weihnachten verboten, weil es so ein kunterbuntes Sammelsurium ist, zu dem die halbe Welt etwas beigesteuert hat – Heiden, Römer, Normannen, Kelten, Türken –, ein Fest, das mit seiner Ausgelassenheit und seinem Übermut, dem Schenken und dem Auf-den-Kopf-Stellen der Ordnung die Macht der Obrigkeit und die Zwänge der Arbeit untergräbt. Es war ein Feiertag, ein Holiday – holy day –, ein heiliger Tag der besten Sorte, an dem der Glaube mit Freude einhergeht.
Und das Leben sollte freudig sein.
Ich weiß, dass Weihnachten längst zum zynischen Kommerzzirkus verkommen ist. Dagegen müssen wir uns – jeder für sich und alle gemeinsam – auflehnen. Weihnachten wird auf der ganzen Welt gefeiert, von Menschen aller Religionen wie von Menschen ohne Religion. Man kommt zusammen und lässt die Streitigkeiten ruhen. In heidnischer wie in römischer Zeit war es ein Fest, das die Macht des Lichts und den Rhythmus der Natur als Teil des menschlichen Lebens feierte.
Mit Geld hatte das Ganze nichts zu tun.
Dabei beginnt sogar die Weihnachtsgeschichte mit Geld, genauer gesagt mit Steuern:
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. (LUKAS 2.1)
Und sie endet mit einem Geschenk – »denn uns ist ein Kind geboren«.
Auf die Gabe eines neuen Lebens folgen die Gaben der drei Weisen aus dem Morgenland – Gold, Weihrauch und Myrrhe.
Im beliebtesten aller Weihnachtslieder »In the Bleak Midwinter / Mitten im kalten Winter« stellt die Dichterin Christina Rossetti die Frage, was wir schenken können, das nichts mit Geld, Macht, Erfolg oder Talent zu tun hat:
Was kann ich Ihm geben, ich armer Mann?
Wär ich ein Hirte, schenkt ich ein Lamm;
Wär ich ein Weiser, ich brächt edles Erz;
Doch was gebe ich ihm? Ich geb ihm mein Herz.
Wir schenken uns hin. Wir schenken uns anderen. Wir schenken uns uns selbst. Wir schenken.
Was auch immer wir aus Weihnachten machen, wir sollten es selbst machen und nicht fertig im Laden kaufen.
Weil für mich ein Festessen mit Freunden zum Schönsten gehört, das die Feiertage zu bieten haben, stelle ich hier auch einige Rezepte vor, die mit persönlichen Geschichten verbunden sind. Was Mengenangaben angeht, bin ich ein hoffnungsloser Fall, ich koche nach Augenmaß, Gefühl und Geschmack. Ist der Teig zu trocken, kommt noch Wasser oder Ei hinein. Ist er zu nass, mehr Mehl. So in der Richtung.
Es gab einen Riesenstreit mit meiner Lektorin über die Maßeinheiten. »Nicht mal Nigella Lawson gibt die Zutaten noch in Unzen an«, sagte sie.
Und als ich »Kohl« schrieb, hakte sie sofort nach: »Wie groß soll der sein?«
Es gibt jeden Tag so viel zu erledigen, da will man sich nicht auch noch über die Größe eines Kohlkopfs Gedanken machen.
Bei den Rezepten kann es schon mal ein bisschen durcheinandergehen, genau wie beim gemeinsamen Kochen, wenn mir plötzlich mittendrin einfällt: »Mist, ich hab die Champignons vergessen«, und wir uns dann einfach ohne behelfen. Also, machen Sie sich keinen Kopf. Mit dem Kochen ist es heutzutage wie mit dem Radfahren. Während man sich früher einfach auf seinen Drahtesel schwang und eine Runde drehte, muss heute jeder die richtige Kluft und eine Schutzbrille tragen und ständig seinen eigenen Geschwindigkeits- oder Entfernungsrekord knacken. Kochen für den Eigenbedarf ist keine olympische Disziplin. Es ist ein ganz gewöhnliches Alltagswunder.
Ich koche gern, aber noch lieber schreibe ich.
Ich lebe in Geschichten, sie sind für mich dreidimensionale Orte. Wenn ich als Kind wegen irgendeines Vergehens in den Kohlenkeller gesperrt wurde, hatte ich die Wahl: Ich konnte Kohlen zählen – ein begrenztes Vergnügen – oder mir selbst eine Geschichte erzählen und in die unendliche Welt der Fantasie abtauchen.
Ich schreibe, weil es mir große Freude macht. Es ist wie ein Spiel, wenn ich mich an die Tastatur setze. Gerade Weihnachten hält besondere Freuden bereit, es ist eine Zeit, die uns beflügelt, eine Zeit für Geschichten. Und über allem waltet der Narrenkönig, der Schutzgeist der Kreativität und der zwölf Raunächte bis zum Dreikönigsfest.
So seltsam es auch klingen mag, aber sogar in dem sonst so trostlosen Haus meiner Kindheit und Jugend war Weihnachten eine glückliche Zeit. Solche Assoziationen bleiben uns erhalten; wir tragen die Vergangenheit immer mit uns herum, und mit ein bisschen Glück erfinden wir sie neu. Genau das möchte ich für Weihnachten vorschlagen. Alles ist eine Geschichte.
Geschichten, die man sich am Weihnachtstag vor dem brennenden Kamin oder mit dampfendem Atem auf einem Winterspaziergang erzählt, strahlen das Magische und Mystische aus, das der Zeit zwischen den Jahren innewohnt.
Schreiben ist eine Offenbarung, etwas Unerwartetes wird sichtbar gemacht. Das uns fast bis zum Überdruss vertraute Weihnachten ist eine Feier des Unerwarteten.
Hier sind die Geschichten, die ich bis jetzt geschrieben habe. Zwölf Geschichten für die zwölf Raunächte. Gespenstergeschichten, magisches Eingreifen in die Wirklichkeit, gewöhnliche Begegnungen, die sich als höchst ungewöhnlich entpuppen, kleine Wunder und ein Hoch auf das Licht.
Und auf die Freude.
Der Geist der Weihnacht
In der Nacht vor dem Christfest, da regte im Haus sich niemand und nichts, denn sogar die Maus war fix und fertig.
Überall lagen Geschenke: eckige mit Schleifen, lange mit Bändern, dicke mit Weihnachtsmannpapier. Und schmale – aufregend wie ein Diamantenarmband oder so enttäuschend wie ein Essstäbchen?
Das Lebensmittelarsenal war aufgestockt, als stünde ein Krieg bevor: Weihnachtspuddings, so groß wie Bomben, sprengten fast die Regale. Datteln in runden Pappschachteln lagen dicht an dicht nebeneinander wie Patronen in einem Munitionsgurt. Draußen, über der Hintertür, hingen die Moorhühner in Formation, sie glichen einem Geschwader Spielzeugkampfflugzeuge. Die Kastaniengranaten waren bereitgelegt. Der Biotruthahn strotzte vor Saft und Kraft – jeder gute Tierarzt hätte ihn wieder zum Leben erwecken können – und hielt neben einem Alufolienberg in Regimentsgröße die Stellung.
»Was für ein Glück, dass sich der Schweinebraten für Dreikönig noch in Kent auf der Wiese tummelt und Fallobst frisst«, sagtest du, während du dich unter Verrenkungen am Küchentisch vorbeischobst.
Ich wankte unter der Last des Weihnachtskuchens, eines Monstrums, das sich ganz wunderbar als Eckstein einer mittelalterlichen Kathedrale geeignet hätte. Du nahmst ihn mir ab und brachtest ihn nach draußen. Die ganze Herrlichkeit musste irgendwie im Wagen verstaut werden, weil wir am Abend noch aufs Land fahren wollten. Je mehr du hineinquetschtest, desto wahrscheinlicher schien es, dass für den Truthahn nur noch der Fahrersitz übrig bleiben würde. Du passtest überhaupt nicht mehr hinein, und ich musste mir den Platz mit einem geflochtenen Rentier teilen.
»Hackles«, sagtest du.
O nein, wir hatten den Kater vergessen.
»Hackles feiert Weihnachten nicht«, sagte ich.
»Hier, bind ihm das Bündel Lametta um den Korb und steig ein.«
»Wollen wir unseren Weihnachtskrach jetzt schon vom Zaun brechen oder lieber warten, bis dir auf halber Strecke einfällt, dass du den Wein vergessen hast?«
»Der Wein ist unter der Schachtel mit den Knallbonbons.«
»Das ist nicht der Wein, das ist der Truthahn. Er ist so frisch, dass ich seine Kiste zukleben musste, damit er sich nicht wieder rauswühlt wie in einer Gruselgeschichte von Poe.«
»Das ist eklig. Dieser Truthahn hatte ein glückliches Leben.«
»Du hattest auch kein schlechtes Leben, trotzdem habe ich nicht vor, dich zu essen.«
Ich sprang auf dich zu und biss dich in den Hals. Ich liebe deinen Hals. Du stießt mich weg – spielerisch. Ist es Einbildung, dass du mich in letzter Zeit nicht nur im Spiel wegstößt?
Mit einem leisen Lächeln machtest du dich daran, den Wagen noch einmal neu zu beladen.
Kurz nach Mitternacht. Samt Kater, Lametta, blinkendem Baum, Rentier, Geschenken, Essen und meinem Arm – aus dem Fenster hängend, weil sonst kein Platz für ihn war – fuhren wir los, du und ich, aufs Land, wo wir für die Feiertage ein Häuschen gemietet hatten.
Weihnachtlich angeheitert zogen Feiernde durch die Straßen, Luftschlangen schwenkend und das Lied von ihrem ebenfalls rotnasigen Kumpel Rudolph grölend. Du meintest, so spät in der Nacht kämen wir durchs Stadtzentrum schneller voran. Als du an der Ampel auf der Hauptstraße langsam wieder anfuhrst, war mir, als hätte ich aus den Augenwinkeln eine Bewegung wahrgenommen.
»Halt an!«, sagte ich. »Kannst du mal kurz zurücksetzen?«
Die Straße war mittlerweile menschenleer; mit vor Anstrengung jaulendem Motor ging es rückwärts, bis vor BUYBUYBABY, das größte Kaufhaus der Welt, das seine Tore, wenn auch widerwillig, ab Heiligabend um Mitternacht wahrhaftig für geschlagene vierundzwanzig Stunden geschlossen hatte (wobei der Online-Verkauf selbstverständlich weiterging).
Ich stieg aus. Im Schaufenster stand die Weihnachtskrippe, samt Maria und Josef in Skiklamotten und einigen Nutztieren, die gegen die Kälte schottisch karierte Hundemäntel trugen. Gold, Weihrauch oder Myrrhe gab es nicht, die Heiligen Drei Könige hatten ihre Gaben bei BBB gekauft. Dieser Jesus bekam eine Xbox, ein Fahrrad und ein wohnungstaugliches Schlagzeug.
Seine Mutter Maria durfte sich über ein Dampfbügeleisen freuen.
Im Fenster ein Schatten, die Nase gegen die Scheibe gepresst. Ein kleines Mädchen.
»Was machst du da?«, fragte ich.
»Ich bin eingesperrt«, sagte sie.
Ich ging zurück zum Wagen und klopfte an die Scheibe.
»Da ist ein Kind im Laden vergessen worden – wir müssen es rausholen.«
Du kamst mit, um es dir selbst anzusehen. Das Kind winkte. »Sicher gehört sie zum Wachmann«, meintest du stirnrunzelnd.
»Sie sagt, sie ist eingesperrt! Ruf die Polizei.«
Als du dein Handy rausholtest, lächelte die Kleine und schüttelte den Kopf. Irgendetwas an ihrem Lächeln machte mich unsicher.
»Wer bist du?«, fragte ich sie.
»Ich bin der Geist der Weihnacht.«
Ich hörte sie deutlich. Sie sprach deutlich.
»Ich krieg kein Netz«, sagtest du. »Probier du’s mal mit deinem.«
Mein Handy war tot. Kein Signal. Wir sahen die seltsam verlassene Straße rauf und runter. Allmählich geriet ich in Panik. Ich rüttelte an der Tür und warf mich dagegen. Abgeschlossen. Keine Putzkolonne. Kein Hausmeister. Es war Heiligabend.
Und wieder die Stimme: »Ich bin der Geist der Weihnacht.«
»Ach, komm weiter«, sagtest du. »Das ist doch bloß ein Werbegag.«
Aber ich hörte gar nicht hin, sah nur das Gesicht im Fenster, das sich im Sekundentakt veränderte, als tanzte ein Licht darüber hinweg, das es mal verschattete, mal erhellte. Diese Augen waren nicht die eines Kindes.
»Wir sind für die Kleine verantwortlich«, sagte ich leise, aber eigentlich galt meine Antwort gar nicht dir.
»Sind wir nicht«, gabst du zurück. »Los, komm. Ich rufe die Polizei von unterwegs an.«
»Lasst mich raus!«, sagte das Kind, als wir zum Wagen zurückgehen wollten.
»Wir schicken Hilfe, versprochen. Wir finden eine Telefonzelle …«
Das Kind fiel mir ins Wort. »Ihr müsst mich rauslassen. Und stellt ein paar von euren Geschenken und auch was zu essen da vorne in den Eingang.«
Du drehtest dich um. »Das ist doch verrückt.«
Aber das Kind hatte mich in seinen Bann geschlagen.
»Ja«, sagte ich. Wie in Trance ging ich zum Wagen, machte den Kofferraum auf und schleppte Geschenke und Essenstüten in den Eingang des Kaufhauses. Jedes Mal wenn ich etwas abstellte, hobst du es auf und brachtest es wieder zurück.
»Du bist übergeschnappt«, sagtest du. »Das ist ein Weihnachtsgag. Versteckte Kamera, ich bin mir sicher. Reality-TV.«
»Nein, das ist kein Reality-TV, das ist real.« Meine Stimme schien von weither zukommen. »Es ist nichts, was wir kennen, sondern etwas, was wir nicht kennen – aber es ist wahr. Glaub mir, es ist wahr.«
»Na schön«, sagtest du. »Mach, was du willst. Hauptsache, wir können endlich weiterfahren. Da hast du. Okay? Und da und da.« Damit knalltest du die Sachen vor die Tür, das Gesicht rot vor Müdigkeit und Genervtheit. Eine Miene, die ich nur zu gut kenne.
Die Hände zu Fäusten geballt standest du da, das Kind so gut wie vergessen.
Plötzlich ging das Licht im Schaufenster aus. Und da stand das Kind auch schon zwischen uns auf der Straße.
Ein anderer Ausdruck trat in dein Gesicht. Du legtest die Hand auf die glatte Scheibe, so klar und undurchdringlich wie ein Traum.
»Träumen wir?«, fragtest du mich. »Wie hat sie das gemacht?«
»Ich komm mit euch mit«, sagte die Kleine. »Wo fahrt ihr hin?«
Als wir weiterfuhren, war es schon nach eins. Mein Arm hatte jetzt auch Platz im Auto, und das Kind saß auf dem Rücksitz neben dem schnurrenden Hackles, der aus seinem Korb geklettert war. Ich warf noch einen Blick in den Seitenspiegel, als wir losrollten: Unsere Lebensmittel und Geschenke wurden nach und nach von dunklen Gestalten weggetragen.
»Das sind die Menschen, die in Hauseingängen wohnen«, sagte das Kind, als könnte es meine Gedanken lesen. »Sie haben nichts.«
»Wir werden verhaftet«, sagtest du. »Diebstahl einer Schaufensterdeko. Wildes Müllabladen. Entführung. Fröhliche Weihnachten, Herr Wachtmeister.«
»Wir haben das Richtige getan«, sagte ich.
»Ach ja? Und was genau wäre das?«, sagtest du. »Die Hälfte unserer Sachen in den Wind schießen und ein verloren gegangenes Kind aufgabeln?«
»Es passiert jedes Jahr«, sagte das Kind. »Jedes Jahr auf eine andere Weise, an einem anderen Ort. Wenn ich bis zum Weihnachtsmorgen nicht frei bin, wird die Welt schwerer. Die Welt wiegt schwerer, als ihr wisst.«
Eine Zeit lang sagte keiner ein Wort. Der Himmel war schwarz, mit Sternen besteckt. In Gedanken sah ich mich dort droben, hoch über dieser Straße, wie ich auf den Planeten Erde hinunterblickte: eine blaue Kugel auf schwarzem Grund, weiße Flecken, Eiskappen an den Polen. Unser Leben und unsere Heimat.
Als ich ein Kind war, hat mein Vater mir eine Schneekugel geschenkt, mit der Erde darin und mit Sternen, die man schütteln konnte. Wenn ich im Bett lag, drehte und drehte ich sie, bis ich mit Sternen hinter den Augen einschlief, warm, leicht und geborgen.
Die Welt hat kein Gewicht; schwerelos hängt sie im Weltall, ein Gravitationsrätsel, von der Sonne erwärmt, von Gasen gekühlt. Unser Geschenk.
So lange wie möglich kämpfte ich gegen den Schlaf an, linste schließlich nur noch aus einem zufallenden Auge auf meine stille, sich drehende Welt.
...Ende der Leseprobe