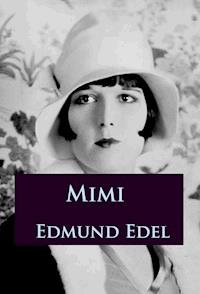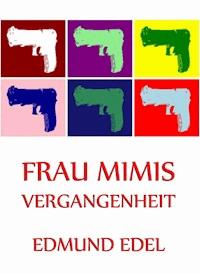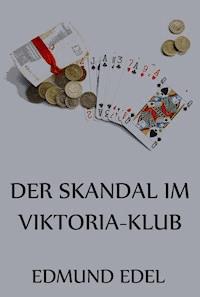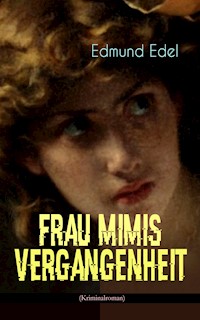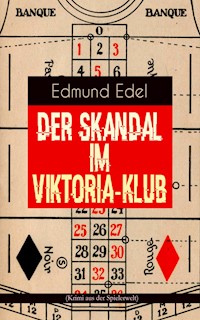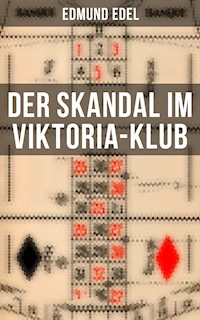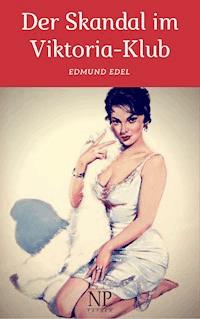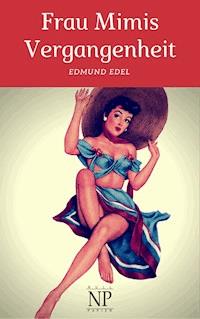
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Krimis bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Ein komischer Boulevard-Krimi aus dem Wilden Berlin der 1910er um einen toten Erbonkel und sein unerwartetes Testament zugunsten einer Nackttänzerin. Fräulein Mimi, ehedem hoffnungsvolle Schauspielerin, jetzt nur noch eine Revuetänzerin, die so manchen Gast mehr als nur ihre schönen Beine vorzeigt, erbt Onkel Ferdinands Vermögen. Klar, dass das den Erbschleichern nicht passt. Denn eigentlich sollte das Erbe an Ferdinands Bruder Adolf oder vielmehr an seinen Neffen Paul fallen, wenn dieser lebendig aus dem Kriege heimkäme. Das Chaos aus Niedertracht und Neid ist vorprogrammiert. Aber Mimi weiß sich zu helfen. Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Edmund Edel
Frau Mimis Vergangenheit
Kriminalroman aus Schieberkreisen
Edmund Edel
Frau Mimis Vergangenheit
Kriminalroman aus Schieberkreisen
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2025Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962810-62-7
null-papier.de/katalog
Inhaltsverzeichnis
Autor
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Siebtes Kapitel.
Achtes Kapitel.
Neuntes Kapitel.
Zehntes Kapitel.
Elftes Kapitel.
Zwölftes Kapitel.
Dreizehntes Kapitel.
Vierzehntes Kapitel.
Fünfzehntes Kapitel.
Sechzehntes Kapitel.
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Krimis bei Null Papier
Der Frauenmörder
Eine Detektivin
Hemmungslos
Der Mann, der zu viel wusste
Noch mehr Detektivgeschichten
Sherlock Holmes – Sammlung
Eine Kriminalgeschichte & Das graue Haus in der Rue Richelieu
Der Doppelmord in der Rue Morgue
Indische Kriminalerzählungen
Kriminalgeschichten
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Autor
Edmund Albert Edel (1863–1934) war ein deutscher Karikaturist, Illustrator, Schriftsteller und Filmregisseur. Er stammte aus einer jüdischen Arztfamilie, die 1864 nach Charlottenburg gezogen war, das damals noch nicht zu Berlin gehörte. Nach einer kaufmännischen Ausbildung versuchte er sich in Paris und München als Künstler. In Paris freundete er sich u. a. mit Toulouse-Lautrec an. Aus dessen Künstlerkreis schöpfte er auch seine Inspirationen zur Plakatmalerei. Über frühe Erfolge als Illustrator und Gebrauchsgrafiker gelangte er Anfang des 20. Jahrhunderts auch zur Schriftstellerei und zum Film. Nach der Machtergreifung der Nazis 1933 fand sich der bis dahin bekannte und geschätzte Künstler und Autor zunehmend antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt. Er starb wenige Monate darauf.
Erstes Kapitel.
Ferdinand Grünmeier lebte zu einer Zeit, da in der Welt noch einigermaßen Ordnung herrschte. Krieg war ein apokrypher Begriff und Revolutionen kannte man nur aus Operetten und aus Zeitungsberichten über südamerikanische Katzbalgereien. Ferdinand war der Erbonkel der Familie. Diese Familie, die der Agent Adolf Grünmeier mit Frau und Sohn darstellte und die ihren Daseinszweck in stramm bürgerlicher Pflicht erfüllte, blickte während zweier Jahrzehnte mit ehrfürchtiger Hochachtung auf den Onkel Ferdinand, den sie mit aller in Familien üblichen Liebe und Sorgfalt umgab. Onkel Ferdinand seinerseits verfügte über nicht so stark ausgeprägten Familiensinn. Er hatte in glücklichen Spekulationen ein ansehnliches Vermögen erworben, das eine siebenstellige Zahl in sich fasste, und benutzte seinen Reichtum, um sich einen guten Tag zu machen, um sich mit allen jenen schönen Dingen zu umgeben, die man sich für Geld anschaffen konnte. Zu diesen schönen Dingen gehörte auch Mimi.
Die Familie Adolf Grünmeier beobachtete den Erbonkel sozusagen aus dem Versteck. Adolf war reichlich zehn Jahre jünger als Ferdinand und fühlte sich daher aus Naturgesetz erbberechtigt. Kein Lebewesen auf der Welt hätte ihm dieses Recht nehmen können. Grünmeiers gab es nicht viele auf Erden und im Berliner Telefonbuch konnte man nur noch einen finden, der den gleichen wohlklingenden Namen führte. Aber dieser Grünmeier schrieb sich mit ai, war also kein echter Grünmeier.
Onkel Ferdinand dachte aber den Teufel daran, sich von seiner Familie überhaupt beerben zu lassen. Er erfreute sich einer ausgezeichneten Gesundheit und amüsierte sich vorläufig so gut es ging. Er war, nachdem es ihm seine Mittel erlaubt hatten, Lebemann geworden, empfing in seiner prachtvoll eingerichteten Wohnung im Westen seine Freunde, versäumte keine Premiere im Theater, war auf allen Rennen und öffentlichen Bällen zu treffen, reiste nach der Riviera und nach der Nordsee, wie es die Saison erforderte. Er hatte den wirklichen Grandseigneurs es abgeguckt, wie sie sich räuspern und ähnliches tun und stellte mit seinem forsch gestrichenen Haby-Bart1 ganz den Typ des Bezwingers von vor 1914 dar.
Sein Bruder Adolf lebte in bescheidenen Verhältnissen und musste viel in der Stadt herumlaufen, um das tägliche Brot zu verdienen. Für seinen Sohn Paul sorgte zwar Onkel Ferdinand, der ihn auf der technischen Hochschule studieren ließ und ihm manchen Hunderter Extrataschengeld zusteckte. Adolf ging treu und brav den Leidensweg der Tretmühle. Im stillen Herzenskämmerchen schlummerte das sichere Bewusstsein, einstmals Herr der Ferdinandschen Million zu werden. Kommt Zeit, kommt Rat. Adolfs Frau, die gute Luise, rechnete nicht mit. Sie war eine jener Hausfrauen, die möglichst billig einzukaufen suchte und die sich selbst und ihren Mitmenschen zur Qual lebte, denn sie litt an der ewigen Zwangsvorstellung, mit ihrem Haushaltungsgeld nicht auskommen zu können.
Jahrelang ging das Leben der Grünmeiers so dahin. Adolf schuftete um die paar Groschen, Ferdinand lebte in Saus und Braus. An seinem Geburtstag oder zu Weihnachten öffneten sich die Schleusen seiner Generosität und er überschüttete seine Verwandten mit einem Abendessen, das er bei Borchardt anmietete. Und Adolf betrank sich jedes Mal in echtem Pommery und Chartreuse. Aber um seine Intimitäten wob Ferdinand immer einen undurchsichtigen Schleier. Man wusste wohl, dass er ein tüchtiger Draufgänger war und dass er trotz seiner sechzig Jahre für den erklärten Liebling der Tanzpalastschönheiten galt. Adolf hörte von manchem Abenteuer seines leichtlebigen Bruders und beneidete ihn im Stillen. Und dachte an das schöne Geld, das ihm durch diese erotischen Übungen verloren ging.
Bis eines schönen Tages das Gerücht zu ihm drang, Ferdinand Grünmeier halte die Schauspielerin Mimi Schwarz aus, die im Metropoltheater allabendlich einem sehr verehrten Publikum ihre schönen Beine und noch andere Teile ihres ebenso schönen Körpers im Gefunkel des Rampenlichtes feilbot.
Diese Wendung der Dinge gab allerdings zu denken.
Adolf berechnete die Unsummen, die diese Verschwendung verschlang.
Als der Krieg ausbrach und alle Leute sich einschränkten, glaubte Adolf, sein Bruder würde sich des Mädels entledigen.
Jedenfalls hörte man im Sturm der Ereignisse nichts mehr von Onkel Ferdinand. Auch bei ihm blieb das Rad stehen und das Einzelschicksal versank im großen Massengrab des Weltenkampfes.
Paul ging ins Feld.
Adolf versuchte, Geschäfte zu machen, wollte seinen Bruder zu Unternehmen veranlassen, die jener aber abwies. Denn er beteiligte sich selbst an Lieferungen und machte große Abschlüsse, die ungeheuren Verdienst abwarfen.
Dann trat eine Katastrophe ein, an die keiner bei Grünmeiers gedacht. Onkel Ferdinand starb nach einer Krankheit von dreitägiger Dauer.
Plötzlich. Ohne eigentlich einen Grund zu haben. Überraschend. An der Grippe, die eine Modekrankheit geworden. Und ein Spötter hätte sagen können, dass Onkel Ferdinand, der alle Moden wie ein richtiger Snob mitgemacht hatte, auch diese Mode nicht auslassen wollte.
Aber Onkel Ferdinands Tod war nicht die einzige Überraschung in der Familie Grünmeier.
Das Verblüffende, das wie ein Blitz aus heiterem Himmel einschlagende, war das Testament.
Eine Niederträchtigkeit.
Das sagte Luise Grünmeier, die Schwägerin.
Es muss übel um das Testament bestellt gewesen sein, wenn Frau Luise sich zu solcher scharfen Kritik versteigen konnte.
Gleich, nachdem der Tod eingetreten war, erschienen Adolf und Luise in der Wielandstraße. Schoben das ihnen öffnende Dienstmädchen energisch beiseite und drangen geradewegs in das Schlafzimmer, wo Onkel Ferdinands sterbliche Reste, in weißen Linnen gebettet, für ewig verstummt dalagen. Sie falteten die Hände und murmelten irgendein Gebet, unter der Suggestion des alles bezwingenden Schicksals. Aber in Adolfs Gehirn überwucherten die Trostworte des Gebetes die Gedanken um die Zukunft und auch zwischen Luisens Tränen zuckten die Blitze der Erwartung.
Ein Schluchzen unterbrach die Andacht, die über dieser Weihestunde des Todes in dem luxuriösen Schlafzimmer lag.
Adolf und Luise schreckten auf, starrten in die Ecke, die vom Lichtkegel am Bett im schummerigen Dunkel gelassen.
Eine schlanke Gestalt löste sich vom Hintergrund, nahm festere Konturen an, näherte sich leise den beiden Verwandten, die erstaunt die Fremde betrachteten.
Die drei standen sich stumm gegenüber.
Luise fand zuerst das Wort.
Mit dem Instinkt der Frau hatte sie das Richtige erfasst.
»Sie sind wohl die Dame von unserem armen Ferdinand?« fragte sie.
Sie betonte spitz das Wort »Dame«, als wenn sie es in Anführungsstrichen sprechen wollte.
Die Blonde nickte schweigend. Dann senkte sie den Kopf und versuchte das ausbrechende Weinen in ihrem Taschentuch zu ersticken.
»Der arme Ferdinand! – – So schnell!« sagte Luise.
Aber Adolf beteiligte sich nicht an dieser Konversation, sondern schaute mit einem mitleidigen Blick auf das junge Mädchen, das in der gebrochenen Lichtstimmung des Raumes mit ihren Goldhaaren wie eine Heilige wirkte, wie eine Abgesandte des Himmels, die den Toten behüten wollte.
Für Adolf war diese Mimi eine Größe von gestern, ein Stern, der erloschen, eine entthronte Königin.
Er überließ die beiden Frauen sich selber und begab sich in die vorderen Zimmer, um sozusagen Besitz zu ergreifen von seinem Eigentum.
Dass ihm all diese Möbel, Gobelins, Antiquitäten, das Silbergeschirr und die Bibliothek, die Perserteppiche und Bilder gehörten, stand bei ihm außer jedem Zweifel.
Wem sonst hätte Ferdinand sein Vermögen hinterlassen können?
Adolf setzte sich an den großen Schreibtisch des Verstorbenen und ließ sich vom Dienstmädchen die Schlüssel geben.
Er durchforschte die einzelnen Fächer, fand allerhand Aufzeichnungen und Papiere, Schuldscheine und Wechsel, Bankabrechnungen. Und er sah, dass sein Bruder dieses irdische Jammertal als ordentlicher Staatsbürger verlassen hatte, der keine Unklarheit über seine Verhältnisse aufkommen lassen wollte.
Adolf vertiefte sich in die Bücher und war mitten in der Berechnung des Vermögensstandes, als Luise eintrat.
»Hast du das Testament gefunden?« fragte sie scharf und bestimmt.
Richtig; das Testament. Daran hatte er ganz vergessen. War ja auch gleichgültig, Formensache.
»Nein«, antwortete Adolf.
Luise ging im Zimmer umher und bestimmte die einzelnen Gegenstände teils zum Verkauf, teils zur Einverleibung in ihre eigene Wirtschaft.
»Man kann doch den ganzen Plunder nicht behalten«, meinte sie. »Dieser Ferdinand hat zu viel unnützes Zeug um sich herumgehabt …«
»Ich hab’s!« unterbrach Adolf seine Gattin, »hier hat es gesteckt: es lag im Wandsafe, zu dem ich eben erst den Schlüssel gefunden.«
Er hatte einen großen Briefumschlag in der Hand, mit dem er seiner Frau winkte, die vor einer wundervollen blauen Vase aus altem Berliner Porzellan stand, sie kritisch abschätzend.
Das Ehepaar blickte gespannt auf den Doppelbogen Papier, der den Inhalt des Briefumschlages bildete. Sie lasen mit weit aus den Höhlen quellenden Augen. Das Licht der Stehlampe stach grell auf der weißen Fläche und die Buchstaben tanzten wie böse Kobolde vor ihren Augen.
Das Testament war ganz kurz gefasst, enthielt nur ein paar Sätze. Es war, wie der Vermerk darauf zeigte, die Abschrift des auf dem Gericht liegenden Originals.
Adolf blickte seine Frau wie geistesabwesend an und es war in diesem Augenblick, da Luise sagte:
»Das ist eine Niederträchtigkeit!! …« Das Testament bestimmte Mimi Schwarz, die Freundin, zur Universalerbin. Aber Onkel Ferdinand knüpfte eine Bedingung an diese Bestimmung: Er verlangte von Mimi, dass sie Zeit ihres Lebens nicht heiratete oder einem Kind das Leben gäbe. In diesen beiden Fällen sollte das gesamte Ferdinandsche Vermögen an die Familie seines Bruders Adolf oder vielmehr an seinen Neffen Paul fallen, wenn dieser lebendig aus dem Kriege heimkäme.
Onkel Ferdinand war immer ein Mann gewesen, der das Außergewöhnliche liebte und der Sinn für Überraschungen hatte – –
François Haby war ein deutscher Unternehmer und Hoffriseur Kaiser Wilhelms II. <<<
Zweites Kapitel.
Die Überraschung war auf allen Seiten. Auch Mimi, über die Ferdinand Grünmeiers Millionen herabgerieselt waren wie einst die Goldstücke Jupiters auf Io, musste sich in die eigentümliche Situation erst allmählich hineinfinden. Es ist immerhin nicht leicht für eine Frau, auf die standesamtliche Abstempelung zu verzichten, eine Staatshandlung, die ja eigentlich zum eisernen Bestand jedes Jungferntraumes gehört. Auf das Kinderkriegen würde sie auch ohne Testamentsbestimmung keinen Wert gelegt haben, wenn nicht das Schicksal mit ihr und Ferdinand Grünmeier eine eigentümliche Narrensposse vorgehabt hätte.
Doch darüber machte sie sich vorläufig keine Gedanken.
Als sie vom Notar gekommen war, der ihr in trockenem Geschäftston die Mitteilung gemacht hatte, dass sie glückliche Besitzerin von einer Million und sechshunderttausend Mark geworden war, wobei er die Einschränkungsbedingungen mit warnendem Tonfall ganz im Stile eines Bußpredigers besonders scharf akzentuierte, hatte sie das Gefühl, die Erdenschwere verloren zu haben. Der Tante Marie, bei der sie wohnte, fiel sie um den Hals, als sie in die saubere Wohnstube eintrat. Sie küsste sie ab, wie einen Liebsten, lachte ihr ins Gesicht, zog sie auf das geschweifte grüne Ripssofa, das noch von ihren seligen Eltern stammte und eine Zierde der kleinen Wohnung bildete. Sie war außer Rand und Band.
»Du bist nicht bei Sinnen«, sagte Tante Marie, als der erste Ansturm sich gelegt hatte und die gute alte Person endlich Atem schöpfen konnte. Aber Mimi stand auf und trat dicht vor die Tante hin.
»Weißt du, was ich bin?«
Sie machte eine gewichtige Miene.
Tante Marie strich verlegen über die nicht sehr saubere Küchenschürze und schaute sie ganz dumm an.
»Millionärin bin ich …!!«
Mimi weidete sich an der kleinen Frau, die sich wie ein Vögelchen unter dem Brausen des Orkans verschüchtert in sich zusammenzog.
Dann erzählte Mimi.
Und dann sprachen die beiden Frauen von neuen ungewohnten Zukunftsmöglichkeiten, schmiedeten Pläne und fassten Entschlüsse, die sie immer wieder durch neue, besser erscheinende ersetzten.
So viel Geld!
Tante Marie konnte es gar nicht fassen, dass das große Glück über ihre Nichte gekommen war.
Aber Mimi war von praktischer Veranlagung und überließ die kleine Tante ihren Fantasien, während sie selbst an die Aufmachung eines neuen Lebens ging, das der eineinhalb Millionen, deren Zinsen sie sich jetzt erfreute, würdig wäre. Sie richtete sich draußen am Kurfürstendamm eine glanzvolle Wohnung ein, die sie mit des verstorbenen Ferdinands Möbeln mit gutem Geschmack ausstattete. Dann stellte sie den ganzen Haushalt auf eine höhere soziale Stufe. Sie machte Tante Marie zu ihrer Hausdame, verbot ihr die Küchenschürze und holte sie mit Gewalt aus der Mädchenkammer, wohin sich die bescheidene alte Jungfer verkrochen hatte.
In ihrem Hause galt Mimi als die reiche Frau Schwarz, Privatiere. In dem großen, palastartigen Kasten, der in der Nähe der Halenseer Brücke lag, kümmerten sich die Mieter nicht viel umeinander und für die Portiersleute war das Geld das allein Ausschlaggebende. Ihrer schauspielerischen Karriere machte sie ein schleuniges Ende, denn sie hatte nicht den Ehrgeiz, in der Öffentlichkeit aufzufallen. Sie liebte die Bequemlichkeit und war froh, keine Vormittagsproben und Abendvorstellungen mehr mitmachen zu müssen. Die unbedingte Freiheit, die ihr das große Vermögen in vollem Maße gewährte, genoss sie in vollen Zügen.
Tante Marie wurde in einfach bürgerlicher Weise ausstaffiert und begleitete sie überall hin. Die kleine scheue Dame wurde von Mimi in die Theater und Konzerte, selbst in die Kabaretts mitgeschleppt, musste bei der Modistin zugegen sein, im Schlafwagen durch die Welt mit ihr dampfen, in den Badeorten neben der schönen Nichte über die Kurpromenade wandeln. Tante Marie wurde Mimis Schlagschatten.
Gegen die Männerwelt verhielt sich Frau Mimi, wie sie sich jetzt nennen ließ, abweisend und zurückhaltend. Für das starke Geschlecht empfand sie keine Sympathie mehr, nachdem das Gespenst der Liebe sich zwischen ihre Millionen gedrängt hatte. Sie wollte nicht in Versuchung geraten. Und was sie bisher in der Liebe erlebt hatte, genügte ihr sowieso.
Das Verhältnis mit dem seligen Ferdinand zum Beispiel – ihr letztes Abenteuer. Es war zustande gekommen, wie eben diese Bekanntschaften immer gemacht wurden. Auf der Rennbahn, eines schönen Frühlingstages, sprach Ferdinand sie an. Und dann entwickelte sich eben aus dem ersten Tête-à-Tête im Extrazimmer bei Hiller eine Liaison, die sie in Anbetracht des vorgerückten Alters ihres Liebhabers gleich auf eine gesicherte materielle Basis stellte. Und während der Jahre, die sie dem »Alten« opferte, verzichtete sie aus Vernunftgründen auf jede weitere Aufregung und Liebessachen, die ihrer Veranlagung überhaupt nicht entsprachen.
Sie hielt nicht viel von der Liebe. Was sie bisher erlebt hatte, gab ihr Recht. Der erste, der sie in die Geheimnisse von Jenseits von Gut und Böse eingeweiht hatte, war ein Lumpenkerl. Ließ sie sitzen und warf sie auf die Straße, wo sie verloren gewesen wäre, wenn Tante Marie sie nicht zu sich genommen hätte.
Dann noch zwei, drei oder mehr Versuche mit den Männern, jüngeren und älteren. Sie hatte kein Glück damit. Egoisten und Knickern fiel sie in die Hände. Sie hielt sich nicht lange mit ihnen auf. Sie wartete.
Bis ein glücklicher Zufall den alten Ferdinand Grünmeier, der wie ein gewichster Schwerenöter prüfend durch die Menge auf der Rennbahn stolzierte, auf sie aufmerksam machte.
Alle, die sich jetzt um ihre Gunst bemühten, prallten mit ihren Bewerbungen an der stahlharten Wand der Gleichgültigkeit ab, mit der sich Frau Mimi panzerte. Aber der unermessliche Reichtum, den die Fama ihr andichtete, zog jeden Tag neue Anbeter in ihren Kreis, die wie die Motten zum Licht flogen.
Frau Mimi wollte sich nicht um ihr Glück betrügen lassen. Sie dachte an die Testamentsbestimmung und hütete sich, sie zu verletzen.
Gegen Ende des Sommers kam sie aus Swinemünde zurück, wo sie die Hochflut der Saison in vollen Zügen genossen hatte. Diese erste Saison nach den Mühsalsjahren des Krieges hatte die Menschen zu wahren Orgien der Vergnügungen gepeitscht und aus der großen Not keine Tugend gemacht, wenn man das Sprichwort so umkehren darf.