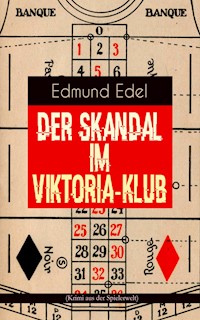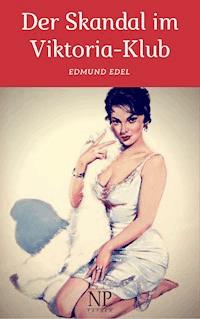Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: idb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Onkel Ferdinand seinerseits verfügte über nicht so stark ausgeprägten Familiensinn. Er hatte in glücklichen Spekulationen ein ansehnliches Vermögen erworben, das eine siebenstellige Zahl in sich faßte, und benutzte seinen Reichtum, um sich einen guten Tag zu machen, um sich mit allen jenen schönen Dingen zu umgeben, die man sich für Geld anschaffen konnte. Zu diesen schönen Dingen gehörte auch Mimi. ..
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 136
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
w
Edmund Edel
Mimi
Kriminalroman (1920)
idb
ISBN 9783962243210
den
Erstes Kapitel.
Ferdinand Grünmeier lebte zu einer Zeit, da in der Welt noch einigermaßen Ordnung herrschte. Krieg war ein apokrypher Begriff und Revolutionen kannte man nur aus Operetten und aus Zeitungsberichten über südamerikanische Katzbalgereien. Ferdinand war der Erbonkel der Familie. Diese Familie, die der Agent Adolf Grünmeier mit Frau und Sohn darstellte und die ihren Daseinszweck in stramm bürgerlicher Pflicht erfüllte, blickte während zweier Jahrzehnte mit ehrfürchtiger Hochachtung auf den Onkel Ferdinand, den sie mit aller in Familien üblichen Liebe und Sorgfalt umgab. Onkel Ferdinand seinerseits verfügte über nicht so stark ausgeprägten Familiensinn. Er hatte in glücklichen Spekulationen ein ansehnliches Vermögen erworben, das eine siebenstellige Zahl in sich faßte, und benutzte seinen Reichtum, um sich einen guten Tag zu machen, um sich mit allen jenen schönen Dingen zu umgeben, die man sich für Geld anschaffen konnte. Zu diesen schönen Dingen gehörte auch Mimi.
Die Familie Adolf Grünmeier beobachtete den Erbonkel sozusagen aus dem Versteck. Adolf war reichlich zehn Jahre jünger als Ferdinand und fühlte sich daher aus Naturgesetz erbberechtigt. Kein Lebewesen auf der Welt hätte ihm dieses Recht nehmen können. Grünmeiers gab es nicht viele auf Erden und im Berliner Telephonbuch konnte man nur noch einen finden, der den gleichen wohlklingenden Namen führte. Aber dieser Grünmeier schrieb sich mit ai, war also kein echter Grünmeier.
Onkel Ferdinand dachte aber den Teufel daran, sich von seiner Familie überhaupt beerben zu lassen. Er erfreute sich einer ausgezeichneten Gesundheit und amüsierte sich vorläufig so gut es ging. Er war, nachdem es ihm seine Mittel erlaubt hatten, Lebemann geworden, empfing in seiner prachtvoll eingerichteten Wohnung im Westen seine Freunde, versäumte keine Première im Theater, war auf allen Rennen und öffentlichen Bällen zu treffen, reiste nach der Riviera und nach der Nordsee, wie es die Saison erforderte. Er hatte den wirklichen Grandseigneurs es abgeguckt, wie sie sich räuspern und ähnliches tun und stellte mit seinem forsch gestrichenen Habybart ganz den Typ des Bezwingers von vor 1914 dar.
Sein Bruder Adolf lebte in bescheidenen Verhältnissen und mußte viel in der Stadt herumlaufen, um das tägliche Brot zu verdienen. Für seinen Sohn Paul sorgte zwar Onkel Ferdinand, der ihn auf der technischen Hochschule studieren ließ und ihm manchen Hunderter Extrataschengeld zusteckte. Adolf ging treu und brav den Leidensweg der Tretmühle. Im stillen Herzenskämmerchen schlummerte das sichere Bewußtsein, einstmals Herr der Ferdinandschen Million zu werden. Kommt Zeit, kommt Rat. Adolfs Frau, die gute Luise, rechnete nicht mit. Sie war eine jener Hausfrauen, die möglichst billig einzukaufen suchte und die sich selbst und ihren Mitmenschen zur Qual lebte, denn sie litt an der ewigen Zwangsvorstellung, mit ihrem Haushaltungsgeld nicht auskommen zu können.
Jahrelang ging das Leben der Grünmeiers so dahin. Adolf schuftete um die paar Groschen, Ferdinand lebte in Saus und Braus. An seinem Geburtstag oder zu Weihnachten öffneten sich die Schleusen seiner Generosität und er überschüttete seine Verwandten mit einem Abendessen, das er bei Borchardt angemietet. Und Adolf betrank sich jedesmal in echtem Pommery und Chartereuse. Aber um seine Intimitäten wob Ferdinand immer einen undurchsichtigen Schleier. Man mußte wohl, daß er ein tüchtiger Draufgänger war und daß er trotz seiner sechzig Jahre für den erklärten Liebling der Tanzpalastschönheiten galt. Adolf hörte von manchem Abenteuer seines leichtlebigen Bruders und beneidete ihn im Stillen. Und dachte an das schöne Geld, das ihm durch diese erotischen Übungen verloren ging.
Bis eines schönen Tages das Gerücht zu ihm drang, Ferdinand Grünmeier halte die Schauspielerin Mimi Schwarz aus, die im Metropoltheater allabendlich einem sehr verehrten Publiko ihre schönen Beine und noch andere Teile ihres ebenso schönen Körpers im Gefunkel des Rampenlichtes feilbot.
Diese Wendung der Dinge gab allerdings zu denken.
Adolf berechnete die Unsummen, die diese Verschwendung verschlang.
Als der Krieg ausbrach und alle Leute sich einschränkten, glaubte Adolf, sein Bruder würde sich des Mädels entledigen.
Jedenfalls hörte man im Sturm der Ereignisse nichts mehr von Onkel Ferdinand. Auch bei ihm blieb das Rad stehen und das Einzelschicksal versank im großen Massengrab des Weltenkampfes.
Paul ging in's Feld.
Adolf versuchte, Geschäfte zu machen, wollte seinen Bruder zu Unternehmen veranlassen, die jener aber abwies. Denn er beteiligte sich selbst an Lieferungen und machte große Abschlüsse, die ungeheuren Verdienst abwarfen.
Dann trat eine Katastrophe ein, an die keiner bei Grünmeiers gedacht. Onkel Ferdinand starb nach einer Krankheit von dreitägiger Dauer.
Plötzlich. Ohne eigentlich einen Grund zu haben. Überraschend. An der Grippe, die eine Modekrankheit geworden. Und ein Spötter hätte sagen können, daß Onkel Ferdinand, der alle Moden wie ein richtiger Snob mitgemacht hatte, auch diese Mode nicht auslassen wollte.
Aber Onkel Ferdinands Tod war nicht die einzige Überraschung in der Familie Grünmeier.
Das Verblüffende, das wie ein Blitz aus heiterem Himmel einschlagende, war das Testament.
Eine Niederträchtigkeit.
Das sagte Luise Grünmeier, die Schwägerin.
Es muß übel um das Testament bestellt gewesen sein, wenn Frau Luise sich zu solcher scharfen Kritik versteigen konnte.
Gleich, nachdem der Tod eingetreten war, erschienen Adolf und Luise in der Wielandstraße. Schoben das ihnen öffnende Dienstmädchen energisch bei Seite und drangen gradenwegs in das Schlafzimmer, wo Onkel Ferdinands sterbliche Reste, in weißen Linnen gebettet, für ewig verstummt dalagen. Sie falteten die Hände und murmelten irgendein Gebet, unter der Suggestion des alles bezwingenden Schicksals. Aber in Adolfs Gehirn überwucherten die Trostworte des Gebetes die Gedanken um die Zukunft und auch zwischen Luisens Tränen zuckten die Blitze der Erwartung.
Ein Schluchzen unterbrach die Andacht, die über dieser Weihestunde des Todes in dem luxuriösen Schlafzimmer lag.
Adolf und Luise schreckten auf, starrten in die Ecke, die vom Lichtkegel am Bett im schummerigen Dunkel gelassen.
Eine schlanke Gestalt löste sich vom Hintergrund, nahm festere Konturen an, näherte sich leise den beiden Verwandten, die erstaunt die Fremde betrachteten.
Die drei standen sich stumm gegenüber.
Luise fand zuerst das Wort.
Mit dem Instinkt der Frau hatte sie das Richtige erfaßt.
»Sie sind wohl die Dame von unserem armen Ferdinand?« fragte sie.
Sie betonte spitz das Wort »Dame«, als wenn sie es in Anführungsstrichen sprechen wollte.
Die Blonde nickte schweigend. Dann senkte sie den Kopf und versuchte das ausbrechende Weinen in ihrem Taschentuch zu ersticken.
»Der arme Ferdinand! – – So schnell!« sagte Luise.
Aber Adolf beteiligte sich nicht an dieser Konversation, sondern schaute mit einem mitleidigen Blick auf das junge Mädchen, das in der gebrochenen Lichtstimmung des Raumes mit ihren Goldhaaren wie eine Heilige wirkte, wie eine Abgesandte des Himmels, die den Toten behüten wollte.
Für Adolf war diese Mimi eine Größe von gestern, ein Stern, der erloschen, eine entthronte Königin.
Er überließ die beiden Frauen sich selber und begab sich in die vorderen Zimmer, um sozusagen Besitz zu ergreifen von seinem Eigentum.
Daß ihm mm alle dieser Möbel, Gobelins, Antiquitäten, das Silbergeschirr und die Bibliothek, die Perserteppiche und Bilder gehörten. stand bei ihm außer jedem Zweifel.
Wem sonst hätte Ferdinand sein Vermögen hinterlassen können?
Adolf setzte sich an den großen Schreibtisch des Verstorbenen und ließ sich vom Dienstmädchen die Schlüssel geben.
Er durchforschte die einzelnen Fächer, fand allerhand Aufzeichnungen und Papiere, Schuldscheine und Wechsel, Bankabrechnungen. Und er sah, daß sein Bruder dieses irdische Jammertal als ordentlicher Staatsbürger verlassen hatte, der keine Unklarheit über seine Verhältnisse aufkommen lassen wollte.
Adolf vertiefte sich in die Bücher und war mitten in der Berechnung des Vermögensstandes, als Luise eintrat.
»Hast du das Testament gefunden?« fragte sie scharf und bestimmt.
Richtig; das Testament. Daran hatte er ganz vergessen. War ja auch gleichgültig, Formensache.
»Nein«, antwortete Adolf.
Luise ging im Zimmer umher und bestimmte die einzelnen Gegenstände teils zum Verkauf, teils zur Einverleibung in ihre eigene Wirtschaft.
»Man kann doch den ganzen Plunder nicht behalten«, meinte sie. »Dieser Ferdinand hat zu viel unnützes Zeug um sich herumgehabt ...«
»Ich hab's!« unterbrach Adolf sein Gattin, »hier hat es gesteckt: es lag im Wandsafe, zu dem ich eben erst den Schlüssel gefunden.«
Er hatte einen großen Briefumschlag in der Hand, mit dem er seiner Frau winkte, die vor einer wundervollen blauen Vase aus altem Berliner Porzellan stand, sie kritisch abschätzend.
Das Ehepaar blickte gespannt auf den Doppelbogen Papier, der den Inhalt des Briefumschlages bildete. Sie lasen mit weit aus den Höhlen quellendem Augen. Das Licht der Stehlampe stach grell auf der weißen Fläche und die Buchstaben tanzten wie böse Kobolde vor ihren Augen.
Das Testament war ganz kurz gefaßt, enthielt nur ein paar Sätze. Es war, wie der Vermerk darauf zeigte, die Abschrift des auf dem Gericht liegenden Originales.
Adolf blickte seine Frau wie geistesabwesend an und es war in diesem Augenblick, da Luise sagte:
»Das ist eine Niederträchtigkeit!! ...« Das Testament bestimmte Mimi Schwarz, die Freundin zur Universalerbin. Aber Onkel Ferdinand knüpfte eine Bedingung an diese Bestimmung: er verlangte von Mimi, daß sie Zeit ihres Lebens nicht heiratete oder einem Kind das Leben gäbe. In diesen beiden Fällen sollte das gesamte Ferdinandsche Vermögen an die Familie seines Bruders Adolf oder vielmehr an seinen Neffen Paul fallen, wenn dieser lebendig aus dem Kriege heimkäme.
Onkel Ferdinand war immer ein Mann gewesen, der das Außergewöhnliche liebte und der Sinn für Überraschungen hatte – –
Zweites Kapitel.
Die Überraschung war auf allen Seiten. Auch Mimi, über die Ferdinand Grünmeiers Millionen herabgerieselt waren wie einst die Goldstücke Jupiters auf Io, mußte sich in die eigentümliche Situation erst allmählich hineinfinden. Es ist immerhin nicht leicht für eine Frau, auf die standesamtliche Abstempelung zu verzichten, eine Staatshandlung, die ja eigentlich zum eisernen Bestand jedes Jungferntraumes gehört. Auf das Kinderkriegen würde sie auch ohne Testamentsbestimmung keinen Wert gelegt haben, wenn nicht das Schicksal mit ihr und Ferdinand Grünmeier eine eigentümliche Narrensposse vorgehabt hätte.
Doch darüber machte sie sich vorläufig keine Gedanken.
Als sie vom Notar gekommen war, der ihr in trockenem Geschäftston die Mitteilung gemacht, daß sie glückliche Besitzerin von einer Million und sechshunderttausend Mark geworden wäre, wobei er die Einschränkungsbedingungen mit warnendem Tonfall ganz im Stile eines Bußpredigers besonders scharf akzentuierte, hatte sie das Gefühl, die Erdenschwere verloren zu haben. Der Tante Marie, bei der sie wohnte, fiel sie um den Hals, als sie in die saubere Wohnstube eintrat. Sie küßte sie ab, wie einen Liebsten, lachte ihr ins Gesicht, zog sie auf das geschweifte grüne Ripssofa, das noch von ihren seligen Eltern stammte und eine Zierde der kleinen Wohnung bildete. Sie war außer Rand und Band.
»Du bist nicht bei Sinnen«, sagte Tante Marie, als der erste Ansturm sich gelegt hatte und die gute alte Person endlich Atem schöpfen konnte. Aber Mimi stand auf und trat dicht vor die Tante hin.
»Weißt du, was ich bin?«
Sie machte eine gewichtige Miene.
Tante Marie strich verlegen über die nicht sehr saubere Küchenschürze und schaute sie ganz dumm an.
»Millionärin bin ich ...!!«
Mimi weidete sich an der kleinen Frau, die sich wie ein Vögelchen unter dem Brausen des Orkans verschüchtert in sich zusammenzog.
Dann erzählte Mimi.
Und dann sprachen die beiden Frauen von neuen ungewohnten Zukunftsmöglichkeiten, schmiedeten Pläne und faßten Entschlüsse, die sie immer wieder durch neue, besser erscheinende ersetzten.
So viel Geld!
Tante Marie konnte es gar nicht fassen, daß das große Glück über ihre Nichte gekommen.
Aber Mimi war von praktischer Veranlagung und überließ die kleine Tante ihren Phantasien, während sie selbst an die Aufmachung eines neuen Lebens ging, das der einundeinhalben Million, deren Zinsen sie sich jetzt erfreute, würdig wäre. Sie richtete sich draußen am Kurfürstendamm eine glanzvolle Wohnung ein, die sie mit des verstorbenen Ferdinands Möbeln mit gutem Geschmack ausstattete. Dann stellte sie den ganzen Haushalt auf eine höhere soziale Stufe. Sie machte Tante Marie zu ihrer Hausdame, verbot ihr die Küchenschürze und holte sie mit Gewalt aus der Mädchenkammer, wohin sich die bescheidene alte Jungfer verkrochen hatte.
In ihrem Hause galt Mimi als die reiche Frau Schwarz, Privatiere. In dem großen, palastartigen Kasten, der in der Nähe der Halenseer Brücke lag, kümmerten sich die Mieter nicht viel umeinander und für die Portiersleute war das Geld das allein Ausschlaggebende. Ihrer schauspielerischen Karriere machte sie ein schleuniges Ende, denn sie hatte nicht den Ehrgeiz in der Öffentlichkeit aufzufallen. Sie liebte die Bequemlichkeit und war froh, keine Vormittagsproben und Abendvorstellungen mehr mitmachen zu müssen. Die unbedingte Freiheit, die ihr das große Vermögen in vollem Maße gewährte, genoß sie in vollen Zügen.
Tante Marie wurde in einfach bürgerlicher Weise ausstaffiert und begleitete sie überall hin. Die kleine scheue Dame wurde von Mimi in die Theater und Konzerte, selbst in die Kabaretts mitgeschleppt, mußte bei der Modistin zugegen sein, im Schlafwagen durch die Welt mit ihr dampfen, in den Badeorten neben der schönen Nichte über die Kurpromenade wandeln. Tante Marie wurde Mimis Schlagschatten.
Gegen die Männerwelt verhielt sich Frau Mimi, wie sie sich jetzt nennen ließ, abweisend und zurückhaltend. Für das starke Geschlecht empfand sie keine Sympathie mehr, nachdem das Gespenst der Liebe sich zwischen ihre Millionen gedrängt hatte. Sie wollte nicht in Versuchung geraten. Und was sie bisher in der Liebe erlebt hatte, genügte ihr so wie so.
Das Verhältnis mit dem seligen Ferdinand zum Beispiel – – – ihr letztes Abenteuer. Es war zustande gekommen, wie eben diese Bekanntschaften immer gemacht wurden. Auf der Rennbahn, eines schönen Frühlingstages, sprach Ferdinand sie an. Und dann entwickelte sich eben aus dem ersten Tête à tête im Extrazimmer bei Hiller eine Liaison, die sie in Anbetracht des vorgerückten Alters ihres Liebhabers gleich auf eine gesicherte materielle Basis stellte. Und während der Jahre, die sie dem »Alten« opferte, verzichtete sie aus Vernunftgründen auf jede weitere Aufregungen und Liebessachen, die ihrer Veranlagung überhaupt nicht entsprachen.
Sie hielt nicht viel von der Liebe. Was sie bisher erlebt, gab ihr Recht. Der erste, der sie in die Geheimnisse von Jenseits von Gut und Böse eingeweiht, war ein Lumpenkerl. Ließ sie sitzen und warf sie auf die Straße, wo sie verloren gewesen wäre, wenn Tante Marie sie nicht zu sich genommen.
Dann noch zwei, drei oder mehr Versuche mit den Männern, jüngeren und älteren. Sie hatte kein Glück damit. Egoisten und Knickern fiel sie in die Hände. Sie hielt sich nicht lange mit ihnen auf. Sie wartete.
Bis ein glücklicher Zufall den alten Ferdinand Grünmeier, der wie ein gewichster Schwerenöter prüfend durch die Menge auf der Rennbahn stolzierte, auf sie aufmerksam machte.
Alle, die sich jetzt um ihre Gunst bemühten, prallten mit ihren Bewerbungen an der stahlharten Wand der Gleichgültigkeit ab, mit der sich Frau Mimi panzerte. Aber der unermeßliche Reichtum, den die Fama ihr andichtete, zog jeden Tag neue Anbeter in ihren Kreis, die wie die Motten zum Licht flogen.
Frau Mimi wollte sich nicht um ihr Glück betrügen lassen. Sie dachte an die Testamentsbestimmung und hütete sich, sie zu verletzen.
Gegen Ende des Sommers kam sie aus Swinemünde zurück, wo sie die Hochflut der Saison in vollen Zügen genossen. Diese erste Saison nach den Mühsalsjahren des Krieges hatte die Menschen zu wahren Orgien der Vergnügungen gepeitscht und aus der großen Not keine Tugend gemacht, wenn man das Sprichwort so umkehren darf.
Frau Mimi war trotz ihrer Unnahbarkeit der Mittelpunkt einer Gesellschaft gewesen, in der man sich nicht langweilte. Jetzt, da sie in ihr Berliner Heim zurrückgekehrt, wollte sie sich von den Strapazen ihrer Erholung, wie sie von ihrer Sommerreise scherzhaft sprach, ausruhen.
Sie fühlte sich gar nicht wohl. Trotz ihres blühenden Aussehens, trotz der frischen, gebräunten Gesichtsfarbe ging es ihr nicht gut. Tante Marie war sehr besorgt um die Nichte. Sie beobachtete sie und versuchte alle Hausmittel, die sie kannte. Aber kein Mittel schlug an. Mimis Laune wurde immer schlimmer, ihre Reizbarkeit nicht mehr zu ertragen.
Tante Marie witterte Unrat.
Mimi wurde still und verschlossen.
Tante Marie drängte auf eine Erklärung. Sie ahnte den Grund von Mimis Krankheit. Denn nun war die hübsche blonde Mimi wirklich krank geworden und jammerte und zeterte, daß die arme kleine Tante Marie nicht ein noch aus wußte.
Und das Unangenehmste für Tante Marie war die Weigerung Mimis, einen Arzt kommen zu lassen.
Aber eines Morgens trat Tante Marie mit einer starken großen Frau in Mimis Schlafzimmer.
»Das ist Frau Lehmann, eine Bekannte von mir«, sagte Tante Marie.
Und sie fuhr leise fort, als wenn sie sich schämte für das, was jetzt kommen würde:
»Frau Lehmann meint, es wäre richtig mit dir, Mimi!«
Es war richtig mit Mimi.
Die weise Frau berechnete, daß das nun schon über fünf Monate her sein müßte.
Mimi bekam einen schönen Schreck.
Ihr erster Gedanke war das Testament und ihr Geld.
Aber wenn doch Ferdinand Grünmeier selber der Vater ist?
Das könnte zu schweren Verwickelungen führen. Und schließlich würde man es ihr nicht glauben. Die Menschen nicht und das Gericht erst recht nicht.
Auch war der Beweis nicht leicht beizubringen.