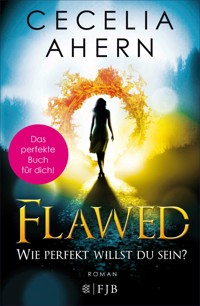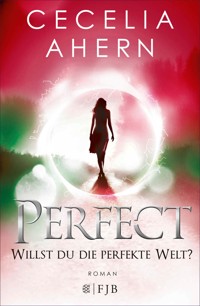9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Verfilmt mit Nicole Kidman, Cynthia Erivo und Alison Brie, von den Macherinnen von GLOW (Apple TV) 30 starke Frauen, 30 starke Geschichten. »Großartig!« Für Sie Bestseller-Autorin Cecelia Ahern erzählt mit unglaublicher Phantasie, Witz und Gedankenspielen von Frauen am Wendepunkt. Frauen, denen Flügel wachsen. Frauen, die aus ihren Schubladen herausklettern. Frauen, die im Boden versinken und dort andere Frauen treffen. Wortwörtlich. Weil wir alle einzigartig sind. Und weil wir alle etwas aus unserer eigenen Geschichte machen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Cecelia Ahern
Frauen, die ihre Stimme erheben. ROAR!
Über dieses Buch
»Dieses Buch ist für mich ein Herzensprojekt. Es geht um unsere eigene Stimme – um all die Momente, in denen Frauen sich erheben.« Cecelia Ahern
Wenn uns Flügel wachsen, wird plötzlich alles möglich; der Alltag wird wunderbar und das Leben phantastisch. Dreißig Frauen, dreißig Storys: 350 Seiten voller Überraschungen, Gefühl und Aha-Erlebnisse.
Da ist die Frau, die im Boden versinkt und dort auf jede Menge anderer Frauen trifft. Oder die Frau, die auf ihrem Grundstück Zweifel sät. Eine andere Frau, deren Uhr so laut tickt, dass sie nicht schlafen kann, und eine, die aus ihrer Schublade herausklettert. Lauter Frauen, denen gerade dann Flügel wachsen, wenn sie es gar nicht erwarten. So wie es für uns alle in jedem Moment möglich ist, wenn wir nur auf uns selbst hören.
In ihren Romanen berührt Cecelia Ahern Millionen Leserinnen und Leser. Mit diesem besonderen Story-Projekt stellt sie mit sprudelnder Phantasie und liebevollem Humor die Fragen, die uns bewegen: Wer bin ich in dieser Welt? Und wer bestimmt das eigentlich? Was ist mir wirklich wichtig? Und was ist für Frauen alles möglich?
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Cecelia Ahern ist eine der erfolgreichsten Autorinnen der Welt. Sie wurde 1981 in Irland geboren und studierte Journalistik und Medienkommunikation in Dublin. Mit 21 Jahren schrieb sie ihren ersten Roman, der sie sofort international berühmt machte: ›P.S. Ich liebe Dich‹, verfilmt mit Hilary Swank. Danach folgten Jahr für Jahr weitere weltweit veröffentlichte Bücher in Millionenauflage. Die Autorin wurde für ihr Werk vielfach ausgezeichnet, schreibt auch Theaterstücke und Drehbücher und konzipierte die TV-Serie ›Samantha Who?‹ mit Christina Applegate sowie einen Zweiteiler für das ZDF. Auch ihr Roman ›Für immer vielleicht‹ wurde fürs Kino verfilmt. Cecelia Ahern lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern im Norden von Dublin.
www.cecelia-ahern.com
Christine Strüh, geboren 1954, lebt in Berlin. Sie ist Übersetzerin von Gillian Flynn, Cecelia Ahern, Judy Blume, Pete Hamill, Laini Taylor und anderen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »Roar« im Verlag HarperCollins, London
© 2018 Cecelia Ahern
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung und -abbildung: www.buerosued.de
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490921-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Für all die Frauen, [...]
[Kapitel]
1 Die Frau, die langsam verschwand
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
2 Die Frau, die man ins Regal gestellt hatte
3 Die Frau, der Flügel wuchsen
4 Die Frau, die von einer Ente gefüttert wurde
5 Die Frau, die Bissspuren auf ihrer Haut entdeckte
6 Die Frau, die dachte, ihr Spiegel sei kaputt
7 Die Frau, die im Boden versank und dort auf andere Frauen traf
8 Die Frau, die das »Seelachs-Special« bestellte
9 Die Frau, die Fotos verspeiste
10 Die Frau, die ihren Namen vergaß
11 Die Frau, deren Uhr tickte
12 Die Frau, die Zweifel säte
13 Die Frau, die ihren Ehemann zurückgab
14 Die Frau, die ihren gesunden Menschenverstand verlor
15 Die Frau, die in die Schuhe ihres Mannes schlüpfte
16 Die Frau, die ein Spatzenhirn hatte
17 Die Frau, die ihr Herz quasi auf der Zunge trug
18 Die Frau, die Rosa trug
19 Die Frau, die abhob
20 Die Frau, die ein gutes Nervenkostüm besaß
21 Die Frau, die Frauensprache sprach
22 Die Frau, die die Welt in ihrer Auster fand
23 Die Frau, die die Hoden hütete
24 Die Frau, die in eine Schublade gesteckt wurde
25 Die Frau, die auf einen Zugwagen aufsprang
26 Die Frau, die lächelte
27 Die Frau, die dachte, anderswo wäre das Gras grüner
28 Die Frau, die völlig aufgelöst war
29 Die Frau, die sich das Beste herauspickte
30 Die Frau, die brüllt
Für all die Frauen, die …
I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore.
Helen Reddy und Ray Burton
1Die Frau, die langsam verschwand
1.
Es klopft leise, dann geht die Tür auf. Schwester Rada kommt herein und macht sie hinter sich wieder zu.
»Ich bin hier«, sagt die Frau leise.
Rada blickt im Zimmer umher, dem Klang der Stimme folgend.
»Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier«, wiederholt die Frau leise, bis Rada aufhört, nach ihr zu suchen.
Ihr Blick fixiert eine Stelle, die etwas zu hoch und zu weit links ist, also eher in Richtung der vom Regen schon fast weggewaschenen Vogelkacke auf der Fensterscheibe.
Die Frau sitzt auf dem Fensterbrett, von dem sie eine gute Aussicht über den ganzen Campus hat, und seufzt leise. Als sie in die Universitätsklinik kam, war sie so voller Hoffnung, hier geheilt zu werden, aber jetzt, sechs Monate später, fühlt sie sich wie eine Laborratte, deren Zustand Wissenschaftler und Ärzte trotz aller Bemühungen und aller ausgeklügelten Untersuchungen einfach nicht verstehen.
Festgestellt wurde lediglich eine seltene, komplizierte genetische Störung, durch die die Chromosomen der Frau immer mehr verblassen. Sie zerstören sich nicht selbst, sie hören auch nicht einfach auf zu arbeiten, sie mutieren nicht – sämtliche Organe im Körper funktionieren normal, alle Tests weisen darauf hin, dass die Frau gesund und wohlauf ist. Kurz gesagt, sie verschwindet, ist aber noch da.
Zunächst geschah es fast unmerklich. Zwar hörte die Frau des Öfteren Sätze wie: »Oh, ich hab dich gar nicht gesehen«, wurde angerempelt, oder jemand trat ihr auf die Zehen, aber es löste bei niemandem Alarm aus. Jedenfalls nicht zu Anfang.
Die Frau verschwand ganz gleichmäßig, das heißt, es fehlte ihr nicht erst eine Hand, dann plötzlich ein Zeh oder ein Ohr, nein, es geschah ganz allmählich; sie verblasste einfach immer mehr, wurde ein Schimmer, vergleichbar mit einem Hitzeschleier auf der Autobahn, eine schwache Silhouette mit einer flirrenden Mitte. Wenn man sich anstrengte, konnte man gerade eben noch erkennen, dass die Frau da war, je nach Hintergrund und Umgebung mal stärker, mal schwächer. Ziemlich schnell fand sie heraus, dass man sie in vollen und lebhaft dekorierten Räumen am besten sehen konnte – vor einer glatten Wand war sie praktisch unsichtbar. Also besorgte sie sich gemusterte Tapeten und dekorative Sesselbezüge, denn wenn die Muster hinter ihrem nahezu transparenten Körper verschwammen, stutzten die Leute, kniffen die Augen zusammen und schauten zweimal hin. Selbst als sie schon so gut wie unsichtbar war, kämpfte die Frau auf diese Weise weiter darum, wahrgenommen zu werden.
Nun wird die Frau seit Monaten nicht nur von Wissenschaftlern und Ärzten untersucht, sondern auch von zahlreichen Journalisten interviewt und von Fotografen fotografiert, die ihr ganzes Können einbringen, um sie bestmöglich auszuleuchten und ein einigermaßen stabiles Bild von ihr einzufangen. Aber keiner von all diesen Menschen hat ihr wirklich geholfen. Sicher, viele von ihnen waren nett und fürsorglich, aber je schlimmer die Lage der Frau wird, umso enthusiastischer werden sie. Sie ist dabei zu verschwinden, und niemand, kein noch so weltberühmter Experte kann ihr sagen, warum.
»Hier ist ein Brief für Sie!« Rada reißt die Frau aus ihrer Grübelei. »Den wollen Sie garantiert gleich lesen.«
Neugierig geworden, schiebt die Frau ihre Gedanken fürs Erste beiseite. »Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier«, sagt sie leise, wie man es ihr beigebracht hat. Den Umschlag in der Hand, folgt Rada dem Klang ihrer Stimme. Dann streckt sie die Hand aus und hält den Brief in die Luft.
»Danke«, sagt die Frau, nimmt ihn entgegen und betrachtet ihn eingehend. Zwar ist der Umschlag aus teurem altrosa Papier, aber er erinnert sie an eine Einladung zum Kindergeburtstag, und sie spürt die gleiche erwartungsvolle Spannung. Dass Rada so aufgeregt ist, weckt ihre Neugier. Post ist nichts Ungewöhnliches, jede Woche treffen Dutzende Briefe ein: von Experten, die der Frau ihre Dienste anbieten, von Schmeichlern, die mit ihr Freundschaft schließen, von religiösen Fanatikern, die sie ins Exil schicken wollen, von schmierigen Männern, die sie anflehen, ihre perversen Wünsche an ihr ausleben zu dürfen, weil sie nicht sichtbar, aber fühlbar ist. Doch sie muss zugeben, dass dieser Umschlag, auf dem in wunderschöner Schnörkelschrift ihr Name steht, einen ganz anderen Eindruck erweckt.
»Ich glaube, ich weiß, woher der Brief kommt«, verkündet Rada und setzt sich neben die Frau.
Vorsichtig öffnet die Frau den teuren Umschlag. Er hat etwas zugleich Luxuriöses und zutiefst Hoffnungsvolles, fast Tröstliches an sich. Sie zieht eine handgeschriebene Karte heraus.
»Professor Elizabeth Montgomery«, lesen die Frau und Rada einstimmig vor.
»Hab ich’s doch gewusst!«, ruft Rada, greift nach der Hand, in der die Frau die Karte hält, und drückt sie fest.
2.
»Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier«, wiederholt die Frau, als das Pflegepersonal erscheint, um ihr beim Umzug in die neue Einrichtung zu helfen, die nun – keiner weiß, für wie lange – ihr Zuhause werden soll. Rada und ein paar andere Schwestern, mit denen die Frau sich angefreundet hat, begleiten sie aus dem Zimmer und bringen sie zu der Limousine, die Professor Elizabeth Montgomery eigens für sie hergeschickt hat. Nicht alle Ärzte sind da, um sich zu verabschieden; einige bleiben fern, um dagegen zu protestieren, dass die Frau die Klinik verlässt, in der man sich doch mit ihr und ihrem Fall so viel Mühe gegeben hat.
»Ich bin drin«, verkündet die Frau leise, und die Autotür schließt sich.
3.
In keiner Phase war das Verschwinden mit körperlichen Schmerzen verbunden. Doch die Gefühle, die damit einhergingen, standen auf einem ganz anderen Blatt.
Schon seit einiger Zeit hatte die Frau das Gefühl gehabt zu verschwinden, ungefähr seit sie fünfzig geworden war. Vor drei Jahren war ihr dann zum ersten Mal die körperliche Veränderung aufgefallen. Der Prozess verlief langsam, aber stetig. Oft bekam sie zu hören: »Ich hab dich gar nicht gesehen« oder: »Wann bist du denn reingekommen, ich dachte, du wärst nicht da.« Immer wieder hielten Kollegen mitten im Gespräch inne, um ihr den Anfang einer Geschichte zu erklären, obwohl sie die ganze Zeit neben ihnen gestanden und alles mitbekommen hatte. Sie wurde es müde, anderen ständig erklären zu müssen, dass sie längst da war, aber im Lauf der Zeit machte ihr die Häufigkeit solcher Kommentare zunehmend Sorgen. Sie fing an, sich farbenfroher zu kleiden, ließ sich Strähnchen in die Haare machen, sprach lauter, äußerte immer ihre Meinung, bewegte sich mit stampfenden Schritten – kurz, sie tat alles, um Aufmerksamkeit zu erregen. Manchmal hätte sie jemanden am liebsten gepackt und den Kopf des Betreffenden in ihre Richtung gedreht, um einen Blickkontakt zu erzwingen. Immer wieder kämpfte sie mit dem Impuls zu schreien: Schaut mich doch an!
An den schlimmsten Tagen ging sie überfordert und verzweifelt nach Hause und musste erst mal in den Spiegel schauen, um sich zu vergewissern, dass sie überhaupt noch da war. Da sich ihr in der U-Bahn immer öfter der Verdacht aufdrängte, dass sie endgültig verschwunden war, steckte sie schließlich einen Taschenspiegel ein, den sie von nun an stets bei sich trug.
Sie war in Boston aufgewachsen und dann nach New York gezogen, weil sie dachte, eine Stadt mit acht Millionen Einwohnern wäre der ideale Ort, um Freundschaft, Liebe und gute Beziehungen zu finden und ein erfülltes Leben zu führen. Lange Zeit klappte es auch ganz gut, aber irgendwann begann sie sich einsam zu fühlen, und zwar umso einsamer, je mehr Menschen um sie herum waren – es war, als verstärke sich dadurch ihre Einsamkeit. Sie arbeitet nicht mehr; vorher hatte sie einen Job bei einem Finanzdienstleister, der in 156 Ländern hundertfünfzigtausend Menschen beschäftigte. In ihrem Bürogebäude in der Park Avenue arbeiteten fast dreitausend Angestellte. Aber die Jahre vergingen, und auch dort kam sie sich zunehmend übergangen und unsichtbar vor.
Mit achtunddreißig Jahren stellten sich bei ihr vorzeitig die Wechseljahre ein, und zwar sehr heftig. Nachts im Bett schwitzte sie oft so, dass sie zweimal die Laken wechseln musste, und in ihrem Innern entwickelte sich eine explosive Wut und Frustration. In dieser Zeit war sie am liebsten allein. Bestimmte Stoffe reizten ihre Haut und lösten Hitzewallungen aus, was wiederum wütende Ausraster nach sich zog. Innerhalb von zwei Jahren nahm sie zehn Kilo zu. Zwar kaufte sie sich neue Kleider, aber nichts fühlte sich richtig an, nichts passte wirklich. Sie fühlte sich einfach nicht wohl in ihrer Haut. Vor allem in männerdominierten Meetings wurde sie rasch unsicher, obwohl sie dieses Problem bisher nie gekannt hatte. Sie war überzeugt, dass jeder Mann im Raum wusste, was mit ihr los war, dass alle die plötzlich aufsteigende Röte an ihrem Hals, die Schweißperlen auf ihrem Gesicht bemerkten und dass jeder es mitkriegte, wenn ihr mitten in einer Präsentation oder einem Geschäftsessen plötzlich die Klamotten am Leib klebten. In dieser Phase konnte die Frau es nicht ertragen, wenn jemand sie anschaute. Sie wollte von niemandem gesehen werden.
Wenn sie abends ausging, sah sie schöne junge Körper, die in knappen Kleidern und auf absurd hohen Absätzen zu Songs tanzten, die sie gut kannte und hätte mitsingen können – schließlich lebte sie ja auch auf diesem Planeten, selbst wenn er nicht mehr für sie gemacht zu sein schien und die Männer in ihrem Alter den jungen Frauen auf der Tanzfläche mehr Aufmerksamkeit schenkten als ihr.
Dabei ist sie noch immer ein wertvoller Mensch, der der Welt etwas zu bieten hat. Nur fühlt es sich für sie nicht so an.
Inzwischen kennt jeder sie aus Zeitungsberichten als »die Frau, die verschwindet« oder »die Frau, die sich auflöst« – mit ihren inzwischen achtundfünfzig Jahren hat sie weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Aber keiner der aus der ganzen Welt angereisten Spezialisten, die ihren Körper und ihren Geisteszustand untersucht haben, ist zu einem überzeugenden Schluss gelangt, viele sind unverrichteter Dinge und enttäuscht wieder abgezogen. Dennoch wurden wissenschaftliche Aufsätze veröffentlicht, Preise verliehen und Koryphäen mit Beifall überschüttet.
Vor sechs Monaten kam der letzte Schub. Inzwischen ist die Frau nur noch ein schimmernder Schemen und sehr erschöpft. Sie weiß, dass die mit großem Enthusiasmus angereisten Spezialisten sie nicht heilen können. Jedes Mal, wenn einer von ihnen die Hoffnung aufgibt, sinkt auch die Zuversicht der Frau wieder ein Stück.
4.
Doch als sie sich ihrem Ziel in Provincetown auf Cape Cod nähern, machen Unsicherheit und Angst plötzlich einer ganz neuen Zuversicht Platz. Professor Elizabeth Montgomery erwartet sie schon an der Tür ihrer Praxis, einem ehemaligen Leuchtturm, der auf die Frau wie ein mächtiges Fanal der Hoffnung wirkt.
Der Fahrer öffnet die Tür der Limousine. Die Frau steigt aus.
»Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier«, sagt sie, während sie den Weg hinaufgeht, um Professor Montgomery zu begrüßen.
»Was in aller Welt reden Sie denn da?«, fragt die Ärztin stirnrunzelnd.
»Das hat man mir so beigebracht«, antwortet die Frau leise. »Damit die Leute wissen, wo ich bin.«
»Das können Sie hier ruhig bleibenlassen«, erklärt Professor Montgomery etwas barsch.
Zuerst fühlt die Frau sich zurechtgewiesen und ärgert sich, weil sie, kaum angekommen, gleich ins Fettnäpfchen getreten ist, aber dann merkt sie, dass Professor Montgomery ihr direkt in die Augen schaut. Sie legt der Frau eine Kaschmirdecke um die Schultern und führt sie die Stufen zu dem Leuchtturm hinauf, während der Fahrer das Gepäck holt. So wie Professor Montgomery hat – abgesehen von der Campuskatze – seit langer Zeit die Frau niemand mehr angesehen.
»Willkommen im ›Montgomery-Leuchtturm für Frauen auf dem Vormarsch‹«, beginnt Professor Montgomery und öffnet die Tür. »Der Name ist ein bisschen eitel und sperrig, aber er hat sich durchgesetzt. Anfangs haben wir unsere Einrichtung ›Montgomery Retreat für Frauen‹ genannt, aber das habe ich ziemlich bald geändert. In ›Retreat‹ schwingt immer der Rückzug mit, mit allen seinen negativen Implikationen. Aber wir gehen unseren Schwierigkeiten hier nicht aus dem Weg, wir fliehen nicht vor Situationen, die uns gefährlich oder unangenehm erscheinen. Ganz im Gegenteil. Wir sind auf dem Vormarsch, wir kommen voran, wir blicken in die Zukunft, wir entwickeln uns weiter.«
Ja! Genau das braucht die Frau. Keinen Rückzug, kein Ausweichen. Sie möchte die Vergangenheit hinter sich lassen.
Professor Montgomery führt sie in den Empfangsbereich. Hier ist der Leuchtturm zwar immer noch sehr schön, aber auch irgendwie unheimlich und leer.
»Tiana, das ist unser neuer Gast.«
Auch Tiana blickt der Frau direkt in die Augen und drückt ihr einen Zimmerschlüssel in die Hand. »Herzlich willkommen.«
»Danke«, flüstert die Frau. »Warum kann sie mich sehen?«, fragt sie die Ärztin leise im Weitergehen.
Aber Professor Montgomery legt ihr nur aufmunternd die Hand auf die Schulter. »Es gibt viel zu tun. Am besten, wir legen gleich los, ja?«
Ihre erste Sitzung findet in einem der Zimmer statt, von denen man einen herrlichen Blick auf den Strand von Race Point hat. Hier, wo man die Wellen ans Ufer schlagen und die Möwen kreischen hört, wo man die salzige Seeluft und das Aroma der Duftkerzen einatmet, erinnert nichts an die typische sterile Klinikatmosphäre, in der die Frau so lange eingesperrt war. Hier kann sie sich endlich entspannen.
Professor Montgomery nimmt in einem mit dicken weichen Kissen gepolsterten Korbsessel Platz und gießt Pfefferminztee in zwei überhaupt nicht zusammenpassende Tassen. Die Ärztin ist sechsundsechzig Jahre alt, hochintelligent und hochdekoriert, Mutter von sechs Kindern, geschieden, zum zweiten Mal verheiratet und das glamouröseste Wesen, dem die Frau je begegnet ist.
»Meine Hypothese«, beginnt sie und zieht die Beine auf den Sessel, »meine Hypothese lautet, dass Sie sich selbst zum Verschwinden gebracht haben.«
»Ich bin also selbst schuld daran?«, fragt die Frau, hört ihre Stimme lauter werden und spürt Wut und Hitze in sich aufsteigen. Der kurze Moment der Entspannung ist schon wieder vorüber.
Professor Montgomery lächelt ihr zauberhaftes Lächeln. »Aber ich gebe nicht Ihnen allein die Schuld daran. Mindestens ebenso verantwortlich ist die Gesellschaft, in der wir leben. Die zum Beispiel junge Frauen vergöttert und sexualisiert. Die der äußerlichen Schönheit und Attraktivität viel zu viel Bedeutung beimisst. Die Frauen unter Druck setzt, den Erwartungen anderer gerecht zu werden, auf eine Art, die Männer nicht kennen.«
Ihre Stimme ist hypnotisierend. Sanft. Aber bestimmt. Ohne Wut. Sie wertet nicht. Sie ist weder bitter noch traurig. Sie ist einfach, wie sie ist. Weil alles ist, wie es ist.
Die Frau bekommt eine Gänsehaut und setzt sich auf, ihr Herz pocht. So etwas hat sie noch nie gehört. Seit vielen Monaten ist dies die erste wirklich neue Hypothese, und sie berührt die Frau in Körper und Seele.
»Wahrscheinlich können Sie sich vorstellen, dass viele meiner männlichen Kollegen meine Einschätzung nicht teilen«, fügt die Ärztin trocken hinzu und nippt an ihrem Tee. »Für sie ist das eine bittere Pille, schwer zu schlucken. Deshalb habe ich angefangen, mein eigenes Ding zu machen. Sie sind nicht die erste verschwindende Frau, die zu mir kommt.« Die Frau sperrt die Augen auf.
»Ich habe viele Frauen getestet und analysiert, genau wie die Experten es mit Ihnen gemacht haben«, fährt Professor Montgomery fort. »Aber es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich begriffen habe, wie man diesen Zustand erfolgreich behandeln kann – ich musste erst ein bisschen älter werden, um es wirklich zu durchschauen.
Zu meinen wichtigsten Themen, zu denen ich viel geforscht und über die ich viel veröffentlicht habe, gehört die Tatsache, dass Frauen, wenn sie älter werden, zunehmend aus der Wahrnehmung der Gesellschaft verschwinden. Weder im Fernsehen noch in Filmen noch in den gängigen Modezeitschriften tauchen sie noch auf. Wenn überhaupt, dann lässt man sie im Vorabendprogramm über das Nachlassen ihrer Körperfunktionen oder sonstige Alterserscheinungen erzählen oder für Mittelchen Werbung machen, die den Alterungsprozess bekämpfen sollen. Als müsste man das Älterwerden besiegen. Klingt das vertraut für Sie?«
Die Frau nickt.
Professor Montgomery macht weiter: »Im Fernsehen werden ältere Frauen gern als neidzerfressene Hexen dargestellt, die einem Mann oder einer jungen Frau das Leben vermiesen, oder sie sind passiv und unfähig, ihr eigenes Leben zu leben. Frauen über fünfundfünfzig existieren auch als Zielgruppe so gut wie überhaupt nicht mehr. Es ist, als wären sie einfach nicht mehr da. Und ich habe festgestellt, dass Frauen, die so behandelt werden, dies häufig verinnerlichen. Meine Erkenntnisse werden gern als feministische Tiraden abgetan, aber es ist kein leeres Geschwätz, es sind Beobachtungen.« Wieder nippt sie an ihrem Pfefferminztee und schaut zu, wie die Frau, die zu verschwinden drohte, langsam realisiert, was sie da hört.
»Sie haben also vor mir schon andere Frauen wie mich getroffen?«, fragt die Frau, noch immer verblüfft.
»Tiana, die am Empfangspult sitzt, war vor zwei Jahren, als sie hierhergekommen ist, genau im gleichen Zustand wie Sie jetzt.«
Professor Montgomery hält inne und lässt der Frau Zeit, den Satz auf sich wirken zu lassen.
»Wen haben Sie gesehen, als Sie reingekommen sind?«, fragt sie dann.
»Tiana«, antwortet die Frau.
»Wen noch?«
»Sie.«
»Und sonst?«
»Niemanden.«
»Dann schauen Sie doch bitte noch mal genau hin.«
5.
Die Frau steht auf und geht zum Fenster. Sie sieht das Meer, den Strand, einen großen Garten. Doch dann stutzt sie, denn auf einmal entdeckt sie auf einer Schaukel auf der Veranda ein Schimmern und erkennt daneben eine schemenhafte Gestalt mit langen schwarzen Haaren, die aufs Wasser hinausblickt. Im Garten kniet eine fast transparente Figur und pflanzt Blumen. Je länger die Frau hinschaut, desto mehr andere Frauen sieht sie, alle in unterschiedlichen Stadien der Auflösung. Wie Sterne, die abends am dunkel werdenden Himmel auftauchen – je mehr sich ihre Augen daran gewöhnen, desto mehr entdeckt sie. Überall sind Frauen. Bei ihrer Ankunft ist sie an ihnen allen vorbeigegangen, ohne sie zu bemerken.
»Auch Frauen müssen lernen, andere Frauen zu sehen«, erklärt Elizabeth Montgomery. »Wenn wir einander nicht sehen, wenn wir uns selbst nicht sehen, wie können wir dann erwarten, dass andere uns wahrnehmen?« Die Frau ist überwältigt. »Die Gesellschaft hat Ihnen beigebracht, dass Sie nicht wichtig sind, dass Sie nicht existieren, und Sie haben gedacht, das ist die Wahrheit. Sie haben die Botschaft in sich aufgenommen, haben ihr erlaubt, Sie von innen her zu zerfressen. Sie haben sich selbst gesagt, dass Sie nicht wichtig sind, und Sie haben es sich geglaubt.«
Die Frau nickt überrascht.
»Also, was müssen Sie jetzt tun?« Montgomery legt die Hände um ihre Tasse und wärmt sich, ihre Augen bohren sich in die der Frau, als würden sie mit einem tieferen Teil von ihr kommunizieren, Signale senden, Informationen übertragen.
»Ich muss darauf vertrauen, dass ich wieder erscheine«, sagt die Frau schließlich, aber ihre Stimme klingt heiser, als hätte sie seit Jahren nicht mehr gesprochen. Sie räuspert sich.
»Da ist noch mehr«, ermuntert Montgomery sie.
»Ich muss an mich glauben.«
»Die Gesellschaft redet uns ja ständig ein, dass wir an uns glauben sollen«, meint Montgomery wegwerfend. »Das ist leicht gesagt, Worte sind billig. Woran müssen Sie denn im Einzelnen glauben?«
Die Frau denkt nach, dann wird ihr klar, dass es hier um mehr geht als nur darum, die richtigen Antworten zu finden. Woran möchte sie glauben?
»Dass ich wichtig bin, dass ich gebraucht werde, dass ich eine Bedeutung habe, dass ich nützlich bin und etwas gelte.« Sie zögert und schaut auf ihre Tasse. »Und sexy.« Langsam atmet sie durch die Nase ein und aus, allmählich baut sie Selbstvertrauen auf. »Dass ich ein wertvoller Mensch bin. Dass ich Potential habe, dass mir Möglichkeiten offenstehen, dass ich immer noch neue Herausforderungen annehmen kann. Dass ich etwas beizutragen habe. Dass ich interessant bin. Dass ich noch lange nicht am Ende bin. Dass ich hier bin und dass die Leute das wissen sollen.« Beim letzten Satz bricht ihre Stimme.
Professor Montgomery stellt ihre Tasse auf dem Glastisch ab und greift nach den Händen der Frau. »Ich jedenfalls weiß, dass Sie hier sind. Ich sehe Sie.«
In diesem Augenblick weiß die Frau, dass sie zurückkommen wird. Dass es einen Weg für sie gibt. Für den Anfang wird sie sich auf ihr Herz konzentrieren. Danach wird alles andere von selbst kommen.
2Die Frau, die man ins Regal gestellt hatte
Es begann kurz nach ihrem ersten Date, die Frau war sechsundzwanzig, alles prickelte und war funkelnagelneu. Sie hatte früh Feierabend gemacht, um zu ihrem neuen Freund zu fahren; den ganzen Tag schon hatte sie die Stunden gezählt bis zu ihrem Wiedersehen. Tatsächlich traf sie Ronald zu Hause an, er war damit beschäftigt, ein Regalbrett an der Wand anzubringen.
»Was machst du denn da?« Die Frau musste lachen, als sie das angestrengte Gesicht ihres Freunds sah, verschwitzt und schmutzig vom Heimwerken, aber mit großer Leidenschaft bei der Sache. Jetzt fand sie ihn noch attraktiver als vorher.
»Ich wollte ein Wandregal für dich machen.« Er sah sie kaum an, sondern hämmerte eifrig den nächsten Nagel ein.
»Ein Wandregal?!«
Aber er hämmerte unbeirrt weiter und checkte schließlich, ob das Brett richtig hing.
»Willst du damit andeuten, dass es dir gefallen würde, wenn ich bei dir einziehe?«, lachte sie, und ihr Herz klopfte. »Ich glaube, eigentlich musst du dann eine Schublade für mich vorbereiten, kein Regalbrett.«
»Natürlich möchte ich, dass du bei mir wohnst. Am liebsten ab sofort. Außerdem wünsche ich mir, dass du deinen Job an den Nagel hängst und dich auf diesem Wandregal niederlässt, damit jeder dich anschauen und bewundern kann. Damit jeder sieht, was ich sehe, nämlich die schönste Frau der Welt. Du musst keinen Finger rühren. Du musst überhaupt nichts tun. Weiter nichts, als auf diesem Brett sitzen und geliebt werden.«
Ihr wurde ganz warm ums Herz, Tränen traten ihr in die Augen. Schon am nächsten Tag nahm die Frau auf dem Brett Platz. Eineinhalb Meter über dem Boden, in der rechten Nische des Wohnzimmers, gleich neben dem Kamin, so traf sie Ronalds Familie und seine Freunde zum ersten Mal. Alle standen mit ihren Drinks um Ronalds neue große Liebe herum und bewunderten sie. Dann setzten sie sich an den Esstisch im Esszimmer nebenan, und obwohl die Frau nicht alle sehen konnte, konnte sie sie doch hören und sich nach Belieben ins Gespräch einschalten, wenn sie es wollte. Sie hatte das Gefühl, über allen zu schweben – angebetet, geliebt, respektiert von Ronalds Freunden, verehrt von seiner Mutter, beneidet von seinen Exfreundinnen. Immer wieder blickte Ronald stolz zu ihr empor, und sein strahlendes Gesicht sprach Bände. Du gehörst mir. Jung und begehrenswert, so glänzte und glitzerte sie neben der Vitrine mit seinen Pokalen, die an die Fußballtriumphe seiner Jugend und die Golferfolge neueren Datums erinnerten. Über dem Schränkchen hing, montiert auf eine mit einer kleinen Messingtafel versehenen Holzplatte, eine braune Forelle: der größte Fisch, den Ronald auf einem Angeltrip mit seinem Vater und seinem Bruder gefangen hatte. Für das Wandboard hatte er die Forelle eigens umgehängt, und deshalb betrachteten seine männlichen Freunde die Frau mit noch größerem Respekt. Und wenn ihre Familie und ihre Freunde zu Besuch kamen, konnten sie in dem Bewusstsein nach Hause gehen, dass die Frau an einem sicheren Ort untergebracht war, wo sie nicht nur vor allen Gefahren geschützt, sondern vergöttert und vor allem geliebt wurde.
Für ihren Mann war die Frau das Wichtigste auf der ganzen Welt. Alles drehte sich um sie und ihren Platz in seinem Zuhause, in seinem Leben. Er schmeichelte ihr, er verwöhnte sie und legte großen Wert darauf, dass sie ständig auf ihrem Wandboard zu finden war. Nur am Putztag gab es einen einzigen Moment, der dem Gefühl, so überaus wichtig zu sein, das Wasser reichen konnte. An diesem Tag ging Ronald nämlich sämtliche Trophäen durch und polierte sie auf Hochglanz. Dann hob er selbstverständlich auch seine Frau vom Regal, legte sie hin, und sie liebten sich. Blitzblank, mit neuem Glanz und voll frischer Energie, so kletterte sie dann wieder hinauf auf ihr Regalbrett.
Sie heirateten, die Frau kündigte ihren Job, kümmerte sich um die Kinder, verhätschelte sie, versorgte sie in schlaflosen Nächten auf dem Wandboard und beobachtete sie dann, wenn sie einschliefen, wie sie auf der Wolldecke oder im Laufstall unter ihr Babylaute machten und nach und nach immer größer wurden.
Da Ronald es am liebsten hatte, wenn die Frau allein auf dem Brett war, stellte er für die Kinder ein Kindermädchen ein. So konnte die Frau auch weiterhin den Platz einnehmen, den er für sie erbaut hatte, nichts von ihr ging an die Kinder verloren, und die besondere Beziehung zwischen ihr und ihrem Mann veränderte sich nicht.
Gelegentlich hörte die Frau Geschichten von Paaren, die sich trennten, nachdem sie eine Familie gegründet hatten, und von Ehemännern, die sich nach der Geburt eines Babys vernachlässigt fühlten. Das wollte sie um jeden Preis vermeiden, sie wollte immer für ihren Mann da sein, und sie wollte sich immer über alles geliebt fühlen. Das Wandregal war ihr Platz. Von dort kümmerte sie sich um alle, und weil sie im Haus eine so zentrale Stellung hatte, blickten alle zu ihr auf.
Doch als die Kinder groß waren und das Haus verlassen hatten, begann sich, zwanzig Jahre nachdem die Frau zum ersten Mal auf das Brett geklettert war, die Einsamkeit in ihr auszubreiten.
Und zwar unüberhörbar wie eine Alarmglocke.
Begonnen hatte es mit der Aufstellung des neuen Fernsehers. Die Frau konnte den Bildschirm nicht sehen, wenn Ronald sich etwas anschaute. Bisher hatte sie das gar nicht gestört, denn sie betrachtete sowieso lieber die Gesichter ihrer Kinder beim Fernsehen als den Fernseher selbst, aber jetzt war die Couch leer, das Zimmer still, und die Frau brauchte Ablenkung und ein bisschen Wirklichkeitsflucht. Sie sehnte sich nach Gesellschaft. Nun hatte Ronald einen neuen Fernseher gekauft, einen Flachbildschirm, den man an die Wand hängte, so dass er nicht gedreht werden konnte. Nicht nur die Kinder waren weg, die Frau konnte auch nicht fernsehen.
Dazu kamen noch die Besuchsabende, die Ronald seit einiger Zeit regelmäßig veranstaltete, ohne seine Frau einzuladen oder ihr auch nur etwas davon zu sagen. Es kamen Leute, die sie zum Teil überhaupt nicht kannte, auch Frauen, die ihr nicht geheuer waren – in ihrem eigenen Haus, direkt vor ihrer Nase. Von oben sah sie, wie Ronalds Leben unter ihr ohne sie weiterging, so als gehöre sie nicht mehr dazu. Noch lächelte sie, um ihre Irritation zu verbergen. Sie versuchte, den Kontakt aufrechtzuerhalten, mitzumachen, aber die anderen hörten sie kaum, sie waren es müde, ständig zu ihr hochzuschauen, es war ihnen inzwischen auch zu viel Mühe, ihretwegen lauter zu sprechen. Ronald dachte auch nicht mehr daran, ihr nachzuschenken, wenn ihr Glas leer war, er schaute nicht mehr nach ihr, geschweige denn, dass er sie den Gästen vorstellte. Es war, als hätte er komplett vergessen, dass sie überhaupt da war.
Vor ein paar Monaten hatte er angefangen, das Haus auszubauen, von der Küche zum Garten hin. Dort empfing er nun die Gäste und servierte das Essen. Das Fernsehzimmer, bisher der wichtigste Raum, Zentrum des ganzen Hauses, war zum kleinen gemütlichen Freizeitzimmer degradiert worden, hatte all seine Pracht verloren, und in der Frau machte sich immer mehr das Gefühl breit, dass sie gar keinen Platz mehr im Leben ihres Mannes hatte.
»Ronald«, sprach sie ihn eines Samstagabends an, als sie den ganzen Tag allein verbracht hatte, weil er auf dem Golfplatz gewesen war und die Kinder ihr eigenes Leben lebten.
Er saß auf dem Sofa und schaute sich im Fernsehen etwas an, was die Frau natürlich nicht sehen konnte. Er gab einen Laut von sich, blickte aber nicht zu ihr herauf.
»Ich hab das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt«, fuhr sie fort. Sie hörte das Zittern in ihrer Stimme, ihr war eng um die Brust. Als du mich hierhergebracht hast, sollten alle Leute mich sehen, ich war das Zentrum deines Lebens, aber jetzt … jetzt läuft alles weit weg von mir ab, ohne mich. Ich fühle mich abgehängt.
Aber sie konnte es nicht aussprechen, die Worte kamen ihr einfach nicht über die Lippen. Schon der Gedanke machte ihr Angst. Sie mochte ihr Wandregal, sie fühlte sich wohl hier, es war ihr Platz, den sie schon so lange innehatte, sie wollte bleiben, wo sie war. Ihr Mann hatte ihr alle Sorgen und Verpflichtungen abgenommen, er hatte alles für sie erledigt.
»Möchtest du ein anderes Kissen?«, fragte er schließlich, nahm ein Sofakissen und warf es ihr zu. Sie fing es auf, schaute erst das Kissen, dann Ronald an, und ihr Herz klopfte wild, etwas in ihrem Inneren schmerzte. Ronald stand auf.
»Ich kann dir ein neues Kissen kaufen, ein größeres«, sagte er und stellte den Fernseher mit der Fernbedienung leiser.
»Aber ich möchte kein neues Kissen«, sagte sie leise, erstaunt über ihre Antwort, denn sonst hatte sie sich immer über solche Dinge gefreut.
Es war, als hätte er sie nicht gehört, vielleicht ignorierte er sie aber auch. Sie wusste es nicht.
»Ich bin mal für ein paar Stunden weg, bis später dann«, verkündete er und stand auf.
Wie in Schockstarre blickte sie auf die Tür, als sie hinter ihm ins Schloss gefallen war, und hörte, wie das Auto ansprang.
Es war ganz allmählich passiert, im Lauf der Jahre, aber für sie war dies ein Augenblick der Erkenntnis. Auf einmal ergaben all die kleinen Anzeichen ein Bild, und es war so eindeutig, dass sie fast von ihrem Brett gefallen wäre. Ihr Mann hatte sie hierhergesetzt, seine kostbare Frau, die er vergötterte, die er beschützen und die er allen zeigen wollte, und jetzt, nachdem man sie oft genug gesehen und bewundert hatte, nachdem jeder ihm zu seinen Errungenschaften gratuliert hatte, erfüllte sie keinen Zweck mehr. Jetzt war sie nichts anderes mehr als ein Möbelstück in einem Fernsehzimmer, ein Dekorationsobjekt wie seine Sporttrophäen. Ronalds vor langer Zeit bejubelte Heldentaten. Die Frau konnte sich nicht einmal mehr erinnern, wann er sie das letzte Mal zum Putzen und Polieren heruntergeholt hatte.
Zum ersten Mal merkte sie, wie unbequem es hier oben war, sie war schon ganz steif geworden. Ihr Körper brauchte dringend Bewegung. Sie musste sich strecken. Sie brauchte Platz, um zu wachsen. Sie hatte so viele Jahre auf diesem Wandbrett gesessen als Anhängsel von Ronald und seinen Leistungen, dass sie gar nicht mehr wusste, wer sie selbst war. Doch dafür konnte sie ihn nicht verantwortlich machen, schließlich war sie aus freien Stücken auf dieses Wandregal geklettert. Egoistisch und begierig hatte sie die Zuwendung entgegengenommen, das Lob, den Neid, die Bewunderung. Ihr hatte es gefallen, etwas Besonderes zu sein, gefeiert zu werden, ihrem Mann zu gehören. Aber sie war dumm gewesen. Nicht weil sie es schön gefunden hatte, sondern weil sie geglaubt hatte, nur darauf käme es an.
Ihre Gedanken drehten sich im Kreis, das Kissen, das sie umklammert hielt, rutschte ihr aus den Händen und landete mit einem sanften Pffft auf dem Plüschteppich. Sie betrachtete es, wie es da lag, und dann überkam sie die nächste Erkenntnis.
Sie konnte das Wandboard verlassen, sie konnte hinabsteigen. Natürlich hatte sie diese Möglichkeit schon immer gehabt, aber aus irgendeinem Grund schien dieses Brett ihr Platz zu sein, ihr angestammter Platz, und niemand verließ doch freiwillig seinen Platz, um sich dann deplatziert zu fühlen. Bei diesem neuen, gefährlichen Gedanken beschleunigte sich ihr Atem, Staub verfing sich in ihrer Kehle, sie hustete und hörte zum ersten Mal ein Rasseln in ihrer Brust.
Da sie keine Lust hatte zu verstauben, kletterte sie langsam hinunter, stellte einen Fuß auf den Sessel, auf dem Ronald vor der Zeit des Flachbildschirms immer gesessen und ihre Füße massiert hatte. Da sie nur Socken trug, rutschte ihr Fuß von der Armlehne, und als sie haltsuchend die Hand ausstreckte, griff sie ins Maul der braunen Forelle. Unter ihrem Gewicht geriet die Forelle heftig ins Schaukeln – sie war all die Jahre nur mit einem einzigen Nagel befestigt gewesen, ziemlich riskant bei etwas so Wichtigem, da hätte ihr Mann doch für mehr Stabilität sorgen müssen. Bei dem Gedanken musste die Frau grinsen. Die Forelle schlingerte an ihrem Nagel, und im gleichen Moment, als die Frau sich auf den Sessel fallen ließ, stürzte sie ab, direkt auf das Glasschränkchen, Heimstätte der Fußball- und Golftrophäen. Krawumm, alles brach in Stücke. Dann wurde es ganz still.
Langsam setzte die Frau einen Fuß auf den Boden. Dann den anderen. Richtete sich vorsichtig auf und hörte dabei ihre steifen Gelenke knacken. Der ihren Augen so vertraute Boden war ihren Füßen vollkommen unbekannt. Sie grub die Zehen in den Teppich, drückte die Fußsohlen tief in die weichen Fasern, verwurzelte sich in dem, was sich unter ihr so neu anfühlte. Jetzt, wo ihre Perspektive sich verändert hatte, fühlte sich der Raum fremd an, wenn sie sich umschaute. Aber sie spürte, dass sie mit ihrem neuen Leben unbedingt etwas anfangen musste.
Als Ronald vom Pub zurückkehrte, fand er sie mit einem Golfschläger in der Hand, seinem besten Driver. Auf dem Boden lagen seine sämtlichen Fußball- und Golftrophäen in einem Meer von Glasscherben. Mit ihren toten Augen blickte die braune Forelle aus dem Chaos zu ihm empor.
»Es wurde mir zu staubig da oben«, erklärte die Frau etwas außer Atem und schwang wieder den Golfschläger. Weil es sich so gut anfühlte, wiederholte sie die Bewegung.
Das Holzregal splitterte, Späne flogen durch die Gegend. Die Frau duckte sich schnell. Auch Ronald ging in Deckung.
Als er langsam und vorsichtig den Arm wieder vom Gesicht zog, sah er so geschockt aus, dass die Frau lachen musste.
»Meine Mutter hat ihre schicken Handtaschen alle in Plastikfolie gepackt und im Schrank verstaut, damit sie schön blieben für besondere Gelegenheiten. Aber da lagen sie dann herum, bis sie tot war. All diese hübschen, heißgeliebten Dinge haben so gut wie nie das Tageslicht erblickt, weil ihr die seltenen besonderen Gelegenheiten in ihrem Leben nicht besonders genug erschienen. Immer hat sie darauf gewartet, dass etwas noch Tolleres passieren würde – statt die Taschen einfach zu benutzen und sich mit ihnen den Alltag zu versüßen. Sie hat mir immer gesagt, ich wüsste die Dinge nicht genügend zu schätzen und sollte meine Habseligkeiten mehr in Ehren halten, aber wenn sie jetzt hier wäre, würde ich ihr sagen, dass sie es war, die alltägliche Dinge nicht zu würdigen wusste. Sie hätten das normale Leben wertvoller machen können, aber stattdessen hat sie das Potential, das ihr zur Verfügung stand, im Schrank versteckt.«
Ronald machte den Mund auf und schloss ihn wieder, ohne dass ein Wort herauskam. Irgendwie ähnelte er der gerahmten Forelle, die zerschmettert auf dem Boden lag.
»Und deshalb«, erklärte die Frau mit fester Stimme, während sie erneut den Golfschläger schwang, »deshalb bleibe ich hier unten.«
Und so geschah es.
3Die Frau, der Flügel wuchsen
Der Arzt meinte, die Hormone seien schuld. Nicht nur sprossen seit der Geburt ihrer Babys plötzlich einzelne Haare auf ihrem Kinn, auch die Knochen auf ihrem Rücken traten immer deutlicher unter der Haut hervor, wie Äste eines Baums, ausgehend von der Wirbelsäule. Sie wollte sich nicht röntgen lassen, wie der Arzt es ihr empfohlen hatte, sie hörte auch nicht auf die Warnungen hinsichtlich Knochendichte und drohender Osteoporose, denn was sie in ihrem Körper fühlte, war nicht Schwäche, sondern das Gegenteil. In ihr wuchs eine Kraft, ausgehend von ihrem Rückgrat, über beide Schultern hinweg.
Wenn sie zu Hause ungestört waren, fuhr ihr Mann mit den Fingerspitzen die Linien der Knochen auf ihrem Rücken nach, und wenn sie ganz allein war, zog sie sich splitternackt aus und stellte sich vor den Spiegel, um die Veränderungen an ihrem Körper in Augenschein zu nehmen. Von der Seite konnte sie die Konturen des geheimnisvollen Gewächses, das sich an ihren Schulterblättern entwickelte, genau erkennen. Sie war froh, dass sich alles unter dem locker auf die Schultern fallenden Hijab verstecken ließ.
Wenn nicht das enorme Gefühl der Stärke gewesen wäre, hätte sie sich Sorgen gemacht.
Sie war noch nicht sehr lange in diesem Land, und die anderen Mütter in der Schule beobachteten sie, auch wenn sie vorgaben, es nicht zu tun. Die Szenerie am Schultor schüchterte die Frau ein, Tag für Tag. Wenn sie durch das Tor ging, hielt sie die Luft an, nahm ihre Kinder fester an die Hand, senkte den Kopf und brachte die beiden mit abgewandtem Blick in ihr jeweiliges Klassenzimmer. Die Menschen in dieser netten Stadt hielten sich für höflich und gebildet, deshalb gaben sie auch selten Kommentare ab, aber sie drückten ihre Gefühle durch die Atmosphäre aus, die sie erzeugten. Schweigen war manchmal bedrohlicher als Worte. Verstohlene Seitenblicke und angespanntes Schweigen, während man in der Stadt neue Regularien erdachte, die Menschen, die aussahen wie die Frau und sich kleideten wie sie, den Zutritt zu Orten wie diesem erschweren sollten. Zu den kostbaren Schultoren. Die Tore beschützten die Kinder, die Muttigrüppchen waren die Wächterinnen. Wenn ihnen doch nur klar gewesen wäre, wie viele Gemeinsamkeiten es zwischen ihnen und der Frau gab.
Auch wenn diese Mütter nicht persönlich die Bürokratie ausführten, die der Frau und ihrer Familie das Leben hier schwermachte, waren es Leute wie sie. Die Männer, mit denen sie nachts das Bett teilten. Die nach ein paar Runden Tennis ausführlich duschten, ihren Tee tranken und dann in ihr Büro fuhren, um sich Regeln auszudenken, wie sie Flüchtlinge und Einwanderer am besten daran hindern konnten, in ihr Land zu kommen. Die Cappuccino trinkenden, Tennis spielenden, Spenden sammelnden Gutmenschen, die sich mehr Gedanken um Bücherwochen und Kuchenbasare machten als um schlichten menschlichen Anstand. Die so belesen waren, dass sie durchdrehten, wenn die Invasionen aus ihren Romanen real zu werden drohten.
Die Frau spürte, dass ihr Sohn sie beobachtete, ihr Kriegssohn, so nannten sie ihn, weil er mitten im Krieg geboren war, in ein auf allen Ebenen leiderfülltes Leben – wirtschaftlich, sozial, emotional. Ihr ängstlicher Sohn, der immer unter Spannung stand und versuchte vorauszuahnen, was als Nächstes passieren würde, und zu erspüren, welches Grauen ihm womöglich bevorstand, mit welcher Demütigung seine Mitmenschen ihn unvorbereitet überfallen, welche Grausamkeit das Leben aus dem Hut zaubern würde. Immer war er auf dem Sprung, kaum fähig, sich zu entspannen und seine Kindheit wirklich zu genießen. Die Frau lächelte ihm zu und versuchte, ihren eigenen Kummer zu vergessen, um ihre negativen Gedanken nicht auf ihn zu übertragen.
An jedem Wochentag staute sich all das in ihr auf, morgens beim Hinbringen und nachmittags beim Abholen, und ihr Kriegssohn spürte es natürlich trotz ihrer Bemühungen. Nicht nur am Schultor, auch im Supermarkt, wenn jemand eine beleidigende Bemerkung von sich gab. Oder wenn ihr als Ingenieur hochqualifizierter Mann versuchte, jemanden davon zu überzeugen, dass er zu wesentlich mehr taugte, als die Straße zu fegen. Der jeden Job annahm, damit sie über die Runden kamen.
Ihr Mann war dankbar für alles, was sie bekamen, aber es machte die Frau nur noch wütender, dass sie für das, was ihnen rechtmäßig zustand, für die Dinge also, die sie sich hart erarbeiteten, so dankbar sein sollten. Als wären sie Tauben, die sich auf der Straße um die Krümel stritten.
Als sie jetzt mit ihrer kleinen Tochter und ihrem Sohn um die Ecke bog und die Schule in Sicht kam, machte sie sich auf die übliche Situation gefasst, aber das Gewächs auf ihrem Rücken pulsierte heute sehr stark. Schon die ganze Nacht hatte sie Schmerzen gehabt, und obwohl ihr Mann sie sanft massiert hatte, musste sie sich, als er eingeschlafen war, auf den Boden legen. Das Pulsieren und die Schmerzen waren immer da, nur die Stärke veränderte sich gelegentlich. Inzwischen hatte sie herausgefunden, dass es immer dann am intensivsten war, wenn sie ihre Wut am heftigsten spürte, wenn sie die ganze Welt schütteln und um jeden Preis zur Vernunft bringen wollte.
Auf Drängen ihres Mannes war sie zum Arzt gegangen. Es hatte Geld gekostet und nichts gebracht, deshalb weigerte sie sich, noch einmal hinzugehen. Das Wenige, das sie besaßen, mussten sie für echte Notfälle sparen. Außerdem erinnerte sie das, was sie verspürte, an ihre Schwangerschaften. Auch jetzt fühlte sie, dass ihr Körper ein neues Leben in sich nährte, nur war es diesmal sie selbst, die zu neuem Leben erwachte. Sie richtete sich auf, doch ihr Körper fühlte sich schwer an und zwang sie, sich wieder zu krümmen.
Nun lag das Schultor, umgeben von den Grüppchen der plaudernden Mütter, schon dicht vor ihnen. Natürlich gab es auch ein paar freundliche Blicke, ein freundliches Hallo, ein Guten Morgen. Ein paar nahmen die Frau überhaupt nicht zur Kenntnis – diejenigen, die den ganzen Tag gestresst hin und her hetzten, gefangen in ihrer eigenen Gedankenwelt, in der sie planten und versuchten, sich selbst einzuholen. Über sie ärgerte die Frau sich nicht. Aber über die anderen. Über die Gruppe. Die mit den Tennistaschen, mit den über dicke Hintern gespannten weißen Röckchen und den Fitnessleggins, aus denen der Speck in Ermangelung eines anderen Auswegs an den Säumen hervorquoll. Diese Gruppe machte die Frau zornig.
Eine von ihnen bemerkte sie. Ihre Lippen bewegten sich kaum, als sie den anderen etwas zuraunte. Jetzt richteten sich weitere Blicke auf die Frau. Erneutes Bauchreden, teils gekonnt, teils weniger gekonnt. Verstohlenes Flüstern, argwöhnisches Starren. Das Leben der Frau, alles, was sie tat, wurde beobachtet und kommentiert. Die Frau stammte nicht von hier, das konnte sie nicht ändern, und sie wollte auch gar nicht zu dieser Gruppe gehören. Genau deswegen misstraute diese Mutterclique ihr ja.
Leider war die Frau heute spät dran, worüber sie sich selbst am meisten ärgerte. Nicht weil sie ihre Kinder nicht pünktlich im Klassenzimmer abliefern konnte, sondern weil sie mitten in der gefährlichsten Zeit eintrafen. Wenn diese Mütter ihre Kinder zu den entsprechenden Klassen gebracht hatten, standen sie gern noch am Schultor herum, steckten die Köpfe zusammen, organisierten Abholdienste, verabredeten Spieltreffen und planten Partys, zu denen die Kinder der Frau natürlich nie eingeladen wurden. In dieser Zeit war es unmöglich, in die Schule zu geraten, ohne mit der Gruppe in Kontakt zu geraten, denn die Gruppe war groß und der Weg schmal. Entweder musste die Frau sich mit ihren Kindern im Gänsemarsch an der Mauer oder an den geparkten schmutzigen SUVs vorbeiquetschen. Oder sie musste sich einen Weg mitten durch die Gruppe bahnen. Wie sie es auch anstellte, sie würde Aufmerksamkeit auf sich ziehen und womöglich mit den Muttis sprechen müssen.
Wütend nahm sie ihr eigenes Zögern und die in ihr aufsteigende Angst vor dieser albernen Clique zur Kenntnis. Dafür war sie doch nicht aus ihrer vom Krieg zerrissenen Heimat geflohen! Dafür hatte sie nicht all die Menschen und Dinge, die sie liebte, hinter sich gelassen, hatte mit nichts als den Kleidern auf dem Leib in diesem überfüllten Schlauchboot gesessen, ihre weinenden, zitternden Kinder umklammernd, in der Dunkelheit, der Stille. Hoffend, dass endlich die Küste vor ihnen auftauchte. Und nicht nur das hatte sie durchgemacht, sondern danach auch noch den Transport in dem finsteren, luftlosen Container, ohne genügend zu essen, ständig begleitet vom Gestank aus dem Eimer in der Ecke, im Herzen nicht zum ersten und auch nicht zum letzten Mal die Angst, dass sie das Schicksal ihrer Kinder besiegelt und sie alle zum Tode verurteilt hatte. All das hatte sie ganz sicher nicht deshalb auf sich genommen, um sich dann von diesen Schultorwächterinnen einschüchtern und den Weg versperren zu lassen.
Das Pulsieren in ihrem Rücken wurde immer stärker, breitete sich über die ganze Wirbelsäule aus, bis hinauf zu den Schultern. Ein stechender Schmerz, der aber gleichzeitig eine seltsame Erleichterung mit sich brachte. Wie die Kontraktionen der Geburtswehen schwoll er an und ab. Doch er wurde intensiver, steigerte sich zu den mächtigen Wogen einer Superkraft.