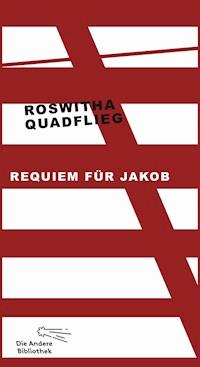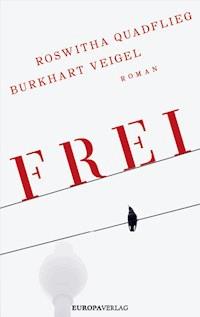
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Student in den Sechzigerjahren war Janus Emmeran einer der erfolgreichsten Fluchthelfer im geteilten Berlin: Hunderten von Menschen verhalf er durch die Mauer in die Freiheit. Mehr als vierzig Jahre später kehrt Janus in seine Schicksalsstadt zurück. Per Kontaktanzeige lernt er hier die fast 30 Jahre jüngere Colette kennen, Tochter eines linientreuen Hochschulprofessors in der DDR und Inhaberin eines kleinen Verlags. Zwischen den beiden, die verschiedener nicht sein könnten, entwickelt sich eine Amour fou, die bald auch Janus' bewegte Vergangenheit wieder lebendig werden lässt – vom Tag des Mauerbaus am 13. August 1961 bis hin zum Aufbau des Netzes der Fluchthilfe in den Wochen und Monaten danach. Ungeachtet ihrer so verschiedenen Lebensläufe in Ost und West versuchen Colette und Janus zueinanderzufinden. Bald wird ihnen klar, dass es nicht nur die deutsche Vergangenheit ist, die zwischen ihnen steht. Janus wird von einem Freund und ehemaligen Fluchthelfer gebeten, Anisa, eine verfolgte junge Frau syrisch-kurdischer Abstammung, in seinem Haus in der Schweiz zu verstecken. Anisas Schwester wurde von ihrem Vater und ihrem Onkel umgebracht, nun droht Anisa ein ähnliches Schicksal. Und in Janus erwacht aufs Neue der Drang, zu helfen. FREI, der mit Spannung erwartete Roman von Roswitha Quadflieg und Burkhart Veigel, erzählt vom Verlangen nach Freiheit und beleuchtet eines der abenteuerlichsten Kapitel deutsch-deutscher Geschichte. Mitreißend erzählt, wirft er die Frage auf nach individueller Verantwortung angesichts der politischen Umwälzungen – damals wie heute.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ROSWITHA QUADFLIEGBURKHART VEIGEL
FREI
ROMAN
1. eBook-Ausgabe 2018
© 2018 Europa Verlag GmbH & Co. KG, München
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,unter Verwendung eines Fotos von © plainpicture/Andreas Süss
Lektorat: Rainer Wieland
Layout & Satz: BuchHaus Robert Gigler, München
Konvertierung: Bookwire
ePub-ISBN: 978-3-95890-248-0
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.
www.europa-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
Nicht: Es muss etwas geschehen!Sondern: Ich muss etwas tun!
HANS SCHOLL
INHALT
PROLOG
DIE MAUER
DIE ERSTE FLUCHT
DIE ANZEIGE
1. TAG
DIE PASS-TOUR / ACHMED
2. TAG
DIE VORLADUNG / MISTER X
DIE KANALISATION
3. TAG
NEUE PÄSSE
MISTER X ERZÄHLT
DER TOTENSCHÄDEL
DIE KATASTROPHE
4. TAG
DER NEUE
DER JUSTIZMINISTER IN UNTERHOSEN
AM ZAUN
5. TAG
6. TAG
MISTER X / DER PLAN
MISTER X / DIE AKTION
7. TAG
TELEFONGESPRÄCHE
8. TAG
HARRY KOMMT NICHT ZURÜCK
PISTOLEN UND SPRENGSTOFF
MISTER X / DER ABSCHIED
9. TAG
DER TUNNEL
JULIANE
10. TAG
DIE ENTTÄUSCHUNG
HARRYS RÜCKKEHR
EINLADUNG VON HEINRICH ALBERTZ
11. TAG
WECHSELBÄDER
EINE NEUE IDEE
MIT DEM CADILLAC NACH WIEN
EIN ENTFÜHRUNGSVERSUCH
12. TAG
DIE FRANZOSEN-TOUR
13. TAG
DIE DEMONSTRATION / DIE ÜBERGABE
14. TAG
ABSCHIED VON BERLIN
15. TAG
16. TAG
17. TAG
18. TAG
19.TAG
20. / 21. TAG
EPILOG
PROLOG
Schwarze Stille. Selbst wenn er die Augen öffnet, bleibt es dunkel. Wohin er den Kopf auch wendet, das Schwarz bewegt sich mit ihm, klebt an ihm. Da trifft ihn der erste Schlag der knochigen Hand am Kopf, der zweite in die Rippen. Aber das tut einem anderen weh, nicht ihm, der gar nicht da ist. Und irgendeiner hört die Großmutter schreien: »Was geisterst du hier herum, mitten in der Nacht? Das werde ich deiner Mutter sagen, du Nichtsnutz!« Noch ein Schlag in die Rippen. »Du bist wie dein Vater!« Doch das geht ihn nichts an. Wenn nur die Tür geschlossen ist, damit die anderen nicht wach werden. Er tastet, sie ist zu. Jetzt geht sie auf; er spürt, wie einer in sein Zimmer gestoßen wird. Er rettet sich in sein Bett und zieht die Decke über den Kopf.
Ein Dröhnen, ein Rauschen. Er sinkt in die Dunkelheit, in schwarzes Wasser, es schlägt über ihm zusammen. Aber er atmet. Wieso kann er atmen? An der Oberlippe spürt er die Luft, die aus seiner Nase strömt. Und seine Brust hebt und senkt sich. Also lebt er, auch da unten. Allmählich lässt das Dröhnen nach, er sinkt nicht tiefer, schwebt langsam weiter, vorbei an bläulich und grünlich leuchtenden Dreiecken, Vierecken, Kreisen. Sind sie Teile von etwas Größerem? Er kann es nicht erkennen. Sie bleiben fern von ihm, bedrängen ihn nicht.
Das Dunkel reißt auf, plötzlich ist es taghell. Er sieht eine rötlich braune Mauer, Stein an Stein, ganz regelmäßig, zwischen den Apfelbäumen auf der Wiese hinter dem Haus, endlos, darüber ein blauer Himmel, sehr nah. Vor der Mauer stehen seine Spielkameraden. Er schwebt auf sie zu. Als er bei ihnen ist, öffnet er den Hosenladen und pinkelt an die Mauer, so wie sie. Das dürfen nur Jungs. Warm und weich streicht der Wind über seine Beine.
Allmählich lässt die wohlige Wärme nach, seine Hüfte wird kalt. Er versucht wegzurücken. Da klopft etwas in seinem Kopf, klopft von innen gegen die Wand aus Knochen, einmal, zweimal, immer wieder. Plötzlich schießt ein Blitz von hinten in seine Augen, weckt ihn: Er hat wieder ins Bett gemacht! Im hohen Bogen wirft er die noch trockene Decke zum Fußende, drückt sich hoch aus der Feuchte, steht aufrecht, windet sich aus dem Nachthemd.
Nackt, das Hemd in der Hand, schleicht er aus dem Kinderzimmer, öffnet die Tür zum Schlafzimmer und trippelt, das Beweisstück voraus, ans Bett der Mutter. Sie atmet leise. Von der Großmutter im anderen Bett hört er nichts. Noch einen Moment der Ruhe, bevor das Unheil über ihn hereinbrechen wird. Aber er muss die Mutter wecken und ihr sagen, dass er wieder etwas Böses getan hat.
Sie fährt aus dem Schlaf, schlägt die Decke zurück, ihr dumpfer süßlicher Geruch bedrängt ihn. Zornig zieht sie ihn mit sich ins Kinderzimmer. Die beiden kleinen Geschwister schrecken auf, ducken sich aber gleich wieder weg in ihre Betten; jetzt ist es besser, nicht anwesend zu sein. Aber die Mutter reißt ihnen die Decken weg und scheucht sie an die Wand. Dann klatscht sie ihm das nasse Hemd ins Gesicht, links, rechts. Nackt muss er sich über einen Stuhl beugen. Der Ledergürtel trifft ihn, fünf Mal, sechs Mal. Den Geschwistern ruft sie zu: »Passt gut auf! So geht es einem Buben, der nicht gehorchen will!«
Bei jedem Schlag bäumt er sich auf, stumm. Schreien darf er nicht, das hat ihm die Mutter schon früher mit »Du weckst noch das ganze Haus!« und weiteren Schlägen eingebläut. Plötzlich ist auch die Großmutter wieder da und schimpft: »Ja, hau ihn her wie ein’ Nusssack!«
Nachdem das Urteil vollstreckt ist, dürfen die Geschwister zurück in ihre Betten. Die Mutter geht in ihr Zimmer, um wieder zu schlafen. Zitternd vor Angst und Kälte muss er unter Aufsicht der Großmutter sein Bett abziehen – schwer für einen Sechsjährigen, dessen Arme kaum über die Matratze reichen – und das nasse Leintuch und das Nachthemd in die Badewanne in der Küche legen. Jeden falschen Handgriff bemängelt sie mit der Faust. Als ihm ein Zipfel des Leintuchs beim Zusammenlegen aus der Hand rutscht, ein Schlag, ein weiterer, als er den grünen Lappen anstatt des gelben zum Säubern des Gummituchs aus der Küche bringt. Ein neues Hemd und ein frisches Leintuch gibt es in dieser Nacht nicht. Er rollt sich auf dem kalten Gummituch zusammen.
Warum schreit die Großmutter immer: »Du bist wie dein Vater!«? Der hat doch mit den anderen Soldaten gegen den Feind gekämpft! Er ist stolz auf ihn.
Am nächsten Morgen weckt ihn die Großmutter. Er muss ihr helfen, den Badeofen anzuheizen, Hemd und Betttuch in der Wanne auszuwaschen und zum Trocknen aufzuhängen. So schafft er es nicht, sein Frühstücksbrot aufzuessen. Wie jeden Morgen nimmt er seine Geschwister an die Hand und bringt sie in den Kindergarten. Dann rennt er zur Schule. Der Weg ist lang, in seinem Ranzen rappeln Schiefertafel, Griffel und das Lesebuch. Gemeinsam mit seinen Klassenkameraden begrüßt er fröhlich die Lehrerin: Heil Hitler! Aber heute wollen ihm die Buchstaben und Zahlen nicht recht gelingen. Er hat Hunger. Der Rest des Frühstücksbrots, das weiß er, wird sein Mittagessen sein. Und die Großmutter wird schreien: »Hundsfotzen und kleine Steinchen bekommst du! Wer nachts in der Wohnung herumgeistert und ins Bett brunzt, braucht kein Mittagessen!«
West-/Ost-Berlin, 13. August 1961
DIE MAUER
Die Sonne ging auf über dem Studentendorf in Schlachtensee. Ein friedlicher Sonntagmorgen, der Wetterbericht hatte einen schwülen Tag vorausgesagt. Gefesselt von Gottfried Benns Wortkaskaden, hatte sich Janus Emmeran in dessen Briefen, Essays und Gedichten verlaufen. Erst weit nach Mitternacht hatte er seine Schlafcouch gerichtet, das Zimmer gelüftet und den Aschenbecher in den Abfalleimer der Gemeinschaftsküche entleert.
Plötzlich trommelte es an seine Tür. »Die machen die Grenze dicht!« Was? Wie spät war es? Janus fuhr hoch, schaute auf seinen Wecker – 6:15 Uhr –, sprang aus dem Bett und lief im Schlafanzug auf den Flur. »RIAS Berlin, eine freie Stimme der freien Welt!«, hörte er und rannte zu der offen stehenden Tür drei Zimmer weiter. »Panzerspähwagen und schwer bewaffnete Betriebskampfgruppen vor dem Brandenburger Tor.«
Zwei Kommilitonen saßen vor dem Radio, er rief ihnen zu: »Das müssen alle hören!«
Sie brachten Radio und Antenne in den Gemeinschaftsraum, öffneten die Fenster, drehten den Regler hoch und ließen die Meldungen durchs Dorf dröhnen. Bald saßen da fünf, dann acht, auch aus anderen Häusern kamen Kommilitonen angerannt.
Fassungslos folgten sie dem Dauerstakkato: »S- und U-Bahn-Verkehr unterbrochen«, »Oberbaumbrücke gesperrt«, »Das Pflaster am Potsdamer Platz wird aufgerissen, gerade werden Betonpfähle eingerammt«.
Janus war gerade zweiundzwanzig Jahre alt geworden. Ein hochgewachsener sportlicher Mann mit schwarzen Haaren und auffällig dunklen Augen. Vor einem halben Jahr hatte er seinen Studienort gewechselt, war von Tübingen – wo er geboren wurde und wo auch seine Mutter lebte – nach Berlin gezogen, dem Zentrum der freien Welt, dem Mekka der Kunst. Aufgrund seiner guten Noten im Vorphysikum hatte man ihm einen Studienplatz an der Freien Universität bewilligt.
Eigentlich hatte er vorgehabt, zusammen mit seinem Freund Fabian, den er von seiner Zeit bei den Gebirgsjägern in Mittenwald kannte, nach Berlin zu ziehen. An den Wochenenden hatten sie gemeinsam musiziert und darüber diskutiert, wie Fabian aus der Bürgerlichkeit seines Elternhauses ausbrechen und Janus sich aus der engen, aus selbstgerechten Gewissheiten zusammengekleisterten Welt seiner Mutter befreien könnte. Aber vier Wochen vor ihrem Umzug war Fabian bei einem Alleingang in den Bergen abgestürzt. Die Bergwacht hatte nur noch seinen Rucksack gefunden.
Janus’ Zuhause war jetzt eine zehn Quadratmeter große Bude – Schreibtisch, Bücherregal, Glastisch, Kleiderschrank mit Kasten für die Bettwäsche, ein Stuhl mit blauem Polster, vor dem Fenster Leinenvorhänge, auch die Schlafcouch war blau bezogen.
Das Dorf, ein lockeres Ensemble aus zwei- und dreigeschossigen Häusern im Südwesten der Stadt – eine Stiftung der Amerikaner, gedacht als Beitrag zur Reeducation der deutschen Jugend nach dem Ende des Nationalsozialismus –, hatte eine eigene Verwaltung und einen studentischen Bürgermeister; kleine Zimmer, große Gemeinschaftsräume und Gemeinschaftsküchen, um Kontakte zwischen den Studenten zu fördern, die Häuser streng getrennt nach Geschlechtern.
Der Sound der Großstadt – anfahrende und abbremsende Autos, rumpelnde S-Bahnzüge, quietschende Straßenbahnen, startende und landende Flugzeuge –, die auch während der Nächte hell erleuchteten Straßen, das Meer von Zeitungen an den Kiosken, die Mädchen in Nylons und wippenden Petticoats faszinierten den jungen Mann aus der Provinz. Janus besuchte Kinos, Kabaretts und Konzerte im Westen, Opern und Theater im Osten, amüsierte sich, wenn die Ost-Berliner in den Pausen ihre Butterbrote auspackten und die West-Berliner mit schwarz getauschtem Geld protzig Sekt und Kaviar bestellten.
Mit einem amerikanischen Kommilitonen, einem Zwei-Meter-Riesen und Halbprofi, spielte er manchmal Tischtennis. Gemeinsam besuchten sie das erste Deutsch-Amerikanische Volksfest auf der Truman Plaza, ein Rummel, dessen größte Attraktion eine mobile Westernstadt war. Hier lernte er einen Offizier der amerikanischen Streitkräfte, Jim Stone, und dessen deutsche Frau Helga kennen. Gelegentlich luden sie Janus zu sich ein, Helga kochte für den armen Studenten, während Jim ihm die Fotosammlung sämtlicher Autos zeigte, die er in den USA und in Berlin gefahren hatte. Wegen dieser naiven Offenheit und ihrer Lässigkeit liebte Janus die Amerikaner. Aber auch wegen ihres bedingungslosen und dollarträchtigen Engagements für Berlin und die Freiheit auf der ganzen Welt.
Den Meldungen in den Tageszeitungen und im Rundfunk, dass täglich Tausende Bauern, Facharbeiter, Ärzte und Jugendliche aus dem »Arbeiter- und Bauernparadies« in den Westen flüchteten, schenkte er kaum Beachtung, die Spekulationen, wann die DDR-Regierung der Massenflucht einen Riegel vorschieben würde, beschäftigten ihn nicht.
Janus hatte geplant, trotz der Semesterferien den August über in Berlin zu bleiben, um sich auf das Gespräch mit dem Theologen vorzubereiten, der Ende des Monats über seine Aufnahme in die Studienstiftung befinden sollte. Dessen große Liebe galt, wie Janus erfahren hatte, Gottfried Benn, ein Anlass, sich intensiver mit dessen Werken zu beschäftigen. Außerdem musste er noch für den ersten öffentlichen Auftritt seines Quintetts am 2. September üben. Im Rahmen der Einweihung des Osteuropa-Instituts sollte er zusammen mit vier Freunden vor den Delegationen der Ford und der Rockefeller Foundation, die das Institut gestiftet hatten, das Schumann-Klavierquintett spielen. Gleich danach wollte er nach Griechenland fahren. Den Entschluss zu dieser ersten großen Reise seines Lebens hatte er schon nach dem Abitur am humanistischen Gymnasium gefasst; damals war ihm aber die Bundeswehr dazwischengekommen. Sechs Wochen lang würde er auf den Spuren der Minoer, Mykener, Athener und Spartaner wandern, den Olymp besteigen, wie einst die Götter aus dreitausend Meter Höhe die Sonne über dem Meer aufgehen sehen und in Olympia auf der ehemaligen Rennbahn die zweihundert Meter laufen. Zur Vorbereitung hatte er während des Semesters Neugriechisch gelernt; jetzt, in den Semesterferien, übte der Dozent freundlicherweise täglich mit ihm eine Stunde Konversation.
All das spielte im Moment keine Rolle. Gebannt lauschte Janus, zusammen mit seinen Kommilitonen, den sich überstürzenden Meldungen. Kurz nach acht Uhr dann das Ungeheuerliche: »NVA in Ost-Berlin! Bruch des Potsdamer Abkommens!« Dazu die Kommentare der Reporter: »Ulbricht macht die Sowjetzone zum KZ« und »Mitten in Berlin zementieren sie die bolschewistische Mordgrenze«.
Während seines Wehrdienstes hatte sich Janus immer darüber amüsiert, wenn sein Kompaniechef mit strammen Worten die militärische Lage darstellte: Grün macht das, Rot jenes. Sandkastenspiele. Aber das hier war kein Spiel, das war Realität, mitten in Berlin.
Die Stimmen seiner Kommilitonen rissen ihn aus seinen Überlegungen: »Diese Verbrecher!« – »Das ist doch nur das Vorspiel. Als Nächstes besetzen sie West-Berlin!« – »Unsinn, das lassen die Amis niemals zu.« – »Wenn die Amerikaner zurückschlagen, gibt es Krieg, und wir sitzen mittendrin.«
Eigentlich, überlegte Janus, tangieren die Absperrungen nur die Ostdeutschen. Er mit seinem bundesrepublikanischen Personalausweis müsste doch unverändert nach Ost-Berlin ein- und auch wieder ausreisen können. Oder brauchte er jetzt ein Visum?
»Ich probier’s mal, ich fahr rüber«, sagte er.
»Sind Sie wahnsinnig?«, brauste einer auf. »Wenn die da drüben verrücktspielen …« Bevor Janus den Raum verließ, hörte er noch: »An Ihrer Stelle würd ich mich erst mal anziehen.«
Weil er nicht sicher war, ob man ihn nicht wieder aus Ost-Berlin herausließ, räumte Janus sein Zimmer auf, legte die Bettwäsche in den Kasten unter dem Kleiderschrank, sortierte seine Bücher und Papiere auf dem Schreibtisch und stapelte die alten Zeitungen in der Ecke. Dann schrieb er einen Brief an seine Mutter, frankierte ihn und legte einen Zettel dazu: Bitte zur Post bringen, falls ich nicht zurückkomme.
Kurz überlegte er, was er anziehen sollte, und wählte ein buntes Sommerhemd. Das würde jedem Vopo zeigen, ich bin keiner von euch, mir könnt ihr nichts anhaben! Dann machte er sich auf den Weg.
Janus stieg in den Elf-Uhr-Bus, am Oskar-Helene-Heim wechselte er in die U-Bahn. Die Abteile waren fast leer.
Selbst notorische Kirchgänger saßen an diesem Sonntagmorgen zu Hause vor dem Radio, um keine der im Minutentakt eingehenden Schreckensmeldungen zu verpassen. Noch glaubte niemand, dass man eine Stadt wie Berlin in zwei Teile schneiden könne, ihre Verkehrsadern, ihre Seen, ihre Flüsse, die Kanalisation. Und jeder erwartete die Nachricht, dass die Amerikaner mit ihren Panzern die Stacheldrahtbarrieren niederwalzen und diesem Spuk ein Ende bereiten würden.
Gegen 12 Uhr erreichte Janus den Bahnhof Zoo. Erfreut stellte er fest, dass die S-Bahn Richtung Ost-Berlin wieder fuhr. Er stieg in einen dieser klapprigen Vorkriegs-Waggons, gespannt darauf, was ihn erwarten würde. Am Bahnhof Friedrichstraße blaffte es aus den Lautsprechern: »Endstation! Alle aussteigen!« Einige Uniformierte musterten die wenigen Ankommenden misstrauisch. Als Janus stehen blieb, um sich zu orientieren, wurde er augenblicklich zu der einzigen noch zugänglichen Treppe gescheucht. Ohne die Grenzer eines Blickes zu würdigen, stieg er in die düstere Halle hinunter. Hier war alles mit Bändern – zwei Ausgänge sogar mit Stacheldraht – abgesperrt, lediglich ein schmaler Durchlass blieb offen, bewacht von drei heftig schwitzenden Uniformierten. Janus hielt einem von ihnen seinen Personalausweis vor den Bauch, ließ sich von oben bis unten mustern – und war durch. Nur ein paar Schritte bis zum Ausgang. Er trat ins Freie, streckte sich, stand da im hellen Sonnenlicht, unangreifbar in seinem bunten Hemd. Er hatte es tatsächlich geschafft, nach Ost-Berlin zu kommen!
Vermutlich würde er hier auch wieder ausreisen können. Doch jetzt reizte es ihn, auszuprobieren, ob er nicht wie früher durch das Brandenburger Tor zurück nach West-Berlin gehen konnte, trotz der aufgefahrenen Panzerspähwagen und der Kampftruppen, die die Reporter im Radio beschrieben hatten. Auf den Straßen begegneten ihm Uniformierte mit grimmigen Gesichtern. Die wenigen Zivilisten wirkten teilnahmslos, als hätten sie eine Jalousie heruntergelassen, um ihr Inneres zu verbergen. Als Janus in die Prachtallee Unter den Linden einbog, sah er, dass der Pariser Platz komplett abgesperrt war. Hier kam niemand mehr durch.
Er lief weiter in Richtung Reichstag, dann, weil auch dort bereits alles abgesperrt war, zum Potsdamer Platz. Schon von Weitem hörte er das Schreien und Skandieren aufgebrachter West-Berliner und beobachtete verwundert, wie West-Berliner Polizisten, die Ellbogen zu einer Kette verhakt, die Menschen daran hinderten, an den neu verlegten Stacheldraht vorzurücken.
Die drei West-Alliierten hatten die absolute Befehlsgewalt in West-Berlin. Aus Sorge, ein lokaler Konflikt könnte sich zu einem Weltkrieg aufschaukeln, waren sie darauf bedacht, jede gewaltsame Auseinandersetzung an der Grenze zu vermeiden. Deshalb wiesen sie den Senat und die West-Berliner Polizei bereits in den frühen Morgenstunden des 13. August an, jede Art aggressiven Protests an der Demarkationslinie zu unterbinden.
Janus war fassungslos. Die Stadt wurde tatsächlich in zwei Hälften gerissen, mit westlicher Unterstützung und deutscher Gründlichkeit. Hilflos musste er mit ansehen, wie ein Mann, der an ihm vorbeirannte und über die Absperrung sprang, von zwei Vopos zu Boden gerissen und in Handschellen abgeführt wurde – ein unbewaffneter, harmloser Bürger! Unbändige Wut packte ihn. Er hatte wieder die Bilder vor sich, die am 4. November 1956 um die Welt gingen, als sowjetische Truppen den Volksaufstand in Ungarn niederwalzten. Panzer, Maschinengewehre, auseinanderstiebende Menschen. Empört waren an jenem Morgen die Schüler in die Klasse gekommen und hatten darauf gewartet, was ihr verehrter Religions- und Philosophielehrer, den sie respektvoll »Professor« nannten, ihnen dazu sagen würde. Während des Dritten Reiches, als Pfarrer, hatte er sich standhaft geweigert, im Gottesdienst die gefallenen Soldaten als Helden zu bezeichnen, und um Vergebung für die Schuld der Deutschen gebetet. Von 1942 bis 1945 hatte er im KZ Dachau gesessen, nach dem Ende des Krieges war er Religionslehrer geworden.
Der »Professor« hatte sich vor die Klasse auf einen Tisch gesetzt, die kalte Pfeife aus dem Mund genommen und seinen Schülern erklärt: »Was in Ungarn geschieht, ist entsetzlich. Aber wer in den beiden letzten Wochen auf eine friedliche Demokratisierung hoffte, hat aus der Geschichte der letzten vierzig Jahre nichts gelernt. Totalitäre Regime wie die Sowjetunion haben nur diese eine Sprache: Panzer, Terror und Gewalt.« Auf die Frage eines Schülers, warum dann immer noch so viele Menschen vom Kommunismus fasziniert seien, gab er zur Antwort: »Diesen Ahnungslosen rate ich, die ›Experten‹ zu befragen, die zu Millionen aus den kommunistischen Ländern in den Westen geflohen sind.« Janus erinnerte sich auch noch an seine Frage damals: »Warum greifen die Amerikaner, die doch die Freiheit in China und Korea verteidigt haben, in Ungarn nicht ein?« – »Weil sie keinen dritten Weltkrieg riskieren wollen.« Und nach einer Pause hatte der Lehrer hizugefügt: »Auch ich habe lernen müssen, Verbrechen und Not zu sehen und mit gebundenen Händen danebenzustehen.« Diese Antwort hatte Janus keine Ruhe gelassen. Er überlegte, ob er nicht wenigstens einigen Menschen in Ungarn helfen, sie vielleicht in einem Schlauchboot über den Neusiedler See nach Österreich holen könnte. Als er am anderen Tag seinen Klassenkameraden von dieser Idee erzählte, nannten sie ihn einen Spinner.
Plötzlich kam ihm sein Kommilitone Thomas Pospiech in den Sinn, einer der drei »Grenzgänger« im Semester, der bei seinen Eltern im Osten wohnte und in West-Berlin studierte. Vor zwei Monaten hatte er ihn im Anatomischen Institut kennengelernt. Wie sollte der jetzt noch in die Vorlesungen kommen? Kurz vor Semesterende hatte er Pospiech zuletzt gesehen und ihn gefragt, warum er nicht an der Humboldt-Universität studiere. Sein Lachen hatte er immer noch im Ohr: Die Studienplätze an der HU seien Funktionärskindern vorbehalten, als Sohn eines selbstständigen Fotografen habe er keine Chance gehabt. Janus erinnerte sich an seine Adresse, Oderberger Straße 24, und beschloss, ihn aufzusuchen.
Auf dem Weg in den Prenzlauer Berg sah er, wie Menschen, die auf der Straße stehen blieben und miteinander sprachen, von Vopos auseinandergetrieben wurden.
Janus betrat den dunklen Hausflur, stieg drei Treppen hinauf und klingelte. Eine Frau öffnete ihm die Tür. Ja, ihr Sohn sei zu Hause.
Pospiech begrüßte Janus erstaunt: »Was machen Sie hier?« Er drehte sich um zu seiner Mutter. Er werde seinem Bekannten die Grenze an der Bernauer Straße zeigen, zum Kaffee sei er zurück.
Sie verließen das Haus und gingen in Richtung Eberswalder Straße.
»Haben Sie eine Ahnung, wie es jetzt für Sie weitergeht?«, fragte Janus.
»Vermutlich werde ich Straßenbahnfahrer.«
»Unsinn!«
»Mein Traum vom Landarzt in der Uckermark jedenfalls ist passé.« Nach den ersten Meldungen heute Morgen sei er zum Marx-Engels-Platz gelaufen und in die S-Bahn gestiegen, um auszuprobieren, wie weit er noch käme. An der Friedrichstraße sei Endstation gewesen. »Wie weit sind Sie gekommen?«
»Genauso weit wie Sie, nur auf einem anderen Gleis.«
»Sind Sie sicher, dass man Sie auch wieder rauslässt?«
Von der Schwedter Straße aus sahen sie die quer über die Bernauer Straße verlegte Stacheldrahtbarriere.
»Ich hoffe«, antwortete Janus.
»Würden Sie mir einen Gefallen tun und mein Büchergeld aus dem Studentenwerk holen?«
»Klar, wenn die es rausrücken. Mit einer Vollmacht von Ihnen möchte ich jetzt aber nicht über die Grenze gehen.«
Sie kehrten um. Plötzlich blieb Janus stehen. »Wenn ich mir’s recht überlege, wäre es doch sinnvoller, wenn Sie zu Ihrem Geld gingen, nicht umgekehrt, oder?«
»Klingt ziemlich logisch. Bloß wie?«
»Können Sie schwimmen?«
»Jetzt, am helllichten Tag, in voller Montur? Ohne mich von meinen Eltern zu verabschieden?« Er überlegte. »Am Landwehrkanal zwischen Treptow und Neukölln wäre vielleicht eine Stelle …«
»Also los!«
»Sie kommen mit?«
»Ich könnte Ihre Kleider retten.«
»Und meinen Eltern Bescheid sagen.«
Sie kamen aber nur bis zur Lohmühlenstraße. Erstaunlich, mit welcher Schnelligkeit die Abriegelung durchgezogen wurde. Vierundzwanzig Stunden vorher hätte Pospiech noch ohne Weiteres durch den Kanal schwimmen können. Enttäuscht fuhren sie zurück.
»Nicht aufgeben! Wir finden einen anderen Weg«, versprach Janus. Plötzlich hatte seine Neugier einen Sinn bekommen, plötzlich war aus seiner Erkundungstour ein Auftrag geworden. Am Marx-Engels-Platz trennten sie sich.
Janus fuhr weiter zur Friedrichstraße. Um zur S-Bahn in den Westen zu kommen, musste er den Bahnhof verlassen, einmal um das Gebäude herumgehen und die Halle von der anderen Seite her wieder betreten. Nach einem kurzen Blick in seinen Ausweis winkten ihn die Grenzer durch – ohne ihn zu registrieren oder in einer Fahndungsliste nachzusehen. Er konnte es kaum glauben: Thomas Pospiech brauchte also nur einen West-Ausweis mit einem Foto, das ihm ähnlich sah – und wäre gerettet.
Am Kiosk im Bahnhof Zoo überflog Janus die Überschriften der Sonderausgaben der Tageszeitungen. Der Regierende Bürgermeister Willy Brandt hatte den Wahlkampf abgebrochen, war bereits in den Morgenstunden nach Berlin geflogen und hatte eine außerordentliche Senatssitzung einberufen. Bundeskanzler Konrad Adenauer befand es offenbar nicht für nötig, nach Berlin zu kommen. Stattdessen hatte er eine Erklärung abgegeben, in der er die Deutschen aufrief, darauf zu vertrauen, dass die Bundesregierung »im Verein mit unseren Alliierten« Gegenmaßnahmen treffen werde. Nach einer Stellungnahme der West-Alliierten suchte Janus vergebens.
»Da kiekste, wa? Heut is wat los in Berlin, allet uff de Beene. Vorm Brandenburger Tor ham se demonstriert«, grinste der Kioskbesitzer hinter seinem Tresen.
»Ich schau nur, ob die Amis was unternehmen.«
»Die? Die müssen Moorhühner schießen, ha ick jelesen.«
Zurück im Studentendorf, fand Janus einen Zettel an seiner Tür: Mutter anrufen! Sie keifte gleich los, sie habe die Nachrichten im Radio gehört. Seine Entscheidung für Berlin sei definitiv falsch gewesen, das sähe er jetzt hoffentlich ein, er solle umgehend nach Hause kommen. Sie beruhigte sich erst, als er ihr sagte, er habe den ganzen Tag Griechisch gelernt, Geige gespielt und Gottfried Benn gelesen. Und als Westdeutscher sei er von der Schließung der Grenze ohnehin nicht betroffen.
In der Nacht lag Janus viele Stunden wach. War sich Pospiech über die Konsequenzen einer Flucht im Klaren? War er wirklich bereit, seine Eltern und Freunde zu verlassen, womöglich für immer? Und wo sollte er, Janus, einen Ausweis hernehmen? Außerhalb des Dorfes kannte er fast niemanden. Wäre das Studentenwerk eine Anlaufstelle? Seine Mutter würde toben, wenn sie erfuhr, was er plante. Egal, es war entschieden. Er würde morgen nicht zu seiner Griechisch-Stunde und nicht zum Geigenunterricht gehen. Notfalls musste er sogar seine Reise zum Olymp und das Konzert im Osteuropa-Institut absagen. Er hatte Pospiech versprochen, eine Fluchtmöglichkeit für ihn zu suchen, und er hatte sie entdeckt.
Janus schwitzte. Die Dunkelheit dröhnte, die Wände und die Decke kamen auf ihn zu. Die Tür war verschlossen.
West-/Ost-Berlin, 14. August 1961
DIE ERSTE FLUCHT
Gleich am nächsten Morgen ging Janus zum Studentenwerk der Freien Universität und erkundigte sich, ob er Thomas Pospiechs Büchergeld abholen könne. Die Sekretärin bat ihn, im Flur Platz zu nehmen, dann wurde er in das Büro des Chefs, Daniel Goldmann, gebeten. Goldmann holte Pospiechs Akte und füllte einen Zahlschein aus. Dann bot er Janus eine Zigarette an: »Sie waren gestern tatsächlich drüben? Mutig.«
Janus meinte, er als Westdeutscher habe doch nichts zu befürchten.
Goldmann lachte. »So kann nur ein ahnungsloser Bundesrepublikaner reden. Mich haben die Genossen zwei Jahre wegen Boykotthetze eingebuchtet, nur weil ich Ulbricht in einem Zeitungsartikel nicht entsprechend gewürdigt hatte. Den Brüdern drüben traue ich inzwischen jede Gemeinheit zu.«
»Ich habe aber noch eine andere Sache.«
»Okay, welche Akte soll ich holen?«
»Nein, etwas ganz anderes.«
Janus berichtete von seiner Entdeckung am Grenzübergang Friedrichstraße. Goldmann war elektrisiert, gab allerdings zu bedenken, dass es jetzt, mitten in den Semesterferien, schwierig sein könnte, passende Ausweise zu bekommen.
Inzwischen waren Dietmar Thiel, Goldmanns Stellvertreter, und drei weitere Mitarbeiter des Studentenwerks ins Zimmer gekommen. Auch sie waren begeistert von Janus’ Idee. Irgendwie helfen wollte jeder. Aber einen Ausweis über die Grenze schmuggeln? Warum sollte man seine Freiheit riskieren für jemanden, den man kaum kannte? Bis vor zwei Tagen hätte Pospiech doch ohne Gefahr und ohne fremde Hilfe flüchten können.
Goldmann unterbrach die Debatte: »Einem Menschen in Not muss man helfen, er muss sich nicht rechtfertigen, was er in der Vergangenheit getan oder unterlassen hat.«
Alle schwiegen. Plötzlich sagte Wilfried Schultz, einer der Mitarbeiter: »Ich hol jetzt meine Freundin rüber. Und deren Freundin. Mit dem Ausweis meiner Schwester.« Wenn seine Freundin hier sei, könne ja ein anderer – vielleicht Janus Emmeran? – deren Freundin holen, mit demselben Ausweis.
»Sollte klappen«, sagte Thiel. »Und danach kümmern wir uns um Emmerans Bekannten. Wir werden einen Ausweis für ihn finden.« Er gab Schultz den Rat, das Papier in die Socke zu stecken. »Wenn Sie drüben mit einem falschen Ausweis erwischt werden, sehen wir Sie erst in drei Jahren wieder.«
Am Nachmittag wartete Janus vor dem Lehrter Bahnhof auf Wilfried Schultz. Und tatsächlich, gegen 17 Uhr kam er die Treppe herunter, eine junge Frau neben sich. Sichtlich stolz und erleichtert ging er auf Janus zu, umarmte ihn und steckte ihm dabei den Ausweis seiner Schwester in die Tasche. Es sei ganz einfach gewesen, sagte er, nach dem Vorzeigen des Ausweises sei seine Freundin durchgewinkt worden. Janus verabschiedete sich, schlenderte ums Karree, prägte sich die Daten des Ausweises ein und schob ihn in seine Socke.
Mit dem nächsten Zug fuhr er zur Friedrichstraße. Unbehelligt, ohne Leibesvisitation, kam er durch die Eingangskontrolle. Vor dem Deutschen Theater traf er, wie abgemacht, eine junge Frau, Kennzeichen: roter Rock. Sie liefen in Richtung Friedrichstadtpalast, und Janus erklärte ihr, wie sie für die nächste halbe Stunde heiße, wann und wo sie geboren sei. Sie kramte in ihrer Handtasche, blitzschnell steckte Janus den Ausweis hinein. Ihre Hand war eiskalt. Auf ihrer Stirn konnte er unter den braunen Locken winzige Schweißperlen sehen. Egal, da musste sie jetzt durch. Er drückte sie kurz an sich, dann schlenderten sie zum Bahnhof und stellten sich wie alle anderen in die Reihe, ein Liebespaar, das nach einem Besuch der Großmutter nach West-Berlin zurückfuhr. Problemlos kamen sie nacheinander durch die Kontrollen und stiegen in die S-Bahn.
Die von Janus entdeckte Fluchtmethode funktionierte also. Die jungen Frauen waren im Westen, sie waren frei! Auch mit Pospiech, davon war er überzeugt, würde es klappen. Janus hatte seinen Platz in der Welt gefunden. Er wusste, dass er das Richtige tat: Er schenkte anderen die Freiheit.
Berlin, Ende Juli 2016
DIE ANZEIGE
Janus fand Colette in einer Zeitungsanzeige: Schnauze voll vom Mittelmaß. IQ und EQ, 40+, 175, HSA, sucht jugendlichen Helden 45–55 in Berlin. Duett und Duell, Tango und Tanga, Lyrik and more. BmB. [email protected].
Sie musste eine echte Berlinerin sein – High Heels und Florett, selbstbewusst und frech. War das die Frau, nach der er schon so lange suchte? Wahrscheinlich stammte sie aus dem ehemaligen Ost-Berlin, HSA als Abkürzung für »Hochschulabschluss« kannte man im Westen nicht. Das könnte spannend werden, er, ein Wessi durch und durch, ehemaliger Fluchthelfer, Staatsfeind der DDR, und eine eigenwillige, von den Männern offenbar frustrierte Ost-Frau. Aber er war alt genug, Toleranz nicht als Schwäche zu sehen, und sie hoffentlich jung genug, um sich auf unbekanntes Terrain einzulassen.
Aber warum suchte sie einen Grünschnabel? Ein reifer Mann in der vollen Blüte seines Geistes passte doch viel besser zu ihr. Warum so konventionell, wo es doch um IQ und EQ ging, um Alles oder Nichts?
Janus Emmeran war jetzt siebenundsiebzig Jahre alt, ein immer noch aufrechter, im Lauf der letzten Jahre grau gewordener Mann mit wachen schwarzen Augen. Wenn man genau hinschaute, sah man, dass seine rechte Ohrmuschel eingerissen war. Er wirkte nicht müde, im Gegenteil, man merkte ihm an, dass er sich vorgenommen hatte, noch einmal durchzustarten.
Ein Leben als Orthopäde und Unfallchirurg in eigener Praxis sowie ein aufreibendes Familienleben mit vier Kindern, Urlaubsreisen, Geburtstags- und Weihnachtsfeiern lagen hinter ihm. Seine Beziehung zu einer Patientin, einer verheirateten Neurowissenschaftlerin, wurde ihm zum glücklichen Verhängnis; seine Frau reichte – nach zweiunddreißig Ehejahren – die Scheidung ein. Er überließ ihr das Haus, den Hund, die Fotoalben – plötzlich fühlte er sich grenzenlos frei. Ohne schlechtes Gewissen ließ er die gewohnten Pfade hinter sich. Ein brasilianisches Callgirl brachte Schwung in sein Leben, eine Weile zog er mit einer Nymphomanin durch die Swinger-Clubs Süddeutschlands, konnte der Atmosphäre dort aber letztlich nichts abgewinnen. Geblieben waren ihm Erinnerungen wie die an den jungen Mann, der ihm in der Club-Sauna den Schluss der Arie des Barbiere di Siviglia vorsang, oder an die Schwarze, die ihm ihr Brustwarzen-Piercing schenkte, das bei einer Ganzkörpermassage hinderlich gewesen war. Auch die Silvesternacht, in der die Brasilianerin, kaum dass sie die Tür hinter sich geschlossen hatte, ihren Pelzmantel fallen ließ und ihm splitterfasernackt einen Samba hinlegte, würde und wollte er nicht vergessen. Seine »Pirschgänge« hatten seinem Ruf als engagierter und fürsorglicher Arzt nicht geschadet, auch seine Freunde waren schon bald nach seiner Scheidung wieder aufgetaucht.
Am 13. August 2011 – zum 50. Jahrestag des Mauerbaus – hatte man ihn, einen der erfolgreichsten Fluchthelfer der Sechzigerjahre, als Zeitzeugen zu einer Talkshow nach Berlin eingeladen. In der Runde von Politikern und Historikern war ihm klar geworden, wie wenig er über den Zusammenhang von Flucht und Fluchthilfe einerseits und der Geschichte Berlins, der DDR und des Kalten Kriegs anderseits wusste, und er hatte sich vorgenommen, über diesen wichtigen Teil seines Lebens zu forschen. Er übergab die Praxis seiner ältesten Tochter Kitty und zog wieder nach Berlin, seine Schicksalsstadt.
Berlin schenkte ihm eine lange vermisste Leichtigkeit. Hier schien alles möglich – heute Verse zu schreiben und morgen mit Privatdrohnen die Menschheit von größenwahnsinnigen Diktatoren zu befreien, irgendwann seine geliebte Pathétique von Tschaikowsky in der Philharmonie zu spielen und ja, endlich auch seine »All-in-One« zu finden. Er tat sich in Partnerschaftsagenturen um, gab Annoncen auf, lernte zu seiner großen Enttäuschung aber nur Frauen kennen, die mit ihm verreisen, mit einem Glas Rotwein auf dem Balkon sitzen, den ziehenden Wolken nachsehen oder mit ihm ihren Schrebergarten hegen und pflegen wollten. War diese freche Anzeige jetzt seine große Chance? Mehr als ein virtueller Tod, weggeklickt in den digitalen Papierkorb, drohte ihm eigentlich nicht.
Er mailte: Dein Feldzug gegen das Mittelmaß gefällt mir! Pass aber auf, dass ich Deine IQs und EQs nicht mit Pfeilen aus Amors Köcher durchbohre! Im Ernst: Darf Dein jugendlicher Held auch etwas älter sein (77), wenn intellektueller Anspruch, Größe (1,90) und vielleicht noch mehr zusammenpassen? Hat Dein Männersieb möglicherweise ein Loch, das mir, einem Wahlberliner, der mit dem unendlichen Erfahrungsschatz eines Geige spielenden Arztes ein neues Leben als leidenschaftlicher Forscher begonnen und sich gerade das Rauchen abgewöhnt hat, ein Durchschlüpfen erlaubt? Mein nimmermüder Geist flöge mit Dir über die höchsten Berge, entdeckte mit Dir die Welt, tanzte mit Dir den Tango und würde nicht erlahmen, Deine Schönheit zu preisen. Herzliche Grüße, Janus.
Zweieinhalb Wochen später, längst hatte er seinen spontanen Höhenflug vergessen und sich wieder in seine Akten vergraben, ploppte ihre Antwort herein:
Hallo Janus, Dein Alter könnte tatsächlich ein K.o.-Kriterium sein. Aber Deine Luftschlösser machen mich neugierig, vor allem, wenn sie nicht mit Rauch gefüllt sind. Warum also nicht? Bei einem Glas Wein ließe sich die Stabilität meines Männersiebs trefflich testen. Anbei zwei Fotos, damit Du weißt, wie die Schönheit aussieht, die zu preisen Du gelobst. Lieben Gruß, Colette.
PS: Um Missverständnissen vorzubeugen, die reizende Colette ist keine Französin, sondern eine Berlinerin, verdankt ihren Namen einem frankophilen Vater und wohnt in Mitte. Und Du?
Erstaunlich! Sie schickte ihm zwei Fotos und verlor kein Wort darüber, dass er ihrem Wunsch nach einem Bild nicht nachgekommen war. Wieso schrieb sie ihm überhaupt noch? Hatte sich kein jugendliches Genie gefunden, war er jetzt ihre zweite Wahl? Immerhin, sie hatte ihn nicht weggeklickt. Auf dem ersten Foto prostete sie, ein Glas in der Hand, irgendjemandem zu, die dunkelblonden Haare nach hinten geworfen. Das zweite, ein Porträt, zeigte ein schmales Gesicht mit grünlichen Augen, ein Lachen, weit über den Bildrand hinaus.
Janus suchte das Foto heraus, das seine Tochter Jill im Herbst letzten Jahres geschossen hatte, als er versuchte, den Bergen und Gletschern in dreitausend Meter Höhe Bach vorzuspielen, eine müßige Darbietung, weil die Töne keinen Widerhall fanden und im Bergwind verwehten.
Liebe Colette, danke für Dein Lachen, Deinen Namen und Dein Angebot! Könnte es auch ein Frühstück sein? Wein ist nicht so meine Sache. Vielleicht schon am Wochenende? Ich wohne in Grunewald, komme aber gern in Deinen Kiez. Herzliche Grüße, Janus.
Schon am nächsten Tag kam ihre Antwort:
Hallo Janus, Danke für Dein Solo aus den Bergen! So was hatte ich noch nie! Aber – bitte nicht übel nehmen – von wann ist das Foto? Ich wüsste gern, wie Du heute aussiehst. Macht das Erkennen beim ersten Treffen leichter ;-) Und klär mich bitte auf: Woher kommst Du, was hat Dich nach Berlin verschlagen, und, entschuldige, warum suchst Du überhaupt eine Partnerin? Und warum eine so viel jüngere? Bis zum Frühstück kannst Du Dir ja ein paar kluge Antworten überlegen. Mein Vorschlag: Samstag 10 Uhr, Café Re am Märkischen Ufer, Nähe Spittelmarkt. Liebe Grüße, Colette. PS: Ich habe einen kleinen Verlag, also eigentlich nur am Wochenende oder am späten Abend Zeit.
Ein weiteres Angebot, wenn auch mit angezogener Handbremse. Er schrieb sofort zurück:
Liebe Colette, Frühstück am Samstag klappt! Bin gespannt auf Dein Männersieb, Deine munteren IQs und EQs und Dein Lachen. Im Übrigen hat mich der Text Deiner Anzeige fasziniert, nicht Dein Alter. Mein Foto stammt vom letzten Herbst. Zufrieden? Wenn Du mehr über mich wissen willst, kommst Du mit Janus Emmeran weiter. Du wirst sehen, dass ich Schwabe bin und mein halbes Leben in Tübingen verbracht habe. Und wie finde ich Dich? Herzliche Grüße, Janus.
Für alle Fälle schickte er ihr noch seine Handynummer.
Ihre Antwort am nächsten Morgen:
Hallo Janus, ich mag Deine Mails. Dennoch spüre ich ein leichtes Unbehagen. Du versprichst Dir vielleicht zu viel. Trotzdem freue ich mich auf Samstag! glg Coco. Von meinem iPhone gesendet.
Keine Handynummer, kein Nachname, und kleine Verlage gab es wie Sand am Meer. Aber wieso Coco? Hieß das bei allem Nein doch ein verstecktes Ja? Er war etwas verärgert, aber jetzt wollte er sie erst recht kennenlernen.
Liebe Coco, ab jetzt so? Übrigens bin ich beruhigt, dass Du bei unserem Treffen nicht gleich die nächsten zwanzig Jahre planen willst. Ich bin gespannt auf unser Frühstück. Herzlich, Janus.
Am Abend kam ihre Antwort:
Lieber Janus, Coco ist mein Deckname, mit so was kennst Du Dich ja aus … Kleine Fahrplanänderung: Hol mich bitte von zu Hause ab, ich habe mir heute Morgen den Fuß verknackst und entdecke gerade die Langsamkeit der Welt auf Krücken. Am besten, Du bringst einen Rollstuhl mit, als Orthopäde hast Du so was doch sicher auf Lager. Meine Adresse: Neue Grünstraße 20. Klingle bei Weißbach, dann komme ich runter. Den Rest meiner Leidensgeschichte morgen. Colette.
Jetzt wieder Colette? War er zu weit gegangen? Aber immerhin ein Name. Auf ihrer Homepage las er: 1968 in Berlin geboren, Romanistik-Studium an der HU, 1995 Promotion, 2001 Habilitation, 2006 Gründung des Weißbach-Verlags, Profil: Vergessene Bekannte, unbekannte Neue. Lyrik. Und noch etwas elektrisierte ihn:
Liebe Colette, meine Berliner Vergangenheit holt mich immer wieder ein. Durch die Kanalisation unter der Neuen Grünstraße lief vor mehr als fünfzig Jahren eine unserer erfolgreichsten Fluchtaktionen. Dein Knacks ist für mich kein Beinbruch, er hat mir immerhin Deinen Namen geschenkt. Gern hole ich Dich ab! Janus.
Berlin, Samstag, 13. August 2016
1. TAG
Janus hatte sich für das helle Leinenjackett und den schwarzen Seidenschal entschieden. Er wartete im Auto, auf keinen Fall wollte er zu früh kommen und Colette bei der finalen Gestaltung ihres Outfits stören. Er hatte sie mit einer langstieligen Rose überraschen wollen, die Idee, sie ihr bei der Begrüßung zu überreichen, aber wieder verworfen – Dame auf Krücken, wohin mit der Rose? – und sein Präsent auf den Rücksitz gelegt.
Pünktlich um 10 Uhr – gerade wollte er aussteigen – ging die Haustür auf. Ein großer grauer Hund stürmte heraus, gefolgt von einem Mann im Trainingsanzug. Beide verschwanden in Richtung Park. Janus schwang sich aus dem Auto, schloss die Tür ab, fand das Namensschild Weißbach und klingelte.
Kurz darauf stand sie vor ihm – schlank, größer, als er sich vorgestellt hatte, die Krücken fest im Griff. Und lachte. Dieses unverwechselbare Lachen. Die Ärmel ihrer roten Bluse hatte sie über die Ellbogen gekrempelt, aus dem linken Hosenbein blitzte ein weißer Verband. Janus begrüßte sie mit Küsschen, Küsschen, sie machte mit. Er half ihr ins Auto. Trotz der Krücken bewegte sie sich erstaunlich sicher; von wegen Rollstuhl. Dann setzte er sich ans Steuer, nahm die Rose vom Rücksitz und überreichte sie ihr.
War sie gerührt? Oder irritiert? Sie zögerte kurz und meinte, jetzt fehle nur noch der Handkuss.
Auf dem Weg ins Café erfuhr er alle Details ihres gestrigen Missgeschicks: im Bad ausgerutscht, Notfallambulanz, Röntgen, Anlegen eines Salbenverbands. Ausgestattet mit den beiden Krückenmonstern habe man sie nach Hause geschickt. Er mochte ihre Stimme. Das leichte Vibrieren verriet, dass auch sie aufgeregt war. Ihr Florett würde ihn heute wohl nur kitzeln.
»Immerhin keine stationäre Einweisung übers Wochenende«, resümierte er, »sonst säße ich jetzt sehr einsam an der Ostfront.«
Colette drehte die Rose zwischen den Fingern. Als er vor dem Café einparkte, legte sie sie wieder auf den Rücksitz.
Sie wählten eine ruhige Ecke im hinteren Raum, er schob ihr den Stuhl zurecht, stellte die Krücken an den Nebentisch und setzte sich über Eck zu ihr. Sie kannte sich aus, bestellte Frühstück Nummer 3, er schloss sich an. Als Colette ihr Ei aufschlug, lief ihr das Eigelb über die Finger, ein unsicherer Blick streifte ihn.
»Ich würd’s ablecken«, lachte er.
Dann fiel ihr auch noch das Messer zu Boden. Sie sei heute wohl etwas durcheinander, habe wegen des Verbandes kaum geschlafen. »Du musst dich eben zufriedengeben mit dem, was deine Kollegen von mir übrig gelassen haben.«
»Ich kann mich nicht beklagen. Der Rest kann immerhin essen, sich die Finger ablecken, mit den Augen blitzen, die Haare über die Schulter werfen. Das reicht für den Anfang.«
Sie leerte das Glas Orangensaft in einem Zug und lehnte sich zurück. »Dein Solo in den Bergen hat mir wirklich gefallen. Du magst Klassik, ja?«
»Die ganze Palette von Bach bis …«
»Ich hab’s befürchtet. Soll ich ehrlich sein? Ich steh eher auf Udo Lindenberg. Seit seinem Auftritt 1983 im Palast der Republik.«
»Wie alt warst du da?«
»Fünfzehn.«
Janus überlegte, ob er das Körnerbrötchen nur mit Butter oder mit Marmelade essen sollte, Colette spürte sein Abdriften: »So schlimm? Stell dir vor, in blauer FDJ-Uniform ziehen wir, meine Klassenkameraden und ich, geschlossen in die Hochburg des Sozialismus ein – ich weiß, du würdest abschätzig Erichs Lampenladen sagen, aber es war doch auch irgendwie ein Palast –, draußen skandieren die Massen Udo! Udo!, die Vopos prügeln auf sie ein, nehmen etliche fest. Und drinnen fahren wir ab im Sonderzug nach Pankow. Mein Vater war entsetzt, als er hörte, dass die Schulleitung uns Karten organisiert hatte. Einer, der unseren Honi einen Oberindianer schimpfte, sollte besser aus dem Verkehr gezogen werden. Für mich waren Udo Lindenbergs Songs Ausdruck meines Protests. Gegen meine Eltern, gegen die Schule, das ganze System. Kannst du mir folgen?«
»Klar, du warst jung, beeindruckt vom Glanz der Staatsmacht. Dann hast du an Udo Lindenbergs Respektlosigkeit begriffen, dass bei euch irgendetwas schieflief, hast protestiert. Verständlich, aber in der DDR von damals aussichtslos.«
»Interessant, wie du mich und die DDR interpretierst. Ist die Psyche junger Mädchen dein Hobby?«
»Damals hatte sich das System längst etabliert, alle hatten sich an die Mauer gewöhnt. Übrigens, genau heute vor fünfundfünfzig Jahren wurde dieses Paradebeispiel sozialistischer Baukultur errichtet.«
»Ich weiß. Im Radio war ja schon den ganzen Morgen von nichts anderem als von diesem 13. August 1961 die Rede.«
War sie genervt? »Findest du es falsch, sich daran zu erinnern?«
Ihren Blick konnte er nicht deuten. Er musste vorsichtiger sein. In ihren Mails hatte die DDR nur leise geknistert, jetzt saß sie leibhaftig neben ihm. Mit leicht geröteten Wangen, blitzenden Augen und kleinen Härchen auf dem Arm.
»Ich frage mich«, sagte er, »ob die Fans, draußen vor dem Palast, nicht lieber einen Sonderzug in die andere Richtung genommen hätten. Für mich hat Musik jedenfalls nichts mit Gruppenwohlgefühl und Protest zu tun. Enttäuscht?«
»Sagen wir, verwirrt. Lassen wir das. Deine Rose war sensationell, aber wenn du Udo statt ihrer auf die Rückbank gelegt hättest …«
»Eigentlich wollte er mitkommen, war ihm bloß ein bisschen zu früh heute Morgen.«
»Okay, okay.« Colette lachte. »Bevor wir hier weiter herumspinnen, kann ich dich beruhigen. Der Feierabend meines Vaters gehörte Beethoven und Tschaikowsky, da ist auch bei mir was hängen geblieben. Abgeblockt habe ich allerdings die Bemühungen meiner Mutter, mir auf dem Klavier den Wilden Reiter und den Fröhlichen Landmann schmackhaft zu machen. Aber dich würde ich gerne mal spielen hören. Muss ja nicht im Hochgebirge sein.« Wieder lachte sie.
War Musik die Lücke in ihrem Männersieb? Als Janus ihren warmen Unterarm berührte, zog sie ihn nicht zurück, auch nicht, als er seine Hand länger liegen ließ. Ihre helle Haut und die kleinen Härchen darauf, ihre Stimme und immer wieder ihr Lachen machten ihn schwindelig. Nicht die Karrierefrau, die sie offensichtlich war, nicht die Professorin, nicht die in der DDR sozialisierte Frau und auch nicht die Lyrik-Liebhaberin zogen ihn in ihren Bann, sondern diese neugierige Eva. »Wenn du magst, spiele ich dir auch einen Tango oder Musik des Buena Vista Social Club vor. Die anderen Stimmen musst du dir dann dazu denken.«
»Wir werden bestimmt was finden.« Übrigens redigiere sie gerade ein spannendes Manuskript. Colette drehte den Löffel in ihrer leeren Tasse.
Janus strich über ihren Mittelfinger. »Und wann wird daraus ein Buch?«
»Das hängt davon ab, wie lange ich samstags mit gewissen Herren frühstücke«, sie zog ihre Hand zurück.
»Verstehe. Möchtest du noch irgendetwas?««
Sie schüttelte den Kopf. »Und wie sich bei mir zu Hause alles entwickelt.«
Janus fragte sich, was sie meinte.
»Meine beiden Kinder schaffen den Absprung einfach nicht, obwohl sie längst erwachsen sind.«
Kinder? Zu Hause? Nichts in ihren Mails hatte darauf hingedeutet.
Fast mechanisch, ohne ihn anzusehen, spulte Colette ihre häusliche Situation ab. »Meine Tochter Chantal ist sechsundzwanzig und studiert Kunst. Sie war schon mal weggezogen, wohnt aber seit zwei Wochen wieder bei mir, nachdem sie sich von ihrem Freund getrennt hat. Sie hat gerade eine Abtreibung hinter sich.« Colette machte eine Pause. »Mein Sohn Alex genießt alle Bequemlichkeiten der Abhängigkeit.«
Janus schob ein paar Krümel auf seinem Teller hin und her. »Hab ich deine Anzeige missverstanden?«
Sie lachte. »Wieso?«
»Na ja …«
»Was spricht denn gegen einen Neuanfang mit Altbestand? Auch du kannst dein vergangenes Leben nicht über Bord werfen. Alex ist jetzt zweiundzwanzig und steht kurz vor dem Abschluss seines Studiums der Kommunikationswissenschaften. Meine zweite Tochter, Valerie, ist im Alter von fünf Jahren an einer Hirnhautentzündung gestorben. Hast du Kinder?«
»Vier.«
»Von einer einzigen Frau?«
»Ja. Aber sie lauern nicht mehr vor meinem Kühlschrank.«
»Wie angenehm.«
Gut, sie hatte ein bisschen getrickst, aber jetzt saßen sie zusammen, frühstückten, und sie leckte sich die Finger ab. Janus spürte wieder dieses Kribbeln, legte seinen Arm um ihre Taille und zog sie an sich. Mit ihren Kindern würde er irgendwie klarkommen. »Wie geht’s eigentlich deinem Fuß?«
»Typisch Arzt! Man packt seine Seele auf den Tisch, und er fragt nach der Anatomie. Könntest du mal nachsehen?«
»Gern. Machen Sie sich frei, junge Frau.«
»Nicht hier.«
Das war die Antwort, auf die er gehofft hatte. Sie fuhren in ihre Wohnung, Chantal und Alex waren ausgeflogen. Colette bat Janus, eine Vase aus der Küche zu holen und die Rose auf den Tisch zu stellen. Im Schlafzimmer nahm er ihr den Verband ab und untersuchte sie.
Sie habe nur eine leichte Zerrung, das medizinische Equipment könne sie getrost weglassen. Erleichtert streckte sie sich aus, und seine warmen Hände waren erstaunliche Argumente, denen sie nichts entgegensetzen wollte.
Als sie aufwachten, war die Sonne längst untergegangen.
»Darf ich dich morgen Abend zu mir in den Grunewald einladen?«, fragte Janus.