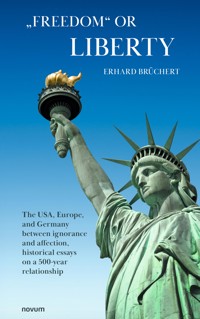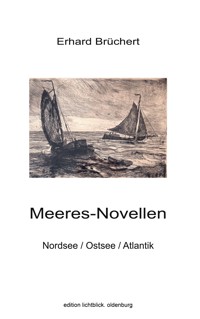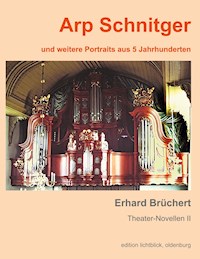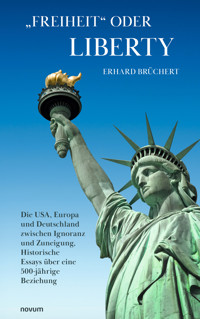
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In historischer Essay-Form werden 500 Jahre voll von Verbindungen, Missverständnissen und Streit zwischen den USA, Europa und Deutschland untersucht. Diese "Verwandtschaft" über den Atlantik hinweg schwankt seit Jahrhunderten zwischen Ignoranz und Zuneigung, sowohl zwischen den wechselnden Regierungen als auch unter der Bevölkerung. Das 18. Jh. hat die USA zu einem Vorbild für westliche "Liberty" erhoben, die sich trotz zweier Weltkriege - ausgelöst im imperialistischen Europa des 19. Jhs - erst im 20. Jh. mehrheitlich durchsetzen konnte; und das nach der Überwindung von Nationalsozialismus und Faschismus. Auch Deutschland fand erst den Weg nach Westen zur parlamentarischen Demokratie und Zivilgesellschaft innerhalb der EU.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2025 novum publishing gmbh
Rathausgasse 73, A-7311 Neckenmarkt
ISBN Printausgabe: 978-3-7116-0073-8
ISBN e-book: 978-3-7116-0738-6
Lektorat: Laura Oberdorfer
Umschlagfoto: Delstudio | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
Innenabbildungen: siehe Bildunterschriften
www.novumverlag.com
Vorwort
Die USA und Deutschland haben ihre Einigkeit gegen Putin mit ihren gemeinsamen Waffenlieferungen für die Ukraine schon längst bewiesen. Innerhalb der EU und der NATO sind beide Staaten enge Verbündete gegenüber einem neoimperialistischen Russland und für die Verteidigung der westlichen Werte. Aber trotzdem gibt es auf beiden Seiten des Atlantiks immer noch – jeweils – anti-amerikanische Stimmen („Anti-Americanism“) oder anti-europäische Gefühle („Anti-Europeanism“).
Die Ursachen für diesen „Streit unter Verwandten“ gehen bis zum Beginn der Neuzeit zurück (Kolumbus). In Deutschland hat es fast 400 Jahre gedauert bis erst gegen Ende des 1. Weltkrieges die schon über hundert Jahre alten „Vereinigten Staaten von Amerika“ als eine ernstzunehmende, republikanische „Nation“ mit einer demokratischen „Liberty“ – die damals schon Millionen Auswanderer aus Europa anzog – wahrgenommen und geachtet worden ist. Die Deutschen haben als „verspätete Nation“ mittels oft benutzten Irr- und „Sonderwegen“ erst die europäische Aufklärung, dann die Gründung der USA und die Französische Revolution im 18. Jhd. „verpasst“. Anschließend haben sie gegen Napoleon und die „eigene Verfassung der Paulskirche“ nur sehr mühsam die ersehnte „nationale Einheit“ im Bismarck-Staat geschafft. Dann wurde dieser Erfolg aber in zwei Weltkriegen gleich wieder verspielt: und zwar mit Wilhelminismus, Kolonialismus, Imperialismus und schließlich – fast bis zum Untergang – durch den Hitlerismus.
Erst danach haben wir 1949 mit unserem Grundgesetz eine parlamentarische Demokratie mit den großen Wertvorstellungen der Aufklärung (Gewaltenteilung/Verfassung/Rechtsstaat/Republik/Gleichberechtigung/Würde des Menschen) erhalten – und das auch mit Hilfe der westlichen Siegermächte und besonders auch nach dem Vorbild der „Liberty“ in der US-Verfassung. Wenigstens konnten wir bei unserem „Grundgesetz“ (im gleichwertigen Range einer Verfassung) auch wichtige und humanitäre Werte und Erfahrungen unserer „Paulskirche“ von 1848/49 und der „Weimarer Republik“ (1918–1933) mit einfließen lassen.
Nach dem 2. Weltkrieg, der Teilung Deutschlands (und Berlins) in West und Ost und der Entstehung des Kalten Krieges (innerhalb einer permanenten Drohung eines 3. Weltkrieges mit globalem Atomtod) zwischen den beiden demokratischen und den sowjetischen Siegern über Hitler war lange Zeit kein sicheres Friedenslebensgefühl der Menschheit, nicht nur der deutschen, mehr möglich. Nur zwischen 1990 und 2000 entstand ein trügerisches Jahrzehnt mit der Illusion vom „Ende der Geschichte“ durch einen „ewigen Sieg“ der Demokratie. Den „Weg nach Westen“ (Prof. H. A. Winkler), den Westdeutschland erst ab 1949 fest eingeschlagen hatte, konnten gerade noch (nach 1990/91) die ost-mitteleuropäischen Staaten Polen, Estland, Lettland, Litauen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Teile des Balkans auch für sich wählen – in freiwilliger, eigener und demokratischer Entscheidung.
Heute hat Putin diesen freiwilligen Weg in die Wertegemeinschaft der westeuropäischen Aufklärung vorerst erheblich erschwert. Finnland und Schweden sind ihn trotzdem schon mutig weiter vorangeschritten. Und die Ukraine kann es ihnen hoffentlich bald nachmachen.
Erhard Brüchert
Widmung
Zum 300. Geburtstag von:
Immanuel Kant – geb. in Königsberg 1724
Und für meine
früheren Schülerinnen und Schüler
sowie meine heutigen Enkelkinder:
Marie (17), Tom (16), Tammo (14)
Das Umschlagfoto:
Kopf der „Statue of Liberty“ – Neoklassizistische Kolossalstatue auf „Liberty Island“ vor dem New Yorker Hafen. Eingeweiht im Oktober 1886. Geschenk Frankreichs an die USA. Entworfen von Frédéric-Auguste Bartholdi, gebaut von Gustave Eiffel – Schöpfer des Eiffelturms in Paris.
2. Die drei Todsünden der frühen Neuzeit (16/17. Jhd.)
Die katholische Kirche kennt seit fast zweitausend Jahren die „sieben Todsünden“. Teilweise wurden sie von antiken Philosophen übernommen und dann im mittelalterlichen Christentum noch verschäft:
Superbia (Hochmut, Stolz, Übermut)Avariatia (Geiz, Habgier)Luxuria (Wollust, Genusssucht, Unkeuschheit)Ira (Zorn, Wut, Rachsucht)Gula (Völlerei,Maßlosigkeit, Selbstsucht)Invidia (Neid, Eifersucht, Missgunst)Acedia (Faulheit, Ignoranz, Überdruss)Zu unterscheiden und hier davon abzugrenzen sind die sogenannten „Erbsünden“, die einen mehr theologisch-alttestamentarischen als einen gesellschaftlichen und sozialen Hintergrund haben.
Für die frühe Neuzeit, besonders in den ersten beiden Jahrhunderten, möchte ich einige der Todsünden bei folgenden, globalen und historischen Ereignissen untersuchen:
Die EntdeckungsreisenDie GlaubensspaltungDas Heliozentrische Weltbild.Zu a) Die Entdeckungsreisen: War es denn überhaupt notwendig, Ende des 15. Jahrhunderts plötzlich einen schnellen „Seeweg nach Indien“ zu suchen (mit „Neid“ und „Habgier“)? Wenn die Wikinger fünfhundert Jahre zuvor schon einen klugen Historiker/in hervorgebracht hätten, der/die auch lateinisch schreiben hätte können (haben sie aber nicht …), dann hätten die späteren Kapitäne der Entdeckerschiffe (vom italienischen Kolumbus bis zum englischen Francis Drake) wohl gründlicher nachgedacht und sie hätten möglicherweise weniger „Neid“ und „Habsucht“ entwickelt. Sie hätten dann nach diesen (fiktiven) Lebenserinnerungen alter Wikinger-Kapitäne sicherlich mehr Respekt vor den Risiken und auch der Nutzlosigkeit von neuen Erdteilen (in der damaligen Zeit ohne Missions- und Kolonisierungswahn) gehabt und ihre kostspieligen, risikoreichen Fahrten nicht gemacht. Das wären dann schon mal zwei Todsünden der Neuzeit weniger gewesen.
In Nordeuropa, der Ostsee und Nordsee bestand ja auch schon seit 200 Jahren ein tüchtiger, weitgehend friedlicher (abgesehen von der Seeräubergefahr mit Störtebeker) Hanse-Wirtschaftsbund, der auf den Grundlagen nationaler, friedlicher und ökonomisch liberaler und gleichberechtigter (wenig kriegerischer) Beziehungen ausgerichtet worden war. Hätte man das nicht noch weiter ausbauen können/müssen, statt Pfeffer und Myrthen aus Indien und das Gold der Mayas zu rauben?
Aber nein, die Entdeckungsreisen gen Westen über den Atlantik waren ja auch noch römisch-christlich motiviert und nicht nur ökonomisch und infrastrukturell. Und die Päpste standen immer noch unter dem Eindruck der gescheiterten sieben Kreuzzüge im Hochmittelalter und sie wollten weiterhin die gesamte, „flache“ Welt zum Christentum missionieren. Und gerade diese weiteren Todsünden der Päpste und auch der christlichen Könige und Kaiser („Stolz“, „Neid“ auf den Islam) haben dann nach 1492 in der frühen Neuzeit durch hemmungslose Kolonisation, Goldgier und Absolutismus in den unterworfenen Kolonien rund um Amerika und Afrika Millionen von Menschen das Leben gekostet und alte Kulturen vernichtet.
Natürlich haben wohl die Entdeckungsreisen die neuzeitliche Technik befördert. Auf der Grundlage wurden der Schiffsbau verbessert, neue Techniken, und Fortbewegungsmittel entwickelt. Diese wurden dann aber leider auch wieder für die Bereiche der Kriegsführung und der Rüstung, vor allem durch Aufrüstung mit Schwarzpulver und Kanonen missbraucht. Dadurch ging die Ritterzeit mit ihren bunten und einfachen Rüstungen zu Ende. Der spanische Nationaldichter Cervantes konnte im Jahre 1605 mit seinem Scherzroman „Don Quijote de la Mancha“ das neue 17. Jahrhundert begrüßen und damit einen Riesenerfolg feiern. Das Ablegen der schweren, verzierten Metallrüstungen der Ritter und ihrer Pferde leitete aber nicht nur den Niedergang des mittelalterlichen, feudalen Ritteradels ein, sondern es brachte von da an in allen Kriegen unzähligen Soldaten und Männern den grausamen, mechanisierten und später sogar industriellen und massenhaften Tod. Hat sich nicht immer erst in den Nachkriegzeiten in den folgenden Friedenszeiten wirklich „der Fortschritt“ entwickeln und einstellen können?
Zu den Todsünden aus der Zeit der Entdeckungsreisen gehört auch die Verbindung von Rassismus und Sklaverei (Grundlagen auch hier: „Neid“, „Habsucht“, „Völlerei“). Es gab zwar leider schon immer Dünkel und Überlegenheitsgefühle von einigen Menschen über andere. Aber das waren am Anfang des Homo sapiens eher regionale Sippenkämpfe oder später die Klassenkämpfe schon in Antike und Mittelalter, wie sie dann ja auch Karl Marx – manchmal durchaus treffend – beschrieben hat. Zum Beispiel hat der sogenannte „moderne und kluge“ Mensch (nach den Affen) wahrscheinlich schon vor rund zwanzig- bis dreißigtausend Jahren nach der letzten großen Eiszeit in Mitteleuropa die eher friedlichen, aber „technisch“ und handwerklich noch ungeschickten Neandertaler in Mitteleuropa ausgerottet.
Und wie der schwedische Nobelpreisträger Svante Pääbo erst kürzlich bei seinen Forschungen über die Gene der heutigen Menschen im Vergleich mit den Genen der Neandertaler aus dem berühmten Tal bei Düsseldorf festgestellt hat, haben wir Menschen heute sogar noch Reste von Genen der Neandertaler in unseren heutigen Knochen und Schädeln. Das können also heute sowohl die Wissenschaft der Archäologie als auch die der Medizin nachweisen. Also musste es vor dreißigtausend Jahren auch schon „Romeos und Julias“ aus den beiden feindlichen Lagern der alten (noch dummen) und der neuen (schon schlauen) Menschen gegeben haben. Übrigens: Die Letzteren kamen sogar aus Afrika über Mittelmeer und Vorderasien nach Europa!
Aber dass dann schließlich in der Neuzeit die Vermischung der Menschen in allen fünf Weltteilen zu einer gewaltigen Verschleppung und Versklavung meist der Menschen aus Afrika und meistens rüber nach Nordamerika geführt hat, das ist leider eine ungeheuerliche Schande und eine weitere Todsünde der sogenannten „weißen Rasse“. Diese weiße, fast nur aus Europa nach Amerika übergesiedelte „Rasse“ hat sich selbst so als die überlegene, ja, die von Gott „auserwählte Rasse“ eingestuft („Superbia“, „Gula“). Und sie hat das Machtgefühl, das sie sich damit selbst zugewiesen und eingeredet hat, brutal und gegen jedes Natur- und Menschenrecht ausgenutzt.
Der Weltteil Europa hat dabei dann im 19. Jhd. am Beginn des Kolonialismus auch im Nachbarn-Weltteil Afrika eine unrühmliche Rolle gespielt. Einige „Forscher und Gelehrte“ mit eher fragwürdigen Grundlagen und Gedanken versuchten schon früh, ihre weißen Überlegenheitsgefühle „naturwissenschaftlich“ und entwicklungsgeschichtlich zu begründen. Die Schrift von Carl Gustav Carus (1789–1869) von 1849 mit dem arroganten Titel „Die ungleiche Befähigung der verschiedenen Menschenstämme für höhere geistige Entwicklung“ hat dabei eine verhängnisvolle Rolle gespielt. Eine solche These hat sich weder medizinisch noch historisch beweisen lassen. Carus war sogar selbst Arzt, Gynäkologe, Anatom und Pathologe, auch romantischer Maler und Psychologe in Sachsen. Seine Schrift hat er sogar zum 100. Geburtstag des Weimarer Klassikers Goethe veröffentlicht, der aber leider schon tot war, um darauf noch angemessen mit Betonung der Aufklärung und den Menschenrechten zu antworten (siehe: Kap. 4: „Die Morgenröte).
Die neue Evolutionslehre von Charles Darwin hat Carus dabei offensichtlich auch falsch verstanden und somit dem Kolonialismus und Imperialismus (s. Kap. 10) Vorschub geleistet. Aber im Grunde genommen kann man den deutschen Pseudowissenschaftler Carus sogar noch aus dem 19. Jahrhundert den Todsünden der Weißen seit dem Mittelalter und der frühen Neuzeit zuordnen: vor allem Stolz und Habsucht.
Carus spricht nämlich von „Tag- und Nachtvölkern“: Die weißen Europäer gehören nach seiner Meinung zu den ersteren, die dunkelhäutigen Menschen aus Afrika zu den zweiten: „Was nun die afrikanischen Neger betrifft (…) nie hat zu irgend einer Zeit eine nur einigermaßen höhere Staatsverfassung unter ihnen selbst geschaffen werden können, nie haben sie eine Literatur oder einen Begriff höhere Kunstanschauungen und Kunstleistungen erhalten (…)“(siehe: Literaturverzeichnis, a. a. O. Richard Nate, „Strange Visions of Outlandisch Things“, S. 143–47)
Carus stellt eine Analogiebeziehung zwischen Hautfarbe und Tageszeiten her. Hat er das vielleicht sogar – sehr unwissenschaftlich – von den deutschen Umgangswörtern „Abendland“ und „Morgenland“ übernommen? Die Römer bezeichneten mit „occident“ ursprünglich den westlichen Teil von Europa, also die lateinsprachigen, römischen Provinzen. Das Wort „Abendland“ taucht in Deutschland erst 1529 auf. Der christlich-romantische Dichter Novalis (1772–1801) benutzt es programmatisch in seiner Schrift „Die Christenheit oder Europa“. Ebenso tun das die beiden Brüder und deutschen Romantiker August Wilhelm und Friedrich Schlegel. Auch sie benutzen es zur Abgrenzung und Aufwertung des lichterfüllten, „alten“ Kontinents Europa.
Der hier so deutlich ausgegrenzte und „schwarze“ Kontinent Afrika wurde ja erst „richtig“ im 19. Jahrhundert „entdeckt“ von eben den europäischen Imperialisten und Kolonialisten. Aber auch die Amerikaner, hauptsächlich die Plantagenbesitzer in den Südstaaten, haben ja Afrika in dieser Zeit als fast kostenloses Rekrutierungsreservoire für ihre Sklaven gerne benutzt. Jedenfalls zumindest bis zum Ende des Sezessionskrieges.
Richard Nate spricht in seinem neuen Buch (siehe oben) von einer interessanten Übereinstimmung der „frühneuzeitlichen Kosmologie mit einer jüdisch-christlich inspirierten Lichtmetaphorik“ (Nate, a. a. O., S. 147). Danach fände man die „Tagvölker“ weit im Osten bei Indien, China und Japan, genauer gesagt: Als „Dämmerungsvölker“, welche den Sonnengang für den Tag als Erste genießen. Darauf folgten der Orient und Nahe Osten als „Morgenland“ und schließlich Europa mit dem Mittelmeer als „Okzident oder Abendland“ wie schon in mittelalterlichen Schriften. Für Afrika bleiben dann – geografisch nicht ganz korrekt – nur noch die schwarzen „Nachtvölker“ übrig. Für Amerika ist in dieser Einteilung noch gar kein Platz vorgesehen, wie es ja noch dem flachen, scheibenartigen und kindlichen Weltbild der Europäer bis zum Jahre 1492 entspricht, als die Sonne sich ja noch angeblich bewegen sollte und im Osten aufgehen und im Westen untergehen musste. Ob sie wollte oder nicht. Aber die Menschen (homo „sapiens“) wollten es so mit ihren irdischen, steinzeitlichen Gehirnen. Die von Kopernikus aufgeklärten und geschockten Westeuropäer (heliozentrisches Weltbild, s. Kap. 1) hätten es ja eigentlich schon viel besser wissen müssen. Aber sie wollten es eben nicht glauben, selbst unser „Reformator“ Luther nicht.
Und tatsächlich hätten die Menschen nach Kolumbus und Kopernikus noch eine „achte“ Todsünde einführen können – nämlich die Todsünde des Irrtums. Diese hätte natürlich nur für Kolumbus und seine Entdecker-Nachahmer gegolten, nicht für den strengen Astronomen Kopernikus selbst und seine naturwissenschaftlichen Schüler.
Klarerweise spricht Carus im 19. Jahrhundert, also weit nach der „Morgenröte der europäischen Aufklärung“, einen europäischen Herrschaftsanspruch über alle anderen Völker dieser Erde aus. Wobei er aber die schon längst entdeckten Erdregionen Nord- und Südamerika geflissentlich übersieht oder nicht als vergleichbar mit den Europäern und Deutschen im echten, alten „Abendland“ ansieht (Todsünden: „Stolz, Neid, Trägheit des Geistes, Irrtum“).
Bemerkenswerterweise haben große und nicht christliche Länder in Asien – Indien, China und Japan – solchen kolonialistischen Versuchungen im 19. Jahrhundert anfangs noch widerstanden. Dann aber, erst im berüchtigten 20. Jahrhundert, haben sie ebenfalls imperialistische, nationalistische und rassistische Verbrechen begangen, wie sie hier von Carus – vielleicht nicht ausdrücklich, aber doch indirekt – vorbereitet wurden. Nate spricht sogar davon, dass dieses Werk von Carus ein Standardmodell im 19. Jhd. war, nicht nur in Deutschland. Dazu weist er hin auf das Buch des Engländers Edward Burnett Taylor: „Primitive Culture“ von 1871, in welchem die Menschheit in „civilized“ und „barbarians“ oder sogar „savages“ (Wilde) unterteilt wird (s. Nate, a. a. O., S. 146).
Zu b) Die Glaubensspaltung: Im Jahre 1517 begann mit Luthers Thesenanschlag an der Schlosskirche in Wittenberg die Glaubensspaltung der inzwischen schon mehr als tausend Jahre alten Weltkirche des Christentums. Diese hatte sich ja sehr mächtig und durchaus unerwartet und eindrucksvoll aus dem Imperium der Römer (Republik plus Kaisertum) erhoben und im mittelalterlichen Papsttum hochgearbeitet. Auch die Päpste hatten schon immer starke, eher weltlich gesinnte Gegner, die als deutsche Kaiser, Kurfürsten, Landadel oder sogar in vereinzelten Bauernrevolutionen (Stedinger Aufstand 1234, Bauernkriege 1524/25) Oppositionen aus dem einfachen Volk gebildet haben. Im Verlaufe von Jahrhunderten ist daraus eine Art Urform der Gewaltenteilung entstanden, die bis heute in westlichen Demokratien das Prinzip weltlicher Staat und Volk gegen geistliche Kirche und Papsttum bildet. Bis zur Glaubensspaltung am Beginn der Neuzeit hatte die römische Kirche Europa weitgehend im Griff und sie war damit neben dem Judentum und dem Islam im Nahen Osten bis nach Indien und China hin die dritte weltumfassende Mono-Theologie der Welt mit dem Glauben an jeweils nur einen Gott: Jahwe, Jesus/Gott oder Allah;
Im Jahre 1618, fast genau hundert Jahre nach Luthers erster Protestaktion – mit der er ja ursprünglich die Papstkirche nur reinigen oder „reformieren“ wollte, beginnt im Zentrum von Europa der Dreißigjährige Krieg (1618–48). Mit „Stolz“, „Habsucht“ und „Neid“ und zwar auf allen Seiten. Es entwickelte sich ein großer Glaubenskrieg zwischen den protestantischen, neuzeitlichen und den altkatholischen, noch mittelalterlichen Mächten in Europa. Dieser entstand nach einem hektischen, schwierigen, ja, chaotischen 16. Jahrhundert, in dem die Menschen noch in der Masse nicht kapiert hatten, dass „ihr Mittelalter“, welches für sie natürlich die Gegenwart war, schon längst abgedankt hatte, aber „ihre Neuzeit“ immer noch an Geburtswehen krankte. Die Folgen waren: Reformation und Gegenreformation, Uneinigkeit der Protestanten: Lutheraner gegen Wiedertäufer, Mennoniten, Calvinisten, Zwinglianer und weitere „Freikirchen“, Gründung der kämpferischen Jesuiten durch Ignatius von Loyola (als kath. Gegenentwurf zu Luther), lutherische Landeskirchen mit erstaunlicher Einheit von fürstlichen Thronen mit evangelischen Kanzeln („Cuius regio, eius religio“), schmalkaldische Kriege gegen katholische Restländer, Hugenottenkriege in Frankreich, spanisch-niederländischer Krieg, Erstarken von katholischen Monarchien unter Kaiser Karl V., Philipp der II. in Spanien, Gründung einer englischen, anglikanischen Kirche unter dem Schutz eines erstarkenden, englischen, im Prinzip protestantischen Königtums, Goldrausch und Machtgier der Spanier und Portugiesen in deren ersten Kolonien in Mittel- und Südamerika.
Um die Jahrhundertwende der Jahre 1599/1600 kippten diese bürgerkriegsähnlichen Kriege im erbitterten Kampf um die christliche Glaubenshoheit allmählich und im Grunde genommen historisch logisch in einen gewaltigen, europäischen Krieg um, nämlich den Dreißigjährigen, der dann 1618 durch ein geradezu lächerliches Ereignis, dem Prager Fenstersturz auf der Prager Burg, ausgelöst und dann weitgehend auf deutschem Territorium geführt wurde – unter der Beteiligung sämtlicher europäischer Großmächte mit wechselnder Intensität.
Davon hatte Martin Luther überhaupt nichts geahnt. Er hat es auch nie so gewollt. Sein politisch-historisches Verständnis reichte ja eigentlich gar nicht über seine Lieblingsthemen hinaus, nämlich die hochdeutsche Bibelübersetzung, dabei die theologische Erforschung seines eigenen „Gewissens“ und höchstens dann noch die Schaffung einer großartigen, deutschen Standard- und Einheitssprache. Damit hat er dann auch mehr oder weniger wider Willen eine ungeheure Volkserhebung und Massenbildung durch den neuen Buchdruck (Johannes Gutenberg) ausgelöst.
Aber zunächst herrschte noch die große und überhaupt nicht christliche Kriegsfurie in Europa („Superbia“ und „Avariatia“). Sie wurde angeführt von der damals schwedischen Großmacht unter ihrem König Gustav Adolf mit der Unterstützung von mehreren norddeutschen, protestantischen Fürstentümern und von dem Söldnerführer Albrecht Wallenstein, der vom katholischen, deutschen Kaiser Ferdinand angeworben und bezahlt worden war. Der frühe Tod des Protestanten Gustav Adolf in der Schlacht bei Lützen 1632 und dann die folgende, ausufernde Macht- und Geldgier (Todsünden) von Feldherr Wallenstein sowie die Schwäche des katholischen Kaisers führten dann zu den sprichwörtlich gewordenen Grausamkeiten und Verheerungen in Deutschland. Mit dem „Westfälischen Frieden“ in Osnabrück und Münster endete dann schließlich der große Krieg mehr oder weniger unentschieden. Insgesamt waren die deutschen, regionalen Fürstentümer am schlimmsten geschädigt worden. Frankreich konnte seinen Aufstieg unter König Ludwig XIV, dem „Sonnenkönig“, fortsetzen und ausbauen. Schweden musste fortan mühsam um seinen Anspruch ringen, eine europäische Großmacht zu bleiben – auch in Rivalität zu Russland und dem neuen Zaren Peter dem Großen. Die nordeuropäischen Schwerpunkte Niederlande und England, beide als Seemächte, verlagerten ihr Interesse von Europa immer mehr auf die Gewinnung von Kolonialgebieten in der neu entdeckten Welt, also nach „Übersee“.
Die Glaubensspaltung in der Neuzeit hatte nach rund 250 Jahren zwischen 1500 und 1750 also keinen eindeutigen Sieger. Eher hatten die europäischen Staaten nach langem Ringen überall Federn lassen müssen. Alle genannten „Todsünden“ – mitgeschleppt aus dem Hochmittelalter – hatten negative Wirkungen verursacht. Auch die Entdeckerländer seit 1492, nämlich Spanien, Portugal, die Niederlande, England und Frankreich, mussten ihre Ansprüche und Hoffnungen auf die Ausbreitung in den neuen Erdteilen verlangsamen, konnten sie aber bald wieder aufnehmen. Auch da gab es aber wichtige Weichenstellungen: Frankreich schied Ende des 18. Jahrhunderts nach der Französischen Revolution weitgehend in Nordamerika aus. Spanien und Portugal wurden nach Mittel- und Südamerika abgedrängt – auch von den jungen und erstarkten USA – oder sogar ins ferne Asien (Goa). Auch die Niederlande gaben schließlich ihre Ansprüche mehr oder weniger kampflos ab. Als ihre Gründung „New Amsterdam“ an der Ostküste von Nordamerika schon im Jahre 1664 von den Engländern in „New York“ umbenannt wurde, war klar, dass von den alten Entdeckerländern am Ende des 17. Jahrhunderts nur noch England als strahlender Sieger übriggeblieben war, nachdem es ja schon vorher Spanien abgedrängt hatte.
Dieser Sieg wurde aber auch sehr bald durch die Fluchtbewegung der englischen Kolonialisten in Nordamerika und damit ihrem Unabhängigkeitsstreben von der britischen Krone und ihrem Heimatstaat relativiert. Siehe weiter unten (s. Kap. 5).
Zu c) Das Heliozentrische Weltbild: Die Erkenntnis, dass unsere Erde ein kugelförmiger Planet um die feststehende Sonne ist, hat viele Menschen damals weniger begeistert als zunächst verstört und empört. Deshalb konnte die katholische Kirche ja auch über ein Jahrhundert lang (bis Galilei und Kepler) im 17. Jhd. an dem Postulat „flache Scheibe“ festhalten. Und es gibt ja einige „Querdenker“, die das heute im 21. Jhd. immer noch glauben (Todsünden „Zorn und Stolz“ und natürlich „Irrtum“, welche heute sogar bei allen Klimaleugnern verbreitet sind, auch bei Trump und seinen verblendeten Anhängern). Und so wie Kolumbus sich zeitlebens gegen störrische Päpste (Todsünde „Trägheit“) wehren musste, so sieht der Weltumsegler Boris Herrmann aus Oldenburg noch heute die weltretterische Notwendigkeit, auf sein riesiges Großsegel seiner Rennyacht zu schreiben: „Unite behind the Sciences“. Also: „Vereint Euch endlich hinter den Wahrheiten der Naturwissenschaften!“ Die naturwissenschaftliche Astronomie, Geografie, Medizin, Technik oder Seenavigation per Satelliten dürfen auf keinen Fall heute damit aufhören, sich gegen die Dummheit und die Macht von Politikern vom Schlage eines Trumps oder Bolzonaro durchzusetzen, die immer noch ihre Lügen und ihr Leugnen über den sichtbaren Klimawechsel und die Naturzerstörung per „Twitter“ oder „Tiktok“ und auf anderen Formaten als „Fakes“ (und keineswegs „Facts“) verbreiten.
Zum Glück setzte sich das heliozentrische Weltbild nach ca. 200-300 Jahren doch durch. Aber dass es so lange dauerte (Todsünde: „Trägheit“), lag auch schon damals nicht nur an dem Widerstand von Kirche und den Mächtigen, sondern auch an der Langsamkeit und Schwerfälligkeit der einfachen Menschen (moderne Todsünde bis heute: „Irrtum“!). Manche Menschen wollten und wollen einfach nicht an die naturwissenschaftlichen Beweise glauben oder sie verstehen diese gar nicht. Um 1500 war es eben auch eine schwierige, psychologische Notwendigkeit, ein Weltbild und damit zugleich auch das Menschenbild von dem einmaligen, von einem Gott geschaffenen („… macht euch die Erde untertan …“) Menschen auf eine neue, demütige Erkenntnis von der Kleinheit des Menschen gegenüber der großen Natur auf unserem Globus zu übertragen. Obwohl das Christentum, besonders im Neuen Testament, diese Einsicht ja durchaus an mehreren Stellen verbreitet (Gleichheit aller Menschen, Demut gegen alle Lebewesen, das Friedensgebot der Bergpredigt von Jesus).
Jedem Menschen – und nicht nur den Päpsten und Königen – musste erst bewusstwerden, dass er/sie nicht die Krönung der Schöpfung war, sondern nur ein kleines Rädchen im Kreislauf der Natur und Evolution (Charles Darwin/Alexander von Humboldt: siehe Kap. 9).
Das war eine entlarvende Erkenntnis mit Schockwirkung für die Zeitgenossen im 16. Jahrhundert. Liegt darin nicht auch eine seelische Ursache für die Wirren dieser Zeit? Wie sollten die Menschen das damals so schnell verkraften? Wir heutigen Menschen hatten fünfhundert Jahre Zeit, um uns daran zu gewöhnen. Und einige haben das immer noch nicht geschafft. Und stehen wir heutigen Menschen nicht sogar wieder vor so einer Schwelle, bezogen auf die Weltraumforschung, das Universum oder auch nur die lächerlichen Raketenreisen zum felsigen Mond (zwei Wochen) oder hin zum staubigen und eisigen Mars (zwei Jahre) oder aus „unserer Milchstraße“ ganz hinaus (nur in Millionen von Lichtjahren zu machen!)?
Die Kapitäne der Entdeckerschiffe und ihre Mannschaften, ebenso wie die in ihre eigene geistliche Gewissheit und ihr „Gewissen“ vernarrten Protestanten um Luther und seine Anhänger konnten immerhin von einer großen Zukunft träumen. Nur wer das nicht tun wollte, der musste sich schwer damit tun, um nicht die Abwertung seiner eigenen, menschlichen Existenz zu betreiben. So wie es ein Großteil des neuen Ordens der Jesuiten in der Gegenreformation betrieb, vor allem auch gerade im spanischen und portugiesischen Südamerika.
Die Weigerung, das heliozentrische Weltbild anzunehmen, kann man also von allen Todsünden aus dem Mittelalter als die verständlichste, ja, menschlichste, bezeichnen. Daraus darf man allerdings kein „Menschenrecht auf naturwissenschaftlichen Irrtum“ ableiten, wie das heutzutage ja bei einigen Querdenkern gegen die Impfpflicht oder beim Leugnen der Klimakipppunkte der Fall zu sein scheint.
***
3. Flucht in die Kolonien vor Krieg und Absolutismus in Europa
Da wir uns ja hier auf die deutsche Sicht und Perspektive auf Nordamerika und Kanada konzentrieren wollen, müssen wir die mittel- und südamerikanische Kolonialgeschichte mit Spanien und Portugal jetzt ein bisschen vernachlässigen. Denn sogar schon am Beginn des 30-jährigen Krieges (s. oben) im 17. Jhd. machte England an der Küste nördlich vom heutigen Boston und Massachusetts einen kleinen, aber gesamthistorisch riesigen Schritt nach vorne bei der Eroberung seiner nordamerikanischen Kolonien. Und im Unterschied zu den Wikingern (s. oben) blieben sie dort in den nächsten 250 Jahren anwesend und erweiterten Stück für Stück ihre kolonialen Erwerbungen bzw. Eroberungen – allerdings auf Kosten der „indianischen“ (heute: „indigenen“) Ureinwohner.
Der Zweimaster „Mayflower“ startete am 6. September 1620 von Plymouth aus, so wie Sir Francis Drake schon 40 Jahre vorher bei seiner ersten kompletten Weltumsegelung, in die Neue Welt und landete nach zehn harten Segelwochen am 21. November kurz vor dem Wintereinbruch in der Nähe des heutigen Örtchens Provincetown am Cape Cod, nördlich von Boston. An Bord waren 102 Passagiere: Männer, Frauen und Kinder von einer protestantischen, in England verfolgten Sekte der „Pilgrims“, die ihre Freiheit des Glaubens und der Person in Amerika suchten. Diese englischen, protestantischen Flüchtlinge – oder genauer: durch die anglikanische Staatskirche Vertriebenen – gingen in die amerikanische Gründungsgeschichte als die „Pilgerväter“ ein. Sie stammten aus Mittelengland und ihre Nachkommen in den USA genießen dort bis heute den Rang eines kolonialen Uradels. Im Herbst und Winter 1620 – in Deutschland und Europa tobte schon die Kriegsfurie – befanden sich die Pilgerväter und ihre Familien aber auch in einem jämmerlichen Zustand. Nur mit großer Anstrengung und mit der anfänglichen Hilfe von „Indigenen“ konnten sie sich Grassodenwinterhäuser errichten, die heute dort für die Touristen nachgebaut worden sind. Nur so konnten die englischen Flüchtlinge kalte Stürmen, Eis und Schnee des ersten Winters überstehen. Trotzdem starben viele an Lungenentzündungen oder Tuberkulose.
Die „Pilgrim Fathers“ waren Calvinisten bzw. radikale Puritaner, die in Gegnerschaft zu der „Church of England“ (auch ein Produkt der „Glaubenskämpfe“ im 16. Jhd., siehe oben) das Heimatland verlassen hatten. Sie strebten eine absolute, gleichberechtigte Gemeindeautonomie an und glaubten, dass sie nur direkt Gott und Jesus Christus unterstellt wären. Sie lehnten sogar das christliche Kreuzzeichen und Weihnachten als altheidnischen Brauch ab, weil sie dafür keine Belege in der Bibel fanden, trotz intensiver Suche und nicht mehr in der lateinischen, sondern in der englischen Heimatsprache.
Sie schlossen den Mayflower-Vertrag, in dem sie sich zu demokratischen Prinzipien im Sinne einer selbstverwalteten, freien Gemeinschaft verpflichteten („self rule, self government“). Das war gewissermaßen der „Rütli-Schwur“ der ersten europäischen Einwanderer in Nordamerika und den späteren USA. Die Pilgerväter gaben sich damit das heilige Versprechen, dass man für alle Menschen „gerechte Gesetze“ („just and equal laws“) schaffen müsste und danach leben sollte. Diese Regierungsform würde allein dem Willen Gottes für alle Menschen in Gleichheit und Freiheit entsprechen.
Diese im Prinzip einfachen Vorstellungen entstanden unter den knapp hundert Menschen auf der Flucht vor Unterdrückung und feudaler Unfreiheit in Europa. Im Jahre 1621 unterzeichneten sie einen Friedensvertrag mit dem Häuptling der Wampanoag-Ureinwohner. Einige Jahrzehnte lang entwickelten sich mit weiteren, hinzugekommenen Aussiedlern aus England relativ harmonische Beziehungen zu den Einheimischen. Doch schon ab 1637 (Pequot-Krieg) wurden die Spannungen größer. Im sogenannten „King Philip’s War“ von 1675 bis 1676 wurden die Indigenen mit fast 3000 getöteten Opfern durch die Einwanderer in der Region des späteren Staates Massachusetts so geschwächt, dass sie sich davon nie mehr erholten. Die weißen Siedler aus England hatten in Amerika gesiegt mit weißem „Stolz“ oder mit erbarmungslosem „Zorn“? Oder gar mit einer „Habsucht“, trotz ihrer naiven, urchristlichen Ideologie aus den alten Zeiten der Christenverfolgungen in den römischen Katakomben?
***
Eine ähnliche Entwicklung nahmen die weiter südlich gelegenen Gebiete der englischen Kolonien um Virginia und Philadelphia. Diese entstanden zu einem kleinen Teil sogar schon vor der Landung der „Mayflower“ beim Cape Cod. Das Ziel der Pilgerväter im Jahre 1620 waren ja auch eher die kleinen, englischen Siedlungen weiter südlich gewesen, die dort schon bereitstanden. Diese hatte man aber wegen widriger Wetterverhältnisse nicht mehr erreichen können.
Noch zeitlich weiter zurück machte schon im Jahre 1584 Sir Walter Raleigh im Auftrag von Königin Elisabeth I. eine Expedition an die Westküste und nannte sein besetztes Gebiet zu Ehren der unverheirateten Elisabeth „Virginia“ („Virgin Queen“). Walter Raleigh hat im Unterschied zu seinem Rivalen Francis Drake um die Huld der Königin sogar langfristig mehr Erfolg gehabt als der Kaperkapitän und Seeräuber Drake. Dafür muss man allerdings weit voraus denken, nämlich an die Gründung der USA ab Ende des 18. Jahrhunderts. Das konnten alle noch nicht voraussehen, weder Raleigh, Drake und auch nicht ihre Queen Elisabeth die Erste.
Schon 1607 bildete sich eine mehr oder weniger private „Virginia Company“, welche die kleine Siedlung „Jamestown“ aufbaute. Sie lockte schon ab Dezember 1606 eine Gruppe von protestantischen Glaubensflüchtlingen aus England mit 144 Männern nach drüben. Von diesen lebten 1607 allerdings nur noch 38. Alle anderen waren an Hunger und Krankheiten gestorben. Es drängten trotzdem weitere Flüchtlinge in die Neue Welt. Und als ein gewisser John Rolfe 1612 die Tabakpflanze als günstiges Wirtschaftsgut in Nordamerika entdeckte und zum ersten Mal aberntete, begann ein ökonomischer Aufschwung. Tabak wuchs gut im feuchten Klima Virginias. Vorher bekriegten sich „die Weißen“ aus England aber noch mit den Ureinwohnern. Das waren verschiedene Stämme: die Powhatan, Irokesen, Nottaway, Meherrin, Sioux, Monacan und Cherokee.
Auch aus Deutschland kamen immer mehr Einwanderer, die meisten auch als protestantische Glaubensflüchtlinge. Als Erste gründeten Leute aus dem Siegerland im Jahre 1714 die „Kolonie Germana“ (nicht Germania). Sie gingen dort in die regionale Geschichtsschreibung als die „good old Germans“ ein.
Die späteren Staaten der USA „Virginia“ und „Pennsylvania“ gehören zu den 13 englischen Kolonien, die 1776 ihre Unabhängigkeit von England erkämpften. Diese beiden Staaten waren auch anfangs das Ziel der meisten deutschen Einwanderer und Glaubensflüchtlinge. In Philadelphia wurde später nach der Trennung der Kolonien von England nur knapp entschieden, dass nicht Deutsch, sondern Englisch die Standardsprache in den USA werden sollte. Viele der berühmten Gründerväter der USA kamen aus Virginia: Patrick Henry, Thomas Jefferson, Richard Henry Lee, James Madison, George Mason oder George Washington. Das alte Mutter- und Kolonialland England gab seine Rechte am 9. Dezember 1775 endgültig auf und der in Williamsburg tagende „Konvent von Virginia“ erklärte am 15. Mai 1776 Virginia für unabhängig. Das war dann nur noch knapp zwei Monate vor der „Independent Declaration“ der dreizehn Gründerstaaten der USA, zu denen natürlich Virginia gehörte.
***
Der deutsche Anglist Richard Nate von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt hat kürzlich (2023) diesen fragwürdigen Drang der Europäer nach Amerika und später auch nach Afrika und leider auch die Gier der Europäer in der frühen Neuzeit in der englischsprachigen Literatur des 16. bis 20. Jahrhunderts mit entlarvenden Ergebnissen untersucht. Richard Nate zeigt dort auch am Beispiel von Carl Gustav Carus (1789–1869