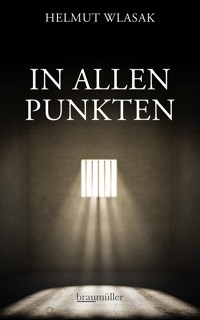19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Braumüller Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Seit mehr als 25 Jahren fasziniert Strafrichter und Buchautor Helmut Wlasak mit seinen Vorträgen. Dabei behandelt er auf einzigartig unverblümte, teils schockierende, aber auch humorvolle Weise alle denkbaren, oft verharmlosten Gefahren des Erwachsenwerdens und -seins, insbesondere im Umgang mit Alkohol, Drogen und verschiedenen Süchten. Doch beschränkt er sich nicht nur auf die Schilderung dieser Herausforderungen, sondern präsentiert gleichzeitig Lösungsansätze. Seine bemerkenswerte Verhandlungsführung in Strafprozessen, verbunden mit dem unbeugsamen Streben nach der Wahrheit, machte ihn über den Gerichtssaal hinaus bekannt. Die Sorgen und Probleme des kleinen Mannes sind ihm aus seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Mitglied der internationalen Vinzenzgemeinschaft ebenso vertraut wie die Strukturen der weltweiten organisierten Kriminalität. Seine Devise lautet: Glauben Sie mir die Geschichte nicht. Verbringen Sie mit mir einen Tag im Verhandlungssaal des Landesgerichts für Strafsachen, dann sehen Sie die Welt mit anderen Augen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Markus– Das Laster der Leidenschaft
Peppi – Seine kürzeste Show.
Ursula und Berndt– Bis zum bitteren Ende.
Aleksander und Co – Lauf, wer kann!
Konrad – Zu viel versprochen?
Freispruch – Was ist eigentlich ein Freispruch?
Amalia – „Geht vielleicht ein Freispruch?“
Hildegard – Eine Omi anderen Kalibers
Roswitha – Wenn es kompliziert wird.
Franz und Anna – Auf der Suche nach Konsens.
Kevin – Aus dem Rhythmus.
Alois gegen Alois – Die hohe Kunst der Medizin.
Erwin Alfred – Zu schön, um wahr zu sein.
Ferdinand – „Menschen stolpern nicht über Berge,
sondern über Maulwurfshügel.“ (Konfuzius)
Gregor oder Victor – S 4, S 6, S 8: Ein bisschen mehr geht immer!
Ludwig – Tarnen und Täuschen.
Werner – Wer die Chance ergreift, muss nicht gewinnen.
Marcel – Unerwartete Berührungen.
Sylvia und Lydia – Rache ist auch keine Lösung.
Constantin – Fluglinie des Vertrauens.
Ivan – Kleiner oder großer Fisch?
Philipp – Homo Oeconomicus.
Cezweihafünfoha – Der Stoff, aus dem die (Alb-)Träume sind.
Hans – Schachmatt in der Kirche.
Martin – Einen Jux wollt’ er sich machen.
Horst-Dieter – Mehr als zu viel.
Nina – Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ewald – Ordnung muss sein, Freispruch auch.
Das Treffen
Nachwort
Impressum
Vorwort
Auch dieses Buch ist wie seine beiden Vorgänger („In allen Punkten“ und „Nicht schuldig“) kein Versuch der Darbietung erfundener Kriminalgeschichten. Es sind keine Geschichten, die von ausgedachten Verbrechen handeln. Vielmehr spiegeln die einzelnen Episoden Erlebtes wider, wie es sich über einen Zeitraum von 43 Dienstjahren in mehr als 7.700 Fällen für den Autor als Strafrichter zugetragen hat. Wenn man sich noch dazu äußerst intensiv mit Täterinnen und Tätern, Zeugen und Opfern beschäftigt, führt dies auch zumeist zu Hintergrundinformationen, die für gewöhnlich nicht in den Akten landen.
Der Inhalt dieser Erkenntnisse lauert aber auch gewissermaßen tagtäglich in unserem Umfeld, ergibt sich oftmals geradezu von selbst und muss somit nicht für Erzählungen ideenreich erfunden werden.
Das Verbrechen: in einer Vielzahl von Einzeltaten und Geschehnissen. Aus der Unvollkommenheit des Menschen, seinen Emotionen und Handlungsweisen, auch als Reaktion auf Situationen und Handlungen anderer. Gänzlich unbegreiflich manchmal, zum Teil menschlich nachvollziehbar, aber immer real.
Real Crime.
Markus
Das Laster der Leidenschaft
Staatsanwalt Pirchinger erhob sich langsam. Er hielt ein Blatt Papier in der Hand, auf das er durch seine Brille blickte. Nach seinem obligatorischen Räuspern begann er mit dem Anklagevortrag.
„Hohes Gericht! Ich bin nicht der zuständige Sachbearbeiter und kenne mich dabei auch nicht aus. Daher bin ich auch – ganz offen gesagt – sehr froh, dass der Herr Vorsitzende das heute hier und jetzt verhandelt, denn er gilt als einer, der sich da auskennen sollte. Möge das Hohe Gericht den Weg durch diesen Dschungel finden und entscheiden!“
Pirchinger war dafür bekannt, nicht lange um den heißen Brei herumzureden, er brachte die Dinge zumeist mit wenigen Worten auf den Punkt und war auch gefürchtet, so manch konstruiertes Lügengebirge von Angeklagten innerhalb kürzester Zeit mit nur wenigen Fragen zum Einsturz zu bringen.
Auch der Verteidiger streute dem Gericht schon im Eröffnungsplädoyer Rosen.
„Hohes Gericht, sehr verehrter Herr Vorsitzender! Ich kann mich da nur den Worten des Herrn Staatsanwaltes anschließen. Auch ich bin hier nicht vom Fach und kann da nicht mitreden, das sage ich ganz offen. Es wird aber schon jetzt darauf hingewiesen, dass sehr viel in der Anklage nicht stimmen kann und vor allem zahlreiche Fakten überhaupt nicht den Tatsachen entsprechen können, die Anklagebehörde hat sich da allerlei, um nicht zu sagen sehr vieles zusammengereimt. So finden sich im Ergebnis auch in deren Begründung zur Anklage keinerlei logische und somit nachvollziehbare Schlussfolgerungen. Das sei an dieser Stelle jedenfalls schon gesagt. Dazu kommt der Umstand, dass viele Anzeigen miteinbezogen und in die Anklage aufgenommen wurden, die in keinster Weise erhoben worden sind. Lange Rede, kurzer Sinn: Mein Mandant ist nicht schuldig und kommt eigentlich – wie die berühmte Jungfrau – zum Kind.“
Damit war eigentlich schon alles gesagt. Man wusste, wohin die Reise ging, eindeutig Richtung Freispruch.
„Herr Angeklagter!“, begann der Vorsitzende die Befragung, „Was sagen Sie zur Anklage? Schuldig oder nicht schuldig, teilweise schuldig? Bei der Polizei und beim Ermittlungsrichter waren Sie ja nicht gesprächig! Sie wissen aber auch, dass ein Geständnis ein Milderungspunkt ist, wenn es umfassend, reumütig oder der Wahrheitsfindung dienlich ist“, ergänzte er. Wie immer. Gelegentlich half diese Belehrung, vor allem wenn sie eindringlich wirkte.
„Teilweise schuldig, Herr Vorsitzender!“, antwortete der Angeklagte. Er war von mittlerer Statur, mit ordentlichem Schulabschluss und hatte bis zuletzt als Verkäufer gearbeitet. So stand es zumindest in den Akten. Die teilweise Verantwortungsübernahme und Schuldeinsicht überraschte offenkundig den Verteidiger. Dies konnte man zumindest aus seinem Blick schlussfolgern.
„Bei welchem Faktum?“, wollte der Vorsitzende wissen, um allenfalls etwas abkürzen zu können.
„Das weiß ich jetzt nicht“, antwortete der Angeklagte beinahe entschuldigend.
„Sie werden wohl wissen, was Sie sich geschnappt haben, oder? Vor allem wenn es nur eine gewesen ist!“, entgegnete sofort der Vorsitzende, um sogleich fortzufahren.
„FLH, XLH oder XLCR oder doch eine FXS?“
„Nein.“
„Sie wissen aber schon, wovon ich spreche, oder?“
„Ja, klar doch! HD!“
„Na also. Oder war es eine GS oder doch eine CB oder XL oder sogar eine CBX?“
„So eine hätte ich gerne gehabt.“
„Sind Sie auch selber gefahren?“
„Schon, aber zunächst nicht so viel. Außerdem hatte ich nicht genug Geld.“
„Das geht wohl jedem so. Wann haben Sie dann angefangen?“
„Eigentlich eh gleich, schon mit 18.“
„Und vorher? Zwischen 16 und 18 sind Sie nicht gefahren?“
„Ja, schon. Halt die Kleinen!“
„Die Fünfzigerln. Original, aber auffrisiert?“
„Nicht wirklich.“
„Na geh, das glaub ich Ihnen jetzt aber nicht. Es hat ja jeder was gemacht, der eine mehr, der andere weniger.“
„Erst war es weniger, dann mehr!“
„Sag’ ich doch. Zylindervergrößerung auch oder nur Standard mit Auspuff und so?“
„Schon. Vergaser auch verbessert.“
„Vergrößert oder gleich ausgetauscht?“
„Zuletzt schon. Der Italiener musste es schon sein, ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie der hieß!“ In den Augen des Angeklagten war durchaus ein Aufleuchten zu sehen, es fiel dem Vorsitzenden sofort auf.
„Dellorto. So hieß er. Dellorto. Oder ein größerer Bing?“, entgegnete der Vorsitzende und lag damit richtig.
„Dellorto! Ja genau, so hieß er!“, die Begeisterung des Angeklagten war nicht mehr zu übersehen.
„Dann ist das Ding richtig gut gegangen, nur stieg auch der Durst anständig!“, bekräftigte jetzt wieder wissend der Richter.
„Ja genau, aber beim Auspuff musste man aber auch was machen, sonst war es nichts Besonderes“, erläuterte jetzt der Angeklagte.
„Dann werden Sie die innenliegenden fortgesetzten Eisenröhrln abgeschnitten haben, oder?“
„Ja sicher, sonst wäre der Motor ja nur zugestöpselt gewesen“, antwortete der Angeklagte wohlwissend.
„Und bei der Übersetzung werden Sie dann auch etwas verändert haben, oder? Sonst drehte das Werkl ja sofort in den roten Bereich.“
„Logisch. Ich habe sie viel länger übersetzt.“
„Vorne größer und hinten kleiner, um einige Zähne. Bei mir war es 15 zu 38. 37 ging auch.“
„Das weiß ich jetzt nicht mehr.“ Dennoch schien der Angeklagte nachzudenken.
„Macht ja nichts. Aber dann sind Sie auch etwas Größeres gefahren?“
„Schon, aber nicht gleich etwas Großes. Erst noch kleiner und dann langsam mehr. Es ist sich ja nicht mit dem Geld ausgegangen!“
„Was haben Sie dann gemacht?“
„Ziemlich viel gehackelt, ehrlich. Gelegentlich jede Menge an Überstunden. War eh okay, nicht immer lustig, aber …“
„Aber ein Ziel vor Augen. Dann geht es, oder?“
„Ja!“, antwortete der Angeklagte und irgendwie merkte man, dass sich seine ursprünglich vielleicht verborgene, aber durchaus fühlbare Nervosität mit jedem Satz, den er sprach, reduzierte und sich bei diesem Thema zuletzt völlig auflöste.
„Was sind Sie dann gefahren?“
Diese nächste Frage des vorsitzenden Richters hatte so überhaupt nichts mit dem Prozessstoff zu tun, wie auch die meisten Fragen zuvor. War dies vielleicht für den Verteidiger zumindest zu Beginn noch etwas irritierend, wusste der Staatsanwalt ganz genau, dass es jetzt keinen Sinn machen würde, diesen Richter darin jetzt zu unterbrechen und auf prozessrechtlich relevante Fragen hinzuweisen.
„CB 360 und dann CB 400.“
„Großer Gott“, entkam es dem Vorsitzenden, „der Viererreihenmotor mit einer Vier in Eins, vielleicht noch in Gelb?“
„Ja, meine war gelb.“ Das Leuchten in den Augen war unübersehbar.
„Und die CB 360 war unkaputtbar!“, brachte sich wieder der Richter ein, „Die hat es ja so schon Ende 1973 gegeben, wurde zuerst in den USA vorgestellt, soweit ich mich erinnern kann. Nach Europa kam sie dann erst 1974 und da bin ich das erste Mal hinten oben mitgefahren.“ Jetzt war auch das Leuchten in den Augen des Vorsitzenden zumindest für den Angeklagten eindeutig erkennbar, dessen Blick an seinem Gegenüber hing.
„Es war auch eine ganz eigene Farbe bei der 360er, so hell- und dunkelblau gemischt“, ergänzte der Mann auf der Anklagebank.
„Und drei weiße Linien dazwischen“, legte der Richter eins noch oben drauf, ohne aber auf eine Frage zu vergessen: „Wie stark war eigentlich die 400er?“
„37 PS“, kam es wie aus der Pistole geschossen.
„Die konnten was, oder?“
„Schon, aber das Fahrgestell war nicht über jeden Zweifel erhaben!“, ergänzte der Angeklagte wohlwissend, „wahrscheinlich die Dämpfer oder grundsätzlich ein zu laxes Federbein!“
„Die Bridgestone sollen aber auch nicht erste Sahne gewesen sein“, konterte der Vorsitzende.
„Die waren eine Katastrophe!“
Man verstand sich, man wusste, wovon man sprach. Es hätte eine Unterhaltung in einem Old- oder Youngtimerclub sein können, der mit zunehmender Dauer nicht nur facettenreicher sondern auch fachspezifischer zu werden schien. Der Staatsanwalt folgte nach außen hin zwar diesem Dialog der offensichtlich Wissenden, im Innersten nervte es ihn, weshalb er schon seit geraumer Zeit in anderen Akten blätterte. Der Rechtspraktikant als eingeteilter Schriftführer hatte schon zu Beginn des Gespräches resigniert und wusste nicht mehr, was er mitschreiben sollte. Und seinen Ausbildungsrichter, der unentwegt mit dem Angeklagten sprach, konnte er auch nicht unterbrechen, ohne sich eine gehörige Portion Unverständnis einzuhandeln. Also hörte er still und leise den Ausführungen der beiden zu.
Wer weiß, wie lange dieser Smalltalk zwischen den beiden Motorradnarren noch weiter gegangen wäre, hätte der Vorsitzende nicht jäh eine besondere Frage gestellt.
„Und welche war Ihre Traummaschine?“
Das Gesicht des Angeklagten verzog sich, ein etwas gequältes Lächeln lief über sein Gesicht, seine Gedanken schienen im Innersten seines Kopfes zu explodieren, die Augenlider zuckten kurz nach links und dann nach rechts, als suchten sie das Objekt der denkbaren Begierde. Dann senkte er seinen Kopf.
„Eine 750 SS oder 750 SEI.“
„Sind auch schön, aber da ist noch viel Luft nach oben, oder?“
Der Angeklagte schwieg diesmal.
„Haben Sie nicht etwas ganz Spezielles bei sich zu Hause stehen?“, fragte jetzt der Vorsitzende.
„Nein, nicht dass ich wüsste!“
„Aus den Polizeiberichten entnehme ich aber, dass auch eine MV Agusta bei Ihnen gefunden wurde. Die gehört ganz offiziell Ihnen, dafür gibt es Papiere usw. Ich habe da nachgeschaut und mir auch die Fotos von der Hausdurchsuchung bei Ihnen angesehen. Das ist eine 1100er mit 1067 cm3 in rot-weiß-rot Lackierung.“
„Ja, aber nichts Besonderes“, entgegnete umgehend der Angeklagte.
„Nichts Besonderes? Sie scherzen! Da stehen noch ein paar Buchstaben dabei, Herr Angeklagter!“
Die Ausführungen des Richters klangen beinahe bedrohlich.
„Da steht Grand Prix dabei. Wollen Sie mir jetzt wirklich ein Gschichterl drücken?“, die Worte wirkten nun bedrohlicher, vor allem aber waren sie lauter, erst die nächsten waren wieder im Plauderton.
„Wollen Sie mich testen, Herr Angeklagter? Ich werde es abkürzen. Die 1100 MV gehörte schon damals im Jahr 1973 zu den absoluten Traummaschinen und resultierte eigentlich aus dem Wettrüsten der japanischen Hersteller. Mit mehr als 236 km/h stellte sie alles in den Schatten, was es damals und auch noch Jahre danach gab. Der exorbitant hohe Preis war wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass angeblich nur vier Stück gebaut wurden. Und eine davon steht bei Ihnen in der Garage. Und Sie meinen, Sie haben nichts Besonderes!“
Das saß. Nach diesem Kurzvortrag widmete sich der Vorsitzende wieder der Frage, die bis dato noch immer nicht geklärt war.
„Ist Ihnen in der Zwischenzeit eingefallen, welche Sie beim ersten Mal mitgenommen haben? Wenn Sie jeden Tag mehrere stehlen, dann weiß man vielleicht wirklich nicht mehr alles und jede Kleinigkeit. Aber wenn es eh nur eine gewesen ist, dann weiß man das! Und bei Motorrädern kennen Sie sich aus, definitiv.“
Der Angeklagte blickte stumm den Vorsitzenden an.
„Ich helfe Ihnen. CB, Z, XJ, FZ, Zephyr, GSX, YZF? Oder machen wir es einfacher: japanisch, deutsch, italienisch? Oder soll ich bei den Marken aushelfen?“, setzte der Richter fort.
Der Verteidiger sprang ein und legte dem Angeklagten die Anklageschrift auf das kleine Tischchen vor dem Stuhl. Nach wenigen Augenblicken war dieser bei jenem Punkt der Anklage angekommen, den er eingestehen wollte.
„Punkt 26 bei groß A. Das ist richtig.“
„Und alle anderen bei A?“
„Nicht schuldig!“
„Und bei groß B?“
„Auch nicht schuldig!“
„Dann fangen wir beim Punkt 26 an. Warum stehlen Sie einem anderen etwas?“
„Weil ich dumm war!“
„Das ist weder eine Antwort noch ein Grund!“, entgegnete der Vorsitzende mürrisch. Er kannte diese Art von Antwort. Der Begriff „dumm“ fand oft An- und Verwendung: in Antworten der Angeklagten wie fallbezogen, aber oft schon in Eröffnungsplädoyers, wo so mancher Advokat als Verteidiger dies in den Mund nahm und damit die Fehlerhaftigkeit oder das wahre Motiv des Verhaltens des Mandanten umschiffen wollte.
„Also, warum haben Sie gestohlen, am Soundsovielten hier in Graz?“, ergänzte der Fragende.
„Weil ich dumm war und mich verleiten habe lassen!“, entgegnete endlich der Angeklagte.
„Wie verleiten?“
„Das ist da so einfach herumgestanden.“
„Was heißt hier herumgestanden? Fahrzeuge stehen meist irgendwo abgestellt und stehen deshalb nicht irgendwie herum!“, ließ der Vorsitzende nicht nach.
„Ich bin dahergekommen und habe sie da am Straßenrand stehen gesehen.“
„Sie oder es?“
„Wie bitte?“
„Sie oder es? Wie sagen Sie dazu?“
„Ich verstehe nicht?“, wiederholte der Angeklagte.
„Sagen Sie die Maschine, also sie, oder es, das Motorrad?“
Gelegentlich wirken Fragen intellektueller als sie tatsächlich sind. Nach einigen weiteren Augenblicken hatte der Angeklagte das geschlechtsspezifische Hinterfragen des Vorsitzenden verstanden. Der Staatsanwalt lächelte, wusste er doch, dass Motorräder das Steckenpferd des Vorsitzenden waren.
„Die Maschine würde ich sagen“, entgegnete nunmehr etwas kleinlaut der Angeklagte.
„Okay, also die Maschine ist dagestanden?“
„Ja, am Straßenrand?“
„Am Straßenrand? Sie meinen wohl am Fahrbahnrand! Dort, wo der Diebstahl stattgefunden hat, genau genommen der Einbruchdiebstahl, gibt es keinen Straßenrand!“
Ob der Angeklagte auch diese Unterscheidung sofort erfasste, war nicht wirklich ersichtlich, er antwortete nur mit einem schlichten Ja.
„Sie haben also dieses Motorrad dort gestohlen, in dem Sie die Lenkschlosssperre aufgebrochen haben und dann?“
„Da war nichts abgesperrt, es ist unversperrt dort gestanden und dann habe ich es nach Hause geschoben!“
„Jetzt sagen Sie aber es, das Motorrad! Weil ich es gesagt habe, oder?“
„Bitte?“ Der Angeklagte schien den Einwand des Vorsitzenden nicht zu verstehen.
„Es, das Motorrad, und nicht sie, die Maschine. Egal. Die gesamte Strecke? Zu Ihnen nach Hause?“, setzte dieser nach.
„Ja!“
„Das sind vorsichtig geschätzt mindestens zehn Kilometer, wenn es die Adresse ist, die im Akt steht und die Sie ja auch genannt haben!?“
„Könnte hinkommen“, stimmte der Angeklagte mit dem Richter überein.
„Sie schieben das Motorradl zehn Kilometer weit? Ganz alleine, ohne Helfer?“
„Ja, dieses Motorrad hab’ ich wirklich alleine geschoben“, antwortete der Angeklagte wie aus der Pistole geschossen.
„Dieses? Aha! Und bei einem anderen hat Ihnen jemand geholfen?“
„Jaaa …, aber den möchte ich nicht nennen!“
Was sich in diesem Moment Verteidiger und Staatsanwalt dachten, kann man sich wohl zusammenreimen, unklarer vielleicht die Situation im Gedankengang des Angeklagten. Dazu kam der Umstand, den Moment zu nutzen, und eine sich auftuende Chance zur Aufklärung nicht zu zerstören. Es geht doch nichts über ein ungezwungenes Gespräch.
„Wann hatten Sie einen Helfer, den Sie nicht nennen wollen?“, setzte das Gericht sofort nach.
„Am nächsten Tag, weil ich da regelrechte Spatzen hatte!“, gab der Angeklagte unumwunden zu.
Der Vorsitzende blickte kurz in die Anklageschrift und suchte bei den aufgelisteten Fakten das jeweilige Datum, schon bald wurde er fündig.
„Das war dann am Soundsovielten. Das war aber eine leichtere Maschine!“, konstatierte der Richter.
„Ja und zu zweit ist es auch viel besser gegangen!“ In den Augen des Angeklagten spiegelte sich so etwas wie Erleichterung wider.
„Und die Maschin’ haben Sie dann zu zweit geschoben? Da haben Sie dann nicht so viel zu schleppen oder – besser gesagt – zu schieben gehabt? Wieder zu Ihnen nach Hause?“
„Nein, die haben wir zum Joe geschoben, weil der eine bessere Garage hat.“
Erst als der Satz bereits vollends beendet war, dürfte dem Angeklagten neuerlich erst wirklich bewusst geworden sein, was er da jetzt gerade gesagt hatte. Man konnte sein Erschrecken nicht nur vorne auf der Richterbank deutlich wahrnehmen, es schien, als ob dieses bis in die letzte Ecke des Verhandlungssaales gleichsam tobte, um dort abrupt gegen eine Wand zu prallen. Er saß mit leicht geöffnetem Mund da und blickte den Richter an, der sich überhaupt nichts anmerken ließ, vielmehr sogar seinen Blick vom Angeklagten nahm und auf einige Fakten der Anklage spähte.
„So eine GS 750 hat aber an die 250 bis 255 Kilogramm, oder?“
Jetzt blickte der Vorsitzende den Angeklagten an. Es war vielmehr Feststellung als Frage. Sicherlich hätte man vielleicht irgendwo in diesem Akt eine Stelle gefunden, wo dieser Umstand notiert gewesen war, oder auch nicht. Hatte man aber damit zu tun, in dem man schon einmal auf einer derartigen Maschine gesessen oder sie auch nur geschoben hatte, musste man wohl auch etwas dazu sagen können. Das Gericht wartete aber gar nicht auf eine Antwort.
„Die 500er hat gute 25 Kilogramm weniger. Stimmt’s, Herr Angeklagter? Ich meine die GS 500 mit dem Vierzylindermotor, nicht mit dem Zweizylindermotor!“, ergänzte der Vorsitzende.
Der Angeklagte nickte und senkte leicht den Kopf.
„Das heißt, dass Sie die GS 500 auch gestohlen haben, aber eben nicht alleine! Das war die Sache dann gleich am nächsten Tag!“
Auch das war keine Frage mehr, sondern eine Feststellung, die nicht bestritten wurde …
„Es stellt sich jetzt nur die Frage, ob dieser Joe mitgeschoben hat oder ob er die Maschine nur in seine Garage bekommen hat und vielleicht wieder ein anderer mitgeschoben hat“, ergänzte der Vorsitzende.
„Er hat mitgeschoben“, gab der Angeklagte nunmehr etwas leiser, aber dennoch gut hörbar, von sich.
„Wie oft?“, wollte das Gericht wissen. Es war still im Verhandlungssaal, mucksmäuschenstill. In keinem Grab hätte es stiller sein können. Die Sekunden wurden zu Minuten. Die absolute Stille wurde nur vom Summen der Halogenleuchten des Saales gestört.
„Eh immer!“ Die Antwort klang resignierend.
„Nicht immer! Ein einziges Mal haben Sie ja alleine geschoben, haben Sie zumindest gesagt! Sie erinnern sich? Würde auch passen, weil es die einzige Örtlichkeit ist, die zumindest annähernd in der Nähe Ihres Wohnortes ist“, entgegnete ihm der Richter.
Der Angeklagte schwieg. Sein Schweigen schien aber wohl unmissverständlich als Zustimmung interpretierbar.
„Also ein Mal alleine, sonst immer zu zweit?“
Das nunmehrige Schweigen schien aber etwas anderes sagen zu wollen.
„Sie waren nie alleine, stimmt’s?“, fragte der Vorsitzende nach langen Sekunden.
„Ja“, kam leise die Antwort.
„Aber das waren keine Schiebeaktionen, sondern Transportfahrten von Ihnen und diesem Joe?“
„Ja!“
„Und diesem Joe haben Sie auch im Sommer des Vorjahres mitgeteilt, dass kein Akra da ist?“
Nach einigen Sekunden folgte auch auf diese Frage des Vorsitzenden ein leises Ja des Angeklagten.
„Wer soll das sein?“, meinte nunmehr der Staatsanwalt.
„Das ist niemand, Herr Staatsanwalt!“, erwiderte der Vorsitzende. Und zum Angeklagten gewandt: „Sie meinen damit, dass Sie keinen dazugehörigen Auspuff haben, keinen Akrapovic!“
„Ja.“
Auch diese Antwort kam für den Vorsitzenden nicht überraschend.
„Der sichergestellte E-Mailschriftverkehr dokumentiert einige Abnehmer, oder?“
Auch jetzt folgte ein leises Ja.
„Aber eine ZX900 habe ich nicht gestohlen!“, ergänzte der Angeklagte nach einigen Sekunden der wiederum eingetretenen absoluten Ruhe im Saal.
„ZX900, eigentlich mit B und ZX900C sind nur Typen- bzw. interne Modellbezeichnungen für die Typengenehmigung, Herr Angeklagter. Sonst heißt sie ZXR 900 und ein „Ninja“ kommt hinten auch noch dazu. ZX900 steht in der Anzeige wohl nur deshalb, weil der die Anzeige aufnehmende Polizeibeamte die Daten vom Zulassungsschein abgeschrieben haben wird. Ein Foto dieser Maschine ist auch im Akt. Und genau so ein Bild von der Maschine – nur ohne Nummerntafel – gibt es auch auf Ihrem Laptop, Herr Angeklagter. Und yellow ball hat nichts mit einem gelben Ball zu tun, sondern ist die typische Lackierung einer Kawasaki. Soll ich Ihnen noch sagen, welchen Modells? Wo sie gestohlen wurde, wissen wir. Wollen Sie diskutieren oder beenden wir das Trauerspiel?“
Der Vorsitzende musste dem Angeklagten gar nicht erklären, dass er selbst diese Motorräder kannte oder gefahren war und daher über umfassendes Wissen verfügte, wie schon in den Eröffnungsplädoyers von anderer Seite angenommen wurde. Was auch die anderen in der Anklage genannten Motorräder betraf.
Man beendete das Trauerspiel.
DT, XJ, XT, XJR, ZX, ZRX, ZXR, CB, GS, GSXR, FJR, FJ, RD, MT, CBX, XLH, Z, TL und Co bedurften keiner näheren Erörterung mehr.
Der Angeklagte, der sich den Wunsch nach einem sündteuren Oldtimer über den Diebstahl zahlreicher moderner Bikes und Youngtimer finanziert hatte, wurde zu einer längeren unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt. Seine umfassende Mitwirkung an der Ausforschung seiner Mittäter mit teilweiser Sicherstellung des Diebsgutes brachte ihm eine nachträgliche Strafmilderung. Sein sündteurer Traum von einem Zweirad wurde zugunsten der geschädigten Privatbeteiligten letztlich versteigert und steht heute in einem Museum in Norddeutschland.
Gesichert.
Noch mehr gesichert, nachdem Markus dort gesichtet worden sein soll …
Peppi
Seine kürzeste Show.
All jenen, die Peppi bereits im ersten Buch „In allen Punkten“ kennengelernt haben, ist wahrscheinlich bekannt, dass er für gewöhnlich wortreich seine Verteidigungsstrategie aufgebaut hatte, um dem jeweiligen Schlamassel der Anklage zu entkommen. Diese zahlreichen erfolglosen Versuche führten über die Jahre hinweg jedoch immerhin zu einer gewissen Läuterung, wodurch sich seine letzten Auftritte zumeist kürzer hinzogen. Peppi war zu Beginn der Verhandlung somit persönlich überzeugt, dass es so etwas wie einen Freispruch gar nicht geben konnte.
Der mit Abstand kürzeste Prozess im Straflandesgericht sei dem werten Leser/der werten Leserin hiermit berichtet.
Diesmal ging es bei ihm um keinen Fall der Schwerkriminalität, dennoch ergab sich aufgrund besonderer Umstände und der Strafschärfung im Rückfall die Zuständigkeit des Gerichtshofes und nicht des Bezirksgerichtes.
Peppi befand sich in Untersuchungshaft und wurde zur Hauptverhandlung von den Justizwachebeamten vorgeführt. Da es um ihn auch in finanzieller Hinsicht nicht zum Besten bestellt war, sollte lediglich ein Verfahrenshilfeverteidiger als Fürsprecher des Angeklagten eingesetzt werden, mit dem Peppi allerdings zuvor noch kein Wort gewechselt hatte. Er nahm wie gewöhnlich seine Verteidigung selbst in die Hand und lehnte es auch ab, mit seinem Anwalt zuvor in der Justizanstalt „unnötig Zeit zu verplempern“. Kurz nach Betreten des Verhandlungssaales und nach Abnahme der Handschellen durch den Justizwachebeamten erhob Peppi beide Arme und streckte sie Richtung Saaldecke.
Der Richter schob seine Brille nach vorne und blickte Peppi an, um ihn zu fragen – obwohl diese Gestik gerichtsintern natürlich bekannt war, aber eher selten praktiziert wurde: „Das bedeutet?“
Noch bevor Peppi dazu etwas sagen konnte, führte der Staatsanwalt, langgedient und somit ein alter Fuchs, schon aus: „Hohes Gericht, das ist nach meinem Verständnis ein umfassendes, reumütiges und der Wahrheitsfindung dienliches Geständnis!“
Peppi blickte zum Staatsanwalt: „Danke, Herr Staatsanwalt, schöner hätte ich es gar nicht sagen können. Ich hätte nur Hände hoch gesagt. VollesHände hoch sogar.“
„Na dann! Dann sind wir schon fertig, 18 Monate, verstanden, Herr Angeklagter?“
„Ja, danke.“
Peppi wollte sich hierauf die Handschellen wieder anlegen lassen, indem er nunmehr seine Arme dem Justizwachebeamten hinhielt, drehte sich dann aber wieder dem Richter zu und meinte auf seine unverwechselbare Art, leicht vorwurfsvoll:
„Herr Rat, ich habe heute Geburtstag!“
Der Richter blickte nochmals kurz in den Akt, fand dort die Bestätigung dieses Umstands und korrigierte sich:
„15 Monate!“
„Danke!“
In der Justizanstalt erzählte Peppi später seinen Mithäftlingen wortreich, wie er mit dem Gericht gefeilscht habe, um zu einem günstigen „Tarif“ zu kommen, sogar der Staatsanwalt sei auf seiner Seite gewesen.
„Und ein Geständnis bringt mindestens die Hälfte. Sogar noch weniger!“
Es braucht nicht immer ein Freispruch zu sein. Man kann auch mit einer Verurteilung zufrieden sein. Mehr oder minder.
Ursula und Berndt
Bis zum bitteren Ende.
Berndt wurde jäh aus seinem Schlaf gerissen. Das Schreien war unüberhörbar, zuerst unklar und missverständlich, wurde es jedoch mit jeder Sekunde deutlicher und klarer. War er sich anfangs noch nicht sicher gewesen, erkannte er nunmehr eindeutig diese Stimme. Und sie fuhr ihm in sein Innerstes. Wie hasste er diese Stimme, die kreischend um Aufmerksamkeit heischte, sich in seinen Gehörgang bohrte und ihn innerlich zusammenzucken ließ. Wie hasste er alles, was diese Stimme von sich gab. Vorwürfe über Vorwürfe. Nichts passte ihr, nichts konnte er ihr recht machen.
Das Geschrei artete in ein Gekreische aus, das er nicht mehr hören konnte, nicht mehr hören wollte. Das er nicht mehr gewillt war, zu ertragen. Er zog sich die Bettdecke über den Kopf, um zumindest etwas abgeschirmt zu sein. Herrliche, kuschelige Wärme und Ruhe in seinem Bett, in dem er nunmehr die letzten Jahre alleine gelegen war. Seine Gattin war aus diesem ausgezogen und nächtigte nunmehr im ehemaligen Kinderzimmer. Die Kinder waren längst groß und erwachsen geworden und gingen ihren eigenen Lebensweg, wodurch auch Ruhe eingekehrt war; oftmals sogar zu viel Ruhe. Er hatte sich nach und nach anderen Freuden und Freunden zugewandt. Das obligatorische Treffen mit Arbeitskollegen nach der Arbeit wurde Routine; liebgewordene Tradition, die ihm am Wochenende abging. Daher liebte er mittlerweile die Wochentage mehr als die eintönigen Wochenenden, die nur deshalb auszuhalten waren, da er sich zu gewohnten Zeiten in der Küche seine Bierflaschen öffnete, deren Inhalt gierig leerte, wie genau diese Stimme ihm immer vorhielt. Wie er diese Stimme verabscheute! Und diese Stimme hatte ihn nun auch diesmal wieder unsanft aus seinen Träumen gerissen, die von wunderbaren Geschichten aus der Jugendzeit erzählten, als er noch jung und dynamisch war. Die Wirklichkeit sah anders aus.
Das Sprechorgan war mittlerweile am Höhepunkt seiner Lautstärke angekommen, als das Zuschlagen einer Türe alles beendete. Nunmehr war es ruhig, die Stimme war weg. Es gab nichts mehr zu hören. Berndt war froh und erleichtert, dass sie weg war, er sie nicht mehr hören musste. Diese Stimme, die zu seiner Frau gehörte, hatte sie endlich in die Arbeit mitgenommen. Sollte sie doch dort schreien und andere beflegeln. Aber das tat sie hinterlistigerweise nicht. Zu den anderen war sie ja immer freundlich und nett. Da gab es kein Geschrei. Die Ruhe tat ihm gut. Sein Puls bremste sich wieder ein, sodass er wieder einschlief. Als er Stunden später erwachte, fühlte er sich besser. Erst langsam kamen die Erinnerungen in ihm hoch, es fröstelte ihn beim Gedanken an seine Frau, der vergnügliche Nachmittag und Abend mit seinen Freunden zauberte jedoch ein Lächeln in sein Gesicht, das sich aber rasch neutralisierte, als sich der Kopfschmerz bemerkbar machte. Der war wohl seinen ständig wachsenden Konsumationen geschuldet; gelegentlich gab es kein Halten, was alkoholische Getränke und Zigaretten betraf. Doch er schob alle Zweifel zur Seite. „Ich will eh nicht g’sund sterben“, war so sein Statement, wenn ihm die Stimme wieder einmal vorgehalten hatte, dass er zu spät und vor allem schon wieder angetrunken nach Hause gekommen war.
Nach dem Kaffee und einem Aspirin waren die Kopfschmerzen leichter zu ertragen. Er hatte sich endlich angezogen, als ihm einfiel, dass es noch etwas zu tun gab. Es war höchste Zeit, sich um seinen „Nachwuchs“ zu kümmern, wie er sie liebevoll nannte. Sein Nachwuchs war beinahe das Wichtigste in seinem aktuellen Leben geworden. Er liebte seinen Nachwuchs, konnte diesem stundenlang zusehen, baute ihm laufend neue Attraktionen, was die Stimme als unnötige Geldausgabe quittierte. Auch deshalb hasste er diese Stimme. Warum musste sie immer und überall ihren Senf dazu geben und machte nicht einmal vor seinem Nachwuchs halt? Es passte nichts, was er tat. Berndt ging zum Regal. Sein Nachwuchs benötigte Futter; Spezialfutter für seine Zierfische in seinem heißgeliebten Aquarium. Es stand als eine Art Raumteiler im riesigen Wohnzimmer, das mit seiner Größe wohl auch diese unsagbare Leere dokumentierte, die es zwischen den Eheleuten gab. Früher belebten die Kinder, Geburtstage und sonstige Festivitäten diesen Raum, nunmehr regierte die Leere. Die umherschwimmenden Fische in diesem Großaquarium verstärkten dies noch. Aber Berndt fühlte sich zu ihrer Bedächtigkeit mittlerweile hingezogen. Aber als der Mann mit der Futterdose in der Hand an sein topgepflegtes Aquarium trat, erstarrte er.
Richter Wasakovsky betrat sein Büro und blickte auf das Einlauffach, in dem sich schon wieder neue Akten türmten und auf eine Bearbeitung warteten.
„Es gibt keinen Tag, an dem nichts Neues daherkommt!“, klagte seine Kanzleibeamtin und hatte damit keinesfalls unrecht. Es gab tatsächlich nur mehr äußerst selten einen Tag, an dem kein neuer Akt den Weg ins Untersuchungsrichterbüro fand. Und so ging es allen KollegInnen im Hause.
„Ich möchte einmal einen Tag erleben, an dem die Zeitungen schreiben, es sei nichts los und es wäre nichts geschehen“, antwortete er seiner Mitarbeiterin.
„Werden wir nie erleben.“
„Da könnten wir sogar Gift darauf nehmen!“
Man war sich einig und sollte auch bis dato damit recht behalten.
Nach Durchsicht der Akten verblieb zuletzt ein dünner Aktendeckel. Die Staatsanwaltschaft beantragte in diesem gerichtlichen Verfahren im Zuge gerichtlicher Vorerhebungen die „verantwortliche Abhörung“ einer Frau, die das Vergehen der Tierquälerei oder Sachbeschädigung begangen haben könnte, wobei „insbesondere im Detail die subjektive Tatseite der mutmaßlichen Täterin abzuklären wäre“, sowie die zeugenschaftliche Einvernahme ihres Ehegatten, der aber „auf das ihm zustehende Entschlagungsrecht als Angehöriger“ belehrt werden möge, zumal das nicht eindeutig aus dem Polizeiprotokoll zu entnehmen wäre.
„Herr Schwarzacher!?“, rief der Untersuchungsrichter, nachdem er die Kanzleitüre in den Gang des ersten Stockes geöffnet hatte.
„Ja!“
„Bitte, wenn Sie hereinkommen!“
Ein großer, schlaksiger Mann betrat den Raum der Geschäftsabteilung 18. Er trug einen schwarz-weiß karierten Mantel, dazu schwarzen Schal samt ebensolchem Hut, darunter einen schwarzen dreiteiligen Anzug. Der Krawattenknopf war perfekt gebunden und saß. Das weiße Hemd roch nach Lavendel – dem Duft der Provence. Sein suchender Blick verriet, dass er sich nach einer Garderobe umsah, die es versteckt hinter der Doppeltüre gab.
„Sie können Mantel und Hut gerne hier bei diesem Tischchen ablegen“, meinte die Kanzleibeamtin, die den Eintretenden genau musterte. Derart elegant gekleidete Personen waren eher die Ausnahme. Der Lavendelgeruch nahm Besitz vom Raum, der gelegentlich nach Schweiß oder sonstigen körperlichen Sekretionen regelrecht dampfte, insbesondere, wenn vermeintliche Zeuginnen des kriminellen Rotlichtmilieus zwangsweise unmittelbar nach erbrachter Dienstleistung von der Polizei vorgeführt wurden. Da half dann auch kein Aufreißen der alten, unter Denkmalschutz stehenden Holzfenster; derartige Gerüche verflüchtigen sich niemals so schnell, wie sie zuvor gekommen waren. Sie waren sogar hartnäckiger als der schalste Verwesungsgeruch und toppten mitunter jene Geruchsvariationen, die im Zuge von Leichenöffnungen, insbesondere des Darmtraktes, den Weg zur Nase der Anwesenden suchten und fanden. Angstschweiß, den es durchaus gelegentlich auch in der Verhörzelle oder in der Gerichtskanzlei gab, begleitete meist den Verursacher in seine Zelle oder bis in die Gänge des Landesgerichtes zurück.
„Sie heißen Berndt Schwarzacher und sind der Ehegatte der Angezeigten.“ Es war keine Frage des Untersuchungsrichters, vielmehr eine Darlegung der angenommenen Umstände.
„Ja!“
„Sie haben einen Ausweis mit?“
„Selbstverständlich!“
Der Mann griff in die Innentasche seines Sakkos und brachte ein Lederetui zum Vorschein, in dem seine Dokumente zu sein schienen, war es doch prall gefüllt. Der Duft des Leders schien mit dem Lavendelaroma um die Gunst der Anerkennung zu feilschen. Man glaubte sich unmittelbar in ein kleines italienisches Lederwarengeschäft, wie man es etwa von der Oberadria kennt, versetzt. Erst jetzt fielen Ledergürtel und Lederschuhe beim Einzuvernehmenden auf, die wohl auch ihre Duftmarke in den Raum entließen. Wasakovsky musste unweigerlich an Caorle denken, wo er sich vor Jahren in einem genau solch duftenden Laden einen Lederschlüsselanhänger gekauft hatte. So roch auch nur italienisches Leder. Wasakovsky bemerkte, gedankenverloren wie er war, nicht die ausgestreckte Hand, die ihm einen Führerschein entgegenhielt. Erst das deutliche Bitteschön ließ ihn aus dem Verkaufsladen zurück in die Gerichtskanzlei treten. Er fasste sich schnell.
„Danke!“ Sekunden später verschwand das Dokument wieder im Dunkel der Sakkoinnentasche. Auch die Kanzleibeamtin starrte den Zeugen an. Sie schien durch ihn hindurch zu blicken, was nicht verwunderte, war sie gedanklich doch auch an dem oberitalienischen Urlaubsort, wie sie später zugestand.
„Als Angehöriger müssen Sie keine Aussage machen, Sie haben ein gesetzliches Aussageverweigerungsrecht!“, setzte Wasakovsky fort.
„Nein, nein. Ich möchte aussagen“, antwortete Berndt, für die Anwesenden überraschend.
„Also, warum die Anzeige?“
„Ich habe die Anzeige gegen meine Frau gemacht, weil das, was sie gemacht hat, eine Riesensauerei ist. Und das lasse ich mir nicht gefallen.“
„Was ist wirklich geschehen?“, wollte der Untersuchungsrichter wissen.
„Das weiß ich nicht. Ich habe nur nach dem Aufstehen nach meinen Fischen gesehen und die waren tot. Alle. Alle waren hinüber und trieben oben an der Wasseroberfläche. Meine Frau hat das gemacht. Da bin ich mir sicher. Sie weiß, was die Fische mir bedeuten, sie sind meine Lieblinge, das Aquarium ist mehr als ein Hobby.“
„Und woran sind die Fische gestorben? Wissen Sie das?“
„Ja. Die Fische sind vergiftet worden. Eindeutig. Alle vierzig. Das ganze Aquarium roch nach Chemie. Nach Putzmittel und Chlor. Hundertprozentig, ich habe es ja selbst gerochen.“
„Wo sind die Fische jetzt?“
„Entsorgt.“
„Die gibt es also nicht mehr! Keine Beweismittel mehr, keine tierärztliche oder toxische Untersuchung mehr möglich.“
„Richtig!“
„Und worauf gründet sich Ihre Annahme, Ihre Frau habe dies vorsätzlich gemacht? Wäre ein Fehler oder Missgeschick nicht auch möglich?“
„Das glaube ich nicht!“
„Der Glaube an sich oder an etwas mag ja schön sein, nur in unserem Fall und in meinem Job ist dies nicht des Pudels Kern, Sie verstehen?“
„Ja, schon.“
„Hatte Ihre Frau einen Grund, Ihnen das anzutun?“
„Sie ist auf mich nicht gut zu sprechen. Es kriselt in unserer Beziehung.“
„Aber das ist ja kein Grund, dem anderen vierzig Fische zu killen, oder? Wenn jede oder jeder dem anderen die Viecher umbringt, die der mag, nur weil es in der Beziehung Probleme gibt, dann gibt’s bald keine Haustiere mehr “, warf Wasakovsky dem Zeugen vor.
„Es war meine Frau, eindeutig!“, der Zeuge blieb dabei.
„Der Satz kommt nicht ins Protokoll, weil es keine Wahrnehmung von Ihnen als Zeuge, sondern lediglich ihre Vermutung oder Annahme ist. Wer putzt das Aquarium?“
„Ich. Nur ich. Wasserwechsel, Filter etc.“, betonte der Zeuge.
„Und das Umfeld? Die Möbel? Das Zimmer?“, fragte Wasakovsky.
„Macht alles meine Frau. Sie putzt die gesamte Wohnung. Ich rühre da nichts an“, bekräftigte der Zeuge.
„Nicht fifty-fifty also?“, meinte der Untersuchungsrichter.
„Wie bitte?“
„Ich meine nur. Sie helfen im Haushalt also nicht mit?“
„Nein. Wozu? Das muss sie machen!“
„Haben Sie mit Ihrer Frau darüber eigentlich gesprochen?“
„Nein, wir reden nicht mehr viel miteinander. Sie hat nur geschrien, dass es mir recht geschehe, wenn die Fische krepieren.“
Nachdem der Zeuge das aufgenommene Protokoll unterfertigt und die Kanzlei verlassen hatte, blickte die Kanzleibeamtin den Untersuchungsrichter fragend an.
„Keine Ahnung, was da passiert ist. Frag mich nicht! Morgen kommt die beschuldigte Frau zur Einvernahme, ich bin gespannt, was sie erzählen wird“, meinte Wasakovsky zur Beamtin und verließ sein Büro.
Als Wasakovsky sich am nächsten Morgen am Gang seiner Kanzlei näherte, saß vor dieser bereits eine Dame auf der Bank.
„Wenigstens ist sie gekommen“, dachte sich Wasakovsky und war froh, keine sonstigen Zwangsmaßnahmen anwenden zu müssen.
„Frau Schwarzacher? Kommen Sie bitte gleich mit“, meinte Wasakovsky im Vorübergehen zur Wartenden, die sogleich aufstand und mit in die Kanzlei ging.
„Nehmen Sie Platz. Sie wissen, worum es geht? Ich muss Sie als Beschuldigte zur Anzeige Ihres Gatten einvernehmen. Sie können eine Aussage machen, müssen aber nicht, Sie brauchen sich auch nicht selbst zu belasten. Haben Sie das verstanden?“
„Ja sicherlich, ich weiß, dass es um die Fische meines Mannes geht. Ich fühle mich da auch voll schuldig. Es stimmt, dass ich diese Tiere meines Mannes getötet habe“, antwortete die Frau, die von zierlicher Gestalt war und sehr gepflegt wirkte. Sie trug ein beiges Kostüm, hatte ein leichtes Tuch um ihre Schultern und wirkte nicht nervös, eher vorbereitet und gefasst, antwortete umgehend auf die ihr gestellten Fragen und blickte den Untersuchungsrichter mit großen Augen an.
„Wie kam es dazu?“, wollte der Untersuchungsrichter wissen.
„Ich stand in der Früh – wie immer – auf, weil ich ja zur Arbeit musste. Ich war zunächst in der Küche und richtete das Frühstück. Als ich dann ins Bad ging, kam ich natürlich am Aquarium meines Mannes vorbei, das zwischen dem Flur und dem Wohnzimmer steht. Und ich sah seine Fische, wie sie da herumgeschwommen sind. Am Boden vor dem Aquarium lagen die Socken und die Hose meines Mannes und ein schmutziges Schnoitztüchlkugelte auf der Kommode herum. Ich nahm dieses weg und habe dann die Oberfläche desinfiziert.“
„Womit?“
„Mit einem Flächendesinfektionsmittel!“
„Und dann?“
„Dann habe ich den Rest aus dieser Flasche ins Aquarium gekippt.“
„Warum?“
„Warum? Damit die Fische … sterben!“
„Warum? Was haben Ihnen die Fische getan?“
„Nichts, aber sie gehören meinem Mann!“
„Das verstehe ich nicht. Was gibt es da für einen Zusammenhang?“
„Gar keinen, ich wollte die Fische meines Mannes umbringen!“
„Und das ist gelungen!“
„Nein, überhaupt nicht. Ich habe das Mittel reingekippt gehabt, aber nichts ist passiert. Die sind weitergeschwommen, als ob nichts gewesen sei.“
„Und dann?“
„Dann bin ich ins Bad gegangen, wollte mir schon die Zähne putzen und mich herrichten. Aus dem Augenwinkel habe ich die Fische beobachtet.“
„Und weiter?“
„Werden noch immer weiter herumgeschwommen sein“, entgegnete die Beschuldigte ziemlich energisch. Der Untersuchungsrichter wollte schon nachhaken, wie sie zu dieser Annahme käme und wie denn dann doch die Fische noch zu Tode gekommen seien und überhaupt. Zahllose Fragen taten sich da auf. Bevor Wasakovsky noch mit der nächsten Frage starten konnte, setzte die Beschuldigte schon selbstständig fort. „Zunächst habe ich sie nicht genau gesehen, aber dann. Die sind herumgeschwommen, und wie. Also bin ich zum Aquarium hin und schau mir das genauer an. Und die schwimmen wie immer. Ich bin dann zurück ins Bad und habe dort ein anderes Putzmittel geholt. Das habe ich dann auch begonnen hineinzukippen. Zuerst wenig, dann immer mehr.“
„Warum?“
„Weil ich sehen wollte, wann das Mittel endlich anfängt zu wirken!“
„Warum?“
„Damit ich sehe, wie die Fische vielleicht zappeln!“
„Warum? Sie sagten zuvor, Sie wollten die Fische umbringen!“
„Ja schon, aber zuvor sollten sie zappeln. So richtig.“
„Die Tiere sollten zappeln? Also mit dem Tod sozusagen kämpfen? Leiden?“, fragte Wasakovsky mehr als überrascht jetzt nach.
„Ja. Und das haben sie dann auch“, entgegnete die Beschuldigte.
„Und als sie gezappelt haben, was haben Sie dann gemacht? Weiteres Putzmittel dazugegeben?“
„Nein, dann wären sie ja wahrscheinlich gleich tot gewesen. Sie sollten weiter zappeln und das taten sie, und wie!“
„Wie lange haben die Fische gezappelt, wie muss ich mir das vorstellen?“
„Als sie dann gezappelt haben, bin ich Zähneputzen gegangen, habe mich hergerichtet und bin wieder zurück in die Küche, mir meinen Kaffee holen.“
„Und die Fische?“
„Haben gezappelt, sind an die Wasseroberfläche und haben sich gebeutelt!“
„Und Sie schauen da zu? Die Tiere leiden, das ist Ihnen schon klar?“
„Ja, ich wollte, dass sie sterben, aber dass sie zuvor zappeln, also leiden!“, entgegnete die Beschuldigte ziemlich gefasst und beinahe seelenruhig.
„Wir reden da nicht von Sachbeschädigung, sondern von echter Tierquälerei, das ist Ihnen schon klar?“, fasste Wasakovsky zusammen. „Sie haben diesen Tieren unnötige Qualen zugefügt. Sie wollten das sogar!“
„Ja, ja und wieder ja!“, antwortete die Beschuldigte nunmehr etwas aufgeregter. „Die Tiere sollten leiden, richtig leiden!“, bestätigte sie sogleich nochmals.
„Sie fühlen sich daher der Tierquälerei schuldig?“
„Ja. Die haben gezappelt.“
„Wie lange haben die armen Tiere da gezappelt?“
„Weiß ich nicht?“
„Warum?“
„Weil ich meinen Kaffee fertiggetrunken habe und dann gegangen bin.“
„Und da waren die Fische noch nicht tot, sondern haben noch immer gezappelt?“
„Die haben immer noch gezappelt und ich bin gegangen!“
Die Kanzleibeamtin hatte alles mitgeschrieben, jedes Wort, jeden Vorhalt. Sie war Meisterin auf ihrer Schreibmaschine, dennoch fiel Wasakovsky auf, dass es gelegentlich ganz kurze Pausen gegeben hatte.
„Und jetzt müssen Sie mir noch sagen: warum? Warum, Frau Beschuldigte? Macht es Ihnen Spaß, Tiere leiden zu sehen? Gefällt Ihnen das?“, die Fragen waren unangenehm. Zugegeben.
Hatte die Beschuldigte bis dahin immer Blickkontakt mit dem Untersuchungsrichter gehalten, senkte sich jetzt ihr Blick.
„Das passt doch gar nicht zu Ihnen, Frau Schwarzacher!“ Die Worte des Richters klangen beinahe versöhnlich. Schwarzachers Blick blieb am Boden der Kanzlei kleben. An diesem alten, im Fischgrätmuster verlegten Eichenboden, der nie richtig sauber wirkte, auch wenn er beinahe täglich gekehrt und auch immer wieder gewachst wurde.
„Da unten gibt’s nichts zu sehen“, ergänzte der Richter. „Schauen Sie mich an, bitte!“ Und nach einer kurzen Pause: „Warum? Warum wollten Sie die Fische Ihres Mannes töten und zuvor quälen? Man macht nichts ohne Grund, Frau Schwarzacher, oder?“
Schien die Person, die dem Untersuchungsrichter gegenübergesessen war, zuvor noch stabil, gefestigt und durchaus redegewandt, schwand nunmehr diese anmutende Komplexität und leichte Risse machten sich bemerkbar.
„Mein Mann ist ein Schwein. Er hat zwei Gesichter. Nach außen hin mimt er den harmlosen, netten und zuvorkommenden Mitmenschen von nebenan. Der in die Kirche rennt und dort mittlerweile die Kommunion austeilt und sogar als Trauerredner bei Begräbnissen auftritt. Mit salbungsvollen Worten. Ha! Dass ich nicht lache! Er und Gott! Ein Widerspruch, wie es ihn nicht besser geben könnte. Innerlich hasst er all diese Angepasstheiten und Zwänge. Aber nach außen hin ein freundliches Gesicht machen. Und mir gegenüber kennt er sowieso keine Grenzen. Ich bin die Nörglerin, der Trottel vom Dienst, seine Privathure. Die Verschwenderin, die alles immer besser weiß, aber dennoch alles falsch macht. In seinen Augen bin ich wertlos und einfach nur Dreck. Zum Wegwerfen. Und so geht er auch mit mir um, seit Jahren.“
„Und da haben Sie nie an Scheidung gedacht, wenn es so furchtbar ist?“
„Ich schon. Aber für ihn gibt es so etwas nicht. Schon aus finanziellen Gründen. Wenn ich eine Scheidungsklage einreichen würde, bin ich am nächsten Tag tot!“
Der Blick der Zeugin war nun ein fester. Er schien sich in seinem Gegenüber zu verbeißen. Es war kein hilfesuchender Blick, sondern wissend und abgeklärt. Wasakovsky glaubte dies zumindest so interpretieren zu können.
„Was war vor dem Quälen der Fische?“
Er blickte ihr tief in die Augen. Sekundenlang. Sie hielt dem Gegenüber stand, ohne jede Regung und ohne Tränen. Nicht das geringste Zucken, kein Wimpernschlag.
„Ich hasse ihn. Vor meinem Anschlag auf die Fische kam er spät nachts nach Hause. Ich hatte schon geschlafen und habe ihn zunächst gar nicht gehört, wir schlafen getrennt in verschiedenen Zimmern. Ich wache auf, weil er schreit. Dann sehe ich ihn im Finstern, er steht ohne Hosen über mir im Bett und schreit, dass ich eine verfluchte Drecksau sei. Und dann hat er mich angepinkelt. Er hat mich von oben bis unten angepinkelt und dabei gelacht, hämisch gelacht. Ich habe noch versucht, mich abzuwenden, aber chancenlos, er klemmte mich mit seinen Füßen ein.“
„Und deshalb dann …?“
„Ja, ich wollte ihm wirklich wehtun. Ihn treffen. So richtig. Und ich weiß, wie er an seinen Fischen hängt. Die sollten zappeln, so lange, dass er sie noch sieht, wenn er sie vormittags dann füttert, ich fühle mich daher auch der Tierquälerei schuldig, obwohl ich dadurch meinen Mann quälen wollte.“
„Weil er sie so erniedrigt, ja gedemütigt hat!“, ergänzte der Untersuchungsrichter.
„Das Anpinkeln von oben bis unten wäre es ja gar nicht einmal gewesen, Herr Rat!“, ergänzte nunmehr die Beschuldigte.
„Sondern?“ Untersuchungsrichter und Kanzleibeamtin blickten sich fragend an.
„Herr Rat, ich getraue es mich ja fast nicht zu sagen“, zögerte die Beschuldigte.
„Bei uns gibt es keine Geheimnisse und wir sind Einiges gewohnt“, beruhigte der Untersuchungsrichter die Zeugin, die sodann fortsetzte:
„Er schrie noch, er würde mich am liebsten ansch…, wenn er jetzt könnte.“
Leichte Fassungslosigkeit machte sich in der Gerichtskanzlei breit, die nicht vom Lavendelduft getragen wurde.
Das Delikt der Tierquälerei wurde somit hinsichtlich aller Tatbestandsmerkmale sowohl in objektiver als auch subjektiver Hinsicht „herausgearbeitet“.
„Sie tut mir leid! Und jetzt kriegt sie dann auch noch eine Anklage“, meinte die Gerichtsbeamtin, nachdem die Beschuldigte die Kanzlei verlassen hatte.
Dem war nicht so. Der zuständige Staatsanwalt stellte das Verfahren ein.
Aleksander und Co
Lauf, wer kann!
Abhauen – das war der einzige Gedanke, der jetzt in ihm schrie. Abhauen, so rasch und unauffällig wie möglich, war angesagt. Unauffällig konnte es schon mal nicht sein. Laufen fällt auf. Eigentlich immer und überall. Daher gibt es in den Vereinigten Staaten von Amerika gelegentlich Vorschriften, die ein Laufen ausdrücklich bei Strafe verbieten. Hier und jetzt lief alles. Niemand hatte ein Kommando gegeben und doch waren alle gleichzeitig losgestürmt. Er lief und mit ihm auch alle anderen. Der Bubenhaufen stob in jede Richtung auseinander.
Was war geschehen?
Die Bubenbande hatte gespielt und war wieder einmal vertrieben worden. Von der Hausmeisterin, die die Hausordnung zu exekutieren hatte. Es war untersagt, im Hof der Siedlungsanlage Fußball zu spielen. Und bei den Klopfstangen, wo man für gewöhnlich Teppiche ausklopfte, gab es kein Votaleimatscher – „Vater, leih’mir die Schere“-Spiel. Und zwischen den Mülltonnen kein Versteckspiel. Schon gar nicht zwischen den abgestellten Autos am Parkplatz. Man hatte den Eindruck, dass sowieso alles verboten war für diese Kinder in jener Siedlung. Aber auch für die der Nachbarsiedlung.
Das war auch der Grund dafür, dass man sich zusammengerottet hatte. Nicht einmal geplant, einfach so. Man traf sich täglich, wenn es die Schulaufgaben und die Eltern zuließ