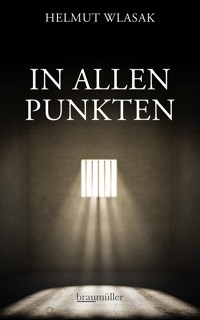18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Braumüller Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
In uns allen schlummern vielleicht potenzielle Täter und Täterinnen. Der Strafrichter Helmut Wlasak weiß aus seiner jahrzehntelangen Erfahrung: Geschieht etwas gänzlich Unvorhergesehenes, können Menschen zu Reaktionen fähig sein, die sie sich selbst niemals zugetraut hätten. Neben versuchtem Mord und Totschlag, islamistischem Terrorismus, Körperverletzungen, häuslicher Gewalt, Drogendeals, Einbrüchen und Betrug taucht der Autor ein in die Abgründe menschlicher Schicksale. Im alltäglichen Strafbereich ergeben sich dabei auch immer wieder unfreiwillig komische, absurde und lustige Situationen. Dieses Buch erzählt Geschichten von Menschen, deren Leben anders verlaufen sind, als sie es jemals erwartet oder geplant hätten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
HELMUT WLASAK
Nicht schuldig
INHALT
Fritz – Hündisches Bezirksgericht
Django – Cowboy und Gendarm
Josip und Giovanni – Unbekannter Feind
Bodo – Spion auf Rechnung
Peter, Heinz’ Angestellter – 30 Gramm Kokain und 2.000 Kondome
Heinz, Peters Boss – Der Tod und Venedig
Özmed – Von Gurken und Gürkchen
Johann, Manfred und Franz gegen Otto und Sepp – Länderkampf der anderen Art
Anneliese und ihr Feldwebel – Fanfaren für das Gericht
Lorenz und Michael – Die Home-Invasion
Irene – Widerstand mit schönen Beinen
Was ist Schuld eigentlich?
Zwei Zivilrichter – Witz oder Anekdote?
Ozim und Drago – Mord oder Totschlag?
Beatrice – Der Stoff, aus dem manche Träume sind
Innocent – Verkomplizierungen und zweifaches Glück
Jack und Roswitha – Letzte Begegnungen
Alfons – Wenn man besser den Mund aufmacht
Harald – Schulschluss
Mathilda – Gestraft genug
Von Dieben und Betrunkenen – Viele Dumme, ein Gedanke
Joachim – Großartiger Plan, schlecht ausgeführt
Karl und Silvia – Gut gemeinte Hiebe
Walter – Ist da jemand?
Josef – Feuerwasserprobe
Erwin – Die komplizierte Beziehung zu „dem da oben“
Dietmar und Max – Illusionen und eine Täuschung
Joszef – Schlauchbeherrschung
Nasir – Wer einmal lügt, dem glauben die Geschworenen nicht mehr
Jochen – Gaunerehrenwörter (und Gauner-Geständnisse)
Silke und Kevin – Freitagnacht
Manuel – Aus dem Leben eines Gedächtniskünstlers
Christoph – JWH 018
Vasilije – Wichtige Detailfehler
Karl-Heinz – Eine Erinnerung
Fritz
Hündisches Bezirksgericht
„Nicht schuldig! Ich hab nichts gemacht!“ Das erklärte auch gleich die Verhandlungsstrategie Severins, des Angeklagten.
„Sie sind auch nicht angeklagt, weil Sie etwas getan haben, sondern weil Sie etwas unterlassen haben“, sagte der Richter. „Sie haben nicht auf Ihren Hund aufgepasst – und der hat einen Radfahrer angesprungen und zu Sturz gebracht, und dabei wurde er verletzt.“
„Jeder, der eine Gefahrenquelle schafft, ist verpflichtet, die nötigen Vorkehrungen zu treffen, um etwaige Gefahren abzuwenden. In Ihrem Fall hätten Sie etwa dem Hund einen Maulkorb verpassen können oder ihn einfach an die Leine nehmen. Und wenn Sie weggehen und den Hund alleine zurücklassen, muss er sicher verwahrt werden“, führte Bezirksanwalt Gerharter näher aus.
„Ja, hab ich schon verstanden, aber der Übeltäter war ja gar nicht mein Hund!“
„Laut Polizei war es Ihr Hund. Ein Schäferhund, er wurde von den Beamten schon öfters umherstreunend angetroffen“, erklärte der Richter.
„Im Ort gibt es mehrere Schäferhunde, mindestens fünf, und das kann jeder im Ort bestätigen“, antwortete Severin.
„Und Sie meinen, die kommen alle fünf infrage? Rennen die alle unbeaufsichtigt umher?“
„Könnte schon sein.“
„,Könnte schon sein‘ heißt aber nichts. Es könnte auch die Welt morgen untergehen – oder erst in viereinhalb Milliarden Jahren. Haben Sie ein Foto von Ihrem Hund?“
„Wofür?“
„Na, damit ich sehe, wie Ihr Hund ausschaut.“
„Wie ein Schäferhund halt so ausschaut …“
„Aber wie schaut Ihrer aus? Darum geht es ja. Können Sie ihn beschreiben?“, bohrte der Richter nach.
„Er hat keine … Besonderheiten … er schaut aus wie ein Schäferhund.“
„Na dann!“, bekräftigte der Bezirksanwalt. Da war man ja schon einmal auf einem sehr guten Weg … Da hier weiter nichts herauskommen würde, eröffnete man das Beweisverfahren. Als ersten Zeugen rief das Gericht Fritz auf, den Geschädigten. Der betrat den Saal mit leichter Verwunderung, war doch die halbe Ortschaft anwesend.
„Also“, begann Fritz. „Ich fahr mit dem Rad in Richtung Hauptplatz, und gerade beim Hohen Gericht fällt mir auf, dass ich verfolgt werde. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste, da spürt man so was. Ich drehe mich um – und seh tatsächlich, dass mir auf der linken Seite ein Schäferhund nachläuft. Weit und breit kein Herrchen. Und auf einmal springt mich der an, dass es mich vom Rad geworfen hat. Als ich schon auf der Straße liege, kommt der Hund noch her zu mir und schaut mich an, getan hat er aber nichts weiter. Vom Café an der Straße hat ein Spaßvogel herübergerufen ,der will eh nur spielen‘ … dabei waren meine Knie und ein Ellenbogen schon blutig.“
So weit, so gut. Auch im Weiteren konnte aber nicht geklärt werden, welcher der infrage kommenden Hunde das gewesen sein könnte. Es wurde also vertagt – mit der Aufforderung an den Angeklagten, seinen Hund beim nächsten Mal mitzunehmen. Und dann waren da ja noch die „mindestens fünf“ anderen Hunde, die der Angeklagte erwähnt hatte. Als ein diesbezügliches Erhebungsersuchen beim Postenkommandanten des Ortes eintraf, dachte der zunächst noch an einen Aprilscherz: Es galt abzuklären, wie viele Schäferhunde es in der Umgebung gab und wer die Besitzer waren. Die Beamten legten sich ins Zeug und forschten sogar sechs weitere Schäferhunde samt Haltern aus. Außerdem: den Kaffeehausgast, der dem Gestürzten über die Straße zugerufen hatte.
Als vier Wochen später der nächste Gerichtstermin stattfand, war der noch besser besucht als der erste. Der Angeklagte, Severin, kam wie gewünscht mit Hund, der dann auch sogleich Fritz, also dem Geschädigten, gegenübergestellt wurde. Fritz konnte das Tier eindeutig als einen sogenannten „Schäferhund“ identifizieren. Für den Strafprozess war das nicht ausreichend.
„Danke für den Hinweis, wir haben uns schon gedacht, dass das wohl ein Schäferhund sein müsste – aber ist das der Hund, der Sie zu Fall gebracht hat?“, wollte der Richter wissen.
Während der Zeuge den Hund musterte, saß der brav und manierlich – also der Hund – und winselte ab und an kurz, aber freundlich. Nach eingehender Betrachtung erklärte Fritz, dass er nicht genau sagen könne, ob dieser Hund der richtige sei. Der sehe „zu sehr wie ein normaler Schäferhund aus“. Nun denn.
Im Folgenden rief der Richter die sechs weiteren Hunde und Besitzer auf, die für heute vorgeladen waren. Sie kamen herein und stellten sich in einer Reihe auf.
„Sehen Sie sich die Hunde in Ruhe an!“, erklärte der Richter Fritz. „Das sind die Hunde, die theoretisch infrage kommen würden.“
Schon während Fritz die Tiere nacheinander anschaute, fielen deren unterschiedliche Charaktere auf. Der eine lag unbeteiligt mit dem Kopf auf den Vorderpfoten und ignorierte den Zeugen, ein anderer wollte gleich auf ihn zustürmen.
„Glauben S’, kennt mich der?“, fragte der Zeuge den Besitzer, dieser zuckte aber nur mit den Achseln. Der dritte Hund stimmte daraufhin Gebell an, in das der nächste Hund auch gleich miteinfiel. Es dauerte eine Weile, bis wieder Ordnung hergestellt werden konnte. Das zahlreiche Publikum dürfte die Veranstaltung als durchaus unterhaltsam empfunden haben. Hund Nummer vier war teilnahmslos – wenigstens, sobald er aufgehört hatte zu bellen –, aber interessiert, Nummer fünf hatte sich hinter sein Herrchen verzogen und blickte an dessen Beinen vorbei unsicher auf das Spektakel. Der sechste Hund wollte am liebsten aus dem Saal. (Fluchtgefahr stellte eigentlich einen Haftgrund dar, vorerst wurde davon aber abgesehen. Dennoch: Was hatte der Hund zu verbergen?)
Nachdem Fritz alle Tiere eingehend betrachtet hatte, kam er zu dem imposanten Ergebnis, dass alle der Hunde sehr stark nach Schäferhund aussahen.
„Hätte ich auch gesagt“, gab der Richter zu, und auch der Vertreter der Anklagebehörde konnte zur Lösung wenig beitragen. „Das ist ja wie ein Bilderrätsel, bei dem die Unterschiede zu suchen sind …“
Kurzum, es sah vorerst nicht so aus, als ob dieses Problem gelöst werden könnte. Etwas Dynamik brachte dann aber jener Zeuge ein, der den Vorfall aus dem Café beobachtet hatte.
„Herr Rat, ich sitz jeden Vormittag so gegen zehn Uhr dort, zum Kaffee mit Mehlspeise; ist wirklich wunderbar dort, die machen alles noch selbst. Als ich gesehen hab, wie es den Fritz zerlegt hat, hab ich hinübergerufen, dass der Hund nur spielen wolle, stimmt. Das hab ich aber nur gemacht, weil er selbst das ja auch immer sagt, wenn sein Hund jemanden anspringt.“
„Er hat selbst einen Hund?“, fragte der Richter sichtlich überrascht den Zeugen.
„Ja sicher, der Fritz hat einen Hund!“, bestätigte dieser.
„Ja, sicherlich!“, sagte jetzt auch Fritz.
„Warum sagen Sie das denn nicht?“
„Sie haben mich nie danach gefragt …“, antwortete der Verunfallte kleinlaut, wobei er mit dieser Aussage im Grunde natürlich recht hatte.
Da die Verhandlung sich längst zu einer Sitzung des „Heiteren Bezirksgerichtes“ entwickelt hatte, lag das Folgende auf der Hand. „Bitte sagen Sie nicht, dass es ein Schäferhund ist.“
„Doch, ja.“
Gott sei Dank meldete sich nun wieder der Kaffeehauszeuge zu Wort. „Ich versteh das Ganze sowieso nicht wirklich …“
„Bitte, was verstehen Sie denn nicht?“, fragte der Richter, dessen Ton inzwischen vielleicht ein klein wenig gereizt war. Er verstand selbst ja einiges nicht.
„Warum der Severin angeklagt ist. Das war ja nicht sein Hund.“
„Und woher wissen Sie das?“
„Weil das ja dem Fritz sein eigener Hund war.“
„Wie bitte? Sie wollen mir erklären, dass sein eigener Hund das Opfer vom Rad geholt hat? Vergessen Sie nicht, dass Sie unter Wahrheitspflicht stehen.“
„Was soll das denn heißen? Der Fritz ist von seinem eigenen Hund niedergerissen worden, da bin ich mir sicher! Ziemlich sicher.“
Wenn der Zeuge nicht das „ziemlich sicher“ nachgeschossen hätte, hätte man den Prozess an dieser Stelle vielleicht sogar beenden können. Vor Gericht gibt es zwischen „sicher“ und „ziemlich sicher“ aber einen haushohen Unterschied. Das Gericht wendete sich also wieder Fritz zu.
„Ich werde doch wohl meinen eigenen Hund erkennen!“, stellte Fritz unmissverständlich klar.
Es kam also, wie es kommen musste: Beim nächsten Termin waren statt der ursprünglichen sechs nun sieben Schäferhunde anwesend. Bestimmt würde das alles viel leichter machen …
Im Folgenden wurden die Hundebesitzer aufgefordert, ihre Hunde im Verhandlungssaal festzubinden und dann den Raum zu verlassen. Als der letzte Hundebesitzer draußen war, rief man abermals den Kaffeehauszeugen Karl hinzu, der nun aufzeigen sollte, welcher der Hunde unser Täter war. Karl zeigte gleich aus dem Zeugenstand auf einen der Hunde. Raten Sie, welcher es war! Natürlich der des Opfers! Um Zufälle auszuschließen, wurde Karl wieder hinausgeschickt. Die Hunde wurden neu angeordnet, es wurde auch geprüft, ob sie an Leinen oder Halsbändern etwaige Unterscheidungsmerkmale aufwiesen. Karl kam zurück in den Saal und zeigte denselben Hund an wie zuvor. Klare Sache also. Endlich.
Nun wurde auch das Opfer wieder aufgerufen, und Fritz glänzte schon beim Auftreten, stellte er sich doch zum falschen Hund, in der Meinung, es handle sich um seinen eigenen. Auf die Frage des Richters, welcher Hund denn nun der Übeltäter sei, zeigte Fritz auf einen der anderen Hunde, räumte aber auch gleich ein, dass er sich nicht sicher sei.
Als Fritz dann mit einem fremden Hund hinausgehen wollte, der Hund das aber nicht zuließ, erschien es dem Gericht glaubhaft, dass Fritz nicht bewusst einen falschen Hund bezichtigt hatte, sondern vielmehr tatsächlich nicht sagen konnte, welcher Hund nun wirklich welcher war.
Einen weiteren Akt fand diese Verwechslungskomödie übrigens, als die restlichen Hundebesitzer wieder in den Saal durften und das Gros sich zu fremden Hunden stellte. Das Gericht übernimmt keine Haftung dafür, dass jeder den richtigen Hund mit nach Hause genommen hat. Man kann nur hoffen, dass Hunde nicht auf fremde Namen hören. Am Ende gestanden alle Hundebesitzer, dass sie eigentlich nicht 100%ig ausschließen konnten, dass ihre Hunde zur Tatzeit gestreunt hatten. (Obwohl die Hundebesitzer zu dieser Aussage gesetzlich nicht verpflichtet waren.)
„Ich geb dem Herrn Fritz einen Hunderter. So viel ist mir die Geschichte wert“, meinte dann einer der Hundebesitzer. Dem schlossen sich letztlich alle anderen an. Auch Severin, der ursprüngliche Angeklagte, steuerte einen Schein bei, obwohl er freigesprochen wurde. Den aufkeimenden Applaus im Zuschauerraum unterband der Richter mit einem Ordnungsruf.
„Auch, wenn es danach aussieht, wir sind nicht im Kasperltheater!“
Angeblich sorgte das Verfahren im Nachhinein noch für einige Witze, die zumeist auf Fritz’ Kosten gingen. Sicher ist, dass seit dem letzten Verhandlungstag keine streunenden Hunde mehr im Ort gesehen worden sind. Außerdem wurden farbige Hundehalsbänder verteilt, damit es endlich gelingen konnte, die Hunde auseinanderzuhalten.
Django
Cowboy und Gendarm
„Sie müssen sofort kommen!“, schrie die Frau am anderen Ende der Leitung. „Unser wahnsinniger Nachbar hat schon wieder seine Phase. Der schießt, ich sag’s Ihnen!“
In kürzester Zeit erfragte Inspektor Werpichler alle nötigen Informationen, darunter auch den Namen des mutmaßlichen Täters. Die Strafregisterauskunft nannte mehrere Vorstrafen wegen illegalen Waffenbesitzes und Abfeuerns dieser Waffen in der Öffentlichkeit. Das konnte brisant werden. Die Cobra rückte in Vollmontur aus und war auf alles gefasst.
Als Kind wollte Wolfgang immer gern ein Sheriff sein. Er war damals sogar in einer Bande gewesen, hatte gemeinsam mit seinen Freunden Cowboy und Indianer gespielt. Der Sheriff war er aber nie. Helmut war der Sheriff gewesen. Der hatte einmal einen älteren Schulkollegen – heute hätte man diesen als „Bully“ bezeichnet – mit einem einzigen Faustschlag niedergestreckt; und von da an war Helmut immer der Sheriff. Das fiel Wolfgang ein, während er versuchte, mit dem Schlüssel ins Schloss zu finden. Er hatte heute alte Bekannte getroffen, Kindheitsfreunde, deshalb war es etwas später geworden. Was sie damals nicht alles gemeinsam angestellt hatten. Wolfgang musste lächeln. Es war immer etwas Besonderes, wenn man Freunde aus seiner Vergangenheit traf, vor allem solche aus der eigenen Kindheit, als alles noch so … anders war, die Untiefen des Erwachsenenlebens noch in der unbekannten Zukunft lagen, so weit entfernt, dass man sie nicht einmal erahnen hätte können. Alles, was zählte, waren die Freundschaften und die Abenteuer, die man gemeinsam erlebte. Dann schaffte er es endlich aufzusperren und seine leere Wohnung lag vor ihm, die Antithese zu den warmen Kindheitserinnerungen. Ewig her, das alles. Heute lebte er allein, die Nachbarn mochten ihn nicht. Freunde … ja, hatte er noch welche? Echte Freunde, so wie damals? Wolfgang war nicht sicher. Eigentlich hatte er eher das Gefühl, heute ganz allein auf der Welt zu sein.
Sein erster Weg führte ihn zum Kühlschrank, wo er sich noch ein Bier und einen Schnaps holte. Schade eigentlich, nicht einmal Fotos hatte er von damals. Wolfgang tat sich sogar schwer damit, sich das genaue Bild des Innenhofes zu vergegenwärtigen, aus dem sie die Hausmeisterin damals immer verjagt hatte. Einmal hatte sie daraufhin wütende Briefe an alle Eltern des Wohnblocks geschickt. Wolfgangs Mutter war cool geblieben, hatte sich nicht aufgeregt. Wieder spielte ein Lächeln auf seinen Lippen, jetzt verging aber nur ein Augenblick, bis die Realität es fortwischte. Wolfgang kam seine Wohnung jetzt noch stiller und einsamer vor als sonst. Wenn ihn nicht alles täuschte, sollte er doch noch …
Er ging zu dem Kasten, auf dem seine alten Schachteln getürmt waren. Und tatsächlich: Nach ein paar Versuchen fand er eine, in der wirklich Spielzeug aus seiner Kindheit deponiert war. Er schaffte es, die Schachtel sicher auf den Boden zu verfrachten, obwohl sein Gleichgewichtssinn mittlerweile stark beeinträchtigt war. Sein alter Cowboyhut! Er setzte ihn auf – oder eher: legte ihn auf den Kopf, weil der Hut inzwischen viel zu klein war –, schnallte sich den Revolvergürtel um. Gleich darunter: Das eigentlich wichtigste Stück der Sammlung. Der Sheriffstern, den Helmut ihm irgendwann geschenkt hatte, bevor die Wege der Buben sich für immer getrennt hatten. Beim Anstecken des Sheriffsterns stach er sich ein wenig in die Brust, spürte das aber kaum. Im Revolver waren sogar noch Platzpatronen. Wolfgang stellte sich breitbeinig vor den großen Spiegel, zielte auf sein Spiegelbild und drückte ab, verschoss alle sechs Knaller. Er versuchte ungeschickt, den Plastikrevolver nachzuladen, schaffte es endlich, und feuerte noch sechs Knaller leer. Dann ließ er den Revolver sinken, sah sich im Spiegel an, betrachtete nachdenklich, was aus ihm geworden war, was die Jahre aus ihm gemacht hatten. Er hätte sich noch ein Bier holen können oder sich auch einfach hinlegen, aber etwas hielt ihn fest. Als durfte er diese Erinnerung, die sein Spiegelbild umwölkte, nicht aus den Augen lassen, um sie nicht zu verlieren.
Und da krachte es plötzlich hinter ihm. Von einer Sekunde auf die andere waren Leute in seiner Wohnung.
Wolfgang verstand gar nicht, was gerade passierte. Er drehte sich zu dem Cobra-Beamten um, der längst seine Waffe auf ihn gerichtet hatte. In der Hand, das hatte Wolfgang im Schreck vollkommen vergessen, immer noch den Spielzeug-Revolver …
„Diese Papierschlangen-Knallerpatronen, die es heute gibt, die wären sicher leiser gewesen“, erklärte Wolfgang dem Richter bei der Verhandlung. „Und dann sind da meine Vorstrafen, weil ich immer Waffen haben wollte, aber nicht durfte … und das haben die Nachbarn natürlich gewusst, die haben mich schon mehrmals angezeigt, wenn ich im Hinterhof geschossen habe …“
„Damals waren es aber echte Waffen!“, ergänzte der Staatsanwalt. Die Verhandlung hatte mit einer Überraschung begonnen: Wolfgang und Richter Wasakovski waren als Kinder befreundet gewesen – Verteidiger und Staatsanwalt erkannten aber keine „Befangenheit“ und hatten den Richter daher nicht abgelehnt.
„Und der Widerstand?“, fragte Wasakovski jetzt.
„Ich habe mich nur ganz kurz gewehrt und einem Polizisten einen Haken versetzt. Das tut mir auch sehr, sehr leid“, sagte Wolfgang mit gesenktem Kopf.
„Wenn diese Beamten nicht absolute Profis wären, gäbe es diese Verhandlung heute nicht“, meinte Richter Wasakovski und sah Wolfgang durchdringend an.
„Dafür aber ein schönes Begräbnis“, sagte der Verteidiger.
„Begräbnisse sind nie schön“, gab Wasakovski zurück und rief den nächsten Zeugen auf. Es war der Cobra-Beamte, der als Erster in den Raum gegangen war und seine Waffe gegen Wolfgang erhoben hatte.
„Wir haben gewusst, dass der Angeklagte mehrere Vorstrafen wegen illegalen Waffenbesitzes hat, dass er herumgeschossen hat“, begann dieser mit seiner Aussage. „Die Anruferin war sich sicher, dass er wieder mit einer echten Waffe in seiner Wohnung hantiert und geschossen hat. Wir waren dementsprechend vorbereitet. Und dann stehe ich hinter ihm, und wie er sich zu mir umdreht … sehe ich einen Typen mit Cowboyhut und Sheriffstern, Revolvergurt und Waffe in der Hand. Normalerweise fokussiert man sofort die Waffe, aber irgendwie … ich habe den Sheriffstern gesehen und mein Instinkt hat mir gesagt, dass der Mann nicht brandgefährlich ist. Ich kann es gar nicht besser erklären. Deshalb habe ich zugewartet.“
Richter Wasakovski war begeistert von der Coolness des Mannes. „Ich liege vor Ihnen! Ein Wahnsinn. Man darf gar nicht nachdenken, wie die Geschichte ausgehen hätte können. Ich gratuliere!“
„Danke“, meinte auch Wolfgang, „dass Sie ein echter Sheriff sind!“ Die Aussage wirkte komisch, ohne es überhaupt zu sein. Alle Anwesenden wussten, was gemeint war. Für Wolfgang ging die Sache nicht nur in der Hinsicht glimpflich aus, dass er noch am Leben war. Auch die Strafe wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt war sehr überschaubar, weil die Beamten meinten, es sei kaum erwähnenswert. Cobra-Beamte sind Profis. Und Lebensretter.
Am Ende wollte Wolfgang den Sheriffstern an Wasakovski zurückgeben, der nahm ihn aber nicht an. Ein Geschenk nimmt man nicht zurück.
Josip und Giovanni
Unbekannter Feind
Josip war Jungunternehmer, ohne dabei noch besonders jung zu sein. Er betrieb einen Pizza-Stand samt kunstvoll ummantelter Mikrowellen im Look italienischer Holzöfen. Diese Ummantelung schien aber nicht auszureichen, damit er sich dauerhaft über Wasser halten konnte. Die nötigen Kundenmassen, um sein Schwimmziel zu erreichen, fanden sich nicht. Allerdings: So gab es jede Menge Luft nach oben, nach der Josip sich strecken konnte, um nicht zu ertrinken. In dieser Situation entschied er sich für einen Apnoetauchgang …
Der erste Punkt in seinem Plan: Eine starke Anhebung der Versicherungssummen für seinen Stand. Bald war Josip gegen alles versichert. Nicht nur gegen Vandalismus, sondern gegen Ameisenstraßen, Vulkanausbrüche, Schimmelbefall, Beschuss durch Raumsonden, Blitzschläge und Eisbärenangriffe. Angeblich der feuchte Traum mancher Versicherungsvertreter.
Das Problem hierbei: Die nun hohen Versicherungsprämien setzten Josip noch mehr unter Zugzwang. Wäre das nicht so gewesen, hätte er seinen Plan vielleicht besser ausfeilen können, so musste es jetzt aber schnell gehen.
Eine gute Inszenierung war für das Gelingen sehr wichtig. Er schaffte deshalb in einer weiteren Investition ein Prepaidhandy an und begann, sich von diesem selbst Drohbotschaften zu schicken. Die Mafia wolle Schutzgeld von ihm erpressen, erklärte er kurz darauf bei der örtlichen Polizeistelle, wo man die Gefahr sehr ernst nahm. Gegen die Mafia musste man auf jeden Fall entschieden vorgehen. Die Kriminalabteilung wurde eingeschaltet.
In weiterer Folge wurde Josips Pizzastand zu seiner Sicherheit observiert. Zuerst blieb die Ausbeute gering. Den Beamten ging ein Duo ins Netz, das illegalen Zigarettenhandel betrieb, grob mafiöse Umtriebe konnten aber nicht beobachtet werden. Trotzdem gingen weiter heftige Botschaften bei Josip ein. Das heißt: „Heftig“ waren sie wahrscheinlich, denn so richtig bestätigen konnte das niemand. Wenn die Beamten die Sprachbox-Nachrichten abhörten, lauschten sie dabei gestammelten Silben und Wörtern, auf die sie sich keinen Reim machen konnten. Klar war nur, dass das kein Italienisch sein konnte. Nicht nur nuschelte der Anrufer fürchterlich, es klang auch sehr dumpf, als habe der Anrufer ein Tuch über das Mikrofon gelegt, um seine Stimme zu verfremden. Josip war der Einzige, der die Botschaften so richtig verstand – wie ihm das gelang, konnte niemand sagen. Es half nur, hier mehr in die Tiefe zu gehen. Nachdem man deshalb Josips Telefon anzapfte, blieben die Anrufe aber überraschend aus. Höchstens die eine oder andere Drohung wenig zufriedener Kunden des Pizzastands ging noch ein.
Doch dann kündigte sich ein Durchbruch an. Eines Nachts erschienen zwei kriminell aussehende Mittvierziger in einer schwarzen Limousine. Sie parkten vor Josips Stand ein, gingen bedächtig und mit schweren Schritten auf ihn zu. Dann bestellten sie Bier und Pizza und fuhren ohne weiteren Kommentar wieder davon.
Nichtsdestotrotz trat die Katastrophe ein: Josips kleines Lokal brannte ab, und er selbst trug dabei Verbrennungen im Gesicht und auf dem Oberkörper davon. Im folgenden Verfahren wurde Josip dann Versicherungsbetrug und Brandstiftung vorgeworfen, er blieb aber hartnäckig bei seiner Mafia-Geschichte, eine Sichtweise, die auch sein Verteidiger einnahm. Josips Verteidiger sah in den kriminell aussehenden Mittvierzigern aus der schwarzen Limousine den Beweis dafür, dass die italienische Unterwelt Josip tatsächlich nach dem Leben trachtete, die Anklage Josips also falsch war.
Diese Verteidigungsstrategie wurde sehr schnell schwieriger als erwartet: Bei den „beiden düsteren Gestalten“ handelte es sich in Wahrheit nämlich um zwei sogenannte „verdeckt ermittelnde Beamte“, die einen italienischen Suchtgift-Lieferanten dingfest machen wollten – und dies dann auch noch taten. Warum das also überhaupt erwähnenswert ist? Weil Josips Verteidiger geistesgegenwärtig umsattelte und nunmehr die Schuld auf diesen Suchtgiftlieferanten schob, der für eine italienische Mafia-Familie mit jahrzehntelanger Erfahrung im internationalen Drogenhandel tätig war: Giovanni. Giovanni sollte also Josips Pizzastand angezündet haben. Nach Meinung von Josips Verteidiger jedenfalls.
„Ich liefere Ware“, erklärte Giovanni mit einem gewissen Stolz. „Immer Ware. Ich bin nicht dafür da, Botschaften des Padrone auszurichten.“ Eine klare An- und Aussage. Dennoch witterte Josips Verteidiger eine letzte Chance und zog Giovanni als Zeugen zu Josips Verfahren hinzu. Es kam also zu einer Gegenüberstellung.
„Sie kennen Herrn Josip?“
„Nein. Nie gesehen!“, antwortete Giovanni in seiner Muttersprache. Eine Dolmetscherin war anwesend.
Der Verteidiger wollte seine Hoffnung aber nicht und nicht fahren lassen. „Haben Sie ihn je bedroht?“
Nur zum Verständnis: Schon einmal abgesehen davon, dass Giovanni sich als Zeuge in diesem Fall sogar einer Aussage entschlagen hätte können – es gab überhaupt keinen Hinweis in irgendeinem der Akte, dass Giovanni und Josip jemals miteinander zu tun gehabt hätten. Aber die Hoffnung stirbt eben nie. Und hier schien sich die des Verteidigers völlig überraschend zu erfüllen.
„Wenn er Ware von unserer Familie bekommen und dafür nichts bezahlt hat, dann habe ich mich darum gekümmert, das gehört schon zu meinen Aufgaben!“, sagte nämlich Giovanni mit Überzeugung. Das Aufflackern in den Augen des Verteidigers war nicht zu übersehen.
„Sie haben ihn also bedroht, vielleicht mit dem Abfackeln seines Geschäftes?“
„Ich drohe nicht mit dem Abfackeln des Geschäftes. Wozu? Wer nicht bezahlt, kommt auf die Liste, wer auf der Liste ist, wird abgefackelt. Wozu drohen? Zeitverschwendung!“
„Dann haben Sie sein Lokal also abgefackelt?“, wollte der Verteidiger wissen, der somit endlich den schlüssigen Beweis für die Unschuld seines Mandanten Josip sah.
Giovanni tat ihm den Gefallen: „Wenn er auf unserer Liste war, dann wurde das gemacht, si si!“
Es war ganz still im Verhandlungssaal 101 im ersten Stock des Landesgerichtes für Strafsachen in Graz.
„Auf welcher Liste?“, hakte der Verteidiger nach.
„Auf der Liste des Padrone.“
„Und auf dieser Liste steht Josip, Pizzeria Al Dente, Graz-Liebenau‘?“, mischte sich der vorsitzende Richter des Schöffensenates ein. Es war klar, dass hier jemand ganz schön im Dunkeln tappte.
„Wer?“, fragte Giovanni.
Der Vorsitzende wurde langsam unrund. „Der Angeklagte! Josip, der hinter Ihnen auf der Anklagebank sitzt!“
„Kenne ich nicht persönlich, aber wenn er auf der Liste steht, dann wird er das sein.“
„Andere Frage“, der Vorsitzende wollte diese Sache endlich beenden, „hatten Sie den Auftrag, hier einen Pizzastand abzufackeln, weil der Besitzer Ihrem Padrone oder sonst wem Geld geschuldet hat?“ Die Dolmetscherin übersetzte es Giovanni ebenso laut, wie auch der Vorsitzende sprach, dessen Nerven langsam nachgeben wollten. Giovannis Blick sagte tausend Worte. Er musste alle in diesem Saal für Idioten halten.
„Mutter Gottes! Heilige Jungfrau, hilf! Ich verstehe die Frage nicht“, gab Giovanni endlich zurück. „Ich war hier in – wie heißt die Stadt? – Graz, danke, weil ich fünf Kilogramm Kokain abliefern und das Geld dafür übernehmen sollte. Pedro und Luigi waren falsche Käufer, verstanden. Polizia, verstanden. Aber was will das Gericht mir da anlasten? Ich habe bei dem Pizzalokal geliefert, habe aber nichts angezündet. Wo soll es denn gebrannt haben?“ Ehrliche Verzweiflung in der Stimme.
„Da verwechselt jemand Äpfel mit Birnen“, sagte der Richter kopfschüttelnd zum Verteidiger, der wollte aber immer noch nicht aufgeben – bis dann endlich auch Giovanni der Geduldsfaden riss, der dafür aber klarere Worte fand als zuvor der Richter.
„Was ist daran so kompliziert, Advocado? Ich habe Kokain geliefert, nicht offene Forderungen sanktioniert, ist das so schwer zu verstehen?“
In seinem eigenen Prozess zeigte Giovanni sich übrigens ebenso verständig. Er gestand umfassend und fragte nur nach, wo der lustige Anwalt vom letzten Mal sei. Weniger schuldeinsichtig war Josip. Er leugnete immer noch verbissen, sich selbst mehrfach angerufen und bedroht zu haben, und leugnete auch bis zuletzt, selbst das Benzin ausgegossen und sich beim Legen des Feuers selbst schwer verletzt zu haben. Er blieb bei seiner Version des Mafia-Anschlages.
Die eingesetzten Diensthunde der Exekutive witterten Brandbeschleuniger an drei unterschiedlichen Stellen, das mit der Brandstiftung stimmte also schon einmal. Dann besahen sich aber die Gerichtsmediziner Josips Verletzungen und schlossen definitiv aus, dass Josip mit Benzin überschüttet gewesen wäre. Vielmehr bestätigte sich die Ansicht, dass Josip selbst zuerst an drei Stellen Benzin in der Küche ausgeschüttet hatte, dann mit dem Benzin eine Spur bis an den Eingangsbereich leerte – und die Tatsache außer Augen gelassen hatte, dass nicht Benzin brennt, sondern seine Dämpfe; sprich: das Gemisch von Benzin und Luft. Josip musste sein Zündhölzchen also nicht erst an das Benzin-Rinnsal führen. Schon als er das Streichholz anrieb, gab es eine solche Explosion, dass Josip von der Wucht samt Türe ins Freie geschleudert und die auf Pizzaofen gestylten Mikrowellen in der näheren Umgebung verstreut wurden.
Die katastrophale Geschäftsentwicklung hätte Josip fast zum Selbstmörder gemacht. Es ist unsicher, ob das im Rundum-sorglos-Paket der Versicherung gedeckt gewesen wäre … und was er davon gehabt hätte.
Bodo
Spion auf Rechnung
Bodo war knapp unter siebzig Jahre alt. Den Verhandlungssaal betrat er mit perfekt geglätteten Bundfalten, sein Krawattenknopf wie mit dem Lineal ausgerichtet. Gepflegtes, kurz geschnittenes Haar. Nur das Muster seines Sakkos wirkte ein wenig aus der Zeit gefallen und dürfte eher vor einer ganzen Weile in Mode gewesen sein.
Auf die personenbezogenen Fragen, die jede Verhandlung einleiteten, antwortete Bodo nicht etwa mit einem einfachen Ja, sondern eher zackig mit „korrekt“ oder „zutreffend“.
„Pensionist?“
„Stimmt auch!“
„Wie hoch ist Ihre Pension? Oh, Rente, meine ich natürlich, so sagt man in der Bundesrepublik, oder?“, fragte der Richter.
„Ich sage nicht ,Bundesrepublik‘, ich sage nur ,Deutschland‘!“, entgegnete der Angeklagte.
„Eigentlich stammen Sie ja aus der DDR, der Deutschen Demokratischen Republik.“ Es war keine Frage, sondern eine Feststellung.
„Ich stamme aus dem Osten“, bestätigte Bodo. „Das war noch eine andere Zeit. Eine bessere als heute.“
„Finden Sie wirklich? Stichwort Menschenrechte, Freiheit, staatliche Überwachung, Grenze, Todesschützen, Berliner Mauer und so“, hielt der Richter dagegen.
„Die staatliche Überwachung war notwendig.“
„Ach so?“, warf der Staatsanwalt ein.
„Es kann nicht sein, dass die Leute tun, was ihnen gefällt“, sagte Bodo, als ob das eine Selbstverständlichkeit wäre. „Sie überwachen den Staatsbürger ja auch!“
„Ich überwache gar niemanden“, deponierte der öffentliche Ankläger, „ich klage ihn an, wenn er gegen das Strafgesetz verstößt. Das ist ein Unterschied, mein Herr.“
„Und dass es so weit gar nicht kommt, haben wir den Bürger überwacht“, setzte der Angeklagte unvermittelt fort.
„Bespitzelt, würde ich sagen. Mit Vorbeugung hatte das nichts zu tun!“, konterte umgehend der Ankläger.
„Ich bin auch kein Freund der Stasi“, unterbrach der Richter und versuchte wieder zurück zum Thema zu kommen, „aber darum geht es jetzt nicht. Wie hoch ist Ihre Pension?“
„345 Euro, dazu bekomme ich eine Art Ausgleichszulage und eine … Anpassungsberechnung, heißt das, glaube ich. Die deutsche Pensionskasse zahlt etwas dazu und auch die österreichische, insgesamt sind das so knapp an die 1.100 Euro.“
„Und seit wann sind Sie jetzt in Österreich, und warum?“ Auf diese Standardfrage hatte der Richter von „die Leute sind hier nicht so aufdringlich“ bis „höchste Sozialunterstützung“ schon alles Mögliche gehört. Manche fanden das Land auch „einfach schön“.
„Seit circa fünf Jahren. Deutschland ist mir zu viel Westen, das ist mir als ehemaligem Ossi nicht so angenehm. Österreich ist nicht so westlich“, antwortete Bodo.
„Das höre ich auch zum ersten Mal – was haben Sie früher beruflich gemacht?“, wollte das Gericht wissen.
Der Angeklagte zögerte. Der Richter blickte ihn an. „Also?“
„Ich habe für den Staat gearbeitet.“
„Als …?“
„Als Beamter.“
„Schön, hätte ich mir denken können. Aber in welcher Beamteneigenschaft? Lehrer, Polizist, Bibliothekar, Staatssekretär …“
„Ich war für die Sicherheit zuständig!“
„Schön, also Volkspolizist! Vopo, so hat das einmal geheißen, oder? Oder waren Sie im Außenamt, Geheimdienstbeamter, Soldat?“
Der Angeklagte blickte den Richter weiter an. Auge in Auge. Bodo sagte kein Wort.
„Na geh’, sagen Sie schon. So spannend ist das auch wieder nicht!“, rutschte dem Staatsanwalt heraus. Bodo blieb stumm.
„Sie waren bei der Stasi!“, rief der Richter, ohne den Angeklagten aus dem Blick zu lassen. „Sie waren bei der geheimen Staatssicherheit, stimmt’s?“
Der Angeklagte reagierte noch immer nicht.
„Okay, und was haben Sie da gemacht?“, bohrte der Richter weiter, davon überzeugt, dass seine Behauptung zutraf.
„Ich war für die Sicherheit zuständig“, sagte Bodo.
„Haben wir schon gehört. Wie muss ich mir das vorstellen?“ Die Universalfrage schlechthin. Sie passte in fast jeden Kontext.
„Ich war unter anderem für Notlandungen von Flugzeugen auf Autobahnen zuständig“, erklärte Bodo jetzt.
„Das geschah so oft in der DDR?“
„Ja, doch.“
„Und da machten Sie dann was genau?“
„Ich war für das Organisatorische zuständig!“
Das wäre schon die nächste passende Stelle für die Universalfrage gewesen, aber es wurde langsam Zeit, zum Tatgeschehen zu kommen. Was man an Kompetenzen mitbringen musste, um Notlandungen von Flugzeugen auf Autobahnen zu organisieren, sollte im Dunkeln bleiben.
„Na gut. Lassen wir das so stehen“, erklärte der Vorsitzende des Gerichtes also. „Was sagen Sie zur Anklage wegen schweren Betruges? Dieser Tatbestand ist ja in der BRD – und auch in der seinerzeitigen DDR – sehr ähnlich gefasst, um nicht zu sagen, gleich.“
„Des Betruges bin ich nicht schuldig. Ich habe niemanden betrogen und mich auch nicht durch Täuschung über Tatsachen unrechtmäßig bereichert.“
„Na bitte, Sie wissen, worum es geht. Als ehemaliger staatlicher Sicherheitsbeamter weiß man so etwas natürlich“, ergänzte der Staatsanwalt. Offenkundig hatte er Gefallen am Angeklagten gefunden.
„Ich habe nie jemanden getäuscht. Ich habe vielleicht zu viel versprochen, aber nie jemanden getäuscht“, erwiderte Bodo mit fester Stimme. „Außer mir konnte der Dame niemand helfen, also habe ich mich ihres Problems angenommen. Meine Leistung habe ich erbracht, daher stand mir auch eine Geldforderung zu.“
„Aber was war Ihre Leistung?“, wollte der Richter wissen. „Die fünf oder sieben Seiten, die Sie an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geschickt haben? Das war Ihre Leistung? Ernsthaft?“ Der Richter musste selbst lächeln, während er mit den handbeschriebenen Blättern aus dem Akt wedelte. „Das haben Sie geschrieben?“
„Ja, das ist meine Ausarbeitung.“
„Mit der Rechtschreibung scheinen sie eher auf Kriegsfuß zu stehen. Und diese ganzen Rechtsnormen, die Sie anführen, haben Sie woher? Studiert oder vom Hörensagen?“
„Aus dem Internet, da habe ich recherchiert!“
„Und daher muss das alles richtig sein, oder wie?“
„Ich bin davon ausgegangen.“
„Aber Sie glauben doch wohl selbst nicht, dass wegen eines Nachbarstreits, in dem es um einen umgeschnittenen Baum geht, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte angerufen werden kann?“
„Ich bin davon ausgegangen. Hier geht es um das Naturrecht.“
„Naturrecht hat nichts mit Bäumen zu tun!“, unterwies der öffentliche Ankläger, dem diese Verhandlung nun doch langsam zu absonderlich wurde.
Der Richter versuchte, zurück zu den wichtigen Fragen zu kommen. „Bitte, nochmals; ich muss darauf zurückkommen: Was war Ihre Leistung? Das …“ – dabei wedelte der Richter erneut mit den Zetteln – „kann es ja nicht gewesen sein!“
„Ich bin Monate an dieser Sache gesessen! Ich habe allein schon zehn Ordner mit Anwaltsschreiben und Gerichtsbeschlüssen durchgelesen!“
„Und deshalb hat die Beratene Ihnen dann fast 20.000 Euro zahlen müssen?“
„So in etwa“, sagte Bodo, jetzt wieder ruhiger.
„Fürs Lesen und diese … Ausarbeitung?“
„Ja.“
„Ein seriöser Rechtsanwalt hätte nicht so viel gekostet. Nachdem dieses Schreiben als unzulässig zurückgewiesen wurde … wie würden Sie Ihre Leistung nachträglich beziffern?“
„Meine Arbeit wurde immer wertgeschätzt und anerkannt. Schon in meiner mehr als fünfunddreißigjährigen Dienstzeit!“
„Ja, mit 345 Euro, oder so?“ Die Reaktion des Gerichtes, wenn auch nicht ganz korrekt, bewirkte interessanterweise dennoch ein gewisses Umdenken bei Bodo.
„In Ordnung. Ich gebe jetzt zu, dass meine Ausarbeitung höchstens eintausend Euro wert sein wird.“
„Und sonst haben Sie nichts versprochen oder behauptet?“
„Nein, was hätte ich versprechen sollen?“
„Dass Sie als Doktor sich auskennen, alles in die Wege leiten werden, dass Sie Überwachungsmaßnahmen setzen et cetera. Nichts mehr in Erinnerung?“, meinte der Richter, im Akt blätternd.
„Nicht, dass ich wüsste!“
Während der Angeklagte selbstsicher auf der Anklagebank posierte, startete das Beweisverfahren mit der ersten Zeugin, einer rüstigen Pensionistin und Bekannten des Opfers.
„Ich lernte ihn als Buschauffeur kennen, er fuhr die Linie 30. Wir sind ins Gespräch gekommen, weil ich an der Endhaltestelle aussteige, und dort hat er dann auch immer Pause gemacht. Wir haben uns öfter unterhalten, und dabei habe ich ihm halt auch von meiner Bekannten aus dem Singkreis und dem Streit mit ihrer Nachbarin erzählt. Er meinte, er werde sich des Problems annehmen, weil er schon seit Jahrzehnten in der Sicherheitsbranche wäre und mit einem Partner eine Security-Firma betreiben würde. Ausforschungen, Observierungen, Satelliteneinsätze und so. Auch ganz geheime Angelegenheiten, das wäre sein Thema. Immer wenn es um Menschenrechte gehe, sei er sowieso der richtige Mann. Er sei europaweit in Sicherheitsfragen unterwegs“, führte die Zeugin aus.
„Und da arbeitet er als Busfahrer?“, warf der Richter ein.
„Ja, als Aushilfe; und zur Tarnung.“
„Wie sind Sie darauf gekommen, dass diese Behauptungen stimmen könnten?“
„Er hat mir ja seine Visitenkarte gegeben, die habe ich heute auch mit. Hier steht es auch, sehen Sie: Security – Business – Safety International, Commander Lieutenant …“ Die Zeugin gab dem Richter das Kärtchen.
„Da ist ein Kampfhubschrauber drauf?“, sagte der Richter zum Angeklagten. „Sollen wir Sie also ,Herr Commander Lieutenant‘ nennen? So steht es auf der Karte.“ Bodo wirkte regelrecht zusammengefallen. Entweder das oder er war tatsächlich seit Beginn der Verhandlung ein wenig geschrumpft.
„Das ist nicht meine Karte“, entgegnete er leise.
„Aber Sie haben sie der Zeugin gegeben!“
„Kann sein.“
„Was heißt ,kann sein‘? Ja oder nein?“
„Ich habe sie ihr gegeben, ich habe aber nicht gesagt, dass das meine Firma sei. Die war erst in Gründung.“
Jetzt mischte sich die Zeugin ein: „Er hat gesagt, dass er mit einem Sheriff gemeinsam internationale Investigationen machen würde. Sie wären quasi Marktführer in Europa, hätten beispielsweise gestohlene Autos in Italien gefunden, weil sie Zugriff auf die Satelliten haben, und deshalb die besten Bilder bekommen. Dass das alles Hand und Fuß hat, habe ich bemerkt, wie sie im Radio berichteten, dass in Genua diese Autobahnbrücke eingebrochen wäre. Das sagten sie gerade im Radio und ich bin direkt nach den Nachrichten zur Bushaltestelle. Er war auch dort und hat mir erklärt, dass er die nächsten Tage nach Genua müsse, um das aufzuklären. Allein, dass er schon davon gewusst hat“, sagte die Zeugin ehrfürchtig, „da war ich mir sicher, dass er sich da wirklich auskennt.“
„Das könnte er aber, wie Sie selbst ja auch, aus den Nachrichten gehabt haben …?“, konstatierte der Richter perplex.
„Das glaub ich nicht. Er ist ja vor dem Bus gestanden, wie hätt’ er da Radio hören sollen? Ich weiß auch, dass er im Zuge seiner Ausbildung sogar mit dem Putin zusammengearbeitet hat. Jetzt sind sie auf Du und Du. Er war ja auch bei der Hochzeit von dieser Ministerin und hat dort sogar den Wodka von Herrn Putin trinken dürfen. Der kennt Leute! Er hat mir auch ein Foto von dem Herrscher von Nordkorea gezeigt, für den hat er auch einmal gearbeitet.“
„Frau Zeugin“, unterbrach das Gericht, „nur eine rasche Zwischenfrage: War auf dem Bild des nordkoreanischen Diktators auch der Herr Angeklagte selbst abgebildet?“
Die Zeugin: „Nein! Wieso?“
Es gab also wenigstens etwas zum Schmunzeln. Von der Selbstsicherheit des Angeklagten war inzwischen nicht mehr so viel übrig.
Zeugin Nummer zwei stand der ersten in nichts nach. Sie erklärte sofort, wie Bodo durch seine Kontakte auf Satelliten zugreifen könne, wenn etwas überwacht werden solle. So könne er auch ihren Garten überwachen, weil es ja dauernd Streitigkeiten mit der Nachbarin gebe.