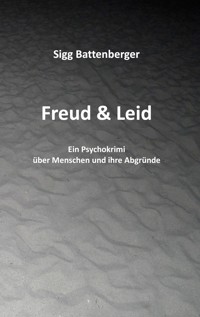
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Im Sommer 2020 wird der Psychoanalytiker Dr. Hofmann in seiner Praxis in Frankfurt überfallen und lebensgefährlich verletzt. Die betagte Hausbesitzerin wird dabei ermordet. Das Motiv des Überfalls ist zunächst völlig unklar. Die Untersuchung übernimmt Kriminalhauptkommissar Bauer, der vor Jahren selbst Patient bei Hofmann war. Er trifft seinen ehemaligen Analytiker als Patienten an und erfährt in einem zähen Ringen um die ärztliche Schweigepflicht, dass eine neue Patientin, Amalia R, die als Escort-Dame im Dienste der kalabrischen Mafia arbeitet, Anlass für das Gewaltverbrechen sein könnte. Nicht nur die Ndrangheta, sondern auch andere Verbrechersyndikate kämpfen um Informationen und Einflussnahme auf wichtige Personen. Dr. Hofmann möchte seine Patientin Amalia, die ihm mehr bedeutet, als ihm professionell lieb ist, schützen, und verleugnet dabei, dass er selbst in Gefahr schwebt. Der Kommissar will die Mörder fassen und das Verbrechen aufklären; er möchte aber nicht, dass seine Rolle als damaliger Patient bekannt wird. Alle drei Hauptpersonen durchleben innere Konflikte von seelischem Leid wie Depression, Angst, aber auch Lust, Erotik und sonstige Abgründen, die sie so nicht hätten, wenn sie sich nicht begegnet wären. Stimmt der Satz des Philosophen Thomas Hobbes: Homo homini lupus? Werden Amalia und Dr. Hofmann davonkommen? Sicher ist: Der Coronavirus und seine Pandemie sind wie das internationale organisierte Verbrechen eine ständige und unheimliche Bedrohung der Menschheit - nicht nur im Sommer 2020. Der Kriminalroman "Freud & Leid" rückt die Beziehungen und Lebensgeschichten der Protagonisten in den Vordergrund und legt weniger Wert auf die Schilderung blutiger Gewalt. Er berührt beiläufig und humorvoll gesellschaftliche Themen, wie aktuelle Fragen des Gesundheitswesens, die elektronische Patientenakte, die Schweigepflicht, psychoanalytische Praxis, Ethik, Etymologie, Mythologie und Philosophie. Es handelt sich ein die dritte korrigierte Auflage (Nov. 2023). Der Autor arbeitete als Psychoanalyliker. Sigg Battenberger ist sein Pseudonym.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Handlung: Franz Xaver Hofmann, Psychoanalytiker in Frankfurt, wird Mitte August 2020 in seiner Praxis überfallen und schwer verletzt. Die Vermieterin des Hauses wird dabei getötet. Die Untersuchung des Gewaltverbrechens übernimmt Kommissar Georg Bauer. Zufälligerweise war er fünf Jahre vorher selbst in Psychotherapie bei Dr. Hofmann wegen eines sogenannten Burnouts. Jetzt findet er seinen ehemaligen Therapeuten als angeschlagenen Patienten vor und erfährt nach einem zähen Ringen um die ärztliche Schweigepflicht, dass eine Patientin, die als Escort-Dame im Dienste der kalabrischen Mafia arbeitet, der Anlass für das Gewaltverbrechen sein könnte. Nicht nur die Ndrangheta, sondern auch osteuropäische Verbrechersyndikate kämpfen um Informationen, Einflussnahme und besonders um Geld.
Dr. Hofmann möchte seine Patientin, die ihm mehr bedeutet, als ihm professionell lieb ist, schützen und verleugnet dabei, dass er selbst in Lebensgefahr schwebt. Der Kommissar dagegen möchte, dass seine Rolle als ehemaliger Patient bei der Untersuchung nicht bekannt wird.
Seelisches Leid wie Depression, Angst, Aggression, Destruktion, aber auch das Libidinöse wie Lust, Erotik, Humor gesellen sich zu den realen Konflikten der Protagonisten, die sie zum Teil so nicht hätten, wenn sie sich nicht begegnet wären.
Der Kriminalroman „Freud & Leid“ rückt die Biographien und die Lebensgeschichten der Hauptpersonen in den Vordergrund; er legt weniger Wert auf die Schilderung blutiger Gewalt. Vielmehr berührt er beiläufig und humorvoll aktuelle gesellschaftliche Fragen des Gesundheitswesens und der Medizin (Schweigepflicht, elektronische Patientenakte, Corona-Pandemie) sowie der Psychoanalyse, Ethik, Etymologie, Mythologie und Philosophie.
Der Autor arbeitete als Psychoanalytiker in eigener Praxis.
Sigg Battenberger ist ein Pseudonym.
Die Hauptpersonen
Hofmann, Franz Xaver, Dr. med.: 59 Jahre, Psychoanalytiker, Psychosomatiker und Psychiater in Frankfurt wurde in seiner Praxis überfallen und lebensgefährlich verletzt.
Bauer, Hans-Georg: 50 Jahre, Kriminalhauptkommissar, Leiter des Kommissariat 11 der Kriminalinspektion für Kapitaldelikte des Polizeipräsidiums Frankfurt wurde mit der Untersuchung des Gewaltverbrechens beauftragt. Bauer war vor fünf Jahren Patient bei Dr. Hofmann.
Ruschke, Anna Amalia: 30 Jahre, Escort-Girl, ist seit wenigen Monaten Analysepatientin bei Dr. Hofmann, weil sie aus der kriminellen Szene aussteigen wollte. Sie ist seit dem Überfall auf Hofmann verschwunden.
Homburger, Alfons, Dr. phil.: 56 Jahre, auch Anatol genannt, Psychologe und Psychoanalytiker, Kollege und Freund von Franz X. Hofmann
von Ysenberg, Carola: 47 Jahre, Caro oder Carol, ist Patientin von Dr. Hofmann und Headhunterin.
Die Nebenrollen
in alphabetischer Reihenfolge:
Bauer, Annette: 50 Jahre, Sozialarbeiterin, Bauers Ehefrau
Bauer, Bettina: 20 Jahre, Freiwilliges soziales Jahr, Bauers Tochter
Cha, Hung: 29 Jahre, Kriminaloberkommissar (KOK), Informatiker im Kommissariat 11, Backoffice
Demir, Cem: 29 Jahre, Polizeimeister (PM)
Henninger, Thea: 30 Jahre, Kriminaloberkommissarin (KOK), Kollegin von KHK Bauer
Kovac, Mira: 22 Jahre, Jurastudentin, Praktikantin in K 11
Sandberg, Dorothea: 82 Jahre, Vermieterin der Praxis in der Gruberstraße 17. Sie wird bei dem Überfall auf Dr. Hofmann getötet.
da Silva Santos, Maria: 70 Jahre, Putzfrau von Dr. Hofmann
Helmolt: 48 Jahre, Landwirt, Bauers Schwager
Hofmann, Constanze, Dr. rer. nat.: 58 Jahre, Meeresbiologin am Alfred-Wegener-Institut, Kiel, Ehefrau von Dr. Hofmann
Hofmann, Justus: 23 Jahre, Student, Sohn von Hofmann
Hofmann, Marie: 25 Jahre, Studentin, Tochter von Hofmann
Hoffmann, Silke: 24 Jahre, Krankenschwester
Malzahn, Jutta: 62 Jahre, Sekretariat des Kommissariats 11
Maren: 27 Jahre, Ambulanzschwester
Maria: 46 Jahre, Schafzüchterin, Bauers Schwester
Max, Michael, Dr. med.: 33 Jahre, Chirurg
McKenny: 39 Jahre, Nachbarin von Dr. Hofmann
Patzke, Julia, Dr. med.: 65 Jahre, Gerichtsmedizinerin
Przybylski, Marek: 31 Jahre, Polizeiobermeister (POM) im Kommissariat 11, Backoffice
Riehl, Frank: 50 Jahre Rechtsanwalt in Frankenberg, Freund und Studienkollege von Hans-Georg Bauer
Schmitt, Johannes, PD Dr. med.: 60 Jahre, Chef der Traumatologie
Siefert, Diana: 32 Jahre, Kriminaloberkommissarin (KOK)
Stölling, Ina, Dipl. Psych.: 50 Jahre, Verhaltenstherapeutin in Berlin, Tochter von Frau Sandberg
Werner, Aaron: 43 Jahre, Kriminaloberkommissar (KOK)
Wondracek, Wolf: 51 Jahre, Polizeiobermeister (POM)
Unbekannter Mann: 36 Jahre aus Osteuropa, Täter, von der Mafiakonkurrenz in Frankfurt ermordet
Unbekannter Mann:28 Jahre aus Osteuropa, Mittäter, in U-Haft, schweigt wie ein Grab
***
Inhaltsverzeichnis
1. Carol
2. Angst und Panik
3. Befreiung
4. In der Notaufnahme
5. Auf Station
6. Der Tag danach
7. Anatol
8. Der Arzt als Patient
9. Kriminalhauptkommissar Bauer
10. Frau von Ysenberg
11. Der Kommissar als Patient
12. Besuch bei seinem kranken Arzt
13. Bei Carol zuhause
14. Pneumothorax
15. Sonntags im Präsidium
16. Schweigepflicht – ein Exkurs
17. In der Gruberstraße
18. Der Krimihasser
19. Kripoarbeit – ein weiterer Exkurs
20. Der Montag nach dem Verbrechen
21. Klinkenputzen
22. Caro im Präsidium
23. Videoüberwachung
24. Zweiter Besuch bei Patient Hofmann
25. Das zweite Gespräch mit Frau R.
26. Dienstbesprechung am Dienstag
27. Schritt für Schritt
28. Der AMB-Mercedes
29. Orbita
30. Stagnation
31. Zwischenbilanz
32. Hofmanns Entlassung
33. Hofmann wieder zuhause
34. Ein unheimliches Wochenende
35. Aufräumen
36. Bei Alfons
37. Sonntag, Alpträume, lange Weile
38. Ein anderes Setting
39. Die folgenden Tage
40. Das zweite Gespräch nach dem zweiten Überfall
41. Praxisneustart
42. Dienstag, 1. September - zum Ersten
43. Dienstag, 1. September – zum Zweiten
44. Der zentrale Traum
45. Bruch des Arztgeheimnisses
46. Die Biographie von Frau R.
47. Die Therapievereinbarung
48. Teambesprechung am Freitag
49. Drittes Gespräch Bauer-Hofmann
50. Gangster haben kein freies Wochenende
51. Die vierte Fahndungswoche
52. Intervision
53. Amalia’s Psychodynamik
54. Constanze auf dem Eis
55. Halali – Ende der Jagd?
56. Gewaltenteilung
57. Blinder Ödipus
58. Semifinale
59. Zweites Semifinale
60. Finale mit drei Postkarten
1.
Carol
Sie parkte ihr Auto schräg gegenüber der Einfahrt, um eine gute Sicht auf das Gartentor zu haben. In der Allee war es ziemlich schattig, dennoch behielt sie ihre Sonnenbrille auf, durch die Reflexionen der Frontscheibe wäre sie ohnedies von außen schlecht zu erkennen. Die ruhige Straße mit ihren beidseitigen Platanen erinnerte sie immer wieder an die Straßen in der französischen Konzession von Shanghai mit den alten Villen und chinesischen Häuschen, wo sie vier Jahre lang gelebt hatte; nur fehlten hier im Dornbuschviertel die kleinen Geschäfte und Restaurants. Die Gruberstraße mit dem holprigem Basaltpflaster vermittelte die gediegene Atmosphäre Frankfurter Bürger, als wäre die Zeit etwas stehen geblieben, irgendwie old-fashioned. Bei old-fashoned musste sie an den Cocktail denken, den sie früher aus altem Whiskey, Angostura bitter, Wasser, Orange und etwas Zucker gemixt hatte. Bei diesen Temperaturen würde aber ein Gin mit Tonicwater und Limette besser schmecken. Hundert Meter weiter durchschnitt die hässliche und laute Eschersheimer Landstraße mit ihrer oberirdischen U-Bahn den Stadtteil.
Es war kurz vor 17 Uhr. Langsam müsste die Person doch durch das Gartentor kommen, für die Carol auf der Lauer lag. Sie wollte nur sehen, wie die neue Patientin aussah, die freitags vor ihr auf der Couch lag. Sie muss deutlich jünger sein, dem intensiven Parfüm nach zu schließen; der frische Duft gefiel Carol zwar, die Dosis war aber übertrieben, dadurch stellte sie sich ihre Couchschwester als kleines nuttiges Luder vor, das sich mit ihrem Parfüm aufdringlich zudieselte, um irgendetwas zu überdecken. Carol hatte auch den Eindruck, dass ihr Clooney, wie sie Dr. Hofmann gerne nannte, nach jeder Stunde mit dieser Neuen irgendwie aufgekratzt wirkte. Sie wolle ihm das demnächst einmal um die Ohren hauen. Frei assoziieren sollte sie ja, und sie konnte seine Antwort jetzt schon antizipieren, dass sie offenbar immer noch mit ihrer jüngeren Schwester um die Aufmerksamkeit ihres Vaters rivalisiere. „Ja, Scheiße! Und wenn?“ sagte sie laut und schlug auf das Lenkrad. Auch wenn das stimmte, kann sie die Neue einfach nicht riechen und spähte wieder zum Gartentor.
Die Klimaanlage schnurrte. Es klopfte an der Fahrerscheibe. Carol fuhr sie halb runter. Eine mittelalterliche Frau sagte freundlich, aber streng: „Sie können hier nicht parken, das ist eine Einfahrt. Und würden Sie bitte den Motor ausschalten?“ Carol scannte sie aus ihrem Mini Cooper langsam von unten nach oben ab. „Aber selbstverständlich“, sagte sie scheißfreundlich, fuhr das Fenster wieder hoch und schaute auf die andere Straßenseite. Hoffentlich hatte sie jetzt nicht verpasst, was da aus der Praxis kam. Carol wartete noch einen Moment, fuhr dann weiter vorne eine kleine Parklücke an und gab damit die Einfahrt frei. Die Nachbarin verfolgt sie mit ihren Blicken, während sie weiter verwelkte Rosen aus dem Busch schnitt. Als Carol zum Gartentor der Praxis betont elegant schritt, sagte die Nachbarin zu ihr über die Straße: „Danke, geht doch.“ Carol reagierte nicht.
Sie ging durch den Vorgarten und klingelte an der Sprechanlage; es war ihre Zeit. Sie hörte keinen Türsummer, klingelte noch einmal und wartete – vergeblich. Klingelte ein drittes Mal. Plötzlich schoss ihr der Gedanke in den Kopf, dass die Therapiestunde heute abgesagt worden sei und sie das vergessen haben könnte. Sowas traute sie sich zu. Sie hatte schon öfters eine Stunde „verpeilt“, wie ihre Tochter sagen würde. Sie kramte hastig in der großen Handtasche nach ihrem Handy, rief den Kalender auf, fand aber keinen Eintrag. Dann beschloss sie, Dr. Hofmann anzurufen. Es meldete sich der Anrufbeantworter mit seinem üblichen Text; nach dem Piepton sagte sie: „Hier ist Ysenberg. Ich stehe jetzt vor Ihrer Praxistür. (Pause) Wir haben doch heute um 17 Uhr Therapiestunde. Oder habe ich mich geirrt?“ Es passierte nichts. Carol rief ein weiteres Mal an und ergänzte, sie bitte um einen Rückruf. Sie ging daraufhin zwar etwas gesäuert zum Auto zurück, hatte aber ein ungutes Gefühl, weil ihr Dr. Clooney extrem zuverlässig war; er war zwar für ihren Geschmack etwas bieder und von vorgestern, fast wie ein Finanzbeamter, aber sehr verbindlich. Das alles passte nicht zu ihm.
Vielleicht liege er ja tot in seinem Sessel oder hat einen Herzinfarkt, dachte sie. Sollte sie einen Krankenwagen rufen? Na gut, den könnte er auch selbst rufen, wenn er Herzbeschwerden habe, außerdem sei er Arzt. Dann hatte sie die Fantasie, er treibe es auf der Couch mit der neuen Duftwolke und ließe sie draußen stehen. Beide Möglichkeiten gefielen ihr überhaupt nicht, die letzte schon gar nicht.
Spontan beschloss sie, bei der alten Dame im Parterre der Praxis zu klingeln, der sie schon öfters im Vorgarten und Treppenhaus begegnet war; sie kannten sich aus einer höflichen Distanz.
Der Summer schnarrte und Frau Sandberg schaute durch den Spalt ihrer Wohnungstür. Carol behielt die Haustür in der Hand und fragte, ob Dr. Hofmann in der Praxis sei, sie habe einen Termin, er öffne aber die Tür nicht. Frau Sandberg hielt eine Hand hinter ihr Ohr, sie habe nicht richtig verstanden. Carol trat näher an sie heran, wiederholte ihre Frage deutlich lauter. Ja, sie habe den Doktor heute gesehen, er habe auch Patienten, soweit sie das mitbekommen habe, bestätigte die alte Dame. Wegen der Corona-Infektionen meide sie, aus dem Haus zu gehen. Sie könne ihr leider nicht weiterhelfen und: „Ich glaube nicht, dass die Sprechanlage defekt ist, aber klingeln Sie doch oben an der Praxistür noch einmal.“ Carol bedankte sich und ging in den ersten Stock, klingelte, klopfte gegen die Glastür, lauschte mit einem Ohr an der Tür, dabei stützte sie sich mit der rechten Hand ab. Es war nichts zu hören. Schließlich trat sie wie ein trotziges Kind gegen die Praxistür und verstauchte sich dabei den rechten Fuß. Heute trug sie zierliche Riemchensandalen und ein luftiges Sommerkleid, es waren immerhin 30° C. Der Fuß tat so weh, dass sie sich auf die Treppe setzen und die Zehen massieren musste. „Verdammt nochmal“, sagte sie, als sie bemerkte, dass auch der Nagel eingerissen und der rote Nagellack an der Großzehe abgesplittert waren. Hoffentlich wird der Nagel nicht blau, dachte sie. Nach einer Minute ging sie fluchend die Treppe hinunter.
Frau Sandberg stand noch hinter der etwas geöffneten Tür. „Und? Antwortet er?“
„Nein, ich habe nichts gehört, er hat nicht reagiert.“
„Muss ich mir jetzt Sorgen machen?“ fragte sie Carol, die wiederum ihre Schultern zuckte und sagte: „Ich weiß auch nicht. Ich gebe Ihnen mal meine Telefonnummer, falls Sie etwas herausfinden oder meine Hilfe brauchen.“ Sie schrieb die Nummer auf einen Kassenbon, den sie in der Tasche fand - eine Visitenkarte wollte sie ihr nicht geben - und verabschiedete sich mit einem Gefühl von Irritation und Ärger.
Carol ging etwas unrund in die Eschersheimer Landstraße, um in der Bäckerei Brot zu kaufen; mit einem Mundschutz musste sie in der Schlange anstehen. Obwohl es heiß war, kaufte sie sich einen Kaffee. Sie saß in ihrem Mini und biss gefrustet eine Ecke aus dem frischen Brotlaib, der wunderbar roch, und trank in kleinen Schlückchen den heißen Kaffee.
Im Rückspiegel sah sie einen Mann aus dem Tor der Nr. 17 kommen, dunkel gekleidet, Sonnenbrille, Mundschutz, Schirmkappe, unter dem Arm trug er eine rote Plastiktüte. Zog er sich gerade Handschuhe aus? Warum Handschuhe? Im Hochsommer? Warum Mundschutz? Mundschutz war doch nur in Geschäften wegen der Corona-Infektion Pflicht. Er ging mit schnellen Schritten nach links in die entgegengesetzte Richtung von Carol. „Da stinkt doch was zum Himmel!“ zischte sie und startete den Motor, stellte den Becher in die Halterung der Mittelkonsole, um den dunklen Typen abzupassen. Sie fuhr flott um das Karree, was wegen zweier Ampeln Zeit kostete, Sie konnte den Kerl aber nicht entdecken, er war einfach verschwunden. Sie überlegte, noch einmal bei Frau Sandberg zu klingeln, um nachzusehen. Sie entschied sich dann aber dagegen. Es war inzwischen halb Sechs.
Auf der Heimfahrt in Richtung Osthafen dachte sie daran, ihre Beobachtungen der Polizei mitzuteilen. Sie hatte ein äußerst ungutes Gefühl bei der ganzen Sache, aber sie wollte sich auch nicht lächerlich machen. Dabei hatte sie sich doch für ihren Dr. Clooney so hübsch gemacht, sie wollte ihm zeigen und klar machen, dass die neue Schnepfe sich nicht so viel einzubilden brauche. Jetzt kehrte sie unverrichteter Dinge und mit leichten Blessuren nach Hause zurück und beschloss, auf dem Balkon das Wochenende mit einem eisgekühlten Prosecco einzuläuten; das Wetter war wunderbar, der Blick nach Süden über den Main war wie Urlaub. Wegen der Corona-Pandemie machte es auch keinen rechten Spaß und war nicht so einfach, sich mit Freunden in einer Kneipe zu treffen. Ihr Mann hätte dafür sowieso keine Lust gehabt, er gehörte zu den Risikopatienten.
2.
Angst und Panik
Hofmann kam langsam zu sich. Er bekam schlecht Luft; über seinem Mund spannte sich ein Klebeband. Das rechte Nasenloch war verstopft. Panik stieg in ihm hoch. ‚Langsam durch die Nase atmen!‘ sagte er sich. Er realisierte, dass er auf dem Boden direkt vor seinem Bücherregal lag. Sein Kopf dröhnte, das Gesicht und der Brustkorb schmerzten. Im Mund schmeckte er Blut, die Lippen waren angeschwollen und durch das Klebeband verschlossen. Das Atmen fiel ihm schwer. Seine Hände waren auf dem Rücken gefesselt; seine Beine konnte er nicht ausstrecken, weil sie auch nach hinten angewinkelt zusammengebunden und offenbar mit den Fesseln der Hände verknotet waren. Und er hatte einen Strick um den Hals, der ihn würgte, sobald er die Beine strecken wollte. Er lag auf der Seite und musste husten, der Geschmack seines Blutes war ekelhaft, zum Kotzen; er bekam Angst zu ersticken. Wie ein Stück Vieh verschnürt, geknebelt bereit zum Abtransport – so fühlte er sich. Sich wehren und dagegen ankämpfen, verschlimmerte seine Situation. Da musste jemand etwas vom Foltern verstehen und es darauf angelegt haben, dass Hofmann sich selbst erdrosselt. Er beschloss, möglichst entspannt auf der Seite zu liegen und langsam durch die geschwollene Nase zu atmen. Nur keinen Panikanfall bekommen und nicht an den Fesseln zerren!
Was war passiert? Jemand hatte ihn überfallen; er konnte sich aber an nichts erinnern. Plötzlich kam ihm der Gedanke, dass der Gewalttäter - eine Frau war es bestimmt nicht - noch in der Praxis sein könnte. Hofmann blieb ganz still und lauschte in die Stille hinein. Er hörte nichts außer sein Atmen und das Pochen im Kopf. Es fiel ihm schwer, zu erkennen, was um ihn herum los war; seine Brille hatte er nicht auf und das rechte Auge war zugeschwollen. Dennoch sah er im Zwielicht die Verwüstung seines Praxisraums, Bücher, Ordner, Papiere lagen verstreut herum. Die Gardinen waren zugezogen und ließen aber einen breiten Streifen Licht auf den weichen, roten Perserteppich durch. Ihm war warm, dennoch begann er zu zittern.
Das deutsche Wort Angst kommt nicht umsonst vom Lateinischen angustus, das „eng“ bedeutet. Was Hofmann spürte, war mehr als Angst, es waren Wellen von Panik. Bei Panikattacken möchte man weglaufen oder kämpfen; beides konnte er aber nicht. Er stöhnte, versuchte zu rufen, brachte nur dumpfe Laute heraus, die außerhalb seiner Praxis bestimmt niemand hören konnte. Die Tür zum Behandlungszimmer war besonders schallisoliert. Wieder versuchte er, sich aufzubäumen mit dem Effekt, dass sein Körper mit Schmerzen antwortete. Er stieß sich vom Bücherregal vorsichtig ab, um in dem dunklen Raum mehr erkennen zu können, aber auf dem Teppich war es mühsam, sich zu drehen. Der Impuls, sich aufbäumen und zu wehren, wechselte in ein Gefühl von Angst und Resignation.
Erschöpft kreisten erneut die Gedanken, das Unfassbare zu fassen zu bekommen und irgendwie zu verstehen: ‚Ich liege zusammengeschlagen und gefesselt in meiner Praxis. Das ist kein böser Traum, sondern brutale Realität? Wer hat mich zusammengeschlagen und gefesselt? Und warum überhaupt? Wie viel Uhr ist es eigentlich? Wie lange war ich bewusstlos?‘
Hofmann versuchte seine Erinnerungen vor dem Blackout lebendig werden zu lassen, also zu assoziieren, das, was seine Patienten und er tagtäglich machten. Er erinnerte schemenhaft ein Bild, dass er die Tür zu seiner Praxis öffnete und statt seiner Patientin Frau R. ein Mann vor ihm stand, den er nicht erwartet hatte. Der Unbekannte schubste ihn grob zurück in den Flur und dann in das offene Behandlungszimmer. Er war von großer kompakter Statur, dunkel gekleidet und trug einen schwarzen Strumpf mit zwei Löchern für die Augen über dem Kopf. In diesem Moment war wohl alles klar. Der Eindringling forderte von ihm etwas, bevor bei ihm die Lichter ausgingen. Was danach genau geschah, konnte Hofmann nicht erinnern. Er musste eine heftige Gehirnerschütterung gehabt haben. So etwas dauerte normalerweise nur wenige Minuten, dann kommt das Bewusstsein mit einer Erinnerungslücke wieder. Sein Filmriss musste aber deutlich länger als bei einer Gehirnerschütterung gewesen sein. Vielleicht habe er sogar eine Contusio cerebri, bei der das Gehirn durch äußere Gewalt und den Aufprall auf einer Seite gequetscht und auf der andern gedehnt wurde, dachte Hofmann. Blutungen könnten die Folge sein. Ihm wurde richtig übel bei diesen Gedanken. Wie lange war er überhaupt bewusstlos?
So verharrte er und versuchte seine Gedanken zu sortieren und seine Emotion zu kontrollieren. Bei ihm gab es nichts zu holen. Kein Geld, keine Wertgegenstände, keine Medikamente wie Opioide. Hofmann hatte eine Praxis für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychoanalyse. Da gibt’s nur Phantasien, Träume, Alpträume, o.k., viel Leid, aber auch Freude, zumindest aber viel Freud. Hofmann verfluchte seine Situation. Er war absolut hilflos und konnte nicht um Hilfe rufen, seine Nachbarin und Vermieterin im Parterre war eine charmante alte Dame, die aus Eitelkeit kein Hörgerät trug. Die Mieterin im Dachgeschoß war in Urlaub oder auf Dienstreise. Niemand würde ihn hören, niemand ihn heute vermissen und nachsehen. Seine Frau war beruflich im Ausland, die erwachsenen Kinder ebenso. Verabredungen hatte er keine – wegen der Scheiß-Pandemie. Oszillierend zwischen aufbäumender Dramatik, Wut und tiefer Resignation gab er sich der Situation hin, etwas anderes blieb ihm auch nicht übrig. Hofmann spürte die Wärme des Fußbodens, sein Zittern und seine Anspannung ließen nach; er schlief vor Erschöpfung ein.
3.
Befreiung
„Herr Doktor! Machen Sie die Augen auf!“ Hofmann schaute in das verschwommene Gesicht einer Frau, die ihn laut ansprach und schüttelte. Er stöhnte vor Schmerzen. Dann riss sie ihm das Klebeband, das fast zirkulär um den ganzen Kopf reichte, ab. Das tat ihm zwar sehr weh, aber endlich bekam er durch den Mund Luft. Hofmann versuchte zu sprechen, brachte nur einen Hustenanfall zustande, auch konnte er jetzt besser hören. Es war wie eine Wiedergeburt und Befreiung!
Eine tiefe Dankbarkeit erfüllte ihn, als Maria da Silva Santos, wenn auch hektisch und schrill klagend ihm die Fesseln mit einer Schere durchzuschneiden versuchte. Es musste nach 19 Uhr sein; Frau Santos putzte freitagsabends oder samstags die Praxis.
Sie überschüttete ihn mit Fragen. Er murmelte immer wieder: „Vielen Dank! Vielen Dank ... Sie sind ein Engel!“ Seine Stimme klang rau und kehlig. Mühsam und benommen setzte er sich auf und lehnte sich an das Bücherregal. Als nächstes versuchte er, seine abgestorbenen Hände und Beine wieder zu bewegen. Seine Handgelenke wiesen tiefe Einschnitte durch die Kabelbinder, die neben ihm lagen, auf; seine Hände waren blau-rot verfärbt und geschwollen, seine rechte Hand schmerzte bei der kleinsten Bewegung. Vor ihm lagen noch zwei schwarze Stromkabel.
Frau Santos reichte ihm ein Glas Wasser, eine Wohltat, auch wenn das Trinken mühsam und schmerzhaft war. Sie schaute ihn beim Trinken ruhig an und schlug dann ihre Hände vor ihrem Gesicht zusammen: „Ihre Patienten sind gefährlich!“ Sie schaute sich in der Praxis um. „Das ist wie eine Bombenexplosion!“ Überall lagen Papiere, Ordner und Gegenstände herum.
Hofmann fragte sich, wo seine Brille sei. Er bemühte sich aufzustehen und murmelte, er müsse die Polizei rufen, doch dazu kam es nicht, er kollabierte und verlor wieder das Bewusstsein.
Als er zu sich kam, fand er sich auf dem Rücken mit hochgelegten Beinen wieder. „Schocklage. Bei Führerschein gelernt“, sagte Frau Santos. „Die Polizei ist schon da.“ Eine junge Frau, die sich als Kriminalkommissarin Henninger von der Kripo Frankfurt vorstellte, fragte, ob er Dr. Hofmann sei, ob er wisse, wo er sei und was passiert sei. Hofmann fühlte sich wie überfahren: So viele Fragen auf einmal zu stellen, war nicht professionell; meist würde nur die letzte Frage beantwortet und die war für ihn die schwierigste, dachte er. „Mein Name ist Hofmann, ja“ versuchte er klar zu artikulieren. „Sie können keine näheren Angaben machen?“ Eine blöde Suggestivfrage dachte Hofmann, schüttelte den Kopf und wollte sich gerade aufzusetzen.
Ein Mann in roter Jacke sprach ihn sehr bestimmend an, er solle besser liegen bleiben und leuchtete ihm mit einer Taschenlampe mehrfach in beide Augen, packte dann einen Arm und legte ihm eine Blutdruckmanschette an; ein zweiter Rettungsassistent machte sich am anderen Arm zu schaffen und stach ihm in den Handrücken. „Ihr Blutdruck ist im Keller. Wir werden Ihnen eine Infusion mit einem Schmerzmittel anhängen.“ Nach wenigen Minuten fiel er in eine wohlige Müdigkeit, einen Dämmerzustand, aus dem er nur durch eine grobe Ansprache erweckbar war.
Inzwischen war das Team der Spurensicherung eingetroffen und schwärmte in weißen Ganzkörperanzügen durch die Praxisräume – ein surreales Szenario, das Hofmann schemenhaft mitbekam. Er fragte sich beim Anblick der Szene, warum die Einen wie in einem Ganzkörperpräservativ steckten und die Anderen nicht? Zum Beispiel die Kommissarin, die zu den Rettungsassistenten, die im Gegensatz zu ihr einen Mundschutz und Handschuhe trugen, sagte, dass sie Hofmann in eine Klinik bringen sollten, weil er im Moment keine verwertbaren Aussagen machen könne. Sie schlug zudem vor, einen Notarzt zur Begleitung hinzuziehen. Die Rettungsleute verneinten, das bekämen sie schon alleine hin und würden umgehend das Nordwest-Krankenhaus anfahren; das Markuskrankenhaus und das Bürgerhospital seien heute Abend gesperrt; Atmung und Kreislauf seien stabil, Wirbelsäule schien unverletzt zu sein, innere Verletzungen oder eine Hirnblutung müssten dort ausgeschlossen werden, rapportierte der Rettungsassistent.
Zwei weitere Polizisten durchsuchten die Praxis und stellten fest, dass es keinen Computer, aber lose Anschlusskabel gab. Die Spurensicherung machte Fotos, nahm Fingerabdrücke, suchte nach Textilfasern und Haaren an der Stelle, an der Hofmann gefesselt wurde. Sie stellte die Kabelbinder und Elektrokabel, die als Fesseln benutzt wurden, sicher. Die Praxis müsse anschließend versiegelt werden. Von Frau Santos ließ sich die Kommissarin die Schlüssel und ihre Telefonnummer aushändigen und fragte nach Familienangehörigen von Dr. Hofmann. Sie bestätigte, dass sie schon viele, viele Jahre für Dr. Hofmann arbeite, kenne auch seine Privatadresse, wisse nur, dass er verheiratet sei und zurzeit alleine lebe. Er habe sie neulich gebeten, einige Lebensmittel für ihn einzukaufen.
Die Kommissarin fragte nach dem Handy des Opfers. Frau Santos sollte es anrufen, vielleicht befindet es sich hier in der Praxis. „Er stellt es in der Therapie immer aus, ruft aber zurück.“ Es war kein Klingel- oder Summton zu hören.
4.
In der Notaufnahme
Während der Fahrt im Rettungswagen wachte Hofmann auf, er hatte eine Sauerstoff-Nasenbrille auf. Der Sanitäter nahm sie einige Male ab, um seine Nasenlöcher abzusaugen, das rechte Nasenloch war blutverkrustet. Hofmann fühlte einen Verband auf dem rechten Auge. Auch der Sanitäter wollte wissen, was passiert sei. Hofmann verstand die Frage wegen des Krachs durch das Martinshorn nicht, da brauchte er auch nicht zu antworten. Vor jeder Kreuzung schaltete das moderate Martinshorn auf Pressluft um. Das Schaukeln und Rumpeln im Rettungswagen war sehr schmerzhaft. Sie sagten ihm, dass sie das Nord-West-Krankenhaus anfahren würden.
Die Aufnahmeprozedur in der Ambulanz des Krankenhauses kam ihm mechanisch, aber vertraut vor. Hell erleuchtete Räume, gekachelte Wände, mehrere Gesichter beugten sich wechselweise über ihn, stellten Fragen, andere antworteten. Das Licht, die Gerüche, die Menschen in hellblauer OP-Kleidung, die die Ruhe weghatten, das Klappern von Instrumenten und das Geräusch, wenn Verpackungen aufgerissen wurden. Alle trugen hellblaue OP-Masken, was die Augen sehr betonte. Hofmann lag inzwischen auf einem Untersuchungstisch unter einer OP-Lampe. Das Umlagern hatten die Rettungsassistenten sehr schonend gemacht. Er fror und versuchte sich im Raum umzusehen. Er erinnerte sich an seine eigenen Erfahrungen als Student und Assistenzarzt in der chirurgischen Ambulanz. Er fragte sich, ob er selbst als Student in diesem Krankenhaus gearbeitet hatte, aber alles sah anders aus.
Eine Schwester fasste ihn fest am Unterarm. „Ihr Name ist Hoffmann?“ Mit einem f, sagte Hofmann mit kratziger Stimme: „Franz Xaver Hofmann“ und stammelte weitere Daten zu seiner Person. Ob er sich ausweisen könne, fragte sie weiter. Nein, er wisse nicht, wo seine Brieftasche sei. Die OP-Lampe, die ihn blendete, wurde jetzt weggeschoben und ein neues Gesicht tauchte auf.
„Sie sind ein ärztlicher Kollege, wie mir die Polizei sagte? Mein Name ist Max, Dr. Max. Ich bin hier der Ambulanzarzt.“ Dr. Max schaute seinem Patienten lange ins Gesicht, dann glitt sein Blick auf Hofmanns Körper entlang nach unten und wieder nach oben. Die Schwester begann, seine Schuhe und Hose auszuziehen, sein Hemd wurde kurzerhand aufgeschnitten, die Knöpfe dauerten wohl zu lang. Nackt, nur mit der Unterhose bekleidet, lag Hofmann auf dem Tisch und zitterte. Sie deckte ihn mit einem blauen Leinentuch zu.
Ein älterer Arzt kam vorbei und fragt Dr. Max: „Was haben wir da?“ und schaute Hofmann ins Gesicht. Max rapportierte: „Ein ärztlicher Kollege, 59 Jahre, sei heute überfallen und geknebelt worden; vermutlich Frakturen, sichtlich im Gesichtsschädel; innere Verletzungen müssen ausgeschlossen werden. Er ist bei vollem Bewusstsein, sein Kreislauf ist stabil.“
Im Weggehen sagt der ältere Arzt: „Lassen Sie auch einen Mediziner draufschauen, Sono wegen der Milz, EKG und so weiter. Neurologen sowieso. Die Röntgenbilder will ich sehen.“
Hofmann erinnerte sich aus seiner Ambulanzzeit, dass die Chirurgen mit Medizinern die Internisten meinten. Dr. Max frage Hofmann, ob er wisse, wo er sei. „Ja, in einem Krankenhaus, im Nord-West-Krankenhaus?“ Ob er das Datum nennen könne. Hofmann überlegte und Max sagt: „Na. Ungefähr.“ Hofmann: „Ja, Freitag, der 14. August 2020, gegen Abend.“
„Sehr gut“, sagte Max gedehnt übertrieben wie bei einem Hund, der das Stöckchen apportiert hat. „Dann müssen Sie mir erzählen, was passiert ist.“
Hofmann konnte diese Frage nicht mehr hören; sagte nach einer kurzen Denkpause: „Wenn ich das wüsste, ich muss wohl überfallen worden sein.“
„Wo?“ fragte Max.
Hofmann sprach von dem Überfall, an den er keine Erinnerung habe, heute am späten Nachmittag und, dass er als Psychoanalytiker alleine in seiner Praxis arbeite, während Max seinen Körper systematisch abtastete und hier und da Schmerzreaktionen auslöste: „Ein Psycho-Doc also? ... Analytiker mit Couch und so? ... Wie beim alten Freud?“ Hofmann hatte große Mühe, im Liegen zu sprechen, und sagte mit Mühe: „Ja, so ungefähr.“
Max fragte, ob er Schmerzen habe. „Nur wenn Sie darauf herumdrücken oder ich lache“, meinte Hofmann etwas gequält, aber bei nüchterner Betrachtung stimmte das. Während Max ihn weiter körperlich untersuchte, den Bauch abtastete und abhörte, merkte er an: „Gut. Die Milz hat’s offenbar nicht erwischt. Das wird das Sono zeigen.“ Ihn aufsetzen lassen, um die Wirbelsäule abzuklopfen und die Lunge abzuhören, wollte er den anderen Medizinern und Neurologen überlassen.
Er fragte Hofmann etwas spitz: „War das ein Patient, der mit Ihrer Therapie nicht ganz einverstanden war?“ Eine Antwort wollte Dr. Max nicht hören, sie war wohl eher rhetorisch gemeint, weil er sich der Schwester zuwandte. Scheint wohl ein Witzbold zu sein, dieser Nichtmediziner, dachte Hofmann.
„O.k. Schwester Maren, ich brauch’ ein Set für die Wundversorgung.“ Und zu Hofmann gewandt: „Wir nähen jetzt die Platzwunde am Kopf, untersuchen das Auge und machen dann ein paar Röntgenaufnahmen. Danach sehen wir uns wieder. Ok.? Danach lassen wir den Neurologen und den Internisten draufschauen. Einen Psychiater brauchen Sie ja nicht, oder.“ Dabei grinste er hinter seiner Maske und gab ihm einen Klaps auf den Oberarm. Der Kollege scheint wirklich ein von Empathie befreiter Spaßvogel zu sein, dachte sich Hofmann.
Die Kopfplatzwunde war vom Blut völlig verkrustet, die Haare wurden großzügig mit einem schabenden Geräusch rasiert, lokale Betäubung, Wundreinigung und die Naht wurde schnell gesetzt. Die Reinigung des rechten Auges, das völlig zugeschwollen war, gelang nur zum Teil. Es wurde mit einer Kompresse abgedeckt, Dr. Max traute sich da wohl nicht heran.
„Haben Sie einen Tetanusschutz?“ fragte die Schwester. Hofmann sagte: „Ja“, wusste es aber nicht wirklich.
Später wurde er umgelagert und von einem Mann auf einer Trage durch lange Gänge gefahren. „Ich bring Sie zum Röntgen.“ Angenehm fand Hofmann, dass ihm die Menschen, die an ihm herumhantierten, sagten, was sie gerade machten oder vorhatten. Der Transporter musste mit der Trage zickzack durch den Flur manövrieren, weil alles voll stand, und rumste mehrfach an, was weh tat. „Sie haben einen rustikalen Fahrstil“, sagte Hofmann nuschelnd. Der Transporter grinste und sagte stolz, er sei in Kairo Taxifahrer gewesen. Na prima, dachte sich Hofmann. Vor einer Glastür mit Aufschrift Radiologie angekommen, musste er alleine warten und wäre am liebsten geflüchtet, wenn er gekonnt hätte; die Patientenrolle war für ihn so demütigend.
Das Röntgen war eine längere Prozedur, Hofmann hatte den Eindruck, sein ganzes Skelett außer den Beinen wurde geröntgt und zwar jeweils in zwei Ebenen. Spätestens danach musste er zeugungsunfähig sein, so viele Röntgenstrahlen hatte er abbekommen. Seine Familienphase war aber ohnedies abgeschlossen. Die Röntgenassistentin wurde plötzlich sehr hektisch und veranlasste den schnellen Rücktransport.
Schwester Maren war zur Stelle. Hofmann nahm sie jetzt erst etwas genauer wahr; eine stämmige junge Frau mit allerlei Tätowierungen, ein Drache schaut aus ihrem Kragen heraus, die Haare waren asymmetrisch geschnitten und unterschiedlich gefärbt, am Ohr sah er eine Batterie von kleinen Ringen. Sie fragte ihn auf der Rückfahrt, die gefühlvoll und unfallfrei ablief, warum er sie „mit nur einem Auge so schräg“ angeschaut habe. Hofmann fühlte sich ertappt. Ihr selbst gefalle ihr Äußeres, außerhalb der Klinik sei sie noch krasser unterwegs, sie sei eben ein Punk. „Sie sind ein richtiges Kunstwerk“, sagte Hofmann und nach einer Pause: “Ich dachte aber, Punk ist out.“ Maren reagierte gespielt beleidigt. Dann wollte sie wissen, ob er von einem Patienten so zugerichtet worden sei. „Nein, das war kein Patient. Aber es muss etwas mit einem Patienten zu tun haben.“ Maren meinte, dass Ärzte und Pflege- und Rettungspersonal öfters mal von Patienten attackiert würden, besonders von Besoffenen und Psychopathen. „Der Dr. Max hat neulich von einem Patienten eins voll auf die Acht bekommen, hatte ein ziemlich dickes blaues Auge. Der weiß, wie das ist.“ Ach so, dachte sich Hofmann, daher Max‘ witzig gemeinte Frage nach einem unzufriedenen Patienten.
Von Dr. Max wurde ihm eröffnet, dass er eine Serienfraktur der Rippen links habe, die etwas disloziert seien und ggf. die Lunge verletzen könnten; ferner hatte er einen Bruch des Jochbeins rechts. Sorgen machte eine Frakturline im Orbitaboden rechts mit einem Hämatom in der Augenhöhle. Ob er auf dem Auge sehen könne? Nein, ganz schlecht. Er bekam das geschwollene Lid gar nicht auf.
Nach dem neurologischen Konsil, das sehr gründlich und anstrengend war, kam eine junge Internistin, die ein EKG ableitete, behutsam den Bauch und die Lunge abhörte und einen Ultraschall des Bauches durchführte. Sie fragt, ob er Husten, Fieber, Halsweh, Grippesymptome, Störung des Geruchs- und Geschmacksinns oder gar Kontakt zu einem an Covid-19 Erkrankten gehabt habe. Dann nahm sie einen Nasen-Rachenabstrich wegen Corona ab und sagte lächelnd: „Wenn der Patient dem Arzt den PCR-Abstrich übelnimmt, dann hat er den richtig durchgeführt.“ Sie zwinkert ihm zu, wünscht gute Besserung und verschwand. Sie erinnerte Hofmann an seine Tochter Marie, die zurzeit in Montreal am McGill-Hospital das Praktische Jahr absolvierte; sie war am Ende ihres Medizinstudiums.
Dr. Max kam nach den Konsiluntersuchungen vorbei und sagte Hofmann, dass er stationär aufgenommen werde müsse; ob er damit einverstanden sei. Hatte er eine Wahl? Wenig später kam Schwester Maren mit einem Stapel Unterlagen, klemmte sie unter die Auflage, befestigte ein Armband an seinem Handgelenk mit den Worten: „All inclusive“, was Hofmann nicht verstand. Sie verabschiedete sich und wünschte gute Besserung. Später las er auf dem Bändchen seinen Namen und seine „Fallnummer“ mit einem Barecode versehen. Er fühlte sich auch wie ein Fall, erst zu Fall gebracht, dann zum Fall gemacht.
Hofmann musste auf den gut gelaunten ägyptischen Taxifahrer warten, der ihn auf die Station bringen sollte. Er fragte sich, ob das die ganze Anamneseerhebung gewesen sei. Wollten die Kollegen nichts wissen über Vorerkrankungen, welche Medikamente er nehme, ob er Allergien habe oder die Adressen und Telefonnummern von Angehörigen etc. Niemand fragte genau, wie er versichert sei. Sehr atypisch. Auch gut! Über die Notfallversorgung konnte er sich fachlich jedenfalls nicht beklagen.
Alle um ihn herum trugen hellblaue OP-Masken. Im Alltag waren im August Mund-Nase-Masken nur in den Geschäften verpflichtend zu tragen, auf der Straße im öffentlichen Leben nicht. In seiner Praxis trugen weder er noch seine Patienten eine Maske; es wurde ein Abstand von ca. zwei Metern eingehalten, sich die Hände geben war den Hygieneregeln geopfert worden. Die Hände und Kontaktflächen wurden häufig desinfiziert.
5.
Auf Station
Hofmann wurde von einer jungen Schwester in Empfang genommen, die sich mit Silke Hoffmann vorstellte. Der Transfer von der Trage ins Bett gelang nur mit Schmerzen im Brustbereich. Nach einem Blick auf die Unterlagen ergänzte die Schwester: „Ich bin Hoffmann mit zwei f, Sie mit einem.“ Sie sei seine zuständige Schwester auf der Station für Traumatologie. Wegen der unterschiedlichen f musste Hofmann an Heinz Rühmann als Pfeiffer in der Feuerzangenbowle mit 3 f denken, eines vor und zwei nach dem ei. Auch dachte er, dass sich die Zeiten wohl geändert haben, als Schwestern und Pfleger nur mit dem Vornamen angesprochen wurden. Er sah auf ihrem Namensschild: „Silke Hoffmann, B.Sc. Pflege“. „Sie haben Pflege studiert?“ Ja, sagte sie stolz und maß die Temperatur, den Blutdruck, Puls und Sauerstoffsättigung, „alles bestens“¸ sie fragte nach Schmerzen und kündigt eine Injektion Clexane in die Bauchdecke zur Thromboseprophylaxe an. Es war inzwischen 22 Uhr. Die Braunüle, die der Rettungsassistent am linken Unterarm gelegt hatte, funktionierte noch, hier wurde eine Infusion mit einem Opioid gegen die Schmerzen und ein Antibiotikum angehängt. Hinzu kam eine ältere Schwester, die sich als Nachtschwester Cynthia vorstellte. Die beiden machten eine kurze Übergabe. Ob er Hunger habe? Nein, nur Durst, sagte er. Cynthia brachte ihm einen Tee und Mineralwasser, weil sein Mund sehr trocken war und er schlecht sprechen konnte.
Hofmann wachte aus einem Alptraum auf, in dem er den gewaltsamen Überfall wohl zu verarbeiten suchte. Er sah schemenhaft im Halbdunkel andere Menschen im Zimmer. Ein weiterer Patient wurde in das Zimmer gefahren, mit Infusionen, Perfusor und einem Monitor, ständig kamen und gingen Pflegekräfte, es ging zu wie in einem Taubenschlag.
Es war ungefähr drei Uhr; die Nacht war gelaufen. Hofmann machte sich viele Gedanken, wer sich um seine verwüstete Praxis kümmern und die Patienten informieren könnte. Dass die Praxis für einige Zeit geschlossen werden müsse, war ihm mehr als klar. Seine Frau war in der Antarktis unterwegs, seine beiden erwachsenen Kinder nicht in Frankfurt. Wo war sein Mobiltelefon abgeblieben, wo sein Portemonnaie mit der Kredit- und EC-Karte. Müsste er die Karten sperren lassen? Das TAN-Verfahren lief über das Handy. Er hatte weder ein Telefon, noch eine Internetverbindung und schon gar nicht seine wichtigen Telefonnummern und eMail-Adressen. Er wusste nicht, was die Kripo gefunden hatte. Er würde morgen versuchen, Frau Santos zu erreichen; sie hatte ja auch einen Schlüssel für seine Wohnung in Ginnheim. Ohne sein Mobiltelefon fühlte er sich wie amputiert. Das war wie ein Schlag ins Kontor, „eine einzige Scheiße“, sagte er laut. Nichts ging mehr! Er musste sich damit abfinden, dass er jetzt und in nächster Zeit völlig abhängig von anderen und ohnmächtig war.
Er beschloss, seinen Freund und Kollegen Anatol zu kontaktieren, der eigentlich Alfons heißt. Alfons wurde vor Jahren von Hofmanns kleinem Sohn Anatol genannt, weil er ihm ein Kinderbuch geschenkt hatte, in dem die Maus Anatol die Käsefabrik eines Herrn Dupré – oder so ähnlich - vor dem Ruin rettete, da sie alle Käsesorten probierte und auf kleinen Zetteln Verbesserungsvorschläge hinterließ. Seitdem hieß Alfons eben Anatol. Anatol bedeutet Sonnenaufgang, weil die alten Griechen die Sonne im heutigen Anatolien aufgehen sahen.
Am besten wäre es, wenn Anatol seine Patienten telefonisch oder per eMail informieren könnte, doch dazu bräuchte Hofmann seinen Computer und weitere Unterlagen. Ohne sein Handy fühlte er sich aufgeschmissen. Darum würde er sich morgen früh gleich kümmern. Ihm fiel dabei ein, dass in der gesamten Klinik wegen der Corona-Pandemie Besuchsverbot herrschte. Auch das noch! Hofmann kann nicht raus, Freunde und Angehörige können nicht rein.
Mit Frau Sandberg wollte er sich in Verbindung setzen und sie bitten, an der Haustür provisorisch einen Zettel aufzuhängen, dass die Praxis bis auf Weiteres geschlossen sei.
Durch das Fenster sah Hofmann den Morgen rötlich über dem Osten Frankfurts dämmern. Fechenheim und Offenbach waren ja auch in anatolischer Hand.
6.
Der Tag danach
„Guten Morgen, Dr. Hofmann!“ Schwester Hoffmann mit 2 f, lächelte ihn an. „Haben Sie gut geschlafen?“ Hofmann knurrte nur und blinzelte mit dem einen Auge, das andere war weiter zugeklebt. „Danke, es ging. Den Umständen entsprechend. Die Nacht war kurz.“ „Meine auch“, sagte sie. Hoffmann maß Temperatur, die Sauerstoffsättigung am Finger, den Blutdruck sowie den Puls, leerte die Urinflasche und stöpselte die Infusion ab. Sie bot an, ihm bei der Morgentoilette zu helfen, weil er etwas wackelig auf den Beinen sein dürfte. Dabei schaute sie ihn freundlich an, berührte ihn am Oberarm. Hofmann spürte ein warmes Gefühl von Dankbarkeit und Zuneigung, so als strahle die junge Schwester etwas Mütterliches aus. Hofmann wusste, dass er als verletzter Patient psychisch regrediert und körperlich abhängig war z.B. bei einfachen Verrichtungen; hoffentlich würde er sich noch selbst den Hintern abwischen können, dachte er. Diese Hilfe anzunehmen, fiel ihm schwer. Das Wort Patient kommt vom Lateinischen patior, was ich erdulde, ich leide bedeutet; Geduld mit sich selbst war nicht immer seine Sache, bei seinen Patienten aber schon. Ärzte waren schlechte Patienten.
Sie hängte die Infusion ab und begleitete ihn ins Bad, sagt „Nasszelle“ dazu. Während Hofmann pinkelte und eine Katzenwäsche versuchte, machte Hoffmann das Bett frisch und brachte ein überschaubares Frühstück; der Kaffeeduft verscheuchte die Gerüche nach Krankenhaus. Zwei Kolleginnen von Silke versorgten den neuen Mitpatienten, dem es offenbar nicht gut ging; er war nicht bei Bewusstsein. Die Atmosphäre im Zimmer war gedämpft.
Nach dem Frühstück kam Silke Hoffmann mit einem Anamnesebogen, sie möchte ein Pflegeassessment für den Pflegebedarf durchführen, sagte sie. Kaum hatte sie begonnen, kam eine Frau im weißen Kittel und Mundschutz herein, sie sei vom Aufnahmebüro und verdrängte Hoffmann von Hofmann. Sie erhob allerlei Sozialdaten und ließ ihn als Privatpatienten etliche Formulare unterschreiben. Einen Personalausweis hatte er nicht. Mitten in diese Aufnahmeformalitäten platzte dann noch eine Visite, der ältere Arzt von gestern begleitet von Silke Hoffmann und einer weiteren Schwester. Die Dame vom Aufnahmebüro sagte, sie käme später wieder vorbei. Die Visite schaute zuerst den Neuzugang von heute Nacht an, sie sprachen gedämpft und wirkten besorgt.
Dann zu Hofmann: „Ich bin hier der Oberarzt, Schmitt ist mein Name. Sie sind Kollege, Dr. Hofmann? Gut, dann kann ich mich kurzfassen.“ Auf dem Namensschild stand PD. Dr. med. J. Schmitt, Leitender Arzt Traumatologie. Hofmann habe neben den vielen Prellungen und der Platzwunde am Kopf drei Probleme:
1. Eine Rippenserienfraktur links, wobei die 10. und 11. Rippe etwas disloziert seien und unter Belastung das Rippenfell perforieren könnten. „Pneumothorax, Sie verstehen. Wenn Sie Luftnot bekommen, bitte sofort melden!“ Die Therapie sei konservativ: Starke Analgetika, die bekomme er ja schon, ferner Atemtherapie, damit er keine Pneumonie entwickele. Sauerstoff brauche er keinen, sondern gute Atemexkursionen, auch wenn‘s weh täte, nicht flach atmen. „2. Eine Jochbeinfraktur rechts, 3. eine Orbitabodenfraktur rechts mit Hämatom. Ihr Visus dürfte nicht stimmen.“ Er riss den Augenverband ab, spreizt die geschwollenen Lider auseinander, verdeckte das linke gesunde Auge und fragte: „Sehen Sie mich?“ Dann ohne Abdeckung links: „Sehen Sie mich doppelt?“ Hofmann war über seine Doppelbilder erschrocken.
Dr. Schmitt: „Gut, wir machen am Montag ein CT, da dürfte das Hämatom kleiner sein und stellen Sie in der Kopfklinik vor. Der Orbitaboden muss korrigiert werden. Wahrscheinlich ist er auch in die rechte Nasennebenhöhle eingebrochen. Noch Fragen? Ich komme morgen Vormittag wieder vorbei.“
Der Oberarzt nickte, drehte sich um und war weg. Hofmann blieb etwas sprachlos zurück, er hatte das Gefühl, von einem LKW gestreift worden zu sein. Wenn Schmitt salutiert hätte, müsste Hofmann die Hacken zusammenschlagen, obwohl er nicht beim Militär war, er hatte Zivildienst in der Krankenpflege absolviert. Die Augen von Silke Hoffmann rollten über ihre Maske, sie lächelte ihm konspirativ zu und verschwand mit der Visite.
Das alles musste Hofmann erst einmal auf sich wirken lassen. Ein Chirurg ist kein Psychotherapeut und wie er gestern wieder gehört hatte, versteht er sich noch nicht einmal als Mediziner, sondern offenbar als ein chirurgischer Handwerker, aber hoffentlich ein guter.
Im Laufe des Morgens brachte ihm ein Krankenpfleger eine Karte, um das Telefon am Patientenbett zu aktivieren. Die Karte sei mit 20 € geladen und aus der Stationskasse vorgelegt, er möchte bei Gelegenheit die 20 € begleichen. Hofman bedankte sich für diesen unbürokratischen Service und fragte sich, wo sein Portemonnaie abgeblieben sei.
Zunächst rief er sein privates Mobiltelefon an, das er zuletzt in der Praxis hatte. Vielleicht klingelte es irgendwo; eine unsinnige Aktion, denn wie könnte jemand das Gespräch annehmen ohne Fingerprint. Egal, jetzt konnte er Anatol erreichen, aber er hatte seine lange Handynummer nicht im Kopf. Er verfluchte seine Abhängigkeit von den digitalen Medien. Er erinnerte sich an die private Festnetznummer einer Kollegin, um Anatols Nummer in Erfahrung zu bringen. Samstagsmorgens sind die meisten Leute einkaufen. Er versuchte es bei seiner Kollegin Hanna aus der Intervisionsgruppe, deren Privatnummer hatte er im Kopf, warum auch immer. Es gelang ihm, die etwas verschlafene und ungehalten wirkende Tochter dazu zu bewegen, ihrer Mutter auszurichten, dass sie ihn unter dieser Nummer, die er ihr diktierte, zurückrufen möge; es sei sehr, sehr wichtig.
Es war alles nervig und kompliziert! Hofmann fluchte über die Situation und über sich selbst. Als nächstes rief er Frau Sandberg an, ihre Nummer hatte er im Kopf gespeichert: er wollte sie bitten, Anatol einen Schlüssel der Praxis auszuhändigen; sie ging aber nicht ans Telefon. Dann sprach er mit Frau Santos und erfuhr, dass sie ihren Schlüssel der Kommissarin überlassen hatte; die Praxis sei versiegelt worden. Hofmanns Schlüssel und Handy seien nicht gefunden, vom Portemonnaie sei nicht gesprochen worden. Das Portemonnaie! Hofmann musste unbedingt die Kredit- und EC-Karte sperren lassen. Aber wie konnte er das vom Krankenbett aus veranlassen? Er verfluchte den Schlüsselsalat und seine Hilflosigkeit und seine Abhängigkeit. Die Quittung kam postwendend: ein schmerzhafter Hustenanfall.
Nach über einer Stunde rief seine Kollegin Hanna zurück. Hofmann schilderte kurz seine missliche Lage und ließ sich Alfons Mobiltelefonnummer geben. Hanna bat ihn, sich unbedingt bei ihr zu melden, wenn sie etwas für ihn tun könne.
7.
Anatol
Als Hofmann seinen Kollegen Alfons, alias Anatol erreichte, war er sehr erleichtert. Er berichtete, was ihm widerfahren war, und äußerte seine Bitten. Wegen der Corona-Umstände könnte Anatol ihn nicht im Krankenhaus besuchen.
Am Samstagnachmittag stand Anatol vor der Haustür in der Gruberstraße. Frau Sandberg reagierte nicht auf sein Klingeln. Er schlich ums Haus, um vielleicht über ein Fenster in die Wohnung von Frau Sandberg sehen zu können. Hofmann hatte ihm seine Sorge mitgeteilt, dass ihr, die über 80 war, etwas passiert sein könnte, da sie nicht ans Telefon ginge. Anatol kletterte auf einen Sims an der Fassade und rief durch das gekippte Fenster nach ihr. Dann versuchte er das Fenster zu öffnen, was aber unmöglich war. Während er sich abmühte, wurde er am Bein festgehalten.
„Was machen Sie da? Hier ist die Polizei. Runter! Aber langsam.“ Anatol sprang vom Sims und wurde von zwei Polizisten in Uniform festgehalten, er musste sich mit erhobenen Händen mit dem Gesicht an die Hausmauer stellen und wurde abgetastet. Zweimal trat der Polizist gegen seine Innenknöchel, weil er offenbar seine Beine nicht breit genug machte. „Hey, was soll das“, beschwerte sich Anatol.
„Dann mach‘ halt die Beine auseinander“, konterte der ältere Polizist und legte ihm Handschellen an.
„Das kann ich Ihnen alles erklären“, sagte Anatol möglichst gelassen.
„Ja, das sagen alle Einbrecher. Papiere?“ fragte der ältere Beamte.
Der junge Polizist ging mit Anatols Ausweis zum Streifenwagen zur Personenabfrage, was etwas dauerte. Anatol fragte den Polizisten, der ihn in Schach hielt, ob er den Kollegen anrufen dürfe, der hier seine Praxis habe und für den er diese sportliche Einlage an den Tag gelegt hätte; normalerweise nutze er schon die Türen.
Anatol reichte sein Handy dem Polizisten und Hofmann schilderte ihm den Überfall von gestern und, dass sein Kollege Homburger die Vermieterin sprechen und um einen Schlüssel zur Praxis bitten sollte. Seine Sorge sei, dass der alten Frau etwas zugestoßen sei, weil sie telefonisch nicht erreichbar sei. Nebenbei erwähnte er, dass eine Kommissarin Henniger den Schlüssel zur Haustür und Praxis mitgenommen habe.
Eine Rücksprache des Beamten im Präsidium ergab, dass die Praxis nach dem Überfall am Freitagnachmittag versiegelt wurde und niemand sie betreten dürfe. Am Montag gäbe es einen Lokaltermin. Da sei nichts zu machen. Der versuchte Einbruch in eine fremde Wohnung sei trotzdem eine Straftat, fügte der Streifenpolizist an. Anatol wurde zunehmend sauer und schaute auf das Namensschild.
„Und was ist mit der alten Dame, Frau Sandberg, Herr Wondracek?“
„Polizeiobermeister Wondracek.“
„Einverstanden, Herr Dreisternegeneral, dann dürfen Sie mich auch Dr. Homburger nennen.“ Anatol war noch mehr angesäuert; statt sich um das Schicksal der Vermieterin zu kümmern, ließ der Polizist seinen bescheidenen Dienstgrad raushängen.
„Gut, Herr Homburger, dann verlassen Sie sofort das Grundstück; Sie werden noch von uns hören.“
Homburger zu Wondracek: „Schauen Sie bitte nach der Frau Sandberg, ihr ist bestimmt etwas zugestoßen. Andersfalls werden Sie ebenfalls von mir hören“, und verließ verärgert das Grundstück.
Im Auto berichtete Anatol seinem Freund von seiner herben Begegnung mit der Polizei. Hofmann musste lachen: „Ein Psychoanalytiker wird von der Polizei beim Einbruch in die Praxis eines Kollegen erwischt!“ Dieses Lachen musste er büßen. Er meinte, dass die Nachbarschaft sehr aufmerksam und neugierig sei, besonders welche Leute in seiner Praxis ein- und ausgingen. Dass Frau Sandberg nicht anzutreffen war, beunruhigte ihn sehr. Er werde es den ganzen Samstag weiterhin versuchen, sie telefonisch zu erreichen. Anatol möge bitte einen Aushang an der Haustür anbringen, dass die Praxis vorrübergehend geschlossen sei. Mehr sei jetzt nicht zu machen.
8.
Der Arzt als Patient
Nach dem turbulenten Tagesbeginn wurde es im Zimmer etwas ruhiger, eine Physiotherapeutin kam vorbei, die mit ihm Atemübungen durchführte; sie bat ihn, mit einem Atemtrainer, einem Gerät, in dem drei blaue Kugel hoch zu pusten waren, zu üben. Sie fragte ihn nicht, wie es zu den Verletzungen gekommen sei. Hofmann hatte auch keine Lust, anderen Menschen zu erzählen, was ihm passiert war, er konnte es selbst noch nicht richtig fassen.
Er hörte mehrere Sendungen über das Klinikradio, das Mittagessen schmeckte sogar. Hofmann spürte unerträgliche Langeweile, ab und zu pustete er in den Atemvolumentrainer. Eine Schwester der Mittagsschicht kam vorbei. Hofmann meinte, dass es dem Mitpatienten wohl nicht gut gehe und er eigentlich auf dieser Station nicht richtig sei. „Ja, das ist wohl so. Aber die Intensiv- und Überwachungsstation sind belegt oder werden freigehalten für Covid-Patienten“, sagte die Krankenschwester.
Am Nachmittag kehrte auf Station eine wohltuende Ruhe ein, im Zimmer war es grenzwertig warm. Sein Nachbarpatient war nicht bei Bewusstsein, einige Monitore fiepten gelegentlich, das rhythmische Gebläse der Antidecubitus-Matratze wirkte hypnotisierend.
Hofmann hatte Gelegenheit, die für ihn unfassbaren Ereignisse von gestern auf sich wirken zu lassen. Fakt war, dass er am Freitag um 16 Uhr Frau R. erwartet hatte, die seit drei Monaten bei ihm in analytischer Psychotherapie war. Auf das Klingeln hin öffnete er gewohnheitsmäßig die Haustür, ohne über die Sprechanlage nachzufragen, und dann die Praxistür im ersten Stock. Doch statt Frau R. kam ein vermummter Mann herein und drängte ihn ins offene Behandlungszimmer; was genau ablief, konnte er nicht erinnern. Frau R. hatte die Stunde nicht abgesagt; manchmal erschien sie nicht zur Sitzung und erklärte später ihr Fernbleiben. Es könnte also sein, dass der Überfall in irgendeiner Weise mit Frau R. zu tun hatte.
Er versuchte, sich in Erinnerung zu rufen, wie das Erstgespräch mit Frau R. damals ablief: Sie meldete sich per Telefon im Februar 2020 und bat um ein Gespräch. Sie kam zwanzig Minuten zu spät, habe im Stau gestanden. Frau R. trug eine Lammfelljacke, Jeans, Stiefel mit Fellkragen, das halbe Gesicht war durch einen großen breiten Schal verhüllt, über dem braune Augen hervorschauten. Nachdem sie abgelegt hatte, ging sie selbstbewusst mit wippendem Pferdeschwanz zu einem der beiden Sessel. Ihr enger roter Rollkragenpulli betonte ihre Oberweite. Sie war nicht geschminkt, ihr ausdruckvolles Gesicht zeigte um die Augen herum eine Traurigkeit; ‚Facies depressiva‘, dachte Hofmann. Sie strahlte etwas Bedürftiges und Verführerisches aus.





























