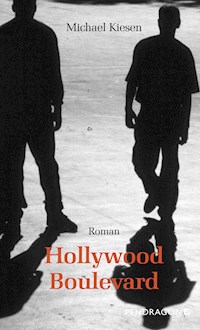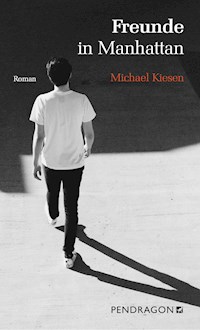
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pendragon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein junger Deutscher erkundet New York und den American way of life. Der Leser gerät mit dem Erzähler in einen Sog von Abenteuer und Sinnlichkeit und lernt die Metropole in ihrer faszinierenden Vielfalt kennen. Es ist das ewige New York, dem eine ungeheure Kraft und Dynamik innewohnt, Heimat für Menschen unterschiedlichster Herkunft, ein Ort, an dem man die Kunst des Überlebens lernen und intensive Freude am Leben finden kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Kiesen · Freunde in Manhattan
Michael Kiesen
Freunde in Manhattan
Roman
PENDRAGON
ALSO VOM HAUS meiner Tante war ich enttäuscht. Ich habe was erwartet … weißt du … wie in Hollywoodfilmen … Bungalow, große Zimmer, Fensterflächen, weiter Garten, Swimmingpool … Aber nichts dergleichen. Ein schmales Holzhaus, dunkelgrün angestrichen, zwei Stockwerke, darüber ein spitzer Giebel … Wenn man den zweiten Stock wegnimmt, würde man bei uns so was als Gartenhaus aufstellen … oder, sagen wir, als Wochenendhaus. Das ist drüben ein sehr verbreiteter Haustyp.
Auf der Fahrt durch Queens vom Kennedy Airport her habe ich zahllose Kästen dieser Art gesehen und bei meinem Ausflug nach Boston … Kennedy ist ja auch in einem Holzhaus aufgewachsen … in einer stillen Straße im Bostoner Stadtteil Brooklyn … die Außenwände auch grün angestrichen, im Innern allerdings geräumiger als bei meiner Tante … und schöner eingerichtet … Die leben drüben bei Weitem nicht so gut, wie man hier so glaubt. Natürlich gibt es in der Gegend, wo meine Tante wohnt, Viertel mit Villen in großen Gärten … und in Boston die Patrizierhäuser auf dem Beacon Hill … und so fort, und so fort … Aber die sogenannte Mittelschicht … ziemlich bescheiden … habe ich den Eindruck. Ein Fernsehgerät und einen Kühlschrank hat so gut wie jeder. Doch diese Holzhäuschen, diese Almhütten, mit denen sie sich zufriedengeben … Zufriedengeben … Na ja, vielleicht ist es richtig, sich mit so einer Behausung zu begnügen, statt alles aus Stein oder Beton zu bauen wie bei uns hier und Jahrzehnte daran abzuzahlen.
Und meine Tante selbst … tja … Sie raucht so viehisch viel. Eine nach der anderen. Du, bestimmt, wenn die nicht so maßlos qualmen würde, wäre ich öfter abends bei ihr geblieben und hätte auf den Fernseher gestarrt, so mies das Programm auch ist. Mit diesem „Esso is doing more … If you say Budweiser you have said it all … Guten Morgen … Lufthansa, the line of the red baron … You have got a lot to live, Pepsi has got a lot to give … If you want to drink more than one … Enjoy Coca-Cola, the real thing …“ Immer wieder knallen einem diese Sprüche entgegen … als ob sie einem Sahnetorte ins Gesicht klatschen würden. Und dazwischen kommt auch nichts Rechtes … fade Familiengeschichten, alberne Shows, Science-Fiction-Krampf, moraltriefende Western, Lustiges und Heldisches aus dem Zweiten Weltkrieg, an dem sie sich immer noch weiden, weil es der letzte Krieg ist, den sie gewonnen haben … am besten sind noch diese Krimiserien, die sie auch bei uns bringen, wenigstens spannend und ab und zu ganz realistisch, wie mir scheint. Warum meine Tante ständig diese Stängel zwischen den Lippen braucht, weiß ich nicht. Vielleicht anstatt. Sie ist Witwe. Ihr Mann wurde ermordet. Kein großes Drama. Ganz banal, ein beinahe alltäglicher Tod in New York: Meine Tante wohnte damals noch in Brooklyn; ihr Mann ging nach dem Abendessen spazieren, allein, weil meine Tante erkältet war; als er nach zwei Stunden nicht zurückgekommen war, suchte ihn meine Tante trotz ihrer Erkältung, zusammen mit einem Nachbarn; sie fanden ihn in einer Hofeinfahrt; er war schon tot, erstochen; seine Brieftasche fehlte.
Was ich sagen will: Wenn ich in der Nähe meiner Tante nicht um meine Gesundheit gefürchtet hätte, wäre ich nicht so oft nach Manhattan gefahren und wäre vielleicht nicht vom „Pfad der Tugend“ abgekommen. „Pfad der Tugend“, wie ihn meine Eltern verstehen. Und andere Spießer. Du, wenn meine Eltern eine Ahnung hätten, was ihr Bubi da drüben so angestellt hat! Es reizt mich schon, ihnen alles zu erzählen, nur um den Ausdruck ihrer Gesichter genießen zu können. Wo sich mein Vater doch solche Mühe gegeben hat, mich zu einem ordentlichen Menschen zu prügeln.
Aber es war wohl nicht bloß der Rauch, der mich fortgetrieben hat. Auch diese Unruhe in mir, der Wunsch, den ganzen Schlamassel hier zu vergessen.
Mein „Weg in die Hölle“ begann mit einem Arrangement meiner Tante. Was daraus entstehen würde, konnte sie jedoch bei aller Sorgfalt nicht übersehen.
„Heute Nachmittag kommt eine gute Bekannte von mir. Sie stammt auch aus Deutschland. Berlin. Sie hat eine sehr nette Tochter. Die bringt sie vielleicht mit.“
Ich freute mich. Sehr nette Tochter … Vielleicht eine mit schulterlangen braunen Haaren und schmalem, regelmäßigem Gesicht … oder meinetwegen eine niedliche Blonde mit vollen Brüsten …
Was dann erschien … ach, weißt du … nett … einen guten Charakter hat sie wohl schon … Eine Fußballfanatikerin ist sie … ja! … man glaubt es kaum. Meine Tante hatte das Tischchen im Garten gedeckt … Wir setzten uns, schon fragte mich Susi … so heißt die Maid … ob ich in oder bei Stuttgart wohnte und ob ich zu den Spielen des VfB ginge. Das sei ja eine interessante Mannschaft gegenwärtig. Allerdings seien sie auswärts oft zu zaghaft. Sie begleite ihren Vater zu jedem Heimspiel von Cosmos. Ob ich das nächste Mal mitginge. Ihr Vater sei für Hertha, weil er aus Berlin komme. Sie sei für Bayern München, wenn auch in den vergangenen Jahren … Und so ging es den ganzen Nachmittag weiter. Der Fallrückzieher von … in dem Länderspiel gegen … und so fort …
Susis Mutter stellte fest, dass wir beide uns ausgezeichnet unterhielten. Dabei sprach fast bloß ihre Tochter. Sie weiß das ganze Zeug aus einer deutschen Sportzeitung, die ihr Vater abonniert hat. Selbst spielt sie auch, mit ihrem Bruder und seinen Freunden im Garten und so.
Ich langweilte mich bei diesem Geschwätz ziemlich. Ich interessiere mich für Fußball ja nicht allzu sehr. Schon weil mein Vater davon so begeistert ist. Sicher, vor dem Fernsehgerät … da lässt man sich schon manchmal mitreißen … bei einem Länderspiel oder Bundesligaspiel … und so ein Fallrückzieher ist schon ’ne Wucht … aber im Grunde … was soll’s? … Dieses ganze Gerenne … Mein Freund Achim meint, Fußball sei etwas Faschistoides, der Trainer als Führer, die Spieler Sieger und Besiegte … das Recht des Stärkeren …
Achim an meiner Stelle hätte wahrscheinlich mit Susi zu streiten begonnen, wegen ihrer „faschistoiden Gesinnung“ … Aber Susis Fußballgerede wäre nicht so schlimm gewesen, wenn ich mich … was ich jetzt sage, würde Achim auch für faschistoid halten … wenn ich mich an ihrem Busen, an ihren Beinen, an ihrem Gesicht hätte erfreuen können … Bezeichnungen wie „hübsch“ und „hässlich“ lässt Achim nicht gelten … Ausdruck elitärer Gesinnung … faschistoid … verwerflich … Trotzdem hat er sich eine Freundin ausgesucht, die recht ordentlich aussieht. Aber eine Giftschleuder ist sie. Samt ihrer netten Figur müsste man schon einen Kran zu Hilfe nehmen, um mich auf die draufzubringen …
Also Susi … ein breites Gesicht, ausgeprägte Backenknochen, zwar blond, aber so ein fades Aschblond, sehr kräftige Arme, stämmige Beine … Im Ringkampf hätte die mich schon besiegen können. Ein guter Kamerad ist sie allerdings bestimmt. Ich sage ja, ihr Charakter …
Warum mich meine Tante mit ihr zusammengebracht hat, kann ich mir nicht recht erklären. Vielleicht hatte sie nichts Besseres zur Verfügung. Vielleicht hat sie als Frau da andere Maßstäbe. Auch möglich, dass sie mich nicht in Versuchung bringen wollte … um keine Vorwürfe von meinen Eltern zu bekommen … oder überhaupt … Was weiß ich, was in so einer Pfarrerstochter vorgeht, die mit einem amerikanischen Soldaten davongelaufen ist?
Susis Mutter sieht bedeutend besser aus als die Tochter, schmaleres Gesicht, schlank … Sie muss einen bösen Bolzen von Mann geheiratet haben. Sie war auch recht liebenswürdig. Sie machte Tante Trudchen meinetwegen Komplimente, sodass ich es hören konnte. Ich sei ja ein reizender Junge, so hübsch, und dieses schöne dunkelblonde Haar, ich hätte eine gewisse Ähnlichkeit mit der Tante … Meine Tante widersprach, ich sei ganz der Vater. Ich sah sie an und sagte barsch, das sei nicht wahr. Tante Trudchen entgegnete ruhig, doch, so sei es, was das Äußere betreffe, den Rest könne sie nicht beurteilen, dazu kenne sie mich zu wenig.
Ich will dich nicht mit allen Einzelheiten dieses Nachmittags langweilen. Jedenfalls gab ich mir beim Abschied einen Ruck, um die drei Weibsen nicht zu verärgern, und fragte Susi, ob wir uns mal wieder treffen könnten. Sie schien hocherfreut zu sein. Meine Tante schlug vor, wir beide sollten zum Jones Beach auf Long Island fahren.
Der Bus hielt am West Bath House des Jones Beach. Eine Frau stand am Eingang des Schwimmbads und sagte, es sei geschlossen, es werde erst am Samstag der kommenden Woche geöffnet. Susi und Ingo sahen einander an. Susi zog die Mundwinkel nach unten, drückte die Lippen vor. Ein Mann kam her. Ihm sagte die Frau das Gleiche wie ihnen. Er fing an zu schimpfen. Die Frau entgegnete, sie könne auch nichts dafür, er solle seinem Gouverneur schreiben.
Ingo: „Und jetzt?“
„Tja … und jetzt … In dieser Parkanlage … so hinter einem Baum oder Busch, da können wir uns irgendwo umziehen. Oder … vielleicht ist die Galerie geöffnet.“
„Galerie?“
„Ja, umgibt das Schwimmbad. Komm!“
Sie gingen zur Meerseite des West Bath House. Auf der Strandpromenade blieben sie stehen. Der ungemein breite Strand, in der Länge an den Horizonten verschwindend. Zahlreiche Menschen im feinen, weißlichen Sand. Wegen der Ausdehnung des Strandes jedoch kein Gedränge. Der Ozean graublau unter einem blassblauen Himmel. Ingo setzte dazu an, etwas zu bemerken wie: toll … wunderschön … Aber er unterließ es. Diese abgenutzten Wörter … zu gering für diese Küste.
Sie stiegen eine Treppe zu der überdachten Galerie hinauf, die das Schwimmbad umgab. Hier oben waren wenige Leute. Ingo sah auf das Schwimmbad hinab, zwei Becken, drei Sprungbretter, an Backsteinmauern kletterte Efeu zur Galerie empor.
Sie be gaben sich zu der hinteren Seite der Galerie und zogen sich um. Huch, hoffentlich kommt jetzt niemand daher! Kommt jemand? Wir werden noch verhaftet. Ach, ich kriege das nicht zu, hilf mir mal!
Dann zum Strand. Nahe dem Meer ließen sie sich nieder, auf zwei schmalen Handtüchern. Susi bewunderte die blaue Mütze, die Ingo aufsetzte. Er sagte, er habe sie in Kopenhagen gekauft. In Kopenhagen? Ja, er sei im vergangenen Jahr mit seinem Schulfreund Achim dort gewesen. Dauernd sei so sonniges Wetter gewesen, er habe eine Mütze gebraucht, er sei in verschiedenen Geschäften gewesen, bis er ausgerechnet bei einem königlichen Hoflieferanten etwas Nettes gefunden habe. So ausgerüstet an den Bellevue Strand nördlich von Kopenhagen; feiner, weißlicher Sand wie hier, Wälder dahinter, jenseits der Meerenge die schwedische Küste erkennbar … Ingo hörte auf zu sprechen. Diese Mädchen dort, die ohne Bikinioberteil dagesessen hatten, anders als bei den Puritanern hier, seine anhaltenden Erektionen … Susi sagte: „Glaubst du, dass der VfB Stuttgart in den nächsten Jahren mal deutscher Meister wird?“
Durst. Schlangen vor hellgrünen Getränkeautomaten neben dem Verkaufsraum des West Bath House. Sie stellten sich an. Die Platten heiß, auf denen sie standen. Das Sonnenlicht auf ihrer Haut. Susi wollte einen Becher Coca-Cola. Ingo entschied sich für ein Getränk, das er nicht kannte: Root Beer. Musste eine Art Bier sein, vielleicht ohne Alkohol.
Endlich gelangten sie an die Automaten. Dann drängten sie sich mit den gefüllten Papierbechern zwischen den Leuten hindurch, setzten sich auf die Stufen zwischen der Strandpromenade und dem Vorplatz des „Badehauses“.
Ingo nahm einen Schluck. „Das schmeckt ja abscheulich! Nach Kaugummi. Wie flüssiger Kaugummi.“
„Ich mag Root Beer auch nicht.“
Er nahm noch einen Schluck. „Pfui Teufel!“
„Trink doch bei meiner Cola mit!“
„Nein, nein. Das trinke ich jetzt. Immerhin löscht es den Durst. Vielleicht mag ich es beim letzten Schluck.“
In der Brandung. Die Wellen waren zu hoch, als dass Susi und Ingo weit hinausschwimmen konnten. Sie sprangen empor, wenn die Wellenkämme auf sie zukamen, ließen sich in die Wellentäler treiben. Es war anstrengend. Ingo schlug nach einer Weile vor, ans Ufer zurückzukehren. Sie waren schon im knietiefen Wasser, da prallte eine offenbar sehr hohe Welle gegen ihre Rückseiten, warf sie um. Sie schliffen ein Stück durch den Sand. Ingo stand auf, half Susi hoch. Sie starrten einander betroffen an, dann lachten sie, rieben den nassen Sand von sich ab.
Wieder auf den Handtüchern. Susi war still. Sie schien müde zu sein. Die graublauen Wellen, die unaufhörlich heranjagten und über den flachen Sand brachen. Diese weite aufgeraute Fläche bis hin zu der leicht gebogenen Linie des Horizonts … der Ingo plötzlich verdross, weil er ein Ende vorspiegelte … über das man gleiten konnte, weiter, weiter … bis zur portugiesischen Küste … zur spanischen … zur französischen … Biaritz … diese Bucht zwischen zwei felsigen Landzungen, wo jetzt wohl seine Eltern lagen, wo er auch sein könnte … das mürrische Gesicht seines Vaters, in den Augen entstand ein Vorwurf, wenn er den Sohn ansah … Ingo drehte sich auf den Bauch. Lachen … es kam von einer großen dunkelgrünen Decke her, auf der zwei Mädchen und zwei junge Männer lagen; gebräunte Hautflächen, Stoffstreifen; eines der beiden Mädchen kreischte auf, ihr Begleiter goss aus einer Dose Saft auf ihre Brüste. Lustig sein … Ingo legte den Kopf auf seine Unterarme, schloss die Augen. Er roch die salzige Frische seiner Haut. Der gebogene Horizont … der Vater, die leicht herabgezogenen Mundwinkel, die beiden schwachen Furchen zwischen den Brauen, die blassblauen Augen, starr auf ein Ziel gerichtet … Ingo kam es vor, als stände jemand neben ihm, um auf ihn einzuschlagen. Er wusste, dass es nicht so war. Trotzdem schienen sich alle seine Muskeln anzuspannen. Ingo biss sich in den Unterarm. Die Unruhe wich nicht. Er legte sich auf den Rücken, öffnete die Augen. Nur Susi neben ihm, nur Susi …
Im Schatten eines hohen Busches. Sie warteten auf den Bus nach Freeport. Vor ihnen auf dem Rasen lagen einige Paare.
Wenn er ein Mädchen bei sich hätte, mit dem er auch gerne da im Gras läge … sie auf den Mund küssen, auf den Hals, sich auf sie wälzen und durch die Jeans ihr Fleisch spüren … und sich sanft an ihr reiben …
Der Bus brauste heran. Sie fügten sich in die rasch entstehende Schlange ein. Sie gerieten ziemlich ans Ende.
Susi machte sich Sorgen: „Hoffentlich kommen wir noch rein.“
„Wenn nicht, fahren wir eben mit dem nächsten und gehen inzwischen spazieren.“
„Aber nicht, dass wir dann wieder draußen bleiben.“
„Ach, bei diesem Wetter könnte man sich auch in den Sand legen und hier übernachten.“
„Mein Bett wäre mir da schon lieber.“
Hinter ihnen eine Stimme: „Guten Tag! Wie geht’s?“ Die Lautbildung war angelsächsisch.
Sie drehten sich um. Ingo starrte ins Gesicht eines lächelnden jungen Mannes. Angenehme Züge, hellbraunes Haar, so gestutzt, dass man auch beim Militär zufrieden wäre. An seiner Seite ein Mädchen, nach Ingos Geschmack ausgesprochen hübsch, schulterlanges, leicht gewelltes dunkelblondes Haar; sie trug ein indisches Hemd aus dünnem weißem Stoff und Bluejeans. Der Fremde hatte ein braunes T-Shirt an, auf das groß eine weiße 15 gedruckt war, sowie zu Shorts gekürzte Bluejeans und weiße Sneakers.
„Haben Sie auch deutsche Eltern?“, fragte Susi. Der junge Mann zuckte mit den Achseln. Er sagte auf Englisch, er spreche nicht Deutsch. „Guten Tag!“ und „Wie geht’s?“ sei alles, was er könne. Er habe das von einem Freund gelernt, der als Soldat in Deutschland gewesen sei. Er sei auch gar nicht sicher gewesen, ob sie Deutsche seien. Nur der Aufdruck auf dieser Tasche … Er deutete auf Ingos Sportt asche. Das sei doch eine deutsche Firma. Susi lachte. Der Amerikaner wollte wissen, ob sie hier ihre Ferien verbrächten. Susi antwortete, er ja, sie dagegen … Die Dunkelblonde sah Susi und Ingo aufmerksam an, lächelte.
Sie befanden sich nun an der Tür des Busses. Ingo ließ Susi und die Dunkelblonde vorgehen. Dann bot er dem jungen Mann an einzusteigen. Er lehnte ab, schob Ingo vor sich her, die Stufen hinauf zum Fahrer, bei dem man bezahlte. Die Leute, die stehen mussten, rückten schon eng zusammen, damit weitere Personen hereinkommen konnten. Der Fahrer: „Move on! Move on! I am not leaving until everybody is in. Move on! Move on!“
Schließlich war der Bus so voll, dass man doch nicht alle Wartenden mitzunehmen vermochte.
Der Bus fuhr ab, jagte die breite Asphaltstraße entlang. Der junge Mann neben Ingo. Wie bitte? Ja, furchtbares Gedränge. Eben zu wenige Busse. Hübsch am Jones Beach; schade, dass die Schwimmbäder noch nicht geöffnet sind. Der junge Mann badete ohnehin fast nur im Ozean. Small Talk bis Freeport.
Am Bahnhof in Freeport. Sie stiegen aus, gingen zur Plattform hinauf. Sie unterhielten sich zu viert. Das Mädchen und ihr Freund wohnten in New York. Ihr gefiel es dort, ihm nicht. Sie stammte aus Boston, studierte jedoch an der Columbia University Soziologie. Die Harvard University besuchte sie nicht, weil sie sich nicht immer in Reichweite ihrer Eltern befinden wollte. Der junge Mann hatte New York ziemlich satt, das Häusermeer, die Hitze im Sommer, die Hetzerei der Leute, ihr Ernst, der Hass … Er würde gerne in San Francisco leben. Er war leider immer noch nicht dort gewesen. Aber Freunde hatten ihm davon erzählt, die wunderbare Lage, das milde Klima, Chinatown, Sausalito, Heiterkeit, südlich das fast unberührte, gewaltige Küstengebiet Big Sur. Aber die Erdbebengefahr. In New York starb man vielleicht bei einem Unfall der Untergrundbahn oder wurde von ein paar Burschen ermordet.
Der Zug fuhr ein. Sie fanden im selben Wagen Plätze, die jedoch nicht beisammen lagen. Susi setzte sich zu Ingo, ihre amerikanischen Bekannten ließen sich ein paar Bänke vor ihnen nieder.
In der großen Halle der Pennsylvania Station. Der junge Mann gab Ingo die Hand.
Er sagte zu Susi und Ingo: „Has been nice talking to you.
Ingo zögerte, die Hand loszulassen. Dieser junge Mann … sein freundliches, selbstsicheres Lächeln … der erste New Yorker, mit dem er gesprochen hatte … einer, der bestimmt mehr erlebt hatte als Achim und er … diese Begegnung nun schon vorbei … Ingo wusste nicht, was er sagen sollte, so gab er die Hand frei.
Die Dunkelblonde lächelte Susi und Ingo an. „Bye, bye!“
Sie und ihr Freund gingen zum Ausgang an der 7. Avenue, Susi und Ingo zu dem an der 8. Avenue.
„Die beiden sind nett“, bemerkte Susi.
Ingo schwieg.
Bevor ich zum ersten Mal allein nach New York fuhr, redete meine Tante auf mich ein, wie ich mich zu verhalten hätte, um diesem Dschungel wieder zu entrinnen. Ob ich noch alles zusammenbringe … Also, wenn man in der Stadt umherwandere, müsse man jeweils nach einigen Schritten zurückschauen, ob einem eine verdächtige Gestalt folge. Falls ja, losrennen. Natürlich müsse man auch auf die Leute achten, die einem entgegenkämen. Verdächtig seien Schwarze und Puerto Ricaner … wenn sie schäbig angezogen seien … meist Heroinsüchtige, die ihren täglichen Bedarf mit Raubüberfällen finanzierten … Sehr gefährlich auch dunkelhäutige Bürschchen unter zwanzig … Alarmstufe eins, wenn eine Gruppe solcher Typen auftauche. Viele von ihnen seien von daheim weggelaufen, hausten mit anderen in halb zerfallenen Gebäuden, machten Raubzüge in der Stadt, schickten ihre Freundinnen auf den Strich. Das seien ausgekochte kleine Bestien, die vor nichts zurückschreckten. Die hätten im Alter von zehn, elf, zwölf Jahren schon ungefähr alles getan, was ein Mensch anrichten könne, Ladendiebstähle, Taschendiebstähle, Raubüberfälle, Brandstiftungen, Vergewaltigungen und oft sogar einen Mord. Neulich sei ihr Chef am Spätnachmittag auf dem Broadway … auf dem Broadway! … von einer Gruppe Jugendlicher umringt worden, sie hätten ihn mit Messern bedroht und verletzt und ihm Aktentasche, Brieftasche, Ringe weggenommen und seien davongerannt. Ihr Chef habe ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Bei dem Überfall seien einige Fußgänger in der Nähe gewesen. Keiner habe ihrem Chef geholfen. Man sei also auch in belebten Gegenden nicht vor den Straßenräubern sicher. Selbst Polizisten würden einem vielfach in solchen Situationen nicht helfen, sondern in eine andere Richtung schauen.
Tante Trudchen riet mir, mich möglichst unauffällig anzuziehen, am besten Jeans, T-Shirt, Turnschuhe. Keinesfalls dürfe ich die hübsche Kombination mit Krawatte tragen, die ich bei meiner Ankunft angehabt hätte. In solcher Aufmachung wirke man wohlhabend, sei somit ein Magnet für die Räuber.
Dann meinte sie, ich solle mich bei meinen Ausflügen nach New York auf Manhattan beschränken, dabei allerdings bloß nicht nach Harlem und Spanish Harlem fahren, auch die Lower East Side solle ich meiden, eine heruntergekommene Gegend. Nach Staten Island könne ich mal rüberfahren, mit der Fähre, sehr hübsch, Freiheitsstatue, Südspitze von Manhattan. Brooklyn und Queens seien uninteressant. Und niemals in den Stadtteil Bronx.
Chaotische Zustände dort. Jeden Tag würden da Häuser brennen. Entweder von den Hauseigentümern angezündet, um die Versicherungssumme für unrentable Gebäude zu bekommen, oder von unzufriedenen Mietern oder von Jugendlichen bloß so zum Spaß …
Abends solle ich überhaupt nicht nach New York gehen. Die Gefahr eines Überfalls sei da wesentlich größer als am Tag. Ausnahmsweise könne ich ja mal … ins Theater am Broadway oder in die Met … oder zu einer Veranstaltung nach SoHo … Aber dann solle ich mich von der 42. Straße und der 8. Avenue fernhalten. Dafür sei ich doch wohl zu jung. Sie wolle deswegen keinen Streit mit meiner Mutter bekommen.
Wenn du eine Tante in München besuchst, was wird sie wohl sagen, bevor du in die Stadt gehst? Nichts. Allenfalls: Viel Vergnügen! Ich habe mich immer wieder gefragt, wie die Amerikaner es geschafft haben, eine Stadt wie New York … und das ist ja kein Einzelfall … in einen solchen Zustand zu bringen, in einem der reichsten Länder der Welt, wo sie doch derart stolz auf ihre Verfassung sind, die so viele Rechte gewährt … die „Menschenrechte“ … auf dem Papier … Mein Freund Achim hat dafür natürlich eine einfache Erklärung. Das ganze System … bürgerlicher Liberalismus … Ausbeutung … Verelendung … Bloß, bei uns hat ein ähnliches System nicht zu den gleichen Ergebnissen geführt. Achim meint, in Peking und Moskau brauche man sich jedenfalls nicht vor Straßenräubern zu fürchten. Ich habe zu ihm gesagt: „Dort tanzen in den Bars auch keine Go-go-girls, oben und unten ohne.“
Auf nach Greenwich Village. Im Bus die 7. Avenue hinunter. Vorbei an der Pennsylvania Station, dahinter der Rundbau des Madison Square Garden Centers. Der Bus kam nur stockend voran. Ziemlich starker Verkehr am frühen Nachmittag. 23. Straße. 14. Straße; führte hin zum Union Square, Standbild des Marquis de Lafayette … Greenwich Avenue, Charles Street. Ingo stand auf. Er riss an der Schnur aus ockerfarbenem Kunststoff, die über den Fenstern hing. Es klingelte. Der Bus hielt. Ingo stieg aus. Er öffnete den Stadtplan. Ingo befand sich etwas nördlich vom Sheridan Square. Über den Dächern im Süden die Türme des Welthandelszentrums. Die Sonne schien durch einen Dunstschleier. Es war windstill, heiß. Er überquerte die 7. Avenue, begab sich auf die Schattenseite der 10. Straße. Er kam zur Avenue of the Americas, zur 8. Straße.
Ingo bog zum Washington Square ab. Auch unter den Bäumen des Parks war es dort schwül. Er knöpfte sein Hemd bis zum Gürtel auf. Viele dunkle Gesichter. Zur Linken der Triumphbogen. Davor eine Versenkung um einen leeren Brunnen. In ihr warfen sich einige jugendliche Afroamerikaner und Weiße eine diskusartige Scheibe aus Kunststoff zu. Ingo blieb stehen. Die Jungen trugen fast alle T-Shirts, Shorts und Turnschuhe, einer hatte das Hemd ausgezogen und sich um die Hüften gebunden. Die Scheibe flog Ingo vor die Füße. Er bückte sich und hob sie auf. Einer der Jungen kam auf ihn zu. Ingo lächelte, warf ihm die Scheibe zu. Der Junge bedankte sich. Ingo ging weiter. Ein Standbild Garibaldis, entschlossener Gesichtsausdruck, er zog gerade das Schwert aus der Scheide. Nicht weit davon eine freie Bank. Ingo ließ sich nieder. Auf der Bank rechts von ihm zwei jüngere Schwarze, auf der links zwei Frauen, weiß, die eine ältlich, die andere jung. Die beiden Schwarzen … arbeitslos? Straßenräuber, die auf den Abend warteten? In ihren Bluejeans und schwarzen T-Shirts wirkten sie recht ordentlich. Trotzdem wohl arme Schweine. Arme Schweine … Ein Unbehagen befiel ihn, er spürte es zunächst im Magen, dann in allen Gliedern. Das knochige Gesicht des Direktors, sein gequältes Lächeln … Bloß das jetzt nicht! Das nicht! Nicht! New York müsste doch weit genug von Stuttgart weg sein …
Zwei junge Schwarze kamen her, einer setzte sich neben Ingo, ziemlich nahe, einer blieb stehen. Sie unterhielten sich mit den beiden Schwarzen, die auf der Bank rechts von Ingo saßen. Der stehende junge Mann kam aus Brooklyn. Viel mehr verstand Ingo von dem Gespräch nicht. Der aus Brooklyn ging nach einer Weile weg. Ingo spürte, er glaubte zu spüren, dass ihn der junge Mann, der neben ihm saß, ansah. Würde sein Nachbar etwas sagen, ihn anbetteln, auffordern abzuhauen, einfach irgendein Gespräch beginnen? Ingo stand auf. Er ging an Garibaldi vorbei, kein Ruf hinter ihm, er näherte sich dem Washington Arch. Unter dem hohen Bogen eine Anzahl Leute, ein Zuschauerring um zwei Afroamerikaner, die Gitarre spielten, und ein Paar, das zu der Musik tanzte, eine Weiße und ein Schwarzer. Ingo blieb stehen. Die Hitze. Er sehnte sich nach einem kühlen Raum, air-conditioned, oder einer Dusche. Er ging zur Avenue of the Americas. Er wartete auf den Bus. Wenn er nur endlich käme! Der mehrspurig vorbeibrausende Verkehr, die Abgase, die Luft rauchig, ein leichtes Brennen in seinen Augen. Tante Trudchens Haus in New Jersey. Er wollte nichts, als dort im Badezimmer sein, sich die Kleider vom Leib reißen und die Dusche andrehen.
Abends 42. Straße. Entgegen dem Wunsch von Tante Trudchen. Er sei zu jung! Mit seinen 19 Jahren. Volljährig!
„Books and Magazines“. Ingo betrat den Laden. Taschenbücher, über eine halbe Wand hinweg. Ein langer Tisch in der Mitte des Raumes, darauf ausgebreitet Magazine; vollbusige Mädchen, Paare, umschlungen, Dreiergruppen, dunkle und helle Haut. Magazine auch in den Regalen, die einen großen Teil der Wände bedeckten. In einer Ecke junge Männer als Titelbilder, die meisten muskulös, mit ungewöhnlich langem Glied und dümmlichem Gesichtsausdruck, ein Heft über „Teenage Masturbation Techniques“, konnte man vielleicht noch was lernen. Einige ältere Männer standen herum und blätterten in Magazinen. Er wie die da? Irgendwie widerlich. Also wieder hinaus auf die 42. Straße.
Zum Broadway, am anderen Ende des Times Square eine Reklametafel für Coca-Cola, sie beherrschte über der Schmalseite eines Gebäudes den Norden des Platzes, „Enjoy Coca-Cola“ blasslila auf hellroten Neonwellenlinien, das Bild erlosch, ein neues erschien: „It’s the real thing … Coke“, Orange auf Rot, verschwand, wurde durch das erste Bild ersetzt … An der Rückseite eines marmorverkleideten Hochhauses vorbei, über die 7. Avenue. Nun die Strecke der 42. Straße zwischen 7. und 8. Avenue. An den Gittern der Treppe zur Untergrundbahn eine Gruppe Jugendlicher, Schwarze und Puerto Ricaner. Wieso waren sie hier? Um sich zu amüsieren? Zu stehlen? Das helle Licht der Filmreklamen von den Vordächern über den Kinoeingängen. Die Vordächer waren fast alle gleich, auf senkrechten, ungefähr zwei Meter hohen Flächen aus weißem, erleuchtetem Glas standen in großen schwarzen Buchstaben die Namen der Filme, meist mit Zusätzen: „first NY running“, „for adults only“. Oder auch „für reife Erwachsene“. Um die weißen Glasflächen gelbe Glühbirnen mit wanderndem Licht. Und die Spielhallen, Bars, Restaurants, Sexshops, Läden für Platten, Lederwaren, Kleider, Alkohol. Die Gesichter, weiße, gelbe, sehr viele schwarze und braune. Die Kleidung, oft abgerissen und dreckig, gewöhnlich sportlich, kaum einmal elegant. Ein Schwarzer kam ihm entgegen, leicht schwankend, die Lider halb geschlossen. Heroin? Ingo wich ihm aus. Nicht weit hinter ihm ein weißhaariger Schwarzer, die Arme halb erhoben, andauernd vor sich hinredend, irgendetwas über „Gott“ und „gehen“. Am Eingang eines Geschäfts ein dunkelblonder junger Mann in weißem T-Shirt, Armeehosen und Texasstiefeln, er wirkte von oben bis unten staubig, als ob er gerade über die Prärie geritten wäre. Jemand sagte etwas zu Ingo. Ein junger Mann stand vor ihm, blond, mittelgroß, kräftig.
Ingo: „Pardon me?“
Der Blonde fragte Ingo, ob er ihm etwas Geld geben könne. Er wohne im „William Sloane House“ und sei bestohlen worden. 60 Dollar seien ihm weggekommen. Er habe nun nichts mehr. Er arbeite zwar, aber seinen Lohn erhalte er erst am Ende des Monats. Es wäre sehr nett, wenn er ihm etwas gäbe.
Der junge Mann sah so sauber aus, war ordentlich angezogen. Ingo wusste nicht, was er von der Geschichte halten sollte. Er zog den Geldbeutel heraus, gab dem jungen Mann einen Dollar.
Der andere sagte, es sei sehr demütigend. Oh bitte, so etwas könne vorkommen. Der junge Mann bedankte sich. Ingo wünschte ihm alles Gute. Der Blonde dankte und ging weiter.
Auf der 8. Avenue. Fast düster nach der Lichterfülle der 42. Straße. An den Hausmauern Mädchen, fast alle Mulattinnen, Perücken, schwarze, blonde, Hotpants, sehr kurze Röcke. In ihrer Nähe lungerten Schwarze und Puerto Ricaner herum. Zuhälter? Zuschauer? Ingo ging rascher. Auch jetzt am Abend war es noch ziemlich warm. Er hatte Durst. An der Ecke zur 46. Straße eine Bar. Er sah durch ein Fenster hinein. Der Raum wirkte sauber. Nur wenige Leute waren anwesend. Ingo ging hinein, nahm auf einem Barhocker Platz. Das Mädchen, das bediente, gefiel ihm, mittelgroß, langes braunes Haar, regelmäßige Züge. Er bat um ein Bier. Sie brachte ein Fläschchen „Miller High Life“. Ein paar Hocker entfernt saß eine blonde Frau, füllig, wohl um die vierzig Jahre alt, neben ihr ein Mann ähnlichen Alters. Die Frau redete fortwährend, sehr laut, an die Bedienung gewandt. Der Mann bei ihr schwieg. Die Bedienung lächelte, erwiderte ab und zu einige Worte. Der blonde junge Mann, der Ingo vorhin angesprochen hatte … Er hätte den armen Kerl zu einem Drink einladen sollen. Woher kam er? Woher aus diesem weiten Land? Wie war er aufgewachsen? Was für eine Arbeit hatte er?
Was tat er in seiner Freizeit? War er tatsächlich bestohlen worden? Die blonde Frau sprach und sprach, lachte.
Das Fläschchen war leer. Ingo ging ins Freie.
Am übernächsten Abend … Ich hatte keine Lust, neben meiner Tante vor dem Fernseher zu hocken und mich von ihr einnebeln zu lassen. Ich sagte, ich würde noch nach Manhattan reinfahren. Ich faselte was von „Saturday Night Fever“, den ich in Deutschland gesehen hätte … und jetzt mal in der Originalfassung … Meine Tante regte sich auf, so spät noch nach New York, das sei doch viel zu gefährlich; wenn ich den Film in Deutschland … dann sei es eigentlich überflüssig, hier auch … Ich quatschte was von Englisch lernen … besser, wenn man den Stoff schon kenne … Sie: In welcher Gegend denn das Kino liege. Am Broadway. Na, der sei lang. Nun, am Times Square. Aber wenn der Film zu Ende sei, solle ich sofort zum Bus gehen; und möglichst nicht durch die 42. Straße, lauter Gesindel dort; und von niemand ansprechen lassen; ob ich nicht doch hierbleiben wolle; auch in belebten Gegenden sei man nachts nicht sicher; vor einigen Jahren sei der Portier des Hotels Lennox von einem Schwarzen erschossen worden, sonntags um Mitternacht … das Hotel liege ungefähr dreißig Meter vom Times Square entfernt, gewissermaßen noch im Lichterschein des Platzes … Du, wirklich, ihr Lamento ging mir schon auf die Nerven. Naja, die Geschichte mit ihrem Mann … braucht man sich nicht zu wundern, wenn eine da leicht hysterisch wird … Also ich schwatzte mich los.
Um ganz ehrlich zu sein … das Kettenrauchen meiner Tante war nicht der Hauptgrund, warum ich nach New York fahren wollte. Die 42. Straße … ich meine die ganze Gegend dort … hatte es mir angetan. Mensch, nimm mal Stuttgart! Wo ist da abends noch echt was los, ich meine auf der Straße? … Weißt du, die 42. Straße … wenn man bloß durchbummelt, bloß das … irgendwie aufregend … man hat den Eindruck, als könne jeden Moment was geschehen, was Wildes, Verrücktes … Und es ist ja dann auch was geschehen an diesem Abend … der Auftakt für allerlei „Wildes und Verrücktes“ …
In New York ging ich erst mal die 8. Avenue hoch, vom Port Authority Bus Terminal aus. Ich war enttäuscht, kaum Mulattinnen da, dafür ’ne Menge Polizisten … solche Arschgeigen! … vertreiben einige hübsche Mädchen, die ein bisschen anschaffen wollen, statt sich um die zahllosen Straßenräuber und Mörder zu kümmern. Dann durch die 45. Straße an Theatern entlang; die marktschreierischen Reklametafeln an den Fassaden: „a new musical hit“, „best play in town“, „tremendously funny“ … ob Würstchenbude oder Theater … die Ware muss abgesetzt werden. Zum Times Square; jedes Mal wenn ich hinkam, war ich zunächst benommen. Von dem Gewimmel auf den Gehwegen, der Lichterfülle, der Schamlosigkeit der riesigen Reklametafeln … Und die Gebäude, an die sie die Reklamen geknallt haben: Am Südende des Platzes, der Allied Chemical Tower, marmorverkleidet, der ist hübsch … auch die beiden schwarz verglasten Wolkenkratzer an der Westseite und Ostseite … Aber sonst … schäbige Kästen … besonders dieser triste Backsteinbau, der die Coca-Cola-Reklame trägt … Und die wechselnde Höhe der Gebäude, mal 2 Stockwerke, dann 10, 4, 8, wieder 2, 40 … Jeder hat offenbar auf seinem Grundstück hochziehen lassen, was ihm behagt hat. Freiheit der Wohlhabenden …
Ich ging dann tatsächlich ins Kino.
Rückweg natürlich über die 42. Straße, damit sich meine Tante nicht umsonst aufgeregt hatte. Ich bummelte unter den leuchtenden Vordächern der Kinos. Der weißhaarige Schwarze wanderte auch wieder umher, der mit halb erhobenen Armen fortwährend vor sich hinredete: „Oh my God, why do I walk? Oh my God, why do I walk? …“ Ich bemerkte den Eingang zu einem Sexshop; vor dem Schaufenster ein junger Mann, mit dem Rücken zum Glas. Der Mensch störte mich, ich hätte gerne in Ruhe angesehen, was ausgestellt war. Wieso musste der gerade da herumstehen, wenn er sich doch nicht für das interessierte, was sich hinter ihm befand? Ein Weißer, hellbraunes Haar, Frisur wie ein Soldat … mir war plötzlich, als hätte ich ihn schon irgendwo gesehen. Ein Typ wie die Nummer 15 vom Jones Beach. War er es etwa? Er schien zu merken, dass ich ihn beobachtete, sah zu mir her. Er begann zu lächeln, trat auf mich zu. Ob ich neulich am Jones Beach gewesen sei? Deutscher? Na also, dann würden wir uns ja kennen; es tue ihm leid, dass er nicht sofort … aber er sehe so viele Gesichter … Er gab mir die Hand. Ich wusste nun nichts Besseres zu sagen als, ich sei im Kino gewesen. „Saturday Night Fever“ hatte er auch gesehen, er fand den Film langweilig; allerdings die Tanzszene und die Musik … Wie’s meiner Freundin gehe; ob ich sie heute Abend in Ruhe ließe? Ich sagte, das Mädchen, mit dem ich am Jones Beach gewesen sei, sei nicht meine Freundin, nur eine Bekannte. Er grinste; eine nahe Bekannte … Ich widersprach nicht, ich ließ ihn in dem Glauben, sie sei eine „Eroberung“ von mir. „What’s your name?“, fragte er. „Ingo.“ „What?“ „Ingo.“ „Ingou?“ „Yes.“ „My name is Mike.“ Er gab mir noch einmal die Hand.
Was sagt man in so einer Situation bei uns? Bier zusammen trinken. Das schlug ich vor. Er zögerte; eigentlich müsste er … na ja, auf einen Drink … Ich fragte, ob er eine nette Bar hier herum kenne; ich sei neulich in einer in der 46. Straße gewesen, sei ein ziemlich fader Laden. Er nannte das „Broadway Pub“ in der 45. Straße; dieses Lokal werde mir bestimmt gefallen.
Wieder zum Times Square. Wir überquerten den Platz an einer Verkehrsinsel. Auf ihr stand so ein Flachdachkiosk. Mike blieb vor dem Bau stehen. Er sagte, er frage sich gegenwärtig jeden Tag, ob er nicht einfach da reingehen und unterschreiben solle. Ich wusste nicht, was das für ein Laden war und was man da unterschreiben konnte. Mike deutete auf so eine Buchstabenreihe unterhalb des Dachs. „US Navy“ und „US Marine Corps“ entzifferte ich. Also irgendwas Militärisches. Er erklärte es mir. War’n Rekrutierungsbüro. Mike hatte vor, bald oder später mal für einige Jahre zum Marine Corps zu gehen. Ich stolperte fast über den Bordstein vor Schreck.
Ich weiß nicht, hast du ’ne Ahnung, was das für ’n Verein ist, das Marine Corps? Genau, das kann sich mit der Fremdenlegion messen. Vielleicht noch brutaler. Wie konnte jemand so was anstreben? War die Fröhlichkeit dieses Jungen eine Maske? Ich konnte es mir nur so erklären, dass ein Mensch auf irgendeine Weise verzweifelt sein muss, in eine Sackgasse geraten, um so einen Schritt zu tun.
Wir gingen eine Weile schweigend nebeneinander her. Ich fand es unangebracht, ihn zu fragen, warum er ins Marine Corps eintreten wolle. Mir schien, als müsste er dann etwas sehr Intimes preisgeben. Und dazu war unsere Bekanntschaft zu jung. Aber meine Neugier trieb mich, die Frage doch zu stellen. Er erwiderte, wenn man ein harter Bursche werden wolle, gehe man zu den „Marines“. Unwahrscheinlich, dass das der eigentliche Grund war. Ich hielt ihm vor, beim Marine Corps müsse es ja furchtbar zugehen … sogar die deutschen Zeitungen würden darüber berichten … Horror Stories … Sicher, es sei eine harte Ausbildung, meinte er, aber wenn man einigermaßen fit sei, stehe man das schon durch; ein guter Freund von ihm sei beim Marine Corps gewesen, dem habe es dort gefallen; jeder bewundere einen, wenn man sage, man sei bei den „Marines“ gewesen. Außer den Pazifisten, entgegnete ich. Er sei auch gegen den Krieg, sagte er, aber ein Land müsse sich doch verteidigen können. Ich ging auf das Problem nicht ein, ich bin da mit mir selbst noch nicht ins Reine gekommen.
Wir betraten das „Broadway Pub“. Links eine lange Bar, rechts Tische vor einer Lederbank, die an der Wand entlanglief. Über der Bank Laternen und Wappenschilder. Wir stiegen auf Barhocker. Ein schlankes blondes Mädchen bediente uns, ihr Gesicht nett, etwas langweilig. Ich bestellte ein Bier. Welche Sorte? Das Mädchen zählte auf: Miller, Budweiser, Michelob … Miller, entschied Mike für mich, das werde mir schmecken. Kannte ich ja schon, ist ’n angenehmes, leichtes Bier. Also zwei „Miller High Life“. Das Mädchen stellte zwei Fläschchen und zwei Gläser vor uns hin. Wir tranken uns zu. Die Wand, auf die wir sahen, war mit Spiegeln bedeckt, vor denen auf einem Büfett zahllose Flaschen standen.