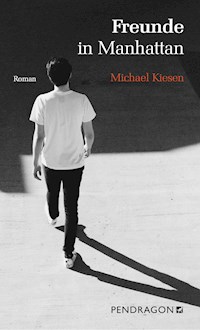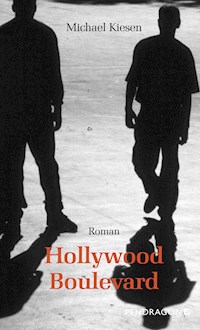
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pendragon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Für David wird der »sunshine state«, das »Wunderland« Kalifornien, Wirklichkeit. Er taucht in eine subtropische Szenerie und lernt im Hollywood YMCA einen jungen Mann kennen, Roy, der aus dem Mittleren Westen abgehauen ist. Mit Roy zusammen begegnet David weiteren jungen Leuten, die sich nicht nach überkommenen Regeln richten, und lässt sich von ihrer tabulosen Lebensweise mitreißen. Die charmant hemmungslose kalifornische Szene ist für ihn ein Gegenpol zu seiner süddeutschen Heimat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Kiesen
Hollywood
Boulevard
Roman
PENDRAGON
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Weider von by Pendragon
1
Die Begegnung. Los Angeles, Stadtteil Hollywood, Hudson Avenue, ziemlich nahe beim Hollywood Boulevard, Haus des YMCA, Umkleideraum. Ich trat vor einen der Spiegel und kämmte mich. Mein Haar war noch recht feucht, obwohl ich es eine Weile mit dem Handtuch gerieben hatte. Um mich herum Bewegung. Hinter mir gingen Leute hin und her. Auf der Höhe meiner Schulter erschien ein Gesicht im Spiegel, rund, flach, gelblich, pechschwarzes Haar, wohl ein Amerikaner chinesischer Herkunft, er begann, sich auch zu kämmen, ich trat etwas zur Seite, um ihm eine Hälfte des Spiegels zu überlassen. Ich drehte mich um. Meine Tasche war noch da, stand auf einem Hocker, der Aufdruck „Lufthansa“, rötlichgelb auf dunkelblau, leuchtete mir entgegen. Jenseits des Hockers zogen sich zwei Mulatten an. Sie lachten, unterhielten sich. In ihrer Nähe ein nackter Weißer, groß, muskulös, er schloss eines der schmalen Schränkchen ab, kam auf mich zu, bog zum Duschraum ab. Ich sah wieder in den Spiegel, kämmte ein paarmal feuchte Haare nach links, die mir senkrecht in die Stirn hingen. Draußen war es sicher schon recht kühl. Ich musste noch hier bleiben und die Haare eine Weile trocknen lassen. Ich konnte ein bisschen fernsehen. Ich steckte den Kamm in die Jacke, nahm meine Tasche, ging zwischen zwei Reihen der schmalen Metallschränkchen hindurch, vorbei an den beiden Mulatten, deren ungehemmte Heiterkeit mich unerklärlicherweise fast verdrießlich stimmte, erreichte den Flur, der an der gegenüberliegenden Wand entlanglief.
In einer Ecke des Raumes befand sich eine Polsterbank, überzogen mit hellbraunem Kunstleder, davor ein Fernsehgerät. Auf der Bank saß ein blonder junger Mann, die Beine ausgestreckt, er sprach mit einem weiteren blonden jungen Mann, der sich auf einem Hocker neben der Bank niedergelassen hatte. Ein zweiter Hocker stand da, frei, ich nahm Platz, stellte meine Tasche auf den Boden. Auf der Mattscheibe ein Mann in hellem Dress, der den Mund bewegte, wahrscheinlich ein Tennisspieler, der interviewt wurde, ich verstand fast nichts, das Rauschen der Duschen, das aus zwei offenen Durchgängen in den Umkleideraum drang, vermischte sich mit dem Ton aus dem Lautsprecher.
Ich versuchte nun, dem Gespräch der beiden jungen Männer rechts von mir zu folgen. Um Bärte ging es. Der Soundso hatte sich einen Vollbart wachsen lassen, stand ihm überhaupt nicht, aber ein anderer hatte auch einen und sah ganz gut damit aus. Dann Sätze, die, vermengt mit dem Rauschen der Duschen und der Stimme aus dem Apparat, mich nicht erreichten. Der auf der Bank hatte hellblondes, leicht gewelltes Haar, eine sehr blasse Haut, trug ein weißes T-Shirt, dunkelblaue Trainingshosen, ungeputzte, an mehreren Stellen zerrissene Tennisschuhe. Der andere war dunkelblond, sein Haar reichte bis über den Kragen, er hatte Bluejeans an, hellbraune Wildlederschuhe, ein rot und weiß kariertes Hemd, dessen Ärmel bis zu den Ellbogen hochgekrempelt waren. Ich fing nun wieder eine Äußerung des Hellblonden auf: Er würde sich gerne einen Bart wachsen lassen, einen Schnurrbart, aber seine Haut sei zu empfindlich. Der Dunkelblonde erwiderte etwas, ich verstand es jedoch nicht, sein Gesicht war von mir abgewandt. Auf der Scheibe erschien ein Nachrichtensprecher. Die Unterhaltung zwischen den beiden jungen Männern brach ab. Ein Film wurde eingeblendet, Flüchtlinge am Rand einer Straße, einige schleppten Reste ihrer Habe auf dem Rücken von Tieren, auf Viehkarren mit, Lastwagen mit fliehenden Soldaten, Geschützdonner, Rauch am Horizont. Wieder der Sprecher, er berichtete von weiteren Kriegswirren, freundlich, fast lächelnd, als ob er von einer Fürstenhochzeit in Monaco oder Liechtenstein erzählen würde. Dann Lokales, empörte Hausbesitzer aus Anaheim, durch deren Wohngegend ein Freeway geführt werden sollte. Der Dunkelblonde bewegte den Kopf mit einem Ruck nach vorn, seine Haare fielen über das Gesicht, er warf den Kopf in den Nacken, die Haare sanken zurück.
Ich weiß nicht, warum ich zu sprechen begann. Vielleicht aus Langeweile. Vielleicht, weil ich mich gerade einsam fühlte. Vielleicht, weil ich mein Englisch üben wollte. Bestimmt, ich bin außerstande anzugeben, wieso ich es tat. Man soll mir auch nicht unterstellen, ich hätte ihn angesprochen, weil er mir gefiel. Ich hatte sein Gesicht bis dahin gar nicht genau gesehen, er hatte sich mit dem Hellblonden unterhalten, dabei hatte sein Hinterkopf in meine Richtung gewiesen, und als er nach Beginn der Nachrichten zum Fernsehgerät hinstarrte, tat ich es ebenfalls. Ich fragte ihn überdies nichts, was ich gerade wissen wollte, vielmehr stand für mich die Antwort fest, ich war schon das dritte Mal hier und kannte mich einigermaßen aus.
Ich sagte also: „Isn’t there a hair-dryer for everbody in here?“
Er wandte mir das Gesicht zu, sah mich an. Sicher erfasste ich in diesem Moment nicht die Einzelheiten seines Gesichts, bewertete es auch nicht. Ich wurde nämlich plötzlich unsicher, ob es im Englischen das Wort „hair-dryer“ gab, ich hatte es aufs Geratewohl gebildet.
Ich sagte daher schnell: „Is this the correct word: hair-dryer? Have you got this word in English?“
Er ging auf meine beiden letzten Fragen nicht ein, er beantwortete nur die erste: „No, you have to bring your own.“ Nein, man müsse seinen eigenen mitbringen. So war es. Ich wusste es schon.
Der Hellblonde äußerte etwas. Ich verstand nur so viel, dass er einen Platz oder Bereich nannte, an dem es zehn Föhne gab.
„Where?“, fragte ich.
Der Dunkelblonde wiederholte, was der andere gesagt hatte: „In the executive branch there are ten hair-dryers.“
Beide verwandten das Wort „hair-dryer“, ich hatte also den richtigen Begriff gefunden.
Da ich den Dunkelblonden wohl immer noch etwas verständnislos ansah, fügte er hinzu: „The executive branch is in another part of the building.“
Aha, in der Managerabteilung, die sich in einem anderen Teil des Gebäudes befand, waren zehn Föhne.
Das sei ja unglaublich, sagte ich lächelnd mit Empörung in der Stimme, die teils ernst, teils ironisch gemeint war, bei denen seien zehn Föhne, aber hier fürs gemeine Volk gebe es gar keinen.
Der Hellblonde murmelte irgendetwas wie „yes“, der Dunkelblonde lächelte. Meine Frage war beantwortet, die Bemerkung des Hellblonden hatte ihren Widerhall gefunden, es gab eigentlich zu zwei Fremden nichts mehr zu sagen, zumal die Nachrichten nach einem Werbespot fortgesetzt wurden, man zeigte ein Fest im Freien, in einem Park wahrscheinlich: auf einer Wiese verkleidete Gestalten, die herumblödelten.
Und doch sagte ich noch etwas, fügte ganz bewusst ein „Reizwort“ ein: „After all it’s too much to bring a hair-dryer all the way from Europe.“
Der Dunkelblonde meinte, es sei besser, das Haar nicht mit Hilfe des Föhns zu trocknen.
Er war auf das Wort „Europa“ nicht eingegangen. Keine Frage: Do you come from Europe? oder: Where do you come from?
Ich war verblüfft, äußerte eine weitere banale Bemerkung: Man sei manchmal ganz froh, wenn man die Haare etwas schneller trocken bekomme.
Der Dunkelblonde lächelte. Nicht spöttisch, sondern freundlich, duldsam.
Ich wandte mein Reizwort noch einmal an: In den Hallenbädern, die ich in Europa besucht hätte, seien immer Föhne angebracht gewesen, für Frauen und Männer. Er antwortete nur: „Really?“ Auch diese Äußerung wirkte nicht abweisend.
Spätestens jetzt musste ich sein Gesicht genügend beobachtet haben, denn ich weiß, was ich ihn als Nächstes fragte.
Dieses Gesicht … Ich bin mir bewusst, dass ich sein Gesicht nicht genau zu beschreiben vermag. Es ist unmöglich, ein Gesicht vollkommen mit Worten zu erfassen. Ich kann nur ein Schema geben und ein paar Einzelheiten daran heften. Der Rahmen: das glatte dunkelblonde Haar, das von den Fransen auf der Stirn in gerundetem Schwung abwärts floss und nur am Hinterkopf die Kragenhöhe erreichte. Die Form: weder breit, noch schmal, weder rund, noch lang, auch nicht oval, sondern zwischen diesen Extremen. Die Augen graublau. Die Nase gerade. Der Mund ohne Besonderheit. Die Wangen nicht voll, vielmehr spannte sich die gebräunte Haut straff zwischen Backenknochen und Kiefer. Meines Erachtens harmonische Züge. Warum? Die einzelnen Teile passten zueinander, insbesondere „stimmten“ die Proportionen, vielleicht nicht im Sinne des Kanons eines Bildhauers der Antike oder Renaissance, aber sie waren so, dass man sie als angenehm empfand.
Was ich nun von ihm wissen wollte, interessierte mich tatsächlich. Ob denn hier in Hollywood nicht jeder, der auch nur ein bisschen gut aussehe, Schauspieler beziehungsweise Schauspielerin werden wolle.
Ich hatte die Frage allgemein formuliert, sie konnte aber eigentlich jeweils nur für eine bestimmte Person beantwortet werden. Er verstand dies sicher, erkannte wohl auch das Kompliment, das in meiner Äußerung enthalten war; er antwortete mit einem schlichten ‚Nein‘ und fuhr fort, natürlich gebe es hier viele Leute, deren Ziel dies sei. Ich wäre nicht überrascht gewesen, wenn er erwidert hätte, er sei Schauspieler oder Schauspielschüler, sein einfaches ‚Nein‘ jedoch verwirrte mich.
Ich entgegnete, wenn ich in Hollywood lebte, würde ich auf jeden Fall versuchen, Schauspieler zu werden. Allerdings sei es wohl recht schwierig, Engagements zu bekommen.
Natürlich, es gebe hier so viele Schauspieler, meinte er. Manche müssten eben irgendwelche Jobs annehmen, bis sie wieder ein Angebot erhielten.
Das sei immer noch besser, fand ich, als dieser Beruf, den ich in Deutschland hätte.
Was für ein Beruf das sei.
„Lawyer.“
Er äußerte, in Deutschland könne man aber sehr jung Rechtsanwalt werden. At a very young age.
Sehr jung. Er hielt mich für sehr jung. Ich erklärte ihm den Ausbildungsgang eines deutschen Juristen, Abitur, Studium, erste Staatsprüfung, Ausbildung in der Praxis, zweite Staatsprüfung.
Ich sei also Deutscher, stellte er fest. Er habe auch deutsche Vorfahren. Er heiße East. Der Name sei anglisiert worden. Er sei ursprünglich länger gewesen, so etwas wie „castle“ sei eigentlich anzuhängen.
Ost, Osten, Ostburg. Ich war zufrieden, das Gespräch bewegte sich in den persönlichen Bereich. Ich sagte wieder „etwas Nettes“: Vielleicht hätten seine Vorfahren dem Adel angehört, wenn das Wort „Burg“ ein Teil des Namens gewesen sei. Das könne gut sein, er sei ja blond. Viele Mitglieder des deutschen Adels seien blond. Ich erkannte die Gelegenheit, mich interessant zu machen, anzugeben. Ich fragte ihn, was denn Adel für einen Amerikaner bedeute, hier gebe es ja so etwas nicht, ob Adel für ihn etwas sei wie aus einem Märchen.
So sei es wohl, meinte er.
Ich erzählte ihm, bei der letzten Party, die ich in Deutschland besucht hätte, seien nur Adlige gewesen, außer mir. Meine Freundin sei adlig. Das bedeute nicht viel heutzutage. Sie arbeite wie jedermann. Eben noch der Name. Und dann der Umgang … Auf ihren Partys sei ich meistens der einzige Bürgerliche. Manche Gäste meiner Freundin seien sicher entsetzt, dass sie so etwas wie mich einlade. Aber andere seien sehr nett zu mir und hätten mich auch schon eingeladen. Dass die so genannten Adligen sich von Bürgerlichen wesentlich unterschieden, hätte ich nicht feststellen können. Sicher, in der Regel ein geschliffenes Benehmen … Ein paar Adlige, die ich kennengelernt hätte, seien mir recht seltsam vorgekommen, leicht beschränkt, dazu nicht gerade attraktiv.
„Ah, yes, the intermarriage“, bemerkte er. Die Inzucht. Oh, rief ich aus, er wisse ja bestens Bescheid.
Ein nackter Mann tauchte plötzlich vor mir auf, kam vermutlich aus der Sauna, deren Tür ein paar Schritte von unserer Ecke entfernt war, ließ sich auf die Polsterbank fallen, neben den Hellblonden, starrte zu dem Fernsehgerät hin.
Der Dunkelblonde wollte wissen, wo ich in Deutschland wohnte. Ich sagte es ihm.
Ah, Stuttgart sei doch die Stadt, wo Mercedes sei. Mörsihdes.
Ja, in einem Vorort. Ein zweites Werk befinde sich in Sindelfingen, nicht weit von Stuttgart. Ich sagte ein paar lobende Sätze über meine Heimat. Die Lage Stuttgarts in einem weiten Tal, das barocke Neue Schloss, das Alte Schloss im Renaissancestil, in einem seiner Türme die Kronjuwelen der Könige von Württemberg. Von Heidelberg habe er sicher auch schon gehört. Das wunderbare Schloss dort, auch Renaissance, aber größer und prunkvoller als das Alte Schloss in Stuttgart, zerstört von einem Feldherrn Ludwigs des Vierzehnten von Frankreich, teilweise wieder aufgebaut, an einem Hang gelegen, von Wäldern umgeben, ein Inbegriff des Romantischen.
Wie diese Stadt heiße.
Heidelberg.
Kenne er nicht.
Das sei seltsam. Heidelberg sei hier meines Wissens sehr bekannt. Die meisten Amerikaner, die nach Deutschland kämen, besuchten Heidelberg. Ob er nicht auch mal nach Europa fliegen wolle.
Europa interessiere ihn nicht besonders, behauptete er. Er wolle lieber bald einmal in eine Reservation fahren. Seine Vorfahren mütterlicherseits seien Indianer.
„Oh really! Then you belong to these persons who really have got the right to live here.“ Dann gehöre er zu den Personen, die wirklich das Recht hätten, hier zu leben.
Er lächelte. „I don’t want to go that far.“ So weit wolle er nicht gehen. Er fügte hinzu, er fühle sich seinen indianischen Verwandten sehr verbunden. Er erwähnte ihren Kampf gegen Entwürdigung und Unterdrückung. Seine Großmutter habe der Führerschicht angehört und habe sich Umsiedlungen widersetzt. Das alles bedeute ihm viel.
Ich sah in sein Gesicht, keine Schlitzaugen, keine starken Backenknochen, die Nase wohl etwas breit, aber so wie man sie in Hamburg oder Dänemark oft antreffen konnte; die freien Unterarme blond behaart.
Ja, ja. Ich könne allerdings nichts Indianisches an ihm erkennen. Er sehe vollkommen germanisch aus.
Er griff mit zwei Fingern der rechten Hand an seine Backenknochen. Doch, da merke man es schon.
Ich verneinte.
Na ja, vielleicht sei es weniger im Gesicht als in der Figur erkennbar.
Ich zuckte die Achseln. Ich stellte fest, es sei schon recht spät und ich hätte allmählich Hunger. Ob er schon zu Abend gegessen habe.
Er schüttelte den Kopf.
Ob ich ihn einladen dürfe, in ein Restaurant. Wenn er nichts Besseres zu tun habe … Ich würde mich sehr freuen. Wir könnten uns dann noch eine Weile unterhalten. Das sei ungemein interessant für mich.
Gut, meinte er einfach.
Ich war eigentlich überrascht, dass er zusagte. Es war Freitagabend, und dieser Südkalifornier, dieser gut aussehende junge Mensch, wollte mich, irgendeinen Deutschen, der sich in Hollywood aufhielt, in ein Restaurant begleiten. Ich schlug ein Lokal in der Nähe meines Hotels vor. Er war einverstanden.
Wir erhoben uns, grüßten den Hellblonden auf der Bank. Ich ergriff meine Tasche, mein Begleiter die seine. Er war mittelgroß, ich überragte ihn mindestens um zehn Zentimeter. Wir drängten uns an zwei Jungen vorbei, die sich auf dem Seitengang vor den Spinden umzogen. Wir näherten uns der Tür zum Vorraum. Sie ging auf. Ein junger Mann erschien, blond, mittelgroß, stämmig. Er begann zu lachen.
„Hi!“, rief er aus und gab meinem neuen Bekannten die Hand. Wo er denn gewesen sei, wollte dieser wissen.
Der andere sagte, es tue ihm Leid, dass er sich verspätet habe, aber ein Freund habe ihn besucht, und er sei ihn nicht so rasch wieder losgeworden. Ob sie ohne ihn gespielt hätten.
„Of course. Now you have to play with yourself.“
Der andere schlug ihm lachend auf die Schulter: „You old bastard! Is Larry still here?“
„No, he left quite a while ago. He has got a date.“
„Yeah, this old fucker.“
Mein Bekannter lächelnd: „Take it easy!“
„Well then, bye!“
Wir schoben uns an ihm vorbei. Durch einen Vorraum, einen teilweise überdachten Hof, die Eingangshalle.
Wir traten ins Freie. Über uns ein wolkenloser Nachthimmel. Ein starker kalter Wind war aufgekommen. Mein Begleiter blieb stehen, öffnete seine Sporttasche, holte einen Pullover heraus, zog ihn an. Die Stufen hinab zum Gehweg an der Hudson Avenue. Wir gingen nebeneinander her, nordwärts, den Lichtern des Hollywood Boulevards entgegen.
Sein Gesicht bläulich im Halbdunkel, zu mir emporgewandt.
„How did you know about the Y?“ Wie ich auf das Haus des YMCA gekommen sei.
Ich antwortete, ich besäße einen amerikanischen Reiseführer für Los Angeles, dort sei dieses YMCA aufgeführt. Ich hätte auch schon in New York Einrichtungen des YMCA besucht. Die Hallenbäder des West Side Y, des Vanderbilt Y und des McBurney Y, Ende Mai, Anfang Juni, als die öffentlichen Hallenbäder geschlossen gewesen seien und es zu kühl gewesen sei, um schon im Freien zu schwimmen.
„How did you like New York?“
Ich begann, von Manhattan zu schwärmen, der Skyline bei Tag und bei Nacht, der Aussicht vom Dach des Rockefeller Center aus, dem stillen Fort Tryon Park am Hudson, den Sonntagnachmittagen auf dem Washington Square, wo sich irgendwelche Bands einfanden und Leute zu der Musik tanzten, der 42. Straße zwischen 6. und 8. Avenue als Corso der Lebenshungrigen, von ungeheuer schwungvollen Theateraufführungen am Broadway, von frischen und nackten Schauspielen, die ich in Greenwich Village gesehen hatte …
Wir bogen in den Hollywood Boulevard ein. Im Gegensatz zur Hudson Avenue war er hell erleuchtet, von hohen gebogenen Straßenlaternen aus, von zahllosen Schaufenstern her; die meisten Geschäfte noch geöffnet. In den Gehweg eingelassen die Sterne für die Großen des Films … die Großen, sagen wir: die Erfolgreichen des Films. Am Rand beider Gehwege zur Fahrbahn hin mittelhohe Lorbeerbäume, das Ruhmessymbol der Alten Welt für hysterische Fleischberge, schwule Säufer, hemmungslose Ausbeuter der Neuen. Und die Menschen, die uns entgegentrieben … Der Hollywood Boulevard eine der wenigen Straßen in Los Angeles, auf der zahlreiche Menschen auch abends gingen. Gerade näherten sich uns zwei Mulattinnen, groß, sehr schlank, schmale, edle Gesichter, sie hatten wohl eine spanische Beimischung.
Ob er schon in New York gewesen sei, fragte ich ihn.
Er bejahte. Er teile meine Meinung, dass es eine sehr interessante Stadt sei, aber leben wollte er dort nicht.
Ich entgegnete, ich liebte New York, trotz des Drecks auf den Straßen, trotz des Smogs, der ab und zu auftrete, trotz der Elendsviertel, einer Schande für dieses reiche Land, trotz der zahllosen Räuber und Mörder, von denen man sich bedroht fühle.
Er wollte wissen, ob ich hier schon in einem Kino gewesen sei.
Ich zögerte. Dieser Pornofilm … ob ich es sagen sollte. Warum denn nicht? „Only once. But I must admit it was a dirty movie.“
Er lächelte. „A dirty movie?!“
Ja. Es sei am vergangenen Montag gewesen. Was könne man schon an einem Montagabend tun …? Da sei ich eben in diesen Pornofilm gegangen.
Ich ergriff seinen Arm, deutete auf den Boden. Wir blieben stehen. Ob er es je beachtet habe, hier sei der Stern der Monroe.
Nein, sei ihm noch nicht aufgefallen.
Wir gingen weiter. Ich nannte Marilyn Monroe genial als Schauspielerin und Frau, sprach von ihrer Ausstrahlung, ihrer Stimme, ihrem Gang, ihrem Körper. Ich hätte fast alle Filme gesehen, in denen sie mitgespielt habe.
Auch ihm gefiel sie sehr.
Ob er wisse, wo ihr Grab sei. Nein.
Schade, ich würde es gerne besuchen. Wahrscheinlich sei es auf dem Hollywood Cemetery. Ich wolle mal hingehen, vielleicht würde ich es finden.
Wir überquerten die Highland Avenue. Ungefähr zweihundert Meter nach Norden die neugotische Methodistenkirche, angestrahlt, vor dem dunklen Wall der Santa Monica Mountains.
Er fragte, ob ich den Film „Erdbeben“ gesehen hätte. Ich verneinte.
Das sei schade. Er sei sehr aufregend, und es werde viel von Los Angeles gezeigt.
Ich erwiderte, ich hätte mit mir gerungen, ob ich den Film ansehen solle oder nicht, aber dann hätte ich mir gesagt, dass ich eines Tages nach Los Angeles fliegen würde und mich die Bilder dann verfolgen würden.
Er sagte, vor ein paar Jahren sei im San Fernando Valley ein Erdbeben gewesen. Ein Krankenhaus sei eingestürzt, eine Kirche, eine Brücke …
Sei mir bekannt. Ich wies auf die nachtumhüllte Bergkette. Das sei da drüben gewesen, da drüben. Ob er keine Angst vor Erdbeben habe.
Ich sah ihn an. Er schüttelte den Kopf. Ich fragte ihn nicht nach dem Grund seiner Gelassenheit, ich wollte diese Wunde, die jeder Kalifornier hat, nicht länger berühren.
Auf der anderen Seite des Boulevard Grauman’s Chinese Theatre, diese beeindruckende graubraune Scheußlichkeit, in den touristenbetrampelten Zementplatten des halbkreisförmigen Vorhofs die Abdrücke der Hände und Schuhe und die Namenszüge von „Filmgrößen“.
Über eine Terrasse ins Restaurant, das ich jeden Tag besuchte, seit ich in Hollywood war.
Die Empfangsdame kam uns entgegen, lächelte mich an. „Here you are again!“
„Yes, I have brought a friend with me.“
„That’s nice. Come along!“
Sie führte uns an einen Tisch für zwei Personen.
„How about this table?“, fragte sie.
„Yes that’s fine. Thank you.“
Sie legte zwei Speisekarten auf den Tisch. „Enjoy yourself! The waitor will be right with you.“
„Thank you.“
Ich bat meinen Bekannten, Platz zu nehmen. Wir setzten uns, sanken ein in die Polster, die mit rotem Kunstleder überzogen waren. Dunkles Holz bedeckte die Wände, aufgeteilt in hohe rechteckige Felder durch kannelierte Leisten, Renaissance amerikanisch.
„A nice place“, stellte mein Bekannter fest.
‚Ja, es ist hübsch hier‘, sagte ich. ‚Aber im Grund widerspricht es meiner Überzeugung, solche Restaurants wie das hier zu besuchen oder in einem so feinen Hotel zu wohnen, wie ich es jetzt tue. Ich suche schon lange nach einem Weg, mich von diesem Wohlstand zu lösen. Meine Arbeit, mit der ich mir all das hier ermögliche, interessiert mich nicht. Na ja, vielleicht zu viel gesagt. Es gibt schon Fälle, die ich gern mache … solche zum Beispiel, bei denen nicht schon alle Probleme in der Rechtsprechung oder wissenschaftlichen Literatur behandelt sind, wo man eine eigene Lösung finden muss. Natürlich auch … man kann mit einer juristischen Ausbildung manchmal Leuten helfen, von denen man meint, dass sie es verdienen. Das ist eine gewisse Befriedigung. Und trotzdem ist mir mein Beruf zuwider. Eine dauernde Hetze, Stöße von Akten Tag für Tag, jeden Schriftsatz muss man in Eile diktieren, wird immer wieder gestört, Anrufe, Besucher. Und die vielen Überstunden. Ich habe den Eindruck, dass mir die restlichen Tage meiner … meiner Jugend gestohlen werden. Mein eigentliches Leben beschränkt sich auf die Sonntage, manche Samstage und ein paar Urlaubswochen. An den Werktagen bin ich todmüde, ausgebrannt, wenn ich abends nach Hause komme, und kann mich allenfalls noch vor den Fernseher setzen. Andererseits ist es so angenehm, sich nicht einschränken zu müssen, gepflegte Hotels, Einzelzimmer mit Bad, Restaurants wie das hier, sauber, Essen bekömmlich, kein Fett, von dem mir übel wird, einmal im Jahr in die Staaten, Ostküste, Westküste, in die Freiheit, wo die Leute „hip“ sind.‘
‚Warum kommen Sie nicht herüber und leben hier?‘
‚Ich habe mir schon die Frage gestellt, ob das zu machen sei. Es dürfte sehr schwierig sein. Wovon könnte ich in diesem Land leben? Ich habe deutsches Recht studiert. Wertlos hier.‘
Ein Hilfskellner mit erkennbar indianischem Einschlag, wohl ein Mexikaner, stellte zwei große rote Gläser Eiswasser auf den Tisch.
Ich sagte: ‚Wir müssen etwas aussuchen. Was essen Sie gerne? Ein Steak, was vom Huhn, Hamburger?‘
‚Ich habe keinen Hunger. Ich nehme nur einen Salat. Haben Sie hier schon Salat gegessen?‘
‚Nein.‘
‚Sollten Sie tun. Kalifornien ist berühmt für seine Salate.‘ California is famous for its salads.
‚Aber nur von Salat werden Sie doch nicht satt. Nehmen Sie etwas dazu!‘
‚Nein, der Salat reicht mir. Es ist spät.‘
Der weiße Oberkellner trat zu uns, lächelnd. „How are you?“
„Fine, thank you“, antwortete ich.
„Are you ready to order?“
„Yes.“
Mein Bekannter deutete auf die Speisekarte, bestellte irgendeinen Salat und Tee. Ich bat um Brunchburger, eine Art Hamburger mit Ei, und Tee. Der Kellner wiederholte das Gesagte beflissen, fragte mich, wie stark das Fleisch gebraten werden solle, bedankte sich, nahm die Speisekarten, ging weg.
‚Ich habe doch vorhin diese Party erwähnt‘, sagte ich, ‚diese Party vor meinem Abflug. Ich unterhielt mich mit einem jungen Baron. Ich kannte ihn von anderen Festen her. Er war immer sehr freundlich zu mir. Er fragte mich, wie es mir gehe. Ich erzählte ihm von meinem Beruf, von dem Stress. Der Baron hat ein Gut und bewirtschaftet es selbst. Er meinte, er als Bauer habe einen natürlichen Beruf, der ihm großen Spaß mache, aber bei mir sei das so … er sagte wörtlich: ‚Die Zeit, die Sie im Büro verbringen, haben Sie nicht gelebt.‘ Und das sogar von einem Baron, einem Konservativen!‘
„What is a baron? Is he royalty?“ Ob ein Baron Mitglied eines Königshauses sei.
„No. Something very low.“ Nein, sondern etwas ganz Niederes.
„But still royalty?“
Ich verneinte noch einmal. Nun musste ich ihm die Hierarchie des deutschen Adels erklären, ich tat es rasch, ungeduldig.
‚Der Baron hat Recht‘, sagte mein Bekannter dann. ‚Ich bin ausgestiegen … aus dem Zugabteil, das meine Eltern für mich gerichtet hatten.‘
Er erzählte. Ich verstand nicht jedes Wort, da ich ihn nicht durch Fragen unterbrechen wollte, wohl aber die Grundlinien. Nach dem Militärdienst hielt er sich einen Sommer bei seiner Familie in Ohio auf. Er erkannte, dass er ihre Lebensweise nicht mitmachen konnte. Schon als Junge hatte sich in ihm Widerspruch geregt. Die abgerundeten Überzeugungen seiner Eltern, die feste Ordnung, die sie als unabänderbar hinnahmen, Gott, der Präsident, der Kongress, Amerika und die restliche Welt, weiß und schwarz, reich und arm. Seine Eltern wünschten, dass er die Universität besuche und eines Tages das Geschäft seines Vaters übernehme. Aber für beides interessierte er sich nicht. Er wollte leben. Am Ende des Sommers erklärte er seinen Eltern, er gehe nach Kalifornien. Alles, was man über Kalifornien hörte, das freie Leben dort, zog ihn an. Er wollte herausfinden, was daran sei. Er reiste nach San Francisco. Er arbeitete zunächst als Zeitungsausträger, dann als Wagenwäscher. Er nahm alle möglichen Jobs an.
Eines Tages bat ihn ein Typ, den er öfters getroffen hatte, er solle ihn und seine Familie besuchen. Er ging hin, erwartete, den Eltern und Geschwistern seines Freundes zu begegnen. Aber es war eine Kommune. Sie setzte sich aus acht Männern, drei Frauen und zwei Kindern zusammen. Sie wohnten in einem großen alten Haus. Es hatte drei Stockwerke. Im Erdgeschoss befand sich der Wohnraum mit Fernsehgerät und Stereoanlage, außerdem die Küche; im ersten Stock und unter dem Dach lagen die Schlafzimmer. Der Freund forderte ihn auf, sich seiner Familie anzuschließen. Er tat es, bekam ein eigenes Zimmer im Dachstock. Es war wunderbar. Sie nahmen einmal am Tag eine gemeinsame Mahlzeit ein, um die man sich nur zu kümmern brauchte, wenn man Küchendienst hatte. Abends saßen sie meist zusammen, hörten Platten, rauchten Marihuana. Es dauerte häufig bis spät in die Nacht. So ging er oft „stoned“ zur Arbeit. Besonders gut an der Sache war, dass man Menschen hatte, die einem halfen, wenn man krank war oder wenn sonst etwas schieflief. Herrlich waren die Kinder. Sie wuchsen ganz frei auf. Er beschäftigte sich besonders mit einem Jungen, um ihm eine Bezugsperson zu geben. Der Junge erschien ihm ein wenig desorientiert. Es gab drei Mädchen, zu denen der Bub ‚Mutter‘ sagen konnte. Die leibliche Mutter, die sich vom Vater des Jungen getrennt hatte, kümmerte sich nicht viel um das Kind.
Ob es in der Kommune nie Streit gegeben habe, wollte ich wissen. Selbstverständlich hätten sie ab und zu gestritten, sagte er. Er habe die „Familie“ verlassen, weil er mit einem der Burschen nicht ausgekommen sei. Trotzdem sei es ein wunderbares Jahr gewesen.
Vielleicht gehe er eines Tages wieder nach San Francisco.
Der Kellner brachte das Essen.
Ich aß ein paar Bissen, fragte dann: ‚Wie war es mit den Mädchen? Waren … galten sie als das Eigentum bestimmter junger Männer, und hatten sich die andern von ihnen fern zu halten?‘
‚Nein, die Mädchen waren niemandes Eigentum, es sei denn, sie wollten es.‘
Ich hätte gerne mehr von den Beziehungen der Mitglieder der Kommune zueinander erfahren, aber ich scheute mich, weiterzufragen. So sagte ich: ‚Seit wann sind Sie hier in Los Angeles?‘
‚Seit drei Jahren. Als ich die Kommune verließ, fuhr ich hierher und nahm wieder irgendwelche Jobs an. Aber jeder Job, den ich bekam, war ein bisschen besser als der vorhergehende. Gegenwärtig arbeite ich vier Tage in der Woche.‘
‚Vier Tage! Das ist gut!‘ Was war es wohl für eine Tätigkeit?
‚Hier nebenan habe ich auch schon gearbeitet.‘
Schade, er sagte nichts weiter über seinen Viertagesjob. Vielleicht wollte er nicht darüber sprechen … der Vergleich mit meinem Beruf …
Er fuhr fort: ‚Ich habe die Hauspost verteilt. Die Sekretärinnen waren furchtbar albern. Ich glaube, sie kamen im Büro kaum mit Männern zusammen. Jedenfalls begannen sie, immer wenn ich auftauchte und ihnen was brachte, zu kichern und tuschelten miteinander.‘
Der blonde Frühlingsgott erscheint bei den Arbeitsbienen im Großraumbüro. Wahrlich ein Ereignis.
Plötzlich interessierte mich sein Vorname. „What’s your first name?“
„Roy.“
Das sei ein hübscher Name. Ich nannte ihm meinen Rufnamen, dann den Nachnamen, buchstabierte beide.
Er sprach sie nach.
Meine Neugier trieb mich weiter. ‚Wie lebt man hier? Viele Partys natürlich …‘
‚Na ja, aber meistens sitzt man doch bloß vor dem Fernsehgerät.‘
‚Wie?! Irgendwo muss doch hier was los sein!‘
‚Ja, so nachts um elf rennen die Leute auf die Straße.‘
‚Und dann geschieht alles?‘ And then everything happens.
‚Ja.‘
Eine seltsame Auskunft, mit der ich nichts anzufangen wusste.
Ich stieß nach. ‚Gehen Sie öfters zu Partys?‘
‚Ab und zu. Aber ich gehe nicht gerne hin. Man spricht mal mit dem, mal mit jenem, ohne dass einen die Leute interessieren.‘
‚Es muss doch hier auch wilde Partys geben.‘
‚Ja, gibt es. Ich war auf ein paar. Es wäre mir peinlich, wenn ich Ihnen davon erzählen würde.‘ I would be embarrassed to tell you of them.
Ich bat ihn, mir trotzdem ein bisschen zu erzählen, ich sei ein moderner Mensch.
‚Also eine … Da war so eine Anzeige in der „Los Angeles Free Press“. Das Übliche: „Swinging party, guests welcome …“ Ich rief an, und sie fragten mich, ob ich Polizist sei, wie ich aussähe, wie alt ich sei und so. Als ich dann ankam, musste ich einen Wertgegenstand hergeben für den Fall, dass ich in dem Haus irgendetwas beschädigen würde.‘ Er sprach nun ziemlich rasch, verschluckte auch Silben. Ich erfasste vom Folgenden nur so viel, dass Spiele stattfanden, zu denen ein Zeremonienmeister anleitete, beispielsweise führten mehrere Paare „etwas“ vor, die anderen sahen zu. Er mochte das nicht.
‚Das kann ich verstehen. Hätte mir auch nicht behagt. Zu organisiert.‘
„I did never answer an ad like that again. But before I was interested in the sex part of it.“ Er antwortete nie wieder auf eine solche Anzeige. Aber zuvor hatte ihn das sexuelle Abenteuer gelockt.
Ich wollte mehr wissen von dieser Seite des kalifornischen Lebens, von dieser Möglichkeit der Befreiung. ‚Waren Sie auch mal auf einer Party, die, sagen wir, auf eine ganz natürliche Weise in eine Orgie überging?‘
‚Ja, zum Beispiel … Ein Freund nahm mich zur Party eines Typs mit, den er kannte. Dieser Freund meines Freunds lebt in einem schönen Haus mit Swimmingpool in Beverly Hills. Er hatte einen Meskalinpunsch gebraut. Wir tranken alle davon, er sagte uns, was es war. Wir wurden wirklich high. Wir zogen uns alle aus, rannten nackt durchs Haus, durch den Garten, sprangen ins Schwimmbecken. Und ich machte Sachen, die ich nie zuvor getan hatte. Aber ich fühlte mich nachher nicht schmutzig oder schuldig. Ich fühlte mich zutiefst befriedigt.‘ And I did things I had never done before. But I didn’t feel dirty or guilty afterwards. I felt deeply satisfied.
‚Ja, so sollte es sein. Wenn es sich bei einer Party ergibt, dass sich die Leute ausziehen und so … das ist wirklich nichts Schlechtes. Ein harmloses, vollkommen natürliches Vergnügen. Aber, was solche Dinge betrifft, müssen wir immer innere Schranken überwinden. Unser christliches Erbe.‘
‚Ich habe mich davon ziemlich gelöst. Ich neige eher dem Zenbuddhismus zu, habe mich allerdings noch nicht gründlich genug damit befasst. Aber ich glaube an eine Art göttlichen Geist, der in uns einströmt und wirkt.‘ … I believe in some kind of divine spirit … Ein mattes „yes“ huschte über meine Lippen. Aber vielleicht hatte seine Religiosität doch einen gewissen Sinn, ich fand, dass eine große Ruhe von ihm ausging, eine Ruhe, die ihn keinesfalls leidenschaftslos oder gar langweilig erscheinen ließ, eine Ruhe, die seine Stimme ausfüllte, diese Baritonstimme, die manchmal ganz leichte nasale Laute hervorbrachte.
Ich sprang zum Thema „Partys“ zurück. Ich erzählte ihm von einem Sommerfest bei meiner Freundin. Die Anwesenden waren nach meiner Schätzung fast alle jünger als dreißig, ein paar knapp darüber. Ich war der einzige Bürgerliche. Wir tanzten, tranken Bowle, unterhielten uns. Niemand gab einer anderen Person einen Kuss, kein Paar tanzte besonders eng oder ekstatisch wild. Alle waren freundlich zueinander, höflich, wohlerzogene Knaben und Mädchen. Es wurde spät, der Himmel war schon blass, ein Teil der Gäste war gegangen, der Rest saß auf der Terrasse, gedämpftes Lachen, small talk. Plötzlich rannte der Hund meiner Freundin zu uns heraus, sprang auf ihren Schoss. Sie trug ein langes rosa Abendkleid, ziemlich tief ausgeschnitten. Der Hund fühlte sich offenbar nicht genug von ihr beachtet, richtete sich auf, verfing sich mit einer Pfote in ihrem Ausschnitt. Meine Freundin lachte leicht verlegen, bemerkte „Na, was machst du denn da?“, holte die Pfote aus dem Ausschnitt, setzte den Hund auf den Boden. Ich zögerte, aber dann sagte ich in diesen Kreis junger Leute, von denen einige Namen trugen, die man aus Geschichtsbüchern kannte: „Der Hund ist derjenige, der sich heute Abend am unanständigsten benommen hat.“ Ein paar lächelten, aber meinen Spott bemerkte wohl niemand.
Meine Äußerung über den Hund freute ihn. Er wiederholte die Wendung „… who behaved naughtiest …“, dazu dieses Lächeln, das ich als „schelmisch“ bezeichnen möchte, aufleuchtend, ohne sich zu jenem übermäßigen Strahlen zu verdichten, wie es bei Selbstzufriedenen oft vorkommt, nicht boshaft, spöttisch oder überlegen, eher wohlmeinend, sanft, echt vergnügt.
Unsere Teller waren leer, meinen Tee hatte ich ausgetrunken, er seinen wohl auch. Ich fragte ihn, ob er noch etwas essen oder trinken wolle. Er verneinte.
‚Haben Sie noch Lust, mit mir auf einen Drink in die Bar meines Hotels zu gehen? Es ist Tanz dort. Allerdings nicht viel los.‘
‚Wäre nett. Aber ich möchte noch einen Bus erwischen, unten am Sunset Boulevard.‘
‚Schade.‘
‚Ja. Haben Sie morgen schon etwas geplant? Ausflug oder so?‘
‚Nein.‘
‚Dann könnten Sie mich morgen früh besuchen. Es interessiert Sie vielleicht, wie man hier so wohnt. Bei mir im Garten stehen ein Orangenbaum und ein Zitronenbaum.‘
‚Was?! Und was daran wächst, kann man essen?‘
‚Aber ja! Ich wohne in einer alten Garage, also nichts Luxuriöses. Aber mir gefällt es. Die Garage habe ich von einem alten Ehepaar gemietet. Sie sind sehr nett.‘
‚Ich besuche Sie natürlich gerne. Aber morgen früh … Ich bin ein fauler Mensch, ich schlafe sehr lange, wenn ich die Gelegenheit dazu habe.‘
‚Morgen Nachmittag gehe ich eben zu einem Rockkonzert und bleibe mit den Leuten zusammen, die ich dort treffe.‘
‚Ach so. Ja … dann werde ich mich eben bemühen, bald aufzuwachen. Wo wohnen Sie denn?‘
‚In der Stanley Avenue.‘
‚Kenne ich nicht. Wo liegt die?‘
‚Es ist eine Seitenstraße des Sunset Boulevard. Nicht sehr weit von hier.‘
Ich ließ es mir näher beschreiben, nach Westen, vier Blocks vor der Fairfax Avenue, Südseite des Sunset Boulevard, Busnummer, Hausnummer.
Wir erhoben uns, ergriffen die Sporttaschen. Ich nahm die Rechnung, die der Kellner irgendwann hingelegt hatte, zog aus dem Geldbeutel einen Dollarschein und schob ihn neben meine Teetasse. Wir begaben uns zur Kasse, ich bezahlte.
Wir verließen das Lokal. Auf einer Terrasse entlang dem Hollywood Boulevard zur nächsten Kreuzung. Die Ampel war auf Rot.
Ich hatte Mühe, auf einem Fleck stehen zu bleiben, so stark war der Wind geworden. Grün. Über die Straße.
‚Sie brauchen mich nicht zu begleiten. Dieser Wind … Ich gehe rasch hinunter. Bleiben Sie da!‘
Ich wusste nicht recht, was ich tun sollte. Warum sollte er sich allein diesem üblen Wetter aussetzen? Aber dann siegte meine Furcht vor einer Erkältung. Wir blieben auf dem Gehweg stehen.
Ich nahm seine Hand, drückte sie fest. ‚Na gut, Sie ahnen nicht, was Sie mir für eine Freude gemacht haben, dass Sie sich so lange mit mir unterhalten haben. Und dass Sie diesen blöden Deutschen sogar zu sich einladen …‘ … this dumb German …
‚Es hat auch mir großen Spaß gemacht.‘
‚Kann ich nicht glauben.‘
‚Doch!‘
Ich ließ ihn los. „Good night, Roy! Take care of yourself.“
„Yes, good night!“
Im Aufzug des Hotels fragte ich mich, ob es wohl richtig war, meinen Bekannten mit „Roy“ anzureden. Vielleicht wäre es angebracht gewesen, den Nachnamen zu verwenden und abzuwarten, bis er erwiderte, ich solle „Roy“ zu ihm sagen.
Ich betrat mein Zimmer. Das breite Bett mit rosa Überwurf, der braune Teppichboden, die weiß getünchten Wände, die graugrüne Kommode, auf der ein Fernsehgerät stand, am Fenster das graugrüne Tischchen und zwei Sessel, die mit rosa Stoff bezogen waren. Und der breite Spiegel über der Kommode. Mein Gesicht … jung, ja, es wirkte gerade recht jung, die Haut bleich, sehr sauber und gestrafft vom Duschen, die braunen Haare stark zerzaust, die dunkelgrüne Iris der großen Augen, der Schnurrbart, die gerade Nase, dieses Gesicht, mit dem ich vielleicht hätte Schauspieler werden können, jugendlicher Liebhaber, anstatt ein „Paragraphenreiter“, „Rechtsverdreher“, Vorschriftensklave, dieses Gesicht, in das meistens Akten starrten oder die Nacht, meine Jugend vergeudet an ein Studium, für das ich mich nie hatte begeistern können, dieser spröde, leblose Lernstoff, dieses Nachbeten der Meinungen von Gerichten und Professoren, meine Jugend vollends zerbröckelnd in einem Beruf, der mich nicht erfüllte, in dem ich mich bisweilen als Dreschochse empfand, in dem ich oftmals Leuten gegen meine rechtliche oder zumindest philosophische Überzeugung Übel zufügen musste, meine Jugend eingetauscht gegen Sicherheit, monatliche Einkünfte, Krankenversicherung, Altersversorgung.
Dieser Lärm draußen, aufeinander schlagende Gegenstände, ein Pfeifen und Brausen. Ich trat ans Fenster. Die schwarze Ebene von Los Angeles breitete sich vor mir aus, übersät mit flimmernden Lichtern, die nach Osten, wo die Hochhäuser der Innenstadt liegen mussten, wie von einer Explosion hochgeworfen erschienen. Die hohen Palmen, die den Sunset Boulevard säumten, bogen sich unter den heranjagenden Luftmassen, auch die wuchtigen Kiefern an der Lanewood Avenue, die zwischen dem Hollywood Boulevard und dem Sunset Boulevard verlief. Es war geradezu ein Sturm. Und der arme Roy jetzt da unten am Sunset Boulevard. Hoffentlich kam er heil nach Hause, ein umstürzender Baum, ein umherfliegender Gegenstand an seinen Kopf …
Ich trug die Lufthansatasche ins Bad, packte das feuchte Handtuch, die nasse Badehose aus, hängte