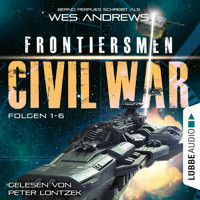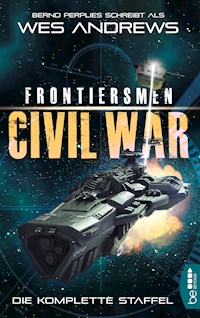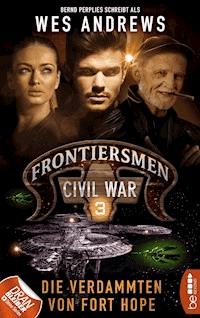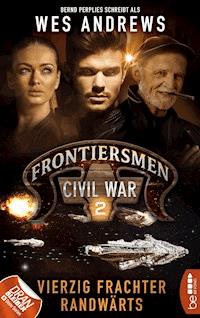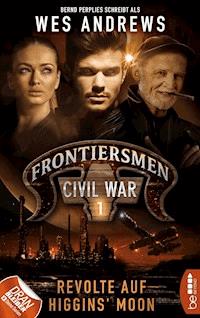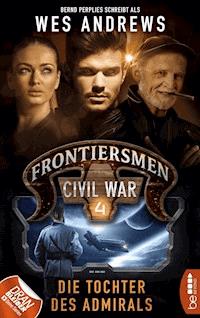6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beBEYOND
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Frontiersmen
- Sprache: Deutsch
Der wildeste Ritt durchs All seit der Erfindung des Hyperantriebs ...
Der Raumhafen auf dem Planeten Alvarado ist ein Sprungbrett zu vielen Randplaneten. Entsprechend gut laufen die Geschäfte. Seit Jahren schon streiten zwei Familien um die Kontrolle über diesen Umschlagplatz, und mittlerweile wird die Fehde mit harten Bandagen geführt. In diesen Kleinkrieg geraten John Donovan und seine Crew, als sie nichts weiter als ein paar Rinder verkaufen wollen. Und auf einmal muss John verdammt schnell lernen, auf zwei Hochzeiten zu tanzen, wenn er sich keine Kugel einfangen will.
Das rasante Science-Fiction-Western-Crossover von Wes Andrews (alias Bernd Perplies) - jetzt als eBook bei beBEYOND! Pflichtlektüre für Space Cowboys!
eBooks von beBEYOND - fremde Welten und fantastische Reisen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
– 1 –
– 2 –
– 3 –
– 4 –
– 5 –
– 6 –
– 7 –
– 8 –
– 9 –
– 10 –
– 11 –
– 12 –
– 13 –
– 14 –
– 15 –
– 16 –
– 17 –
– 18 –
– 19 –
– 20 –
– 21 –
– 22 –
– 23 –
– 24 –
– 25 –
– 26 –
Danksagungen
Über dieses Buch
Der Raumhafen auf dem Planeten Alvarado ist ein Sprungbrett zu vielen Randplaneten. Entsprechend gut laufen die Geschäfte. Seit Jahren schon streiten zwei Familien um die Kontrolle über diesen Umschlagplatz, und mittlerweile wird die Fehde mit harten Bandagen geführt. In diesen Kleinkrieg geraten John Donovan und seine Crew, als sie nichts weiter als ein paar Rinder verkaufen wollen. Und auf einmal muss John verdammt schnell lernen, auf zwei Hochzeiten zu tanzen, wenn er sich keine Kugel einfangen will.
Über den Autor
Wes Andrews (alias Bernd Perplies) saß schon auf dem Rücken eines Pferdes, trug einen Colt an der Hüfte und hat nächtelang in Stiefeln geschlafen. Wenn er nicht gerade Romane schreibt, schaut er sich alte Filme an, streift durch die Natur oder spielt mit rauen Männern Karten. Er lebt mit Frau, Kind und Tieren in einem verschlafenen Städtchen in den Südstaaten.
Wes Andrews
BlutfehdeaufAlvarado
FRONTIERSMEN
Band 2
beBEYOND
Überarbeitete Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Dieses Werk wurde vermittelt durch die LiteraturagenturSchmidt & Abrahams
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Hanka Jobke, BerlinTitelillustration: Guter Punkt München unter Verwendungvon Motiven von Arndt Drechsler, RegensburgCovergestaltung: Guter Punkt, München
eBook-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-5698-4
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für Sergio Leone & Clint Eastwood,die den Western um Mundharmonikaspielerund Männer ohne Namen bereicherten.
Und für meine Eltern,die mich bei meinen Gedankenreisen
– 1 –
Für eine Hand voll Dollar, so lautete eine weithin bekannte Wahrheit, bekam man auf Alvarado alles.
Die Welt lag an der Grenze der Kernwelten und galt als Sprungbrett zu den Randplaneten. Aus diesem Grund wurden am Raumhafen der planetaren Hauptstadt Zaragoza, dem Hauptumschlagsplatz für Waren auf Alvarado, Hightech-Waffen ebenso gehandelt wie guter alter Whiskey, Kernweltenmode ebenso wie Tierfelle, chemische Düngemittel und Steuerelektronik für Terraformer ebenso wie Peko-Schmuck und Getreide.
Auch lebende Tiere wurden regelmäßig nach Alvarado importiert und dort einem festen Abnehmer übergeben oder auf den Warenmärkten zum Verkauf angeboten. Hühner, Schafe, grauhäutige, sechsbeinige Kamas von Loredo oder auch Rinder wechselten hier mit schöner Regelmäßigkeit den Besitzer. Rinder wie die, die John Donovan im Gepäck hatte.
Eine ganze kleine Herde Longhorns von Purcell stand in den beiden Frachträumen seines in die Jahre gekommenen Raumfrachters Mary-Jane Wellington und starrte von Medikamenten benebelt ins Leere, während sie stoisch auf Heuballen herumkaute und stinkende Fladen auf den mit Industriefolie ausgelegten Boden fallen ließ. Sie hatten nur drei Transits von Purcell bis nach Alvarado durchführen müssen, trotzdem war John der Flug so lange wie selten vorgekommen. Tiere gehören einfach nicht in Raumschiffe, in denen man kein Fenster aufmachen kann, dachte er zum wiederholten Mal in den vergangenen Tagen.
»Wo bleibt der Bursche nur?«, fragte sich Pat Hobel, genannt Hobie, der genau wie John auf einem ausgeklappten Liegestuhl im Schatten des Steuerbordfrachtraums der Mary-Jane saß. Unter der zerknautschten roten Schirmmütze – ein Markenzeichen, genau wie seine taschenreiche Weste und der kalte Zigarrenstumpen im Mundwinkel – kniff Johns langjähriger Freund und Mechaniker die Augen zusammen. Suchend ließ er den Blick übers Landefeld des Raumhafens schweifen, eine riesige, betonierte Fläche mit eingezeichneten Landezonen für Schiffe unterschiedlicher Größe, zwischen denen breite Zufahrtsstraßen verliefen.
John zog die Goldimitat-Taschenuhr aus seinem knielangen, grauen Mantel und warf einen Blick darauf. Eigentlich gehörte die Uhr einem Freudenhausbetreiber in Williamsport auf Briscoll. Er hatte dem Mann sein Eigentum längst zurückschicken wollen, aber irgendwie war er noch nicht dazu gekommen.
»Hm«, brummte er. »Hadden-Paton ist schon drei Stunden überfällig. Seltsam. Bei unseren Gesprächen machte er auf mich den Eindruck, als sei er ein Mann, nach dem man die Uhr stellen könnte.«
Henry Hadden-Paton war ein Rinderbaron, der irgendwo außerhalb von Zaragoza eine Farm besaß. Er hatte John und seine Leute engagiert, um zweihundert Tiere einer Rasse, die er hier ansiedeln wollte, von Purcell nach Alvarado zu bringen. Eine Anzahlung hatte der steife und in Johns Augen überkorrekte Ex-Unionsoffizier selbstverständlich geleistet. Dennoch wollte John auch den Rest seines Geldes sehen. Vor allem wollte er die Tiere loswerden, deren Futter langsam knapp wurde.
John steckte die Uhr wieder in die Manteltasche, schlug den Saum etwas zurück und zog das Komm-Gerät vom Gürtel. Er rief Kelly, die gemeinsam mit Aleandro und Piccoli im Schiff geblieben war, um die Rinder zu versorgen.
»Was gibt es, John?«, wollte seine blonde Partnerin wissen.
»Hat sich unser Geschäftspartner Hadden-Paton bei euch gemeldet?«, antwortete John mit einer Gegenfrage.
»Nein.«
Er verzog das Gesicht. »Seine Verspätung beginnt mir mehr und mehr Sorge zu bereiten.«
»Soll ich ihn anrufen?«
»Das wäre fantastisch. Danke, Kelly.«
»Kein Problem, John.«
Kelly hatte ursprünglich in den Kernwelten Medizin studiert, doch kurz vor dem Abschluss alles hingeschmissen, um hinaus ins All zu ziehen und das echte Leben kennenzulernen. John hielt das bis heute für eine etwas fragwürdige Geschichte, aber er war froh darüber, dass er ihr begegnet war – und das nicht nur, weil sie ihm an jenem Abend vermutlich das Leben gerettet hatte, als sie in einer Gasse buchstäblich über ihn gestolpert war.
John beschattete die Augen und ließ seinen Blick über das Landefeld schweifen. Die übliche Mischung aus Passagierraumern, Konzernfrachtern und Freischaffenden hatte sich an diesem Nachmittag am Raumhafen von Zaragoza eingefunden. Die aggressive, stahlgraue Form eines Patrouillenschiffes des Unionsmilitärs fiel John ins Auge. Außerdem schien eine Vaudeville-Truppe vor Kurzem gelandet zu sein, denn eines der Raumschiffe wies eine schreiend bunte Lackierung auf und blinkte aufdringlich im vorderen Bereich des Raumhafens. Bekannte Schiffe fand er nicht. Obwohl Alvarado seit jeher ein Treffpunkt für Frontiersmen war, die sich bis in die Kernwelten vorwagten, schienen sich im Augenblick alle seine Freunde und Feinde an einem anderen Ort aufzuhalten.
Sein Komm-Gerät piepte. Er hob es an die Lippen. »Und, Kelly, wie sieht es aus?«
»Nicht gut«, erwiderte die junge Frau. »Ich erreiche Hadden-Paton nicht, weder auf seinem persönlichen Komm-Gerät noch auf dem offiziellen Anschluss seiner Farm, den Aleandro mir aus dem Netz besorgt hat.«
»Das wollte ich nicht hören.« John fluchte leise. Dann warf er Hobie einen Seitenblick zu. »Wie es scheint, muss ich dem Burschen wohl einen Besuch abstatten.«
Er wandte sich wieder dem Komm-Gerät zu. »Kelly, kopier mir die Adresse unseres Geschäftspartners auf einen Speicherstift. Seine Farm liegt doch irgendwo außerhalb von Zaragoza. Ich fahre mit dem Schweber mal hin und erinnere den guten Mann an unseren Handel.«
»Ist gut«, erwiderte sie. »Ich bringe dir den Zylinder gleich in den Frachtraum.«
John stand auf.
»Soll ich mitkommen?« Fragend blickte Hobie zu ihm hoch.
»Nein, hilf lieber den anderen, die Tiere zu versorgen. Mit unserem guten Rinderbaron komme ich schon klar.«
»Wie du meinst, John.« Hobie zuckte mit den Achseln, bevor er sich ebenfalls erhob und beide Klappstühle einpackte.
Unterdessen stiefelte John zur offenen Rampe des Backbordfrachtraums hinüber. Als er sie erklomm, schlug ihm der Gestank von zu vielen Tieren auf zu engem Platz entgegen. Aus großen, gleichgültigen Augen glotzten ihn die Longhorns an, die hinter einer Absperrung den Frachtraum ausfüllten. Johns zweisitziger Landgleiter, ein Fargo-Ti27, parkte quer davor am oberen Rand der Rampe. Auf der kleinen Ladefläche zwischen den kegelförmigen Außentriebwerken stapelten sich Kisten, die derzeit keinen richtigen Platz im Frachtraum hatten.
»Aleandro«, rief John dem jüngsten Mitglied seiner Besatzung zu, einem zwanzigjährigen Vagabunden von Loredo, der ein wahrer Zauberer im Umgang mit Computern und anderer Feinelektronik war. »Komm mal her und hilf mir mit den Kisten.«
Der junge Mann mit dem schulterlangen Haar, dem weißgrauen Stirntuch und dem etwas gerupft wirkenden Bart lehnte seufzend die Schaufel an die Seitenwand des Frachtraums, mit der er soeben Exkremente in einen Eimer geschippt hatte. Vorsichtig schob er sich zwischen den Rindern hindurch. Er trug Gummistiefel und einen braunen Arbeitsoverall und sah damit aus wie ein jugendlicher Strafgefangener, den man zur Zwangsarbeit auf einer Farm verdonnert hatte.
»Ich bin so froh, wenn wir diese Mistviecher los sind«, stöhnte er, als er über das provisorische Gatter stieg.
»Ich gebe mein Bestes, damit dies noch heute geschieht«, erwiderte John. »Leider ist unser Kunde nicht aufgetaucht, sodass ich zu einem Hausbesuch gezwungen bin.« Er packte eine der klobigen Kisten am Griff.
»Wie unerfreulich.« Aleandro fasste die Kiste auf der anderen Seite und gemeinsam wuchteten sie sie zu Boden.
Kurz darauf hatten sie den Fargo frei geräumt. Sie stellten gerade die letzte Kiste ab, als Kelly aus dem Schiffsinneren durch die Luke in den Frachtraum trat. »John, deine Daten.« Sie wedelte mit einem kurzen, silbernen Speicherstift, während sie sich an den Rindern vorbeidrängte. Über das Gatter hinweg reichte sie ihn John. »Eine Stunde Fahrt etwa. Hadden-Paton lebt in den Sheridan Hills östlich der Stadt.«
»Danke, Kelly.« John nickte ihr zu, nahm den Stift und kletterte in den Fargo. Keine Minute später fuhr er mit dem Schweber schwungvoll die Frachtraumrampe hinunter. »Ich bin heute Abend wieder da«, rief er, bevor er beschleunigte und über das Landefeld davonschoss.
Etwas langsamer steuerte John den Fargo an den Raumhafengebäuden vorbei. Er passierte Ingberts Warenbörse, den verruchten Rocket-Girl-Club und die heruntergekommene, aber unter Frontiersmen legendäre Starship Cantina. John kannte keines der Etablissements aus persönlicher Erfahrung, doch Hobie erzählte immer wieder davon, wenn die Rede auf Alvarado kam. Früher, als die Mary-Jane Wellington noch unter dem Kommando des alten Sturges gestanden hatte, waren der Captain und seine Leute – darunter Hobie – häufiger an diesem Ort gewesen. Bevor John allerdings vor etwa zehn Jahren als junger Mann auf der Mary-Jane anheuerte, hatten sich Sturges’ Geschäfte bereits weiter randwärts verlagert. Es war erst das zweite Mal, dass John Zaragoza besuchte, und beim ersten Mal hatte er keine Zeit für heiße Mädchen und kühle Getränke gehabt.
Nachdem er den Raumhafenbezirk von Zaragoza hinter sich gelassen hatte, steuerte John den Schweber auf eine der Hauptstraßen, die ihn in östlicher Richtung aus der Stadt führte. Zahlreiche andere Gefährte waren unterwegs. Es handelte sich überwiegend um Radfahrzeuge und Fortbewegungsmittel, die auf Prallfeldern dahinglitten, aber auch vereinzelte Pferdegespanne fielen im Straßenbild auf. Deren Besitzer waren vermutlich Farmer aus dem Umland, die den Weg nach Zaragoza auf sich nahmen, um in der Stadt Geschäfte abzuwickeln.
Kaum dass John die Stadtgrenze hinter sich gelassen hatte, ließ der Verkehr spürbar nach. Alvarado war keine kleine Welt, aber ihre Kolonisierung hatte zerstreut stattgefunden, und die Einheimischen – überwiegend Farmer und Tierzüchter – verteilten sich über eine weite Fläche. Austausch mit fernen Nachbarn fand in den meisten Fällen durch die Luft statt. Nur hin und wieder donnerten riesige Lasttransporter mit mehreren Anhängern im Schlepptau von einem Zentrum zum nächsten.
Eine halbe Stunde fuhr John annähernd schnurgerade nach Osten. Links und rechts der Überlandstraße ließen die Anzeichen der Zivilisation immer weiter nach. Schließlich verschwanden sie ganz und das graue Band zog sich durch weites, leeres Grasland. Als die Gegend hügeliger wurde, schob John den Speicherstift ins Navigationssystem des Fargo und rief die Umgebungskarte auf, die Kelly ihm aus dem planetaren Datennetz abgerufen hatte. Dies erwies sich als vorausschauend, denn der Weg, der wenige Minuten später von der Hauptstraße abzweigte, war so unscheinbar, dass er mit Sicherheit daran vorbeigefahren wäre.
Über Stock und Stein ging es in die Wildnis. Struppiges Gras und niedriges Buschwerk bedeckten die flachen Hügelflanken. Gelegentlich ragte ein einzelner Baum auf. Der Schweber federte und wippte, während er auf seinen Prallfeldprojektoren über Bodenunebenheiten hinweg glitt. Eine Wolke aus Staub wehte hinter dem Fargo in den wolkenlosen Nachmittagshimmel. Hadden-Paton musste bereits bemerken, dass Besuch nahte.
Oder auch nicht, ging es John durch den Kopf, als er einen Hügelkamm erreichte und die am Rand eines weitläufigen Talkessels liegende Farm in Sicht kam. John stoppte den Schweber und erhob sich von seinem Sitz, um über den Rand der schmutzigen Windschutzscheibe des Fargo hinwegzublicken. Ein ungutes Gefühl machte sich in seiner Magengrube breit.
Das Anwesen von Hadden-Paton mochte früher von beeindruckender Größe gewesen sein. An ein großes, zweigeschossiges Haupthaus schlossen sich Wohngebäude für Bedienstete und Ställe sowie Schuppen und Fahrzeuggaragen an. Daneben lagen mehrere Paddocks. Jenseits der Farm erstreckte sich offenes Weideland.
Von all dem war nicht mehr viel übrig geblieben. Das Haupthaus stand noch, weil es als einziges Gebäude hauptsächlich aus Stein errichtet worden war. Doch sein Dachstuhl war ein Gerippe aus verkohlten Balken, und die Fenster und Türen glichen leeren, schwarzen Augenhöhlen. Die anderen Häuser, bei denen Holz, Formplast und Wellblech als Baustoffe verwendet worden waren, lagen vollständig in Trümmern. Kaum mehr als in sich zusammengesunkene Haufen aus halb verbrannten Stämmen und geschmolzenen Plastplatten waren übrig geblieben.
»Da soll mich doch einer …«, murmelte John, als er den Blick über die Ruine gleiten ließ, die einst Hadden-Patons Heim gewesen war.
Leben schien es dort unten keins mehr zu geben. Zumindest gewahrte John keine Tiere oder Menschen, die zwischen den Trümmern umherliefen. Allerdings fielen ihm ein paar verdächtige, wenn auch auf die Entfernung schlecht zu erkennende Umrisse ins Auge, bei denen es sich um Tote handeln konnte.
Obwohl er nicht sonderlich erpicht darauf war, diese Toten aus der Nähe zu betrachten, war John das Untersuchen und Plündern von Stätten des Unglücks – meist von im All treibenden Raumschiffwracks – so sehr in Fleisch und Blut übergegangen, dass er sich wieder auf den Fahrersitz rutschen ließ und gemächlich mit dem Fargo näher heranschwebte. Aufmerksam behielt er die Umgebung im Auge. Was immer hier geschehen war, lag nicht lange zurück. An einigen Stellen glommen noch kleine Brandherde, und von den Trümmern stiegen feine Rauchfahnen auf, die rasch in der Luft zerfaserten. Es war nicht ausgeschlossen, dass jemand das Inferno überlebt hatte und nun womöglich verletzt und mit sehr nervösem Zeigefinger Johns Nahen beobachtete.
Er stellte den Schweber am Eingang des Anwesens ab.
»Hallo?«, rief er. »Ist da jemand?«
Nichts regte sich.
John schaltete den Fargo ab, schob sich aus dem Sitz und flankte über die Verkleidung. Bedächtig schlug er seinen Mantel zur Seite und legte die Rechte auf den Griff des Santhe-CG, seines zwölfschüssigen Revolvers, der in einem Holster an Johns Oberschenkel hing. »Hallo? Mein Name ist Donovan. Ich bin ein Geschäftspartner von Mister Hadden-Paton.«
Keine Antwort.
Während er über den Hof schritt, verhärtete sich seine Miene. Der Eindruck von Ferne hatte nicht getäuscht. Es lagen wirklich tote Tiere im Hof zwischen den Brandruinen herum: ein Hund, zwei Ziegen und eine Reihe Rinder, die vermutlich aus einem nahen Stall ausgebrochen waren. Alle wiesen Schussverletzungen auf. Also war es kein Unfall, stellte John fest. Ein Dachstuhlbrand tötet nicht mit Kaliber 45.
Als er sich dem Haupthaus näherte, entdeckte er auch menschliche Leichen. Einige von ihnen mussten durch den Eingang vor dem Feuer geflohen sein. Dort hatte sie ihr Schicksal in Gestalt mordlustiger Revolverschützen erwartet. Andere waren anscheinend bereits brennend aus den Gebäuden geflohen, nur um dann wenige Schritte vor den Mauern ihren Verletzungen zu erliegen. John überflog die Szenerie mit Blicken und zählte knapp ein Dutzend Personen. Ob der Rinderbaron unter ihnen war, konnte er nicht sagen. Zu den Erschossenen zählte er offensichtlich nicht, aber er mochte unter jenen sein, deren Körper vom Feuer derart verzehrt worden waren, dass sie kaum noch als Mann oder Frau zu erkennen waren. Und zu genau wollte John sich diese Toten nicht anschauen. Allein vom Gestank wurde ihm schlecht.
Trotzdem schritt er weiter und durchstreifte vorsichtig die Trümmer. Dabei suchten seine Augen gleichzeitig nach Überlebenden wie nach Wertsachen. Er fand weder das eine noch das andere. Die Mörder von Hadden-Patons Familie hatten in jedweder Hinsicht ganze Arbeit geleistet. »Verdammte Mistkerle«, murmelte er, als er schließlich an den Toten vorbei über den Hof zurück zu seinem Schweber ging.
Neben einem der Paddockzäune fiel ihm ein in der Sonne blinkender Gegenstand ins Auge. Als er nähertrat, erkannte John, dass es sich um einen verzierten silbernen Knopf handelte, der möglicherweise zu einer Jacke gehört hatte. Stirnrunzelnd hob er ihn auf, wog ihn kurz in der Hand und steckte ihn dann ein. Vielleicht lief jemand in Zaragoza herum, dem ein Knopf fehlte und dem John die zweihundert Rinder in Rechnung stellen konnte, auf denen er jetzt saß.
Als er wieder in den Fargo gestiegen war, warf er durch die Windschutzscheibe einen letzten düsteren Blick auf das Gemetzel. Dann startete er den Motor des Schwebers, wendete ihn und überließ den Schauplatz des Schreckens sich selbst.
– 2 –
Eine gewisse Ernüchterung, gepaart mit zunehmender Sorge, machte sich in John breit, als er mit dem Schweber nach Zaragoza zurückfuhr. Wie es aussah, war Hadden-Paton tot. Er mochte keine Leiche gefunden haben, aber angesichts der heruntergebrannten Farm und der Tatsache, dass sich ihr Geschäftspartner bis jetzt nicht gemeldet hatte, war dies überaus wahrscheinlich. Einen elaborierten Täuschungsversuch des Rinderbarons schloss John aus. Kein Mann brannte sein Heim nieder und brachte Menschen und Tiere um, nur damit er eine Ladung Rinder nicht bezahlen musste, deren Kauf und Transport er womöglich irrtümlich in Auftrag gegeben hatte.
John aktivierte das Komm-System des Fargo und rief die Mary-Jane.
»John«, meldete sich Kelly, »schön, von dir zu hören. Konntest du Hadden-Paton aus seinem Mittagsschlaf wecken?«
»Ich fürchte, Kelly, den weckt niemand mehr«, gab John zur Antwort. »Hadden-Patons Farm wurde in Brand gesteckt und alles und jeder dort erschossen – sogar die Tiere.«
»Was sagst du da?«, vernahm er Kellys erschrockene Stimme über Funk.
»Hadden-Paton ist tot! Seine Farm gleicht einem rauchenden Trümmerhaufen, bloß dass er kaum noch raucht. Der Handel ist geplatzt.«
»Aber wir haben doch gestern nach unserer Ankunft am Transitpunkt noch mit ihm gesprochen.«
»Tja, gestern lebte er offensichtlich noch. Und heute lebt er nicht mehr.«
»Das ist doch unmöglich!«
»Unmöglich? Nein. Höchst unwahrscheinlich? Schon eher. Aber ich habe die Ruine und die Toten mit eigenen Augen gesehen. Daran gibt es nichts zu rütteln. Mit wem auch immer sich unser guter Rinderbaron angelegt hat, sein Gegner hat sich ausgerechnet die gestrige Nacht ausgesucht, um den Streit auf die blutige Art beizulegen.«
Eine kurze Weile herrschte Schweigen am anderen Ende der Leitung.
»Jetzt haben wir ein Problem«, meinte Kelly.
»Du sagst es, Süße«, bestätigte John ihr. »Um genau zu sein, haben wir zweihundert Probleme, die uns die Haare vom Kopf fressen und die Frachträume vollscheißen.«
»Und was jetzt?«, wollte seine Partnerin wissen.
John dachte einen Moment darüber nach. »Jetzt begebe ich mich in die nächstbeste Bar und betrinke mich, bis ich vergessen habe, dass der heutige Tag überhaupt existiert hat.«
»John!«
»Na schön, ich beschränke die Alkoholmenge auf einen Whiskey und ein Bier. Aber einen Drink brauche ich jetzt. Das beruhigt die Nerven und klärt den Geist. Danach fällt mir vielleicht ein, wie wir diese Rindviecher an den Mann bringen.«
»Wie du meinst. Aber bleib nicht zu lange weg. Wir müssen mit dem Schweber noch neues Futter kaufen fahren, jetzt, wo wir die Tiere heute nicht mehr loswerden. Denn du willst keine Herde hungriger Longhorns im Schiff haben, glaub mir.«
»Woher weißt du plötzlich so viel über Rinder?«
»Ich habe sie in den letzten Tagen gefüttert, weil gewisse Herren unglaublich viel im Cockpit und im Maschinenraum zu tun hatten.«
»He, das waren routinemäßige Wartungsarbeiten«, verteidigte John sich.
»Geh deinen Whiskey trinken, und dann komm einfach wieder«, gab Kelly zurück.
»Aye, aye, Captain.«
Der Whiskey, den John am Rand des Raumhafenbezirks in einer kleinen Kaschemme namens Willard’s Saloon zu sich nahm, gehörte keineswegs einer Marke an, die John weiterempfehlen würde. Aber er brannte sich angenehm die Kehle hinunter, und für den Moment genügte John das. Nachdem er sich ein zweites Glas und dazu ein großes Bier genehmigt hatte, fühlte er sich langsam besser.
Im Grunde war ihre Lage gar nicht so mies. Die Rinder selbst hatte Hadden-Paton natürlich vor dem Abflug bezahlt. Schuldig war er ihnen allein die Transportkosten. Nun, da ihr Geschäftspartner nicht mehr unter den Lebenden weilte, gehörte die kleine Herde wohl John und seinen Leuten. John bezweifelte, dass jemand aus Hadden-Patons weiterem Familienkreis auftauchte und ihm die Tiere streitig machen würde. Wer immer den Rinderbaron auf dem Gewissen haben mochte, hatte ein ziemlich deutliches Zeichen gesetzt, dass die Hadden-Patons in dieser Gegend lieber keine Rinderzucht mehr betreiben sollten. Natürlich gab es zweifellos irgendwelche Regelungen der Kernwelten-Union, die in diesem Fall griffen. Die Kernwelten-Union, deren Vertreter auch auf Alvarado saßen, hatte für alles irgendwelche Regelungen. Aber der Gouverneur und seine Leute mussten ja nicht erfahren, dass John als inoffizieller Erbe Hadden-Patons die Rinder veräußerte. Also brauchen wir bloß noch einen diskreten, wohlhabenden Käufer zu finden, und wir verdienen bei der Geschichte eine gute Stange Geld extra.
Der Gedanke gefiel ihm, wenngleich er mit einem Anflug von schlechtem Gewissen einherging, weil er aus dem Leid und Tod einer ganzen Familie Profit schlagen wollte. »Nur nicht sentimental werden«, sagte er zu sich selbst. Wir sind nicht schuld an Hadden-Patons Unglück. Und die Rinder den Behörden zu übergeben, wäre einfach nur dämlich. Zur Bekräftigung leerte er den Rest seines Bierglases und hieb es auf den Tresen. Er hob eine Hand und winkte dem Barkeeper. »Zahlen, Kumpel.«
Nachdem ein paar Union Dollar den Besitzer gewechselt hatten, stand John auf und stapfte nach draußen. In der Zwischenzeit hatte sich der Himmel verdunkelt. Die Wolkendecke war dichter geworden, und es sah aus, als zöge von Norden eine Regenfront heran. Höchste Zeit, dass ich zum Schiff zurückkomme, dachte John. Zum einen hatte er keine Lust, in seinem offenen Schweber klatschnass zu werden, zum anderen wartete Kelly sicher schon ungeduldig auf ihn.
Der Fargo parkte auf der Straße vor dem Saloon, zusammen mit ein paar Fahrzeugen anderer Gäste. John wollte gerade einsteigen, als er einen Frauenschrei vernahm. Er hob den Kopf und sah sich um. Eine kleine Gruppe Männer fiel ihm ins Auge, die unter dem Vordach einer Bar zwei Häuser weiter links stand und mit dem unangenehmen Gelächter von Angetrunkenen eine schmale Gestalt bedrängte.
»Nicht mein Problem«, murmelte John leise. Trotzdem konnte er den Blick nicht abwenden.
Die Frau hatte ein schlichtes braunes Kleid an und ein Tuch um die Schultern geschlungen, das sie sich auch über den Kopf gezogen hatte. Einer der Männer, ein feister Kerl mit fleckigem Hemd und Hosenträgern, packte sie und machte Anstalten, sie zu küssen. Erfolglos versuchte sie, ihn von sich zu schieben. Die Frau schrie erneut.
John ließ den Blick über die Straße schweifen. Die Passanten, die vorbeieilten, gaben sich Mühe, in eine andere Richtung zu schauen. Niemand schien sich mit den Burschen anlegen zu wollen.
»Ach, verdammt!« Er zog die ledernen Pilotenhandschuhe aus der Gesäßtasche und streifte sie über.
Ein weiterer Mann packte die Frau. »Zier dich nicht so«, tönte er, »brauchst doch sicher ein paar Dollar. Bei uns kannst du dir was verdienen, glaub mir.«
Seine Kameraden lachten beifällig.
Die Frau hob abwehrend die Hände, und ihre Fingernägel fuhren über seine Wange.
Überrascht hielt ihr Peiniger inne und betastete die roten Striemen. »Na warte!« Er hob seinerseits die Rechte und verpasste ihr eine schallende Ohrfeige.
Keuchend fiel sie zu Boden.
»Los, Jungs, packt sie. Wir suchen uns ein lauschiges Plätzchen und dann zeigen wir ihr, aus welchem Holz wir geschnitzt sind.« Er wandte sich der Frau zu und lachte. »Wir werden uns ein bisschen amüsieren, oder was meinst du?«
In diesem Augenblick packte John von hinten seine Schulter und drehte ihn zu sich herum. »Wie wäre es, wenn du dich mit jemandem amüsierst, der deine Kragenweite hat, Kumpel?« Er wartete nicht darauf, was der Bursche von dem Vorschlag hielt, sondern versetzte ihm einen Faustschlag, der diesen zurück und in die Arme eines Freundes taumeln ließ.
»Eigentlich schlage ich ja keine Betrunkenen«, wandte sich John mit entschuldigender Miene an das Quartett. Sein Blick huschte zu der Frau am Boden, und sein Gesicht verdüsterte sich. »Aber für euch mache ich eine Ausnahme.« Er packte den nächsten am Kragen und sandte ihn mit einem schwungvollen Hieb auf die Bretter.
In die übrigen beiden kam Bewegung. Der eine schob seinen angeschlagenen Kameraden von sich, der andere stapfte mit drohendem Knurren auf John zu. Er war groß und hatte ein kantiges Kinn. Der geht nicht nach einem Schlag in die Knie, fuhr es John durch den Kopf. Also versuchte er es mit einer Links-rechts-Kombination – doch ohne Erfolg. Sein Gegner grunzte nur unwillig und lachte dann, wobei John eine Wolke aus Alkoholgestank entgegenwehte.
»Mach ihn fertig, Hyde!«, feuerte sein Kamerad den Hünen an.
Der Mann namens Hyde schlug zu, doch John duckte sich unter dem Schlag hinweg, der daraufhin einen der beiden Kerle traf, die John bei seinem ersten Angriff auf die Bretter geschickt hatte. Der Bursche hatte sich gerade wieder aufgerappelt und wollte John von hinten packen. Nun kippte er um wie eine gefällte Eiche.
John warf einen raschen Blick über die Schulter, bevor er sich Hyde wieder zuwandte. »Danke, sehr aufmerksam.« Er wich einem zweiten Schlag aus und versuchte es mit einem Schwinger in die Nieren seines Gegners. Keuchend krümmte Hyde sich zusammen. John nutzte die Gelegenheit, packte den Mann an den Schultern und rammte ihm das Knie gegen das Kinn. Hyde taumelte nach hinten, stolperte über seinen am Boden liegenden Kameraden und fiel krachend zu Boden.
Eine schnelle Bewegung aus den Augenwinkeln ließ John herumfahren. Nur wenige Zentimeter vor ihm fuhr eine Messerklinge durch die Luft. Er spürte einen kurzen Schmerz, als sie durch den Mantelstoff seines linken Ärmels schnitt und die Haut seines Oberarms ritzte.
»He!«, protestierte er. »Mit einem Messer zu einer Schlägerei zu kommen ist nicht sehr sportlich.«
»Zum Teufel mit dir, Peko-Freund«, zischte der Mann.
Bevor John sich erkundigen konnte, was das nun heißen sollte, stieß der andere das Messer nach vorn. John drehte den Oberkörper zur Seite und ergriff den Waffenarm seines Gegners. Kraftvoll schlug er ihn gegen einen der Holzbalken, die das Vordach der Bar stützten, und prellte dem Mann so das Messer aus der Hand. Ein kräftiger Rückhandhieb gegen die Nase schickte seinen Gegner über das Geländer auf die staubige Straße.
John wollte der Frau, die sich an die Hauswand drängte, gerade eine rasche Flucht empfehlen, als sich eine schwere Hand auf seine Schulter legte. Er wurde herumgerissen, und es gelang ihm nicht mehr, die Hände zur Abwehr zu heben, bevor ihn ein Hammerschlag ins Gesicht traf. Benommen blinzelnd taumelte er zwei Schritte zurück. Er fühlte sich, als habe ihn ein Transportschweber gerammt.
»Wir sind noch nicht fertig hier«, knurrte Hyde. Blut, das aus seiner aufgeplatzten Unterlippe lief, verschmierte sein Kinn. Er packte John am Schopf und schlug ihm ein weiteres Mal ins Gesicht. Eine Spiralgalaxis des Schmerzes erblühte vor Johns Augen mit explosiver Pracht. Er wankte weiter nach hinten, bis er mit dem Rücken gegen einen der hölzernen Stützbalken stieß. Keuchend schüttelte er den Kopf, um wieder zu sich zu kommen. Als er sich mit dem Handrücken über den Mund fuhr, schmeckte auch er Blut.
Hyde stand grinsend da und wartete. »Komm schon«, sagte er und machte eine auffordernde Handbewegung. »Zeig mir, was du draufhast.«
Hau einfach ab, empfahl John eine innere Stimme. Du hast genug getan. Knurrend senkte John den Kopf und stürmte los, direkt auf Hyde zu. Er rammte seinen Gegner und trieb ihn mit sich durch die Schwingtür des Saloons.
Im Inneren herrschte Halbdunkel. Viele Gäste waren nicht anwesend. Genau der Tisch am Eingang war jedoch mit gleich vier Mann besetzt, die dort Karten spielten. Krachend prallten John und sein Gegner dagegen und warfen den Tisch um. Bierflaschen, Spielkarten und Union Dollar flogen durch die Luft. Einer der Stühle kippte um, und der Mann, der darauf saß, ging mit einem Aufschrei zu Boden.
Der Sturz trieb Hyde die Luft aus den Lungen. Vielleicht war er auch etwas hart mit dem Hinterkopf aufgeschlagen. Jedenfalls wirkte er einen Moment lang benommen, und John nutzte seine Chance. Seine Finger fanden eine der Flaschen, und er zog sie Hyde über den Schädel. Es gab ein dumpfes Gong-Geräusch, das John einen leisen Fluch entlockte. Der Wirt schenkte offenbar nur Billig-Bier in Kunststoffflaschen aus. Er warf die Flasche zur Seite, schlug stattdessen mit der Faust zu und kam taumelnd auf die Beine.
»Entschuldigung«, murmelte er, während er sich mit der Hand durchs zerzauste Haar fuhr. Er nickte den Gästen zu. »Schönen Tag noch.« Dann fuhr er herum und eilte nach draußen.
Die Frau, die er gegen die vier Trunkenbolde verteidigt hatte, stand noch immer unter dem Vordach, was John verwunderte. Er hatte angenommen, dass sie das Weite suchen würde, sobald sich ihr die Gelegenheit dazu bot. Aber vielleicht hatte der Schrecken sie gelähmt. Vielleicht wollte sie John auch für seine Hilfe danken. Er wusste es nicht. Was er allerdings wusste, war, dass ihnen nicht viel Zeit blieb. Schon rappelten sich seine Gegner wieder vom Boden auf.
Hastig ergriff er die in einem dünnen Stoffhandschuh steckende Rechte der Frau. »Kommen Sie, wir müssen hier verschwinden.«
Er wollte sie in Richtung seines Gleiters ziehen, doch in diesem Augenblick flog die Schwingtür nach außen, und die vier Männer tauchten auf, deren Kartenspiel John unvermittelt beendet hatte.
»Hiergeblieben, Freundchen!«, rief einer von ihnen.
»Planänderung«, ließ John seine Begleiterin wissen. »Dort entlang.«
Er zog sie auf eine schmale Gasse neben dem Gebäude zu. Gleich darauf tauchten sie in den Schatten zwischen den Saloon und dem Nachbarhaus ein. Müllcontainer, Flaschenkisten mit Leergut und alter Bauschutt säumten ihren Weg, als sie die Gasse hinunterhetzten, um eine Parallelstraße zu erreichen.
Hinter ihnen peitschte ein Schuss.
Unwillkürlich zog John den Kopf ein. »Das ist doch nicht euer Ernst, oder?« Dann hob er die Stimme ein wenig. »Laufen Sie vor, Miss. Ich gebe uns Deckung.« Er zog sie an sich vorbei und riss gleichzeitig den Santhe-CG aus dem Holster. Blind gab er zwei hoch gezielte Schüsse die Gasse hinunter ab. Wenn möglich, würde er keine ihrer Verfolger töten. So etwas handelte einem nur Scherereien ein, vor allem in einer Stadt, in der man ortsfremd war.
Die Frau huschte um die nächste Ecke, und John folgte ihr. Die Parallelstraße erwies sich als deutlich schmaler als die Straße, aus der sie gekommen waren. Kleine und überwiegend fragwürdig aussehende Geschäfte und Bars reihten sich hier aneinander, deren Besitzer sich die Mieten in der ersten Reihe augenscheinlich nicht leisten konnten. Aus einer rauchigen Kaschemme vernahm John kehliges Gelächter und das exotische Gejaule eines fremdartigen Saiteninstruments. Gleichzeitig drangen der Geruch von Frittierfett eines nahen Straßenstandes und von scharfen Lösungsmitteln aus einer Wäscherei an seine Nase.
Johns Begleiterin wandte sich nach links und hetzte die Straße hinunter. Fahrzeugverkehr gab es so gut wie keinen, und es war noch nicht spät genug, dass die Straßen mit Vergnügungssüchtigen und Kriminellen gleich welcher Art gefüllt wären. Bis zur nächsten Abzweigung lagen sicher hundert Meter Laufstrecke über deckungsfreies Gelände vor ihnen. Zu riskant.
Er beschleunigte seine Schritte, holte die Frau ein und packte erneut ihre Hand. »Kommen Sie«, drängt er sie. »Hier rein.« Er zog sie auf die Wäscherei zu. Aus den Augenwinkeln sah er, wie der erste ihrer Verfolger aus der Gasse auf der anderen Straßenseite auftauchte. Ihre Blicke kreuzten sich. John fluchte unterdrückt. Er hatte gehofft, ungesehen in dem Gebäude verschwinden zu können.
Überraschte Gesichter empfingen John und seine Begleiterin, als sie durch den Raum stürmten, in dem Reihen aufgehängter, frisch gebügelter Hemden, Jacken und Hosen in Transportbeuteln auf ihre Abholung warteten.
»Verzeihung«, sagte John. »Sind gleich wieder weg.« Hastig drängte er sich an den Kleiderständern vorbei in Richtung Hinterzimmer.
Der schmächtige Besitzer und seine zwei Mitarbeiterinnen riefen ihnen aufgebracht in einer Sprache nach, die John nicht verstand. Er nahm an, dass es sich um Chinesisch oder Japanisch handelte, da alle drei asiatischer Herkunft waren.
»Tut uns leid«, versicherte er ihnen noch einmal über die Schulter, bevor er mit seiner Begleiterin durch die Tür verschwand.
Sie rannten an mehreren Industriewaschmaschinen, Trockengebläsen und einer Heißmangel vorbei, die von älteren Frauen bedient wurden. Die Luft war feucht und zum Schneiden dick. Auch hier erregten sie einiges an Unmut, der sich verstärkte, als John mit einem Jungen zusammenprallte, der gerade mit einem Korb voller Laken aus einem Seitengang kam. Der Junge fiel auf den Hintern, und die Laken verteilten sich um ihn auf dem Fußboden.
»Entschuldigung«, rief John.
Irgendwo hinter ihnen verstärkte sich der Tumult im Eingangsraum, als ihre vier Verfolger wie eine Herde wild gewordener Bisons in die Wäscherei eindrangen.
Am hinteren Ende des Waschraums verlief ein Quergang. John wollte sich nach rechts wenden, weil er dort eine Tür erspähte, doch seine Begleiterin zog ihn am Ärmel.
»Nein«, rief sie und deutete in die andere Richtung. »Da.«
Was John in der Eile für einen weiteren Raum gehalten hatte, war in Wirklichkeit ein offenes Tor, an dem ein kastenförmiger Lastschweber parkte, der offenkundig soeben frische Wäsche abgeholt hatte. Der Schweber schien im Begriff zu sein, abzufahren, denn der Motor lief bereits, und am Heck fuhr gerade eine Rollklappe herunter.
Ohne auf John zu warten, rannte die Frau auf den Wagen zu.
»Das schaffen wir nicht!«, rief er ihr nach, aber als sie nicht reagierte, folgte er ihr.
Seine Begleiterin duckte sich und huschte unter der Klappe hindurch. John dagegen war gezwungen, einen Hechtsprung hinzulegen und sich unter den schließenden Metall-Lamellen hindurchzurollen. Ächzend prallte er gegen einen Wäschecontainer und blickte hinter sich.
Just in diesem Moment tauchten ihre Verfolger im Gang auf. Doch bevor sie begriffen, wohin ihre Opfer entschwunden waren, schloss sich die Rollklappe, das Motorenbrummen verstärkte sich, und die Schweber setzten sich in Bewegung.
John wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn. Trotz seiner Schmerzen grinste er zufrieden. »Schade, dass wir keine Gelegenheit hatten, ihnen zum Abschied zuzuwinken«, wandte er sich im Halbdunkel der Ladefläche an seine Begleiterin. »Die dummen Gesichter hätte ich gerne gesehen.«
»Man soll sein Glück nicht herausfordern«, erwiderte sie, als sie neben ihm auf die Knie sank. Ihre Stimme hatte einen eigentümlichen Akzent, den er nicht einordnen konnte. »Ich bin dankbar, dass wir ihnen entkommen sind. Und vor allem danke ich Ihnen, dass Sie mir geholfen haben.«
Er setzte sich auf. »Das war doch selbstverständlich.«
»Das war es nicht. Darf ich Ihren Namen erfahren?«
»Donovan«, erwiderte er. »John Donovan. Und wie heißen Sie?«
»Sekoya.« Sie hob die Hände und schlug das Tuch zurück.
John spürte, wie sich seine Augen weiteten.
Sie war eine Peko.
– 3 –
»Mister Donovan?« Sekoya blickte ihn aus dunklen Augen besorgt an. Sie hatte ein hübsches Gesicht mit ebenmäßigen Zügen, fein geschwungenen Augenbrauen und sinnlichen blauen Lippen. Pechschwarzes, langes Haar war zu einem Knoten im Nacken zusammengebunden. Wäre sie ein Mensch gewesen, John hätte sie eine Schönheit genannt. »Ist alles in Ordnung?«
»Ich, ähm, ja, natürlich.« Er erhob sich in eine sitzende Position.
»Sie wirken etwas erschrocken.«
»Sie haben mich bloß überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass …« Er brach ab und gestikulierte vage vor seinem Gesicht herum.
»… ich eine Peko bin?«
»Ja.«
Fragend legte sie den Kopf schief. »Ist Ihnen das unangenehm?«
»Nein, schon gut«, brummte John.
Genau genommen stimmte das nicht ganz. In Wahrheit hielt er sich von den grünhäutigen Fremden lieber fern. Vor Jahren hatten die erstaunlich menschenähnlichen Außerirdischen Johns Artgenossen mit ihren Texaferm-Reaktoren und der fortschrittlichen Transitfeldtechnologie den Weg zu den Sternen geöffnet. Die Menschen hatten es ihnen, von Profitgier und Größenwahn getrieben, mit hemmungsloser Expansion, Übervorteilung und Gewalt gedankt. Heute lebten die Peko auf Reservatswelten, die ihnen die Regierung der Kernwelten-Union im Rahmen der Neuordnung des Lebensraums in diesem Teil der Galaxis großzügig überlassen hatte, und die meisten von ihnen waren nicht mehr sonderlich gut auf die Menschen zu sprechen. Nicht wenige von ihnen hatten sich in erbitterte Feinde der Menschheit verwandelt, und die Geschichten ihrer Gräueltaten – wie auch seine ganz persönliche Erfahrung – hatten Johns Einstellung den Grünhäuten gegenüber mehr geprägt, als es ihm lieb war.
Um einer Fortsetzung dieses Gesprächs vorzubeugen, rappelte er sich auf und machte sich an der Rollklappe zu schaffen. »Wir sollten jetzt weit genug entfernt sein«, sagte er. »Wird Zeit, dass wir aussteigen. Wer weiß, wohin der Transporter uns sonst fährt.«
Es klickte, als er den Schließmechanismus überbrückte, und die Rollklappe fuhr ratternd wieder nach oben. Der Schweber bog gerade in eine größere Straße ein, an der sich Fahrzeugverkäufer und Raumschiffteilehändler aneinanderreihten. Als der Fahrer merkte, dass seine Heckklappe sich öffnete, bremste er ab.
»Kommen Sie«, sagte John zu Sekoya und sprang von der Ladefläche. Er wartete, bis sie ihr Tuch wieder über den Kopf gezogen hatte und ihm gefolgt war.
Der Lastschweber entfernte sich noch ein paar Meter, dann hielt er am Straßenrand an, und der Fahrer blickte aus der Führerkabine. Er sah John und Sekoya zum Straßenrand laufen und schien eins und eins zusammenzuzählen.
»He, was hattet ihr in meinem Wagen zu suchen, ihr elenden Tramps?«
»Nichts für Ungut, Kumpel«, erwiderte John und winkte dem Mann erschöpft zu.
»Wenn ich euch noch einmal dabei erwische …« Der Mann ließ die Drohung in der Luft hängen, als er Johns Zwölfschüsser unter dem grauen Mantel bemerkte.
John beachtete ihn nicht weiter, sondern marschierte in die Richtung los, in der er Willard’s Saloon vermutete. Dort parkte noch immer der Fargo.
»Warten Sie!«, rief Sekoya ihm nach.
John drehte sich um und sah, dass sie ihm hinterhergelaufen kam. »Was ist noch?«, fragte er vielleicht etwas unwirscher als nötig. Er bereute nicht, der jungen Frau gegen ihre vier Peiniger geholfen zu haben. Trotzdem wollte er diese Sache jetzt möglichst rasch hinter sich lassen – und Sekoya auch. Peko brachten einem nur Ärger ein.
»Wohin gehen Sie?«, fragte sie.
Verwirrt sah er sie an. »Zurück zu meinem Gleiter und dann zu meinem Schiff. Warum?«
Sekoya erwiderte den Blick ernst. »Sie haben mein Leben gerettet. Ich stehe in Ihrer Schuld.«
»Wie gesagt: Es war keine große Sache.«
»Doch, das war es. Diese Männer hätten mich missbraucht und danach getötet.«
»Sie übertreiben. Die waren betrunken. Sicher, Sie hätten Sie vermutlich misshandelt. Aber getötet? Das glaube ich nicht.«
Sie neigte den Kopf und blickte ihn abschätzend an. »Sie kommen nicht von hier, oder?«
»Nein«, bestätigte John. »Eigentlich bin ich nur auf der Durchreise.«
»Peko werden in Zaragoza nicht gerne gesehen«, erklärte Sekoya. »Es hat seine Gründe, dass ich Handschuhe und ein Tuch über dem Kopf trage, um mich zu verbergen. Es gibt hier Banden, die uns jagen – mit Billigung des Gouverneurs.«
»Dann sollten Sie lieber schleunigst von dieser Welt verschwinden.«
»Das ist leichter gesagt als getan. Ich bin hier gestrandet.«
»Traurig, aber nicht mein Problem. Hören Sie« – er deutete mit dem Daumen über die Schulter – »ich muss zu meinen Leuten zurück. Ich bin ohnehin schon spät dran. Also freuen Sie sich über Ihren Glückstag heute und vergessen Sie das mit der Schuld einfach.«
Sie schüttelte den Kopf. »Das kann ich nicht. Ich bin eine Peko.«
»Und?«
»Wir Peko begleichen stets unsere Schuld.«
John verdrehte die Augen. »Bei den Sternen, was wollen Sie von mir? Wollen Sie mich in Ihren Stamm aufnehmen?«
»Das kann ich leider nicht. Mein Stamm lebt fern von hier, und meine Gefährten aus Alvarado wurden schon vor Monaten getötet. Ich bin allein.«
»Mein Beileid«, sagte John. »Was haben Sie dann im Sinn?«
Sie ballte die behandschuhten Hände zur Faust und kreuzte sie vor der Brust. »Ich verkünde hiermit eine Lebensschuld. Sie haben mein Leben gerettet, John Donovan. Es gehört Ihnen, bis ich das Ihre gerettet habe.«
Geschlagene fünf Sekunden starrte John sie einfach nur an. »Wie bitte?«
»Ich habe Ihnen gegenüber eine Lebensschuld, denn Sie haben …«
»Das habe ich schon verstanden. Aber ich begreife nicht ganz, was Sie mir damit sagen wollen.«
»Dass ich Sie von diesem Tag an begleiten werde, bis meine Schuld bei Ihnen beglichen ist«, erklärte Sekoya.
Fassungslos schüttelte John den Kopf. »Oh, nein, das werden Sie ganz sicher nicht, meine Hübsche. Ich habe mein Schiff, meine Crew, mein Leben. Nichts für Ungut, aber darin brauche ich keine Peko – zumal Sie mir nicht gerade wie eine Leibwächterin aussehen. Ich werde also, wenn es recht ist, davon absehen, vor einen fahrenden Schweber zu springen, nur damit wir quitt sind.«
»Ich muss meine Schuld bei Ihnen begleichen«, beharrte Sekoya.
»Nein, das müssen Sie nicht. Wenn Sie unbedingt ein Opfer bringen wollen, bringen Sie es, indem Sie mich in Ruhe lassen. Schönen Tag noch, Miss.« John drehte sich um, ging drei Schritte und wandte sich dann noch einmal zu ihr um. »Und wagen Sie es nicht, mir nachzulaufen«, warnte er sie mit erhobenem Zeigefinger. »Sonst bringe ich Sie um.«
Mit diesen Worten wandte er sich ab und ging davon. Vom Himmel fielen die ersten Regentropfen.
»Tut mir leid«, sagte John, als er wenig später die Messe der Mary-Jane Wellington betrat.
Die Messe war ein Raum von überschaubarer Größe im Herzen des Frachters, und wie immer herrschte heimeliges Chaos. Der Tresen, der die Küchenzeile vom Rest der Messe trennte, war von Kochutensilien und leeren Lebensmittelpackungen bedeckt. Auf dem runden, mit grünem Filz bedeckten Pokertisch, der umgeben von einer Sitzecke in der Nische auf der gegenüberliegenden Seite stand, lagen noch die Karten und Chips ihrer letzten Partie. Um den großen, am Boden festgeschraubten Esstisch in der Mitte des Raums saßen Hobie, Kelly, Aleandro und Piccoli und aßen zu Abend. Es gab Steaks mit Bratkartoffeln und gebratenem Gemüse. Offenkundig hatte Hobie, der nicht nur das Schiff in Schuss hielt, sondern auch meisterlich den Kochlöffel schwang, zwischenzeitlich frische Lebensmittel eingekauft.
»Du kommst gerade noch rechtzeitig für einen guten Happen«, antwortete sein Mechaniker grinsend.
»Auch wenn du ihn dir nicht verdient hast«, bemerkte Kelly missmutig. »Wir wollten noch Futter für die Tiere …« Sie brach ab, als John in den gelben Schein der absichtlich gedämpften Beleuchtung trat. »Meine Güte, hattest du einen Unfall mit dem Schweber?«
»Es war wohl eine Art Unfall, ja«, bestätigte John, als er sich auf einen der verbliebenen freien Stühle fallen ließ. »Ich bin mit Mitgliedern des örtlichen Vereins der Menschenfreunde zusammengestoßen.« Diesen Verein gab es tatsächlich auf einigen Planeten. Die rassistischen Ansichten, die seine Mitglieder vertraten, waren John zuwider.
»Den Peko-Hassern?« Aleandro verzog das Gesicht.
»Entweder das oder es handelte sich einfach um vier besoffene Kuhhirten.«
»Lass mich das mal ansehen«, sagte Kelly und stand auf, um sich an seine Seite zu begeben. Fachmännisch überprüfte sie seine Verletzungen.
»Autsch«, entfuhr es John, als sie seine Wange betastete. »Mir geht es gut. Du brauchst mich nicht zu verarzten.« Er wollte den Kopf wegdrehen.
»Stillhalten.« Kelly hob den Blick und nickte in Richtung einer der in die Wand eingelassenen Spinds. »Aleandro, hol mir mal den Erste-Hilfe-Kasten aus dem Schrank.«
»Geht klar.« Der Junge sprang auf und entnahm dem Spind eine rote Tasche mit weißem Schriftzug. Er stellte sie auf den Tisch.
Kelly zog ein Desinfektions- und Kältespray heraus und begann, damit Johns Wunden zu behandeln. Erwartungsgemäß brannte sein Gesicht unvermittelt wie Feuer, und er grunzte unwillig.
»Nicht jammern«, befahl Kelly. »Sei froh, dass dir deine Menschenfreunde nicht den Kiefer gebrochen haben. Allem Anschein nach haben sie es versucht.«
»Ein oder zwei Mal schon, ja«, gab John zu und verzog erneut das Gesicht, als Kelly eine Schramme an seiner Schläfe abtupfte.
»Um was ging es bei dem Zwischenfall eigentlich?«, wollte sie wissen.
»Die Burschen haben auf offener Straße eine Grünhäutige bedrängt. Und da sich sonst keiner der braven Bürger von Zaragoza zum Eingreifen genötigt sah, habe ich die Gelegenheit genutzt und ein wenig Dampf abgelassen. Ihr wisst schon: der geplatzte Rinder-Job und so. Es tat gut, sich ein wenig abzureagieren.«
»Du hast dich mit vier Kerlen geprügelt, um eine Peko zu beschützen?« Kelly hob erstaunt die Augenbrauen. »Manchmal überraschst du mich, John. Ich dachte immer, dass du keine sonderlich hohe Meinung von den Peko hättest.«
»He, ich habe nichts gegen die Grünhäute, solange sie in ihren Raumsektoren bleiben und unsere Kolonien und Frachtschiffe in Ruhe lassen. Die Randsysteme sind gefährlich genug ohne irgendwelche Stämme auf dem Kriegspfad oder Banden, die auf Planeten Unruhe stiften. Ich meine, Peko, die sich friedlich in unsere Gesellschaft eingliedern und einfach ihrer Arbeit nachgehen, findet man ja nicht sehr häufig.«
»Ach, John.« Seufzend schüttelte Kelly den Kopf. »Ich mag dich wirklich, aber manchmal redest du einfach Unsinn. Umso mehr wundert mich, dass du für die Dame eine Ausnahme von deinen Vorurteilen gemacht hast.« Sie steckte das Spray zurück in die Tasche und zog einen Streifen Fixierpflaster hervor, um ihn auf seine Wange zu kleben.
John brummte mürrisch. »Ich habe zu spät gemerkt, dass sie eine Grünhaut ist. Sie trug Handschuhe und ein Tuch über dem Kopf.«
»Captain, ich weiß, dass ich neu auf diesem Schiff bin und mir keine Kritik an Ihnen zusteht«, meldete sich Harold Piccoli zu Wort. »Aber Sie sollten Menschen wirklich nicht nach ihrer Hautfarbe beurteilen.« Der hünenhafte, dunkelhäutige Mann, den sie vor einigen Wochen für harte Dollar bei Kopfgeldjägern ausgelöst hatten und der seitdem an Bord seine Schulden abarbeitete, sah John ernst an.
»Das würde mir auch nicht im Traum einfallen«, erwiderte John. »Habe ich Ihnen je ein anderes Gefühl vermittelt, Piccoli? Ich denke nicht. Aber Peko sind keine Menschen. Vergessen Sie das nie.«
»So.« Kelly verpasste ihm einen leichten Klaps auf die gesunde Wange. »Fertig. In ein paar Tagen bist du wieder fast wie neu. Versuch bis dahin, dir nicht noch einmal ins Gesicht schlagen zu lassen. Dein linkes Auge und deine Unterlippe brauchen dringend eine Pause.«
»Ich werde es mir merken, danke.« John richtete sich auf dem Stuhl auf und nickte Kelly zu, die ihre Tasche zuklappte und zurück in den Spind stellte.
»Haben Sie die Schlägerei eigentlich gewonnen, Cap?«, wollte Aleandro wissen. »Ich frage, weil Sie … nun ja, Sie sehen etwas mitgenommen aus.«
»Du solltest die anderen Kerle sehen.« John grinste und entschied gleich darauf, dass das eine dumme Idee war, da sich sein schmerzender Kiefer meldete.
»Und was ist aus der Frau geworden?«, erkundigte sich Hobie.
»Tja, das war so eine Sache.« John schob seinen Teller zu den Pfannen in der Tischmitte und füllte ihn mit Fleisch, Kartoffeln und Gemüse. »Sie war natürlich ausgesprochen dankbar, dass ich sie gerettet habe. So dankbar, dass sie etwas von Lebensschuld und dergleichen gefaselt hat. Das scheint im Augenblick sehr in Mode zu sein.« Er warf Piccoli einen kurzen Seitenblick zu, den dieser ignorierte.
»Heißt das, diese Mannschaft bekommt endlich eine zweite Frau?«, fragte Kelly neugierig, als sie zum Tisch zurückkehrte und sich mit den Unterarmen auf die Rückenlehne ihres Stuhls stützte. Sie hob den Kopf. »Nichts für Ungut, Mary-Jane.«
»Schon in Ordnung, Kelly«, erklang die sanfte Frauenstimme der Schiffs-KI aus einem verborgenen Lautsprecher. »Mir ist bewusst, dass ich nicht unbedingt dem entspreche, was eine Frau aus Fleisch und Blut als Busenfreundin bezeichnen würde.«
Die Künstliche Intelligenz, genau genommen ein lernfähiges Bordzentralsystem mit simulierter Persönlichkeit, war ohne Zweifel das ungewöhnlichste Mitglied in Johns Crew. Zu Zeiten entwickelt, in denen die Reisen zwischen den Sternen noch lang und einsam gewesen waren, dienten Mary-Jane und ihresgleichen nicht nur als Kontrollprogramm aller Systeme an Bord, sondern zugleich als Bordpsychologen – als jemand, der zuhörte, wenn man sonst mit niemandem reden konnte oder wollte.
Heutzutage war eine Schiffs-KI mit Persönlichkeit eigentlich überflüssig. Trotzdem wäre John nie auf den Gedanken gekommen, Mary-Jane abzuschalten oder gegen ein moderneres System auszutauschen. Sie gehörte zum dem Frachter, dessen Namen sie teilte, wie der Pokertisch in der Ecke und der Schaukelstuhl in Johns Quartier. Laut Hobie war sie bereits installiert gewesen, als er selbst den Kahn vor gut vierzig Jahren das erste Mal betreten hatte, und die vielen Jahre Betriebsdauer hatten dafür gesorgt, dass Mary-Jane einen ganz eigenen Charakter entwickelt hatte, der weit über schlichte Programmalgorithmen hinausging. Zumindest empfand John das so.
»Nein«, beantwortete er Kellys Frage nach der zweiten Frau an Bord etwas verspätet. Er zog seinen Teller wieder zu sich und begann mit Messer und Gabel sein Steak zu zerteilen. »Wir nehmen keine Peko an Bord. Ich habe ihr klargemacht, dass sie diese Lebensschuldkiste vergessen soll.«
»Und das hat sie hingenommen?« Hobie hob erstaunt die buschigen Augenbrauen. »Ich habe gehört, dass die Grünhäute so eine Lebensschuld ziemlich ernst nehmen.«
John spießte ein Stück Fleisch auf und schob es sich in den Mund. »Ich habe gedroht, sie zu erschießen, wenn sie mir nachläuft«, erwiderte er kauend. Dann verzog er kurz das Gesicht, als sich sein schmerzender Kiefer erneut meldete.
»Ach, John.« Kelly seufzte. »Manchmal weiß ich wirklich nicht, ob ich lachen oder weinen soll, wenn ich dir so zuhöre.«
»Vielleicht wechseln wir einfach mal das Thema«, schlug er vor. »Immerhin sind die Schlägerei und die Peko jetzt Geschichte, die zweihundert Longhorns in unseren Frachträumen dagegen ein sehr unmittelbares Problem.«
»Du hast recht, John.« Kelly warf einen Blick auf das Chronometer an der Wand neben der Küchenzeile. »Und bevor es noch später wird, fahre ich jetzt los und besorge frisches Futter. Ich bediene mich aus der Bordkasse.«
»Sei nicht zu freigiebig, wenn du unsere sauer verdienten Dollar ausgibst«, sagte John.
»Ich gebe mir Mühe. Harold, begleiten Sie mich? Ich könnte jemanden brauchen, der die Futtersäcke in den Schweber hebt.«
»Das mache ich doch gerne, Kelly«, antwortete Piccoli.
Er erhob sich ebenfalls und wollte sein Geschirr wegräumen, doch Hobie hielt ihn auf. »Lassen Sie nur, ich kümmere mich später darum.«
Der dunkelhäutige Hüne nickte dankend, dann verschwanden Kelly und er aus der Messe.
»Problem eins geklärt«, stellte John kauend fest. »Bleibt Problem zwei: Was machen wir mit den Tieren?«
»Habe ich das vorhin richtig verstanden, dass Hadden-Paton aus dem Geschäft ist?«, erkundigte sich Hobie.
»Ja, das ist leider wahr.« Während er seine Mahlzeit beendete, schilderte John Hobie und Aleandro in aller Ausführlichkeit, was er auf der Farm ihres Auftraggebers vorgefunden hatte.
»Aber diese tragische Wende der Ereignisse muss uns nicht unbedingt zum Nachteil gereichen«, schloss er wenige Minuten später. »Alvarado ist eine fruchtbare, gesunde Welt voller Menschen mit Visionen. Einer von denen wird doch zweihundert Longhorns brauchen können.«
»Du willst die Tiere selbst verkaufen?« Hobie klang ein wenig skeptisch.
»Warum nicht?«, hielt John dagegen, als er seinen leeren Teller von sich schob.
»Dir ist schon klar, dass wir die Rinder bereits beim Zoll deklariert haben, oder?«, fragte Hobie, als er aufstand, um die Reste ihres Abendessens wegzuräumen. »Die Behörden wissen, dass die Tiere eigentlich Hadden-Paton gehören. Wenn wir sie jetzt auf dem freien Markt anbieten, und die davon Wind bekommen, könnte uns das ganz schön Ärger einbringen. Insbesondere wenn jemand – so wie du – auf die Idee kommt, hinaus zur Farm zu fahren und nach Hadden-Paton zu schauen. Am Ende stehen wir in Verdacht, ihn und seine Leute umgebracht zu haben, um die Rinder selbst zu verschachern.«
»Ein guter Gerichtsmediziner sollte diese These leicht widerlegen können«, widersprach John. »Wir hielten uns noch gar nicht auf dem Planeten auf, als die Familie umgebracht wurde.«
»Meinst du, das lässt sich in ein paar Tagen wirklich noch nachweisen?«, fragte Hobie über die Schulter, während er mit vollen Armen hinüber zur Küchenzeile ging. »Wir sind hier nicht auf den Kernwelten. Du weißt, wie die Justiz am Rand funktioniert. Da wiegen Verdachtsmomente fast so schwer wie hieb- und stichfeste Beweise.«
»Dann müssen wir halt sehr vorsichtig vorgehen.« John spürte, wie sich eine leichte Gereiztheit in seinen Tonfall einschlich. »Was schwebt dir denn vor, Hobie? Willst du den Angriff auf die Farm melden und die Rinder der Obrigkeit übergeben? Wir hatten Ausgaben auf diesem Flug, für die uns niemand bezahlt. Denn du glaubst doch nicht ernsthaft, dass der hiesige Sheriff für unsere Unkosten aufkommt. Der nimmt die Rinder an sich und verkauft sie selbst.«
Hobie stellte die Pfanne und das Geschirr in der kleinen Küche ab und stützte sich mit einer Hand auf dem Tresen ab. Mit der anderen fuhr er sich nachdenklich durchs schüttere, graue Haar.
»Wahrscheinlich hast du recht«, gab er zu.
»Natürlich habe ich recht.«
»Gibt es hier auf Alvarado keinen Schwarzmarkt, wo wir die Tiere an den Mann bringen können?«, fragte Aleandro.
»Den gibt es durchaus«, erwiderte Hobie. »Zumindest haben wir dort vor zehn Jahren noch eingekauft. Wie das heute aussieht? Da bin ich überfragt.«
»Aleandro, das klingt nach einem Job für dich.« John nickte dem jungen Computerspezialisten zu.
»Geht klar, Cap.« Aleandro tippte sich salutierend mit zwei Fingern an die Schläfe. »Ich klemme mich dahinter und finde heraus, wo man in der Gegend von Zaragoza am besten Waren verschiebt. Geben Sie mir Zeit bis morgen früh.«
»Kein Problem.« John sah zu seinem Mechaniker hinüber, der den kleinen Spülautomaten füllte. »Hobie, wir beide machen unterdessen einen Ausflug ins Raumhafenviertel. Vielleicht kannst du ein paar alte Kontakte ausgraben, die uns weiterhelfen. Du magst zehn Jahre nicht auf Alvarado gewesen sein, aber der ein oder andere alte Bekannte dürfte trotzdem noch hier leben, oder nicht?«
»Ich hoffe es doch.«
Unvermittelt meldete sich Mary-Jane zu Wort. »John, verzeih, dass ich euch störe.«
John legte den Kopf in den Nacken, wie er es unwillkürlich immer tat, wenn er mit der aus den Deckenlautsprechern dringenden Stimme der Schiffs-KI sprach. »Was gibt es, Mary-Jane?«
»Wir haben einen Besucher«, verkündete Mary-Jane. »Sie steht vor der geschlossenen Rampe des Steuerbordfrachtraums und ruft nach dir.«
»Sie?« John runzelte die Stirn.
»Der grünen Hautfarbe nach zu urteilen, die ich mithilfe der Außenkameras erkenne, scheint es sich um die Peko-Dame zu handeln, die du vor den Betrunkenen gerettet hast, John. Ich nehme nicht an, dass es viele andere weibliche Peko in Zaragoza gibt, die dir einen Besuch abstatten möchten.«
Hobie und Aleandro wechselten einen belustigten Blick.
»Das gibt es doch nicht«, knurrte John, als er von seinem Stuhl aufstand.
»Die Frau muss ich kennenlernen«, rief Aleandro und sprang ebenfalls auf.