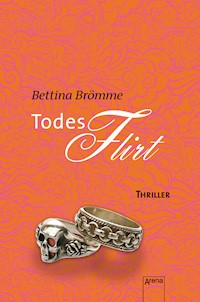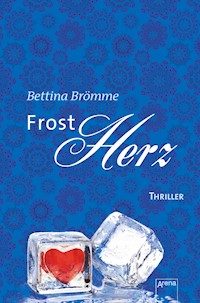
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Arena Thriller
- Sprache: Deutsch
Anne ist nicht wie andere Mädchen. Sie lebt zurückgezogen, ihr Vater überwacht jeden ihrer Schritte. Doch dann lernt sie Cornelius kennen, und mit ihm gemeinsam wagt sie es endlich, sich aufzulehnen. Was sie nicht ahnt: Den Vater quält ein schreckliches Familiengeheimnis, und es gibt jemanden, der auch vor Mord nicht zurückschreckt, um dieses Geheimnis für immer zu wahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Titel
Bettina Brömme
Frostherz
Impressum
Erste Veröffentlichung als E-Book 2013© Arena Verlag GmbH, Würzburg 2013 Alle Rechte vorbehalten Einbandgestaltung: Frauke Schneider ISBN 978-3-401-80209-1www.arena-verlag.de www.arena-thriller.de Mitreden unter forum.arena-verlag.de
Zitat
Der Kummer, der nicht spricht, nagt leise an dem Herzen, bis es bricht William Shakespeare
Einleitung
Freitag, 30.04.
Ich werde ihn töten. Nachdem er mich getötet hat, immer und immer wieder, werde nun ich ihn töten. Ich werde die letzte, mir verbliebene Kraft bündeln und dann zuschlagen. Ich werde mich aus der Herrschaft von Erniedrigung, Terror, Angst und Schmerz befreien. Dies ist mein Gebet. Ich spreche es lautlos wieder und immer wieder. Ich selbst werde mich erhören. Ich werde Vorkehrungen treffen. Mich bewaffnen. Ein kriegerischer Engel, denn tot bin ich schon lange. Aber die Lebenden, die Überlebenden, die muss ich schützen.
Ich kann ihm im Hausflur auflauern, wenn er von seinen Streifzügen zurückkehrt, befriedigt und satt. Mich von hinten anschleichen, ihm lautlos die Schlinge überwerfen und einfach ziehen. Bis er zappelt. Bis er zu Boden geht. Bis kein Sauerstoffpartikel mehr seine Blutbahnen durchzieht. Seine letzte Wahrnehmung soll der Blick in meine Augen sein. Die ihn verdammen. Ich werde mich einen Moment lang als Sieger fühlen. Ob mein Leben danach einen Sinn haben wird, weiß ich nicht. Es ist egal. Denn schon jetzt hat es keinen Sinn außer dem Leiden und das ist sinnlos. Aber vielleicht wird dieser Akt mein Befreiungsschlag. Vielleicht gehe ich als neugeborener Mensch daraus hervor. Oder ich gehe endgültig unter. Aber wenigstens nehme ich ihn dann mit. Ihn, meinen Peiniger, dem ich so lange ausgeliefert war. Von dem ich dachte, dass ich ihm entronnen bin. Ich werde ihm nie entrinnen. Und ich will nicht, dass er aufs Neue Macht über mich erlangt, dieser finstere Dämon, dieser Teufel, der mein Leben zur Hölle und mich zu ihrer Ausgeburt gemacht hat.
1. Kapitel
Als sie aus dem Bus stieg, sah sie schon von Weitem den dunkelblauen Mercedes am Straßenrand stehen. Unwillkürlich beschleunigte sie ihren Schritt, blickte dabei auf die Uhr. Ihr Herz begann schneller zu schlagen. Sie versuchte sich zu erinnern, genau zu erinnern, aber alles war wie immer gewesen. Sie hatte ihm eine SMS geschrieben, als der Bus losgefahren war. Wie jeden Tag.
Sie öffnete rasch die Tür des einstöckigen Eckreihenhauses mit dem Flachdach. Alles war still.
»Johann?«, rief sie. »Papa?« Keine Antwort. Sie warf ihren Schlüssel in das kleine Teakholzschälchen auf dem Schuhschrank, hängte ihre Jacke auf und ging in die Küche. Niemand dort. Wie jeden Tag. Den Blick an die Decke hätte sie sich sparen können. Natürlich leuchtete das kleine rote Licht. Sie rief noch einmal.
»Jemand da?«
Dann sah sie durch die offene Wohnzimmertür seine dunkelbraune Nubuklederjacke auf dem Fußboden vor dem Essplatz liegen.
»Papa?« Ihre Stimme zitterte nun leicht.
Ihr Vater saß auf dem Sofa. Dem alten hellgrauen Sofa mit den dicken Kissen darauf. Auf dem Sofa, auf dem ihre Mutter die letzten Wochen gelegen hatte, bevor sie ins Krankenhaus gekommen war. Vorgestern waren es acht Jahre gewesen. Er saß ganz auf der Kante. Stierte vor sich auf den Beistelltisch, der mit Zeitungen übersät war. Der rechte Arm hing schlaff hinunter, in der linken Hand hielt er das Handy fest umklammert. Anne kniete sich vor ihn auf den Boden.
»Was ist los?«, fragte sie und legte eine Hand auf sein Knie. Ganz langsam bewegten sich seine Augen in ihre Richtung. Er sah sie an, schwieg aber noch immer.
»Papa«, rief sie nun eindringlich und da ging ein Ruck durch seinen Körper. »Was ist los?«
Er legte das Telefon in einer schnellen Bewegung auf den Tisch, als müsse er etwas Ekliges, Schleimiges loswerden. Dann musterte er sie.
»Deine Großmutter«, sagte er endlich. »Deine Großmutter ist tot.«
Anne ließ sich auf ihre Füße zurückfallen. Sie griff nach Johanns Hand.
»Wie? Wieso?« Ein kehliges Flüstern.
Er legte seine Hand auf ihren Kopf und streichelte über ihre dunkelblonden Haare, wieder und immer wieder. Er zuckte hilflos mit den Schultern, seine Augen füllten sich mit Tränen.
»Mich hat vorhin diese Caritas-Frau angerufen, die morgens immer zu ihr kommt«, sagte er sehr langsam.
»Frau Reisinger?«
»So heißt sie wohl. Sie hat sie gefunden. Sie lag im Esszimmer auf dem Boden. Ihr Herz hat einfach nicht mehr geschlagen.«
Er senkte den Kopf. Anne sah, wie die Tränen dunkle Flecken auf seiner hellen Leinenhose hinterließen. Sie presste seine Hand, setzte sich endlich neben ihn.
»Und jetzt?«, war das Erste, was ihr einfiel. Sie fühlte sich starr, kalt. Wie ein eben ausgeschalteter Kühlschrank. Johann hob die Schultern.
»Ich bin vom Büro aus hin. Da war der Arzt schon da. Herzversagen. Sie haben sie dann…«
Seine Stimme riss ab.
»Papa, sie war seit vielen Jahren herzkrank«, versuchte Anne ihn zu trösten. »Sie war immerhin schon 74.«
»Das ist doch kein Alter. Heutzutage.«
Anne wusste nicht, was sie antworten sollte.
»Wieder einer. Wieder einer, der mich verlässt. Ich habe ihr nicht helfen können.« Jetzt schluchzte er. Sie ließ seine Hand los und stand auf.
»Auch ein Wasser?«, hörte sie sich. Die eigentliche Frage hätte lauten müssen: »Warum bist du so traurig?« Doch diese Frage wagte sie nicht zu stellen. Warum war ihr Vater so fassungslos – über den Tod einer Frau, mit der er seit Jahren nicht mehr als das Allernotwendigste gesprochen hatte? Die er gemieden hatte wie der Teufel das Weihwasser? Für die er immer nur harte Worte gefunden hatte?
Eiskalt lief ihr das Wasser die Kehle hinunter. Sie fragte sich, wo ihre Tränen blieben, wieso sie selbst nicht traurig war.
Das erste Bild, das ihr in den Kopf kam, war das so typische Gesicht ihrer Großmutter Annemarie (von deren Namen sie den ersten Teil geerbt hatte). Die Lippen schmal und fest aufeinandergepresst, die weiß-grau melierten Haare streng aus dem Gesicht gekämmt und zu einem Dutt aufgesteckt, die blauen Augen kalt und von den Lidern beschwert – als müsse sie immer dagegen ankämpfen, die Augen ganz zu schließen. Ihre Körperhaltung war meist abweisend, oft saß sie in ihrem senfgelben Sessel mit dem kratzigen Bezug, hatte die Arme vor der Brust verschränkt und starrte vor sich auf den Perserteppich. Gelegentlich hatte sie unsichtbare Falten aus ihrem meist hellblauen Rock gestrichen. Anne war es immer so vorgekommen, als wäre sie stundenlang so gesessen, während ihre Enkelin, als sie noch kleiner war, leise neben ihr auf dem Teppich mit Playmobil-Männchen oder Schlümpfen gespielt hatte. Oder alleine ein Spiel gespielt, das für mindestens zweier Spieler vorgesehen war.
Ihre Großmutter hatte eine Autorität ausgestrahlt, für die sie niemals die Stimme hatte erheben müssen. Sie war schlank, fast mager gewesen. Immer sehr korrekt gekleidet. Ihre Sprache war knapp und präzise, kein Wort zu viel, das vor allem. Sie hatte ihre Enkelin wohlwollend, aber mit Strenge behandelt. Natürlich gab es zu Weihnachten, Ostern und Geburtstag Geschenke und für ein sehr gutes Zeugnis ein wenig Geld. Aber das waren auch schon die einzigen Zuwendungen. Wenn Anne für ein paar Tage bei ihr bleiben musste, wusste sie von vornherein, worin ihre Aufgabe bestand: nicht aufzufallen und keinen Ärger zu machen. Sie hatte sich immer alle Mühe gegeben und es war ihr auch meist gelungen. Anne hatte manchmal gedacht, sie müsste in dem großen Haus mit seinem herrschaftlichen Empfangszimmer, dem riesigen Wohnzimmer, der fast ebenso großen, altmodischen Küche und ihrem Schlafzimmer, in dem ein erdrückend massiver Schrank neben einem wuchtigen Bett stand, ersticken. Wenn sie am Wochenende dort war, musste sie nach dem Essen auf der Wohnzimmercouch immer einen Mittagsschlaf halten, so wie ihre Großmutter es in ihrem Schlafzimmer tat. Eine Stunde lang konzentrierte sie sich auf das Ticken der großen Standuhr, das vom Esszimmer bis zu ihr hinüber als einziges Geräusch in der Stille zu hören war. Sie schlief nie ein. Die Stunde zog sich wie eingetrockneter Kleber. Glücklicherweise gab es für die Nachmittage den Garten mit den Kirsch- und Apfelbäumen, der mehr lang als breit war und in dessen hinterem Teil sie sich zwischen Holunderbüschen und Flieder ihre eigene Fantasiewelt aufbaute. Sie malte Grundrisse in den sandigen Boden, teilte die Zimmer mit Stöcken und Hölzern ab, dekorierte sie mit abgefallenen Blütenköpfen und flocht, leise summend, skurriles Mobiliar aus Grashalmen und vertrockneten Blättern. Es war das einzige Versteck, das sie je gehabt hatte. Nie kam die Großmutter, um nach ihr zu suchen. Und das war auch das einzige Großmutter-Enkelinnen-Geheimnis. Denn natürlich wäre Johann entsetzt gewesen, hätte er mitbekommen, dass die Großmutter Anne für Stunden sich selbst überließ. Anne ging erst zurück ins Haus, wenn es Zeit fürs Abendessen war oder es zu regnen anfing. Nie wurde mehr gesprochen als nötig. Sie konnte sich nicht erinnern, dass ihre Großmutter sie jemals in den Arm genommen hätte. Doch, einmal: als sie ihr gesagt hatten, dass ihre Mutter gestorben war.
Anne wusste nicht, warum sie um diese harte Frau hätte trauern sollen. Und warum es ihr Vater nun so vehement tat, verstand sie auch nicht.
Als sie zu ihm ins Wohnzimmer zurückkehrte, saß er noch genauso unbeweglich da wie zuvor.
»Papa«, sagte sie sanft. »Hast du schon ein Beerdigungsinstitut angerufen?«
»Das hat die Frau von der Caritas gemacht, da kommt nachher einer, er hat vorhin angerufen.«
Anne setzte sich wieder neben ihn aufs Sofa, nahm seine Hand. Dann schwiegen sie beide so lange, bis es an der Tür klingelte.
Die nächsten Tage bis zur Beerdigung blieb die Kanzlei geschlossen. Ihr Vater saß die meiste Zeit auf dem Sofa und starrte vor sich hin. Nicht einmal an ihre Tabletten erinnerte er sie. Sie war sich nicht sicher, ob er die SMS las, die sie ihm wie üblich schickte, wenn sie in der Schule angekommen war beziehungsweise wenn sie den Heimweg antrat. Sie hatte keine Zeit, großartig darüber nachzudenken, denn nach der Schule hatte sie neben den Hausaufgaben und dem Lernen viel zu tun. Sie hatte sich notiert, was der Bestattungsunternehmer an anfallenden Aufgaben diktiert hatte, und die Liste nach und nach abgearbeitet.
Die Trauerfeier war zu organisieren, ein Sarg auszusuchen, eine Anzeige aufzugeben. Welches Kleid sollte die Großmutter im Sarg tragen, welcher Blumenschmuck wurde gewünscht, welche Musik sollte gespielt werden? Sie war stolz, all diese Aufgaben zu meistern. Glücklicherweise waren die allermeisten Dinge telefonisch zu erledigen. Ihr Vater war so sehr in seine Trauer versunken, dass ihm alles egal war.
Beinahe hätte er sie sogar alleine zum Haus der Großmutter fahren lassen. Sie wertete es als gutes Zeichen, dass er sich in letzter Sekunde doch noch umentschied. Schweigend lenkte Johann seinen Wagen in die etwa zehn Minuten entfernte Gartenstraße. Wie ein Mahnmal ragte die äußerlich herrschaftliche Villa hinter den sandsteinfarbenen Mauern empor. Der dunkellila Flieder rankte bis auf den Gehweg und sein Duft drang durch das geöffnete Autofenster. Anne atmete tief ein.
»Gehen wir?«, fragte sie, nachdem ihr Vater den Motor abgestellt hatte.
»Geh du, bitte«, sagte er. »Ich kann das nicht.« Verwundert nahm sie den Hausschlüssel und stieg aus.
Es gruselte sie ein wenig, das Haus alleine zu betreten, um im Kleiderschrank nach passender Garderobe für die Tote zu suchen. Und doch war sie froh, dass Johann ihr diese Aufgabe übertragen hatte. Es roch muffig, ungelüftet. Die zahlreichen Topfpflanzen ließen bereits die Köpfe hängen. Aus dem Kühlschrank entsorgte sie die Lebensmittel, die meisten hatten zu gammeln angefangen.
Im Wohnzimmer, dort wo die Großmutter gefunden worden war, sah es aus wie immer. Nur auf dem alten, ausgeblichenen Perserteppich vor ihrem Lieblingssessel war ein dunkler Fleck zu sehen. Anne sah schnell weg und suchte nach dem, was ihr vertraut war: schwere altrosa Vorhänge neben den blickdichten weißen Stoffgardinen, die gemeinsam viel Licht schluckten. Ein großer schwarzbrauner Schrank voller Bücher und Geschirr, das abgewetzte Sofa, im gleichen hässlichen Gelb wie der Sessel, sandfarbene Tapeten mit verblassenden Blumen darauf. Das Kreuz aus Bronze an der Wand, Heiligenbilder und Landschaften aus dem 18. Jahrhundert auf den Wänden verteilt. Auch wenn das Haus von außen so großbürgerlich wirkte, bemerkte man im Inneren sofort, dass die neuesten Möbel aus den 60er- oder 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts stammten und seit dieser Zeit kaum etwas renoviert oder erneuert worden war. Auf dem Couchtisch stand noch immer das Likörglas, aus dem die Großmutter vermutlich ihren letzten Holunderbeeren-Likör getrunken hatte. Ein winziger Schluck klebte wie angetrocknetes Blut auf dem Glasgrund. Die Großmutter nahm sonst keinen Alkohol zu sich, der allabendliche Likör war für sie mehr ein Schlaftrunk gewesen. Als Anne schon aus dem Zimmer gehen wollte, fiel ihr Blick auf das Klavier, auf dem seit Jahren niemand mehr gespielt hatte. Neben verstaubten Noten, Jugendbildern ihres Vaters und ihren eigenen Kinderfotos stand ein weiteres Glas, ebenso benutzt wie das erste. Verwundert nahm Anne beide mit in die Küche. Niemals hätte die Großmutter gebrauchte Gläser herumstehen lassen. War etwa am Abend vor ihrem Tod noch jemand bei ihr gewesen, der mit ihr getrunken hatte? Kaum vorstellbar. Außer ihrer Freundin Hedi Aumüller hatte Annemarie nie Besuch empfangen. Sie hatte es gehasst, fremde Menschen im Haus zu haben. Sie hatte sich vor Betrügern gefürchtet, die alten Leuten an der Haustür auflauern, um ihnen mit üblen Maschen Geld zu entwenden.
Anne spielte nachdenklich mit dem Glas in der Hand. Sollte sie es einfach abwaschen und in den Schrank stellen? Natürlich! Was sonst! Wahrscheinlich hatte die Großmutter das zweite Glas an irgendeinem früheren Abend selbst benutzt und auf dem Klavier vergessen. Vielleicht hatte irgendetwas sie abgelenkt. Annes Blick fiel auf die hellgrüne, dreieckige Küchenuhr. Seit zehn Minuten fuhrwerkte sie hier schon herum, Johann würde ungeduldig werden. Sie stellte das Glas ungespült zur Seite, holte aus einer Schublade eine Tüte und ging hinauf ins Schlafzimmer.
Auch dort schien alles wie immer zu sein. Nichts, was Annes Argwohn weiter geschürt hätte. Sie öffnete den schwarzen Eichenschrank und stand eine Zeit lang ratlos davor. Was sollte sie nur auswählen? Letztlich hatte ihre Großmutter fast immer das Gleiche getragen: weiße Blusen, wadenlange, eng geschnittene Röcke in Pastellfarben mit dazugehörigen Jacken und eine Perlen- oder Goldkette mit Kreuzanhänger um den Hals.
Sie entschied sich für eine zarte Jacquardbluse in Weiß und einen hellblauen Rock mit Jacke – so hatte schließlich jeder ihre Großmutter gekannt. Musste sie auch Unterwäsche und Schuhe einpacken? Sicherheitshalber tat sie es mit beklommenem Gefühl. Nach einer passenden Kette musste sie etwas suchen, fand dann aber die Goldkette mit dem Kreuz daran in der Nachttischschublade, wo sie unter einem Schlüsselbund mit einem ledernen Etui daran versteckt gewesen war. Sie ließ sich einen Moment neben all die Sachen auf das weiche Bett sinken und begann zögerlich, an der Bluse zu riechen. Nichts als der Geruch von Waschmittel stieg ihr in die Nase. Anne spürte, wie sich die Tränen in ihr sammelten. Draußen hupte es. Sie schluckte, sprang auf, stieß dabei etwas zu Boden, öffnete aber trotzdem rasch das Fenster.
»Komme gleich«, rief sie hinunter. Als sie am Bett entlang zurückging, um die Kleider in eine Tüte zu stecken, bemerkte sie, was sie zuvor im Aufstehen vom Nachttisch gefegt hatte.
Es war ein großformatiges Buch, das ganz neu aussah und das sie bei ihrer Großmutter noch nie gesehen hatte. Auf dem Umschlag war ein Knabenchor abgebildet, in geschwungenen, altmodischen Buchstaben stand darauf: »100 Jahre Cäcilien-Knabenchor – eine Chronik«.
Anne setzte sich aufs Bett und begann neugierig zu blättern. Was hatte ihre Großmutter mit diesem Chor zu tun? Das Vorwort hatte Annes Musiklehrer Fritz von Derking geschrieben, der den bekannten Knabenchor gemeinsam mit dem Dirigenten Anselm Dürnbach seit gut zehn Jahren leitete. Er freue sich, schrieb er, dass ausgerechnet er an dieser Chronik zum 100. Geburtstag mitarbeiten durfte, und wünsche viel Spaß beim Blättern und Wiedererkennen. Annes Augen flogen über die Zeilen, pickten hier und dort einen Satz auf. Sie wusste, dass der Vater ungeduldig wartete, aber sie konnte das Buch nicht aus der Hand legen. Man habe sich große Mühe gemacht, die vielen Bilder aufzutreiben, schrieb von Derking und er freue sich, wenn alle Familien, die jemals einen Sprössling in den Chor geschickt hatten, nun ein freudiges Wiedererkennen mit der Vergangenheit feiern könnten. Dann pries er die bereits ein Jahrhundert anhaltende und vielfach ausgezeichnete Qualität dieses Knabenchores, der fast schon von Anbeginn seines Entstehens an eine feste Größe in der deutschen Chorlandschaft gewesen sei. Er zählte zahlreiche berühmte Sänger auf, die mit dem Cäcilien-Knabenchor ihre ersten Auftritte gehabt hatten, erinnerte an die vielen Konzertreisen, die es vor allem in den 70er- und 80er-Jahren gegeben hatte, und an die hervorragenden Chorleiter, die das Niveau immer weiter gesteigert hatten, sodass man sich nicht schämen müsse, den Cäcilien-Knabenchor in einem Atemzug mit den Regensburger Domspatzen oder den Wiener Sängerknaben zu nennen.
Irritiert ließ Anne das Buch sinken. Wer aus ihrer Familie hatte wohl in diesem Chor gesungen? Ihr Vater etwa? Oder gar schon ihr Großvater? Nie hatte irgendjemand erwähnt, dass ein männliches Mitglied der Familie in diesem renommierten Chor gesungen hätte. Sie blätterte weiter durch das Buch. Sah schwarz-weiße Fotos von Jungen in Matrosenanzügen und militärisch anmutender Kleidung, ernst blickend unter ihren weißen Mützen. Später wurden die Bilder farbig, die Haare länger, die Kleidung bunter, die Posen lässiger. Immer waren es Buben zwischen vielleicht acht und 14 Jahren, die ihr entgegensahen. Manchmal waren sogar berühmte Gebäude aus aller Welt hinter dem Chor zu erkennen: der Eiffelturm, der Tower, die Golden-Gate-Brücke und auf einem der jüngsten der »Burj Dubai«, der höchste Turm der Welt in Dubai. Sie konnte sich gut erinnern, wie von Derking sie mit seinen ausholenden Berichten von dieser Reise wochenlang gequält und die Proben des Schulchores dabei vernachlässigt hatte. Natürlich schnitt kein Land so gut wie sein geliebtes Bayern ab, aber man hörte dennoch viel Euphorie aus seinen Worten heraus. Gerade als sie das Buch zurück auf den Nachttisch legte, hörte sie Johann die Treppen heraufpoltern.
»Anne!«, schrie er. »Wo bleibst du?«
Mit hochrotem Kopf erschien er in der Tür. Anne griff rasch nach der Kleidertüte.
»Bin schon fertig.«
»Was dauert das denn so lange? Ich dachte schon, du bist die Treppe hinuntergestürzt oder so etwas.«
»Nein, Papa«, versuchte sie ihn mit besonders sanfter Stimme zu beruhigen.
»Aber es war nicht so einfach, sich für die richtigen Kleider zu entscheiden. Außerdem musste ich noch nach einer Tüte suchen.« Wie immer fiel ihr das Schwindeln leicht. Und wie immer merkte er nichts davon.
»Du musst doch verstehen«, seine Stimme war schon viel ruhiger. »Dass ich nach diesem Verlust in einem noch viel größeren Maße um dein Wohlergehen besorgt bin. Du bist der letzte Mensch auf der Welt, den ich habe.« Er zog sie an sich, legte seine Arme um ihre Schultern und strich ihr übers Haar. Wieder und immer wieder.
»Mein Mädchen«, flüsterte er. »Ich will doch nur, dass dir nichts passiert.«
»Ich weiß doch, Papa, ich weiß es.«
Immerhin schien bei der Beerdigung die Sonne und es war das erste Mal in diesem Jahr richtig warm. Anne schwitzte in ihrer schwarzen Hose und der dunklen Samtjacke, als die kleine Beerdigungsgesellschaft die offene Grube unter den hohen Bäumen des alten Hauptfriedhofs erreicht hatte. Sie erschrak, als sie hinabsah und erkannte, wie tief unter die Erde der Sarg sinken würde. Neben ihr stand ihr Vater, gebeugt im schwarzen Anzug mit einer schwarzen Sonnenbrille auf der Nase. An seinem Arm hatte sich Hedi Aumüller eingehakt, die älteste und wohl einzige Freundin ihrer Großmutter. Wie immer trug sie viele Schichten an Bluse, Weste und Jacke, statt in den von ihr sonst bevorzugten Papagei-Tönen, wie sie es selbst nannte, heute in Schwarz. Sie streichelte immer wieder über Johanns Hand. Wie so oft dachte Anne, was sie darum gegeben hätte, Hedi als Großmutter gehabt zu haben. Heute erschien ihr der Gedanke noch unpassender als sonst und sie verdrängte ihn rasch.
Neben Hedi, Johann und Anne waren zwei alte Cousinen und ein Neffe der Großmutter erschienen, ein Sohn ihrer älteren Schwester Konstanze, die bereits vor ein paar Jahren gestorben war. Die Trauergemeinschaft setzte sich mitsamt dem Pfarrer, der in seiner Ansprache nicht müde wurde, die religiöse Kraft der Großmutter zu loben, in das nächste Café. Man hatte sich seit Jahren nicht gesehen, man hatte sich nicht viel zu sagen und so fiel das Beisammensein kurz und eher still aus.
Die kleine Versammlung löste sich schon beinahe auf, als Anne von der Toilette zurückkam und ihren Vater mit Hedi an der Garderobe fand. Sie bemerkten sie nicht und Anne schnappte ein paar Sätze auf, die sie überhaupt nicht verstand.
»Hast du mit ihr noch einmal geredet vorher?«, fragte Hedi und legte Johann wieder die Hand auf den Arm. Der ließ den Kopf hängen und schüttelte ihn.
»Ihr habt keinen Frieden gemacht? Johann! Es wäre ihr so wichtig gewesen.«
»Sie wollte nicht. Jedes Mal wenn ich davon anfing, hat sie…«
»Ich weiß, wie schwer es ihr fiel, darüber zu reden. Aber sie hat sich nichts sehnlicher gewünscht, als dass du ihr verzeihst.« Johann sah Hedi endlich an. Wieder schwammen Tränen in seinen Augen. Aber auch Wut.
»Sie hätte Zeit genug gehabt. Außerdem war doch immer ich der Schuldige für sie. Immer!«
»Nein, das ist nicht wahr. Und das weißt du auch.«
»Aber sie hat mich so behandelt.«
Hedi nahm ihm ihre Jacke ab und erblickte dabei Anne. Sie versuchte, Johann unauffällig auf sie aufmerksam zu machen.
»Was ist?«, fragte Anne, aber Johann schickte sie zu den anderen Gästen zurück.
»Wir kommen gleich. Alles in Ordnung!«, sagte er.
Wie sie es hasste! Immer war alles in Ordnung. Nie sprach jemand mit ihr. Als gehöre sie gar nicht zur Familie. Und dabei spürte sie doch, dass etwas nicht stimmte. Dass es brodelte unter der Oberfläche. Seit Jahren schon.
Mittwoch, 05.05.
Jeder Tag ist Qual. Nichts weiter. Es beginnt damit, dass der Wecker mit seinem kreissägenartigen Gebrüll die Stille meines Zimmers zerreißt – nur wenige Minuten nachdem ich eingeschlafen bin. Eigentlich beginnt nichts, es hört nämlich nie auf, ein ewiger Kreislauf des Schmerzes. Nach dem nächtlichen Durchwühlen des Bettzeugs, als lauere hinter jeder Falte der Feind, falle ich, sobald das erste Morgenlicht in mein Gemäuer dringt, in düstere Träume. Voller Matsch und Seich und Morast und Schlamm. Fast bin ich dem Wecker dankbar, dass er mich aus diesem Schlachtfeld herausreißt. Aber dann weiß ich sofort, was mir bevorsteht: Wieder ein Tag, an dem ich in sein Gesicht, in seine Fratze schauen muss – und er, er glotzt zurück aus seinen Schweineaugen, die kein Mitleid kennen und keine Gnade. Und keiner ahnt etwas. Was er mir bis vor zwei Jahren antat. Bis der Stimmbruch meiner Attraktivität ein Ende setzte. Und ich dachte, ich wäre der Hölle entronnen. Aber die Hölle ist in mir. Immer. Und dann sitze ich da, während er seinen Unterricht abhält und von Harmonien spricht, und überlege fieberhaft, wie ich ihn quälen könnte. Wie ich ihn mit siedendem Wasser übergieße, ganz langsam, und warte, bis die Haut Blasen wirft und dann ziehe ich die Haut ab, Stückchen für Stückchen, Zentimeter für Zentimeter. Manchmal schreit einer in meiner Nähe auf, weil es plötzlich meine Haut ist, die ich zerfetze, die ich stellvertretend für seine malträtiere, ohne es zu merken. Erst wenn der Schmerz ankommt in meinem müden Kopf, der nicht mehr so denkt, wie ich es will, fühle ich mich wieder heimisch in mir. Ohne es zu wollen. Denn alles, was ich tue, dient dazu, diesen Körper zu vergessen, wenn ich ihn denn schon mit mir herumtragen muss, ihn nicht einfach abstreifen kann. Erträglich wird es nur, wenn ich meine kleinen weißen oder flüssigen Freunde in meinen Körper einführe, dann spüre ich, wie sie in meine Adern eindringen und das Träge, Lustlose für ein paar Stunden überlagern, wie sie es an den Rand drängen, sodass ich es kaum noch spüre. In diesem Zustand kann ich besonders klar denken.
2. Kapitel
Am Tag nach der Beerdigung nahm ihr Vater wieder das normale Leben auf. Gemeinsam mit Anne verließ er morgens um 7.20 Uhr das Haus. Um 17.15 Uhr kehrte er aus seiner Steuerkanzlei zurück. Bis 18.00 Uhr kochten sie, immer abwechselnd, einmal Anne, einmal Johann. Einkaufen ging Johann zweimal wöchentlich während seiner Mittagspause in einem benachbarten Bioladen, er legte Wert auf gesunde Nahrung. Um 19.00 Uhr sahen sie gemeinsam die Nachrichten an, anschließend konnte Anne sich in ihr Zimmer zurückziehen oder mit ihm weiter Fernsehen schauen. Bevor sie um 22.00 Uhr zu Bett ging, gab er ihr die Vitaminpräparate. Dann schaltete er die Kameras aus und gegen 22.30 Uhr ging auch er zu Bett. Anne war sich sicher, dass ihr Vater dieses geregelte Leben nicht nur schätzte, sondern brauchte. Zum Überleben brauchte. Und sie brauchte ihn. So viel war klar.
Doch schon ein paar Tage nach der Beerdigung geschah etwas, was die Koordinaten ihres Lebens durcheinanderwirbelte. Für immer.
Im Biologieunterricht ging es um Genetik, speziell um Pränataldiagnostik und ähnliche Dinge. Anne fand das Thema sehr spannend und hatte sich im Internet ausgiebigst informiert. Dass sie jetzt mit ihrem Bio-Lehrer Albert Brunner quasi einen Dialog zum Thema Chancen und Gefahren der Molekulargenetik führen konnte, kam bei manchen in der Klasse offensichtlich nicht besonders gut an. Wie so oft. Sie gähnten demonstrativ, einmal flog ihr sogar ein Radiergummi an den Kopf, während sie eine Frage formulierte. Anne war es gewohnt, dass man sie als Streberin betrachtete, wobei sie ihrerseits nicht verstand, warum sich die meisten ihrer Mitschüler für gar kein schulisches Thema mehr zu interessieren schienen. Sie fand es spannend, dass Erkenntnisse über die kleinsten Bauteile des Lebens – die Zellen – große gesellschaftliche Fragen aufwarfen: Was passierte mit den Menschen, mit ihren Werten, wenn man beispielsweise durch Pränatalaldiagnostik frühzeitig feststellen konnte, dass ein Kind mit Behinderungen geboren werden würde? Man konnte so viel darüber nachdenken, ob eine Welt ohne Menschen mit Defekten tatsächlich eine bessere Welt wäre. Ob nicht auch behinderte Menschen die Gesellschaft bereicherten. Oder was wäre gewesen, wenn man bei ihr selbst schon im Embryonalstadium die Veranlagung zu einer Krebserkrankung wie die ihrer Mutter hätte feststellen können? Hätten ihre Eltern sie abgetrieben? Anne fehlte es manchmal, sich mit Gleichaltrigen über solche Themen auseinanderzusetzen. Was man dagegen zu einer Party anzog oder welches alkoholische Getränk am meisten »burnte«, interessierte sie einfach nicht. Und das nicht nur, weil sie sowieso nie zu irgendjemandem eingeladen worden wäre.
Als Brunner nun ausholte, um zu erklären, dass die Pränataldiagnostik die Entwicklung der Menschen durch rechtzeitige Vorauswahl von gesunden Embryonen erheblich voranbringen werde, hörte Anne am anderen Ende der Tischreihe die Stimme eines Mitschülers immer lauter werden.
»Diane, ist das nicht wunderbar«, sagte Cornelius und Anne sah, dass er direkt in sein Handy hineinsprach, als sei es ein Diktiergerät. »Wir gehen auf eine Menschheit zu, die frei sein wird von Unsicherheiten, Schädigungen und Schwächen, wo alles endlich ordentlich und kalkulierbar sein wird und man uns nie wieder dem Anblick eines – Entschuldigung – Behinderten aussetzen wird.« Die Ironie in seiner Stimme war so eindeutig, dass Anne sich ein Lachen nicht verkneifen konnte.
»Was soll das denn, Cornelius?« Brunner war in drei Schritten an dessen Tisch angelangt. »Schalten Sie das Ding aus, Sie wissen, dass ich keine Handys im Unterricht erlaube.«
»Aber, Herr Brunner, ich bitte Sie!« Cornelius war der einzige Schüler, den Anne kannte, der sich Lehrern gegenüber so verhielt, als sei er einer der Ihren.
»Ich möchte es doch nicht versäumen, diese Sternstunde des Wissens und der Wissensvermittlung für die Nachgeborenen festzuhalten. Für jene klugen, gesunden Nachgeborenen, die uns die Pränataldiagnostik sicherlich bescheren wird.« Er grinste bei seinen Worten über das ganze Gesicht. Brunner plusterte sich auf, seine Arme stellte er ein wenig seitlich aus, beinahe wäre er auf die Zehenspitzen gegangen und sein Atem ging schneller. Er rang nach Worten.
»Und ja, erzählen Sie meinem Vater ruhig davon«, nahm ihm Cornelius den letzten Wind aus den Segeln. Alle Lehrer, wirklich alle, sogar die Netten, das hatte Anne selbst miterlebt, drohten Cornelius gerne damit, seinen Vater direkt im Lehrerzimmer mit den Vergehen des Sohnes zu konfrontieren. Ob sie das jemals wirklich getan hatten, wusste Anne nicht. Brunner wendete sich wortlos ab, ging zur Tafel und begann, mit quietschender Kreide Wörter aufzuschreiben. Nukleotide, Eukaryoten, Mosaikgen, Intron, Exon, Translation… waren nur die ersten davon. Dann drehte er sich langsam um, ein schmales Lächeln umspielte seine dünnen Lippen.
»Bis zum nächsten Mal möchte ich, dass Sie eine Begriffserklärung dieser Worte zu Papier bringen. Und ich weise nur sachte darauf hin, dass die Inhalte im Schlaf sitzen sollten. Warum, können Sie sich sicher selbst zusammenreimen.«
Er droht also mit einem Test, überlegte Anne, während die Mitschüler maulend und meckernd die Begriffe in ihre Hefte übertrugen. Sie linste zu Cornelius hinüber, und als sich ihre Augen trafen, lächelte er. Sie lächelte zaghaft zurück.
Bisher hatte Anne kaum Kontakt zu Cornelius gehabt. Er war nach den letzten Sommerferien in ihre Klassenstufe gekommen, wiederholte die Elfte also. Sie hatte nur ein paar der Gerüchte aufgeschnappt, die über ihn in Umlauf waren. Dass er ein großkotziger Angeber war, der sich für was Besseres hielt. Zum einen, weil sein Vater Hermann Rosen Lateinlehrer und Konrektor der Schule war, zum anderen, weil er bis vor gut eineinhalb Jahren in Thailand gelebt und dort die deutschsprachige Schule in Bangkok besucht hatte, wo sein Vater Lehrer gewesen war. Dass Cornelius angeblich einen Spleen hatte und sich immer mit seinem Handy unterhielt, hatte sie gehört. Dass er schwul sei. Solche Sachen, über die Anne nicht weiter nachgedacht hatte. Wozu auch? Sie wusste genau, dass sie sich in seiner Gegenwart unsicher gefühlt hätte, unterlegen. Diese weltläufige Gelassenheit, die er ausstrahlte, ließ sie sich selbst noch kleiner und unbedeutender fühlen. Was würde er schon mit einer wie ihr zu tun haben wollen?
Anne war es gewohnt, dass ihre Mitschüler sie nur wahrnahmen, wenn sie von Nutzen sein konnte. Hausaufgaben abschreiben, mit ihr ein Referat vorbereiten, das dann garantiert gut benotet würde, sich den letzten Physikversuch noch mal erklären lassen. Es war schon immer so gewesen, oder zumindest fast immer. Spätestens jedenfalls seit sie auf dem Gymnasium war.
In der Grundschule hatte sie zumindest eine beste Freundin gehabt, Hanna. Die hatte ebenso leicht gelernt wie sie und war genauso vom großen »Wissenwollen« erfasst wie Anne. Hanna und Anne hatten ihre Lehrerin gepiesackt mit ihren Warum-Fragen und jene Frau Berghuber war schlecht damit klargekommen, die beiden wissbegierigen Mädchen in die Klasse zu integrieren. Erst als Hanna nach der zweiten Klasse wegzog, war Anne still geworden. Was vielleicht auch am Tod ihrer Mutter Irene lag, der in dieselbe Zeit fiel. Niemand hatte allzu viel Aufhebens um den Tod der Mutter gemacht. Ihre Mitschüler und auch die Lehrerin wussten nicht, wie sie mit ihr umgehen sollten, und schwiegen einfach. Johann, der Vater, war zu sehr mit seiner eigenen Trauer beschäftigt und die Großmutter von jeher eine kalte, sehr zurückhaltende Frau. Andere, nahestehende Verwandte gab es nicht. Beide Eltern waren Einzelkinder, sowohl Johanns Vater als auch Irenes Eltern waren schon vor einigen Jahren verstorben.
Seit dieser Zeit jedenfalls hatte sich Anne mehr und mehr in sich selbst zurückgezogen. Sie hatte Freundschaften nicht gesucht und niemand drängte sich ihr auf. Sie inhalierte Bücher wie andere Sauerstoff, sie hatte mit Klavierunterricht angefangen, mit der Zeit aber gemerkt, dass ihr Singen mehr Freude machte. Also hatte sie Gesangsunterricht genommen und ihre Lehrerin war die Einzige gewesen, die sie zu ihren Geburtstagen eingeladen hatte. Mittlerweile sang sie nur noch im Schulchor und kümmerte sich nicht mehr um die Gehässigkeiten der anderen Choristen, die es satthatten, dass jedes Sopran-Solo von Anne gesungen wurde. Doch Fritz von Derking, ihr Musiklehrer und Chorleiter, aufgrund seiner übergroßen Liebe zu Bayern der »Kini« genannt, war froh, gar nicht nachdenken zu müssen, mit wem er die Soloparts besetzen musste. Er bevorzugte Anne sonst in keinster Weise, lobte sie auch nicht überschwänglich vor den anderen, aber dass sie eine solch feste Größe im Chor war, machte sie noch unbeliebter. Anne sang um des Singens willen. Sie fühlte sich frei und schwerelos, wenn die Töne ihre Kehle verließen, sich im Mund formten und die Luft durchflogen wie Vögel den Wald an einem Frühlingsmorgen. Sie vergaß die Welt, wenn sie sang. Mehr wollte sie nicht.
Als der Gong ertönte und sie wie immer als eine der Letzten hinausging, stieß sie in der Tür mit Cornelius zusammen, der schon wieder sein Smartphone aktiviert hatte und hineinsprach. Anne überlegte nicht, die Worte kamen wie von selbst.
»Agent Cooper, wie geht es Diane heute Morgen? Grüßen Sie sie bitte von mir«, sagte sie und spürte in ihrem rot angelaufenen Gesicht das Grinsen, das sich anfühlte wie von jemand anderem hineingemalt.
Cornelius sah sie irritiert an. »Nein!«, rief er theatralisch aus. »Was muss ich aus deinen Worten schließen – eine Connaiseurin, par bleu!«
Anne musste sich eingestehen, dass sie Cornelius’ leicht verquaste, aber auch irgendwie witzige Art zu sprechen bewunderte. Er unterwanderte die gängigen Mode- und sonstigen Trends ihrer Mitschüler nicht einfach durch Verweigerung, durch einen abgekupferten Punker-Anti-Look oder so etwas, sondern durch die Erschaffung seiner selbst als völlig eigenständiger Person. Blaues Jackett mit abgewetzten Goldknöpfen, kaputte Edel-Jeans oder gar neongrüne oder auch lila Leggins, freakiges T-Shirt – das war seine Uniform. Manchmal trug er eine hornfarbene Nerdbrille, oft Kontaktlinsen – und manchmal waren diese grün, manchmal strahlend blau eingefärbt. Dabei waren seine Augen von einem tiefen, satten Braunton, genau wie seine Haare. Natürlich konnte man die meist nach hinten gekämmten Wellen, die fast bis auf die Schultern reichten, als Dandyabklatsch ansehen, aber oft fielen ihm die Strähnen ins Gesicht, standen vom Kopf ab oder wirkten zerzaust, ohne dass er sich darum gekümmert hätte. Cornelius war einfach anders. Ob er tatsächlich schwul war? Keine Ahnung, überlegte Anne. Was wäre, wenn? Nichts.
Sie jedenfalls hatte sich ihm gerade offenbart. Und er hatte es angenommen. Ja, auch sie war eine Twin-Peaks-Süchtige, die jede Folge der legendären Fernsehserie von vor über 20 Jahren beinahe auswendig kannte. Irgendwann hatte sie im Haus der Großmutter einen Karton voller alter Videokassetten entdeckt, und da das passende Abspielgerät in funktionsfähiger Form tatsächlich noch vorhanden war, hatte sie sich einsame Tage bei der Großmutter mit den Kassetten verkürzt. Anne war von der ersten Sekunde an fasziniert gewesen. Wie gebannt hatte sie auf den Bildschirm gestarrt. Schon die gleichermaßen melancholische wie unheilvolle Titelmusik hatte sie verzaubert. Sehnsucht schwang darin mit, ein bisschen Kitsch – der sofort gebrochen wurde von merkwürdigen Bildern von Rotkehlchen, qualmenden Fabrikschloten und sprühenden Metallsägefunken. Noch dazu war alles so behäbig und langsam geschnitten, wie man es heutzutage im Fernsehen nicht mehr zu sehen bekam. Und trotzdem ging ein Sog davon aus, dem sich Anne nicht hatte entziehen können. Und Cornelius offensichtlich auch nicht.
»Wie bist du an Twin Peaks geraten?«, fragte Anne, während sie den Neubau-Gang entlang hinüber zu ihrem Klassenzimmer im Altbau der Schule gingen.
»Ich weiß gar nicht mehr so genau«, antwortete Cornelius und fuhr sich mit den Fingern durch die Haare. »Ältere Typen in meiner Schule in Bangkok hatten die DVDs. Die haben wir uns dann abends zusammen angeschaut. Die meisten haben spätestens aufgehört, als der Laura-Palmer-Mörder feststand – aber ich habe am Ende gleich wieder mit dem Anfang begonnen.«
»Versteh ich gut! Ich hab die alten VHSen meines Vaters so lange geschaut, bis sie total ausgeleiert waren.« Sie lachte.
Cornelius blickte sie nachdenklich an. »Dass du, also ausgerechnet du…« Er grinste ein wenig entschuldigend. »Hätte ich nicht gedacht, dass du die Serie magst.«
Anne zog die Schultern hoch. »Ich weiß. Ich gelte gemeinhin als langweilig.«
Er legte spontan eine Hand auf ihre Schulter. »Nein, pardon, so habe ich das wirklich nicht gemeint.« Er war richtig rot geworden und Anne musste schmunzeln.
»Leute in unserem Alter schauen so alten Kram ja sonst weniger«, holte er aus. »Ich dachte, du stehst wie alle auf How I met your mother oder so. Ich finde das damn good mit dir und Twin Peaks, kannst du mir glauben.«
»Wie damn good coffee oder was?« Beide lachten.
Als sie endlich am Klassenzimmer ankamen, war die Tür bereits geschlossen.
»Scheiße – die Klausur!«, entfuhr es Anne. »Sind wir zu spät? Vor lauter Gebabbel, Mist!«
»Still«, sagte Cornelius und riss mit ausholender Geste die Tür auf, hinter der Gerlinde Hausmann gerade damit beschäftigt war, die Geschichtsklausur auszuteilen.
»Guten Morgen«, sagte der schlaksige junge Mann freundlich und Anne versteckte sich bereitwillig hinter seinem Rücken. Die Hausmann zog leicht genervt eine Augenbraue hoch.
»Haben Sie doch die Güte, mitschreiben zu wollen«, empfing sie die Zuspätkommenden. Während sich Anne zu ihrem Platz durchschlängelte, griff Cornelius in seine mehr einem Aktenkoffer ähnelnde Schultasche und zog die neueste Ausgabe der Zeit hervor.
»Frau Hausmann«, sagte Cornelius lächelnd und blätterte in der Zeitung. »Gerade noch habe ich mit der Kollegin Jänisch dieses Dossier hier«, seine Finger tippten auf die Seiten, »zum Thema Weimarer Republik diskutiert – und da haben wir glatt die Zeit vergessen, Sie müssen schon entschuldigen. Aber jetzt gebe ich lieber Ihnen den Artikel, damit Sie uns nicht unterstellen, wir würden abschreiben.« Ob sie wollte oder nicht, die Hausmann musste die Zeitung nehmen, widerstrebend legte sie sie auf ihrem Pult ab.
»Nun gut, dann konzentrieren Sie sich jetzt bitte auf die Aufgaben«, erklärte sie sachlich und setzte sich. Langsam beruhigte sich Annes Herzschlag, während sie die ersten Aufgaben durchlas. Das würde zu schaffen sein.
Nach dem Unterricht wartete Cornelius auf Anne. Ganz selbstverständlich.
»Endlich jemand, mit dem ich über Twin Peaks reden kann. Das muss einfach ein damn good day werden«, sagte er lachend.
»Wie ging’s?«, fragte Anne ihn. Er wackelte vage mit der Hand. Damit war das Thema für ihn beendet. Da sie den nächsten Kurs nicht gemeinsam hatten – Anne hatte Lateinunterricht bei Cornelius’ Vater Hermann Rosen –, verabredeten sie sich zum Mittagessen in der Kantine.
Anne beobachtete Rosen heute viel genauer. Niemand würde darauf kommen, dass er und Cornelius Vater und Sohn waren. Der Vater klein, rundlich, mit großer Goldrandbrille und einem schütteren weißen Haarkranz auf dem Hinterkopf. Meist trug er sandfarbene Anzüge, die einen Kolonialtouch hatten. Als wolle er sich selbst damit an Bangkok erinnern. Obwohl Thailand nie kolonialisiert gewesen war. Bis zur Pensionierung hatte er vielleicht noch vier, fünf Jahre. Zu den Schülern war er erst einmal freundlich, meistens fair, zu den Jungs eher als zu den Mädchen. Doch jeder merkte ziemlich schnell, dass mit ihm nicht zu spaßen war. Seine seltenen, aber heftigen cholerischen Ausbrüche waren berüchtigt. Immerhin verzieh er meist schnell. Man merkte jedoch, dass er Schüler, über die er sich geärgert hatte, eine Zeit lang sehr genau beobachtete, bevor er sie wieder freundlich behandelte. Anne hatte bisher mit ihm Glück gehabt, was wahrscheinlich auch an ihrer Lateinnote lag. Ihr fiel das Fach leicht, die Grammatik hatte eine klare Struktur, die Vokabeln konnte sie sich schnell einprägen und das Sätze-Enträtseln machte ihr Spaß. Es war nicht ihr Lieblingsfach, aber es war okay. Für die Eins musste sie sich nur wenig anstrengen.
Als sie gegen halb eins in den lichtdurchfluteten Neubau ging, der vor ein paar Jahren an das alte, klassizistische Hauptgebäude des Cäcilien-Gymnasiums gesetzt worden war und in dem sich jetzt die Kantine und die Räume für die naturwissenschaftlichen Fächer befanden, entdeckte sie Cornelius schnell. Er saß am letzten Tisch am Fenster und las in der Zeit, sofern ihn sein Tablett nicht daran hinderte.
»Interessant?«, fragte Anne, als sie sich endlich mit einem dampfenden Teller asiatischer Hühnersuppe zu ihm setzte. Er nickte, schob die Zeitung dann aber beiseite.
»Wie war’s bei meinem Vater?«, fragte er zurück.
Oje. Anne wusste nicht genau, was sie darauf sagen sollte. In welchem Verhältnis Vater und Sohn wohl zueinander standen? »Okay«, sagte sie. »Ich komm gut mit ihm klar. Er ist wenigstens fair und gibt jedem immer wieder eine Chance.«
»Echt?« Cornelius tat überrascht. »Wow! Wer hätte das gedacht.«
»Wieso? Wie ist er als Vater?«
Cornelius trank sein Wasserglas in einem Zug leer. »Na ja. Sein Engagement für die Schule geht deutlich über das für seine Familie hinaus. Ich rede nur mit ihm, wenn er was von mir will. Vielmehr: Er redet dann mit mir.«
»Ach, das ist bei uns auch nicht viel anders«, erwiderte Anne. »Ich muss jetzt allerdings dringend los.«
»Ach, schade! Kein Nachtisch mehr?«
»Nee, viel zu fett!«
»Ich wollte fragen…«, er sog kurz Luft ein und grinste dann. »...ob du hier einen damn bad coffee haben möchtest oder ob du mich lieber in die beste Espressobar der Stadt begleitest, wo es einen damn good one gibt?«
Anne griff nach dem Tablett und umklammerte es. Das Ja lag ganz weit vorne auf ihrer Zunge. Aber das Nein war doch schneller.
»Ein anderes Mal gerne«, sagte sie, wohl wissend, dass dies eine Lüge war. »Ich muss ein Referat vorbereiten und vorher noch Hausaufgaben machen.«
»Ach, komm schon.« Cornelius sah enttäuscht aus. Er stellte seinen Teller und sein Glas auf Annes Tablett, schob sein leeres darunter und nahm ihr beide aus der Hand. »Ein flotter Espresso, dann gehen auch die Hausaufgaben besser. Ist nicht weit von hier.«
Anne schüttelte bedauernd den Kopf. »Es geht nicht. Echt nicht.«
»Morgen?«
Sie nickte, griff nach ihrer Jacke und winkte ihm zu. »Ich muss mich beeilen, tut mir leid.«