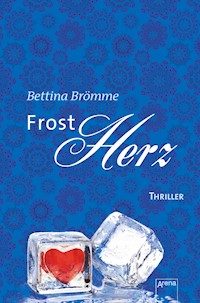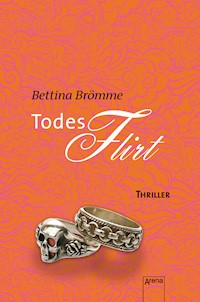
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Arena Thriller
- Sprache: Deutsch
Tabea ist glücklich wie noch nie, als ihre Liebe mit dem stillen David beginnt. Bald fühlt sie jedoch, dass David ihr nicht vollständig vertraut. Was sie nicht ahnt: Alles, was David ihr von sich erzählt hat, ist erfunden. Denn er ist auf der Flucht. Auf der Flucht vor seiner düsteren Vergangenheit, von der er sich losgesagt hat. Doch sein brutalster Feind ist ihm längst auf den Fersen - und der schreckt auch vor Mord nicht zurück.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Titel
Bettina Brömme
Todesflirt
Impressum
Erste Veröffentlichung als E-Book 2012© Arena Verlag GmbH, Würzburg 2012 Alle Rechte vorbehalten Einbandgestaltung: Frauke Schneider ISBN 978-3-401-80175-9www.arena-verlag.de www.arena-thriller.de Mitreden unter forum.arena-verlag.de
Prolog
Fassungslos starre ich auf seinen zerschlagenen Körper. Das grelle Weiß des Raums lässt ihn grauenhaft blass aussehen – totenblass. Seine Nase ist stark angeschwollen, eine Blutkruste zieht sich bis zum Mundwinkel hinunter. Der Kopf ist bandagiert, das rechte Auge kann er höchstens einen Spaltbreit öffnen, es ist braun-grün marmoriert. Er atmet flach, vermutlich wegen der Rippenbrüche. Ein Wunder, dass er noch lebt. Ob er sich erinnert, was geschehen ist? Die Szenen des Abends haben sich in mein Gehirn gebrannt, und wenn ich die Augen schließe, bin ich wieder mittendrin. Ich beiße auf meine Unterlippe, bis ich Blut schmecke. Juli ist noch immer ganz still, aber sie streichelt ohne Unterlass seine lange, schmale Hand, die unter der Bettdecke hervorschaut. Mit ihren mandelförmigen braunen Augen sucht sie meinen Blick. Als wolle sie sagen, alles wird gut. Juli, meine Lebensretterin.
Da gibt er ein kleines Seufzen von sich. Das linke Auge öffnet sich einen Spalt. Man erkennt Rot im Weiß. Die Pupille wandert ziellos umher. Bis er mich entdeckt, erkennt. Seine Mundwinkel bringen unter gehörigem Zittern so etwas wie ein Lächeln zustande. Aber ich kann nicht zurücklächeln. Der Ring aus Eis um mein Herz will nicht tauen.
Alles begann mit dem Gewitter, wird mir klar. Warum erkannte ich die dunklen Wolken, die sich über uns zusammenbrauten, nicht gleich als böses Omen?
1. Kapitel
Die kleine Berivan hatte er sich auf die Schultern gesetzt, Teiki um den Bauch herum gefasst und unter seinen rechten Arm geklemmt. An der linken Hand zog er Hannah, die schon Vorschulkind war, hinter sich her. Ich trug Moritz auf dem Rücken, den Rucksack vor dem Bauch, und versuchte, so gut wie möglich mit David Schritt zu halten.
Die Kräuter, Gräser und Blumen um uns herum wogten, dicke Tropfen fielen auf uns herab und die Kinder jauchzten – nach der schwülen Hitze war diese Erfrischung mehr als willkommen. Hannah streckte die Zunge heraus und wollte die Tropfen auffangen, aber David zog unbarmherzig an ihrem Arm. Mit dem Kinn wies er zu den anthrazitfarbenen Wolken hin, die sich zu Gebirgen auftürmten.
»Lauf, lauf, lauf«, feuerte er sie an und ich fürchtete schon, sie würde – wie es ihre Art war – trotzig mit verschränkten Armen stehen bleiben und ausrufen: »Ich geh gar nicht mehr. Keinen einzigen Schritt!« Aber da gab es einen solchen Donnerschlag, dass Moritz auf meinem Rücken laut aufschrie und Hannah froh war, weiterlaufen zu dürfen. Jetzt weinte auch Berivan und kuschelte sich an Davids blonde lockige Haare. Eng fasste sie ihn um den Hals. Sie würde es als Erste erwischen, würde uns der Blitz treffen. Und er wäre der Zweite. Mit einem Mal war mir eiskalt. David lief, so gebückt es ging.
Bis zum Waldrand waren es vielleicht noch hundert Meter, die Hütte bereits zu erkennen. Die gelben und roten Westen der anderen Kinder leuchteten uns entgegen. David warf mir einen zuversichtlichen Blick zu. Gleich hätten wir es geschafft. Der Regen rann durch mein dünnes Top bis in die Hose hinein – gut, dass sie so kurz war, da kam unten gleich alles wieder heraus.
Es war das erste Mal, dass ich sah, wie der Blitz einschlug. Ich verstand mit einem Mal die Bedeutung des Wortes »blitzschnell«. Ein unvorstellbares Krachen, ein Aufleuchten und eine heftige Erschütterung – dann stand der mannshohe Busch keine 30 Meter von uns entfernt in Flammen. Die Kinder weinten jetzt alle. Ich keuchte und dachte, ich würde gleich umfallen. Die Turnschuhe quietschten bei jedem Schritt und scheuerten am großen Zeh. Ich war wirklich sportlich – in der Schule war ich immer die Schnellste meines Jahrgangs gewesen, aber das hier …
Endlich kam uns wenigstens die Schneider entgegen, nahm David Teiki ab und Hannah. Jessica folgte und nahm mir Moritz vom Rücken. David hob Berivan von seinen Schultern, gab ihr einen kleinen Klaps und sagte: »Komm, kleine Kröte, hüpf ganz flink!« Und das tat sie, bis sie die Hütte erreicht hatte. David streckte seinen Rücken durch und versuchte, die Schultern zu lockern. Kurze Kringelsträhnen hingen beinahe bis in seine türkisblauen Augen. Wasser lief über seine kantigen Wangenknochen und er kniff den ohnehin schmalen Mund vor Anstrengung zusammen. Ohne zu überlegen, griff ich nach Davids Hand und zog ihn hinter mir her. Ich hörte sein Keuchen in meinem Ohr. Ich war froh, als wir endlich die Bäume erreicht hatten, obwohl ich wusste, dass der Aufenthalt hier auch nicht gerade ungefährlich war. Irgendwie fühlte ich mich trotzdem beschützt.
Die Hütte war ein alter Heuschober, dessen Tor auf der Seite zum Feld hin halb offen stand. Sein verwittertes Holz wirkte vor dem schwarzen Himmel noch düsterer. Innen war es ziemlich finster. Es lag eine ganze Menge Heu herum, richtige Berge, und die Kinder hatten angefangen, sich damit zu bewerfen. Sie quietschten schon wieder vor Vergnügen und der Gewitter-Schreck war verflogen. Der Abstand zwischen Blitz und Donner wurde langsam wieder größer.
»Wir warten hier, bis der Regen aufhört«, verkündete die Schneider, sah verärgert auf die Uhr und versuchte – wie immer erfolglos –, Ordnung in ihre aufgesteckten straßenköterblonden Haare zu bringen. Wir waren sowieso zu spät dran. Der Marsch über die riesige Wiese hatte viel zu lang gedauert. Die Eltern würden beklommen vor dem Kindergarten stehen und warten, dass wir ihre Kleinen gesund zurückbrachten. Aber das war typisch für die Schneider: Hauptsache, es sah nach etwas Großem aus. Ein kleiner Ausflug in den nächstgelegenen Wald machte ja nichts her. Nein, über die Panzerwiese zur Flugwerft Schleißheim musste es gehen! Dass die Kinder wie aufgeschreckte Ameisen kreuz und quer über die riesige Wiese stolpern würden – bei schwülen 32 Grad und zu wenig Wasserflaschen dabei –, hätte man vorher ja auch nicht ahnen können. Jessica und Regine tuschelten wie immer. Ihre fast identischen Bobfrisuren in Kupferrot und Hellbraun berührten sich an den Spitzen. Die Schneider versuchte zu zählen, ob alle ihre 25 Schäfchen auch hier waren, während David und ich allen Kindern, die nass geworden waren, halfen, ihre Klamotten aus- und die Wechselwäsche anzuziehen, die in meinem großen Rucksack steckte. Mein Magen knurrte, ich war nass und die Kinder hatten nur Unfug im Kopf. Sie bewarfen sich mit nassen Hosen und T-Shirts, versuchten, sich Heu in die Krägen zu stopfen, und kletterten auf uns herum, als seien wir Spielgeräte. David warf mir gelegentlich ein Grinsen zu und ich bewunderte wieder einmal seine Geduld. Er war noch nicht allzu lange als »Bufdi« in unserer Einrichtung dabei, aber dass er ein Händchen im Umgang mit den Kindern hatte, war schnell klar geworden. Dabei machte er gar nichts Besonderes. Er saß einfach da, hörte ihnen zu, gab Tipps, wenn er gefragt wurde, und manchmal kitzelte er sie durch. Die Kinder liebten ihn – die Jungs wollten mit ihm Fußball spielen, die Mädchen ihn in der Puppenküche bekochen. David machte alles mit. Vielleicht war er auch so begehrt, weil er erstens das einzige männliche Wesen innerhalb der Kindergartenmauern und zweitens nicht ständig da war. Der Verein, der mehrere Kindergärten betrieb, hatte ihn über den »Bundesfreiwilligendienst« für leichtere Hausmeisterjobs und als Springer eingestellt, weil ständig irgendeine Erzieherin krank, schwanger, auf einem Seminar oder im Urlaub war.
Nachdem sich Annegret, eine beliebte und erfahrene Erzieherin in unserem Kindergarten, das Sprunggelenk gebrochen hatte und mehrere Wochen ausfiel, war David nun regelmäßig bei uns. Ich selbst machte seit neun Monaten im »Springseil e. V.« mein freiwilliges soziales Jahr.
Nach dem Abitur hatte ich nicht so genau gewusst, was ich machen sollte, und so kam ich auf die Idee, ein FSJ zu machen. Vielleicht würde mir danach klar sein, ob ich Jura studieren sollte oder doch lieber Psychologie (wofür ich dann immerhin schon zwei Wartesemester vorzuweisen hätte) oder vielleicht Journalismus. Gut, dass ich noch ein Vierteljahr Zeit zum Überlegen hatte …
Meine Eltern, meine Schwester, Max, mein Liebster, und meine Freunde nahmen meine Entscheidung für das FSJ so auf, als stünde sie schon seit spätestens dem Ende des vierten Schuljahres fest. Hätte ich gesagt, ich studiere BWL, wäre für sie alle eine Welt zusammengebrochen. Nein – Tabea wird etwas Soziales machen, das war allen klar. Okay, mir eigentlich auch. Schließlich ist die Welt, in der wir leben, nicht die allerbeste, die man sich vorstellen kann. Aber wenn jeder von uns ein klein wenig dazu beiträgt, sie besser zu machen, dann wird sie auch besser – meine Meinung!
Max hielt mich für eine Sozialromantikerin, unverbesserlich, aber auch unwiderstehlich, wie er, zumindest am Anfang unserer Beziehung vor gut eineinhalb Jahren, immer gerne in mein Ohr säuselte.
Jetzt allerdings flüsterte David: »Schau mal, wie raffiniert Hannah ist.« Er kicherte. »Erst steckt sie Berivan Heu ins T-Shirt, und während die das Zeug wieder rausholt, bedient sich Hannah aus Berivans Brotzeitdose.«
»Hey«, lachte ich zurück. »Du hast das Wort ›Brotzeit‹ schon gelernt – super!« Er knuffte mich in die Seite. Wir saßen an die Wand des Schobers gelehnt, hörten den Wind durch die Ritzen sausen, die Tropfen anklopfen und beobachteten, wie weltvergessen die Kinder durchs Heu tobten. David stammte aus Norddeutschland, woher genau, wusste ich nicht, und war mit der bayerischen Sprache alles andere als vertraut. Obwohl München ja die Welthauptstadt der »Zuagroasten« ist, rieben wir ihm alle seine Sprachunkenntnis ziemlich häufig unter die Nase und ließen ihn gerne an Wörtern wie »Oachkatzlschwoaf« verzweifeln. Er hatte zwei Tage gebraucht, um herauszufinden, dass das »Eichhörnchenschwanz« bedeutete, und jetzt trainierte er emsig und ziemlich vergebens eine korrekte Aussprache.
»Ochkootzlschwoof«, versuchte er es gerade mal wieder und ich lachte laut heraus. David griff nach einer Handvoll Heu und bewarf mich damit.
»Ha’k ’n Hark hatt, ha’k harken künnt«, rief er dabei aus und ich begann noch mehr zu kichern. Was sollte das denn für ein Kauderwelsch sein?
Während er mir diverse Strohhalme aus dem Haar zupfte, verriet er es: »Wenn ich eine Harke hätte, hätte ich harken können. So redet man bei uns.« Ah so.
»Heimweh nach zu Hause?«, fragte ich und mir wurde klar, dass wir uns bisher noch nie über persönliche Dinge unterhalten hatten. Sein immer leicht melancholischer Blick aus den großen Augen wurde wieder ernst. Dann schüttelte er energisch den Kopf, als müsse er eine lästige Fliege verscheuchen.
»Nee«, sagte er knapp. »Überhaupt nicht.«
»War’s nicht schön, da wo du herkommst?«
»Bayern gefällt mir jedenfalls besser«, sagte er. Dann pflückte er einen weiteren Halm von meinem Haar und kitzelte mich damit an der Nase. Ich musste tatsächlich niesen und er lachte. Da klaubte ich Heu auf und bewarf nun ihn damit.
Wir vergaßen, dass wir nicht zu den Kindergartenkindern gehörten. Ich fühlte mich leicht und unbeschwert auf dem Gipfel des Heuberges. Wir stolperten und torkelten, schubsten und bewarfen uns. Ich bekam fast keine Luft mehr, so sehr musste ich lachen.
»Spielstopp«, rief ich, aber er zog mir ein Bein weg. Ich plumpste ins Heu, kullerte seitwärts und donnerte gegen die Bretterwand. Autsch, das war mein Kopf gewesen! David war sofort neben mir. Als sei ich einer unserer Schützlinge, streichelte er mir übers Haar und pustete sogar.
»Entschuldigung, das wollte ich wirklich nicht«, sagte er bestürzt und sah richtig besorgt aus. »Ich wollte …«
»... du wolltest nur spielen«, presste ich hervor und konnte schon wieder grinsen. Er lachte nicht zurück. Sein Blick ließ meinen nicht los. Seine Finger strichen noch immer durch mein kurzes, kräftiges dunkles Haar. Das Schreien der Kinder um uns herum wurde immer leiser, die Hütte immer dunkler. Das einzige Licht strahlte aus seinen Augen direkt in meine. Seine Nase war schmal und lang, die Linien seiner Lippen sehr fein. Er hatte glatte Haut, von Bartwuchs war kaum etwas zu sehen. Ohne zu überlegen, strich ich mit dem Zeigefinger über seine Wange. Fühlte sie sich so glatt an, wie sie aussah? Ich fuhr die Konturen seines Gesichtes ab und er schloss die Augen. Frisch fühlte er sich an und er roch wie vom Wind gelüftete Wäsche. Trotz unseres Laufs vorhin. Meine Finger konnten die Wanderung nicht unterbrechen. Sie strichen über seine zarten, zitternden Augenlider. Sie zogen ein wenig an den störrischen Locken, dann schlossen sie sich, bildeten eine Kuhle und legten sich um sein Kinn. Im Gleichklang näherten sich Hand und Kinn meinem Gesicht. Seine geschlossenen Augen kamen immer näher, ich schloss meine und nun fühlte ich seine Fingerkuppen mein Gesicht berühren. Behutsam, langsam, sanft. Eine Gänsehaut überlief mich. Dann waren die Finger weg. Und seine Lippen da. Auf meinen. Mein Gott, war das schön. Diesmal fuhr der Blitz direkt in mich. Er tastete mit seinem Mund meinen ab. Stückchen für Stückchen. Bitte, hör nie wieder damit auf, flehte ich innerlich. Dann kitzelte mich seine Zunge an den Mundwinkeln.
Komm, dachte ich, komm nur … Sterne explodierten, Welten verglühten, die Zeit kollabierte. Mir war es egal. So hatte mich noch nie jemand geküsst. Dieser Kuss war wie ein Geschenk, das man ein Leben lang nicht vergisst.
Draußen schrie die Schneider mit ihrer spitzen, dünnen Stimme und drängte die Kinder zum Aufstellen in Zweierreihen. David schob mich langsam von sich, ich öffnete die Augen und schloss sie gleich wieder.
»Noch mal«, flehte ich, aber David richtete sich schon auf und zog mich am Arm mit nach oben.
»Ach, da seid ihr«, brüllte Jessica herüber, sodass sich alle Köpfe zu uns drehten. »Hast du ’ne Heuallergie, Tabea? Du bist so rot im Gesicht!«
Ich schüttelte wortlos den Kopf. Ich wollte, dass alle jetzt sofort weggingen und nur wir zwei hierblieben, um durch den Heuschober zu tanzen. Doch leider mussten wir mit.
»Ich sag dem Max nichts«, zischte mir Regine im Vorbeigehen zu und stieß mit ihrer ausladenden Hüfte gegen meine. Es klang wie eine Drohung. Ich zuckte die Schultern.
»Was willst du ihm nicht sagen?«, tat ich leichthin, aber sie zog nur verschwörerisch die Augenbrauen hoch.
Das Gemecker einiger besorgter Eltern war an mir abgeprallt wie ein Flummi an der Zimmerdecke. Die Kinder kicherten und plapperten durcheinander und versuchten, Mama und Papa das Abenteuer »Gewitter« genauestens zu erklären. Und auch ich stand da und suchte nach einer Erklärung. Wieso hatten wir uns geküsst? Während der Fahrt mit der S-Bahn beobachtete ich ihn. Er saß zwischen den Kindern, sie turnten auf den Sitzen und auf ihm herum, er ermahnte sie sanft, machte sie auf seine Beobachtungen aufmerksam – der drollige Hund einer Rentnerin, das schlafende Baby in einem Kinderwagen – und sie folgten ihm wie dressierte Zicklein im Zirkus. Er war einfach wunderbar. Und so ganz anders als Max. Ich versuchte, den Namen zu verdrängen, wegzukauen, runterzuschlucken. Der Gedanke an Max stammte aus einer Parallelwelt, in die ich nicht zurückfinden wollte. Dabei wusste ich genau, dass ich, wenn der Kindergarten schloss, genau dorthin zurückkehren würde. Vielleicht stünde Max sogar hinterm Tor und wartete auf mich. Das tat er selten – aber es würde mich nicht wundern, wenn er es ausgerechnet heute täte. Oh Gott, genau! Heute Abend war ja das Geburtstagsfest seines besten Kumpels Schmolzi. Schrecklich! Bier trinken, Tischfussball spielen und eine Wurst nach der andern vom Grill futtern. Außerdem würden sie sich wieder über die Tofuwürste lustig machen, die mir irgendjemand gutmeinend besorgt haben würde. Ich hasse Tofu – und nur, weil ich Vegetarierin bin, muss ich keinen Tofu essen.
David hörte sich völlig gelassen das Schimpfen von Cuchelos Mutter an, die immer Angst hatte, ihre kleine Prinzessin würde sich im Regen wie Puderzucker auflösen. Ihr ziemlich schlechtes Deutsch war kaum zu verstehen, aber die Tonmelodie sagte alles. David nickte, dann fiel sein Blick auf mich und bekam etwas Schelmisches. Etwas so Vertrautes. Etwas so unglaublich Anziehendes. Okay, ich gebe zu, ich hatte ihn vom ersten Tag an süß gefunden – rein optisch. Aber er war so verschlossen gewesen, freundlich, aber sehr zurückhaltend, dass ich bisher kaum über ihn nachgedacht hatte. Beziehungsweise darüber, was ich für ihn empfand. Jetzt aber – mein Magen zog sich zusammen, als ich seinen Blick auf mir spürte, meine Knie wurden butterweich. Ich wollte die Eltern und Kinder beiseiteschieben, zu ihm eilen, meine Finger in seinen Locken vergraben und ihn küssen, küssen, küssen.
Max’ Kopf schob sich in mein Blickfeld. Mit seinen 1,92 überragte er David bei Weitem. Ich sackte ein wenig zusammen, räusperte mich und winkte aufgesetzt fröhlich zu meinem Freund hinüber. Ich hob meinen Arm, deutete auf die Uhr am Handgelenk und zeigte ihm fünf Finger. Fünf Minuten musste er sich noch gedulden.
David und ich stießen in der Tür des Personalraums zusammen, wo wir unsere Taschen aufbewahrten. Ich wollte eilig raus – er rein. Er sah mich fragend an, aber bevor er etwas sagen konnte, reckte ich mich zu ihm hoch und küsste ihn auf den Mund. Ganz kurz. Es ging so schnell, dass ich gar nicht die Zeit hatte, meine Gedanken zu ordnen: A) Soll ich ihn küssen? B) Sieht uns auch niemand? und C) Bin ich eigentlich völlig bescheuert? Ehe A auch nur angedacht war, war schon alles geschehen. Und wieder war ich verzaubert – kombiniert mit einem drohenden Lachanfall, weil ich die Situation so absurd fand, und einem völlig schlechten Gewissen – hey, da draußen stand mein Freund! David griff nach meiner Hand, aber da lief ich schon fort. Wie konnte ich jetzt den obligatorischen Begrüßungskuss vermeiden? Ich war immer noch nicht wieder Herrin über meine Gedanken, geschweige denn über meine Gefühle.
Zum Glück telefonierte Max und winkte mich zu seinem Wagen, einem alten, silberfarbenen Jeep Cherokee, den er von seinem im letzten Jahr verstorbenen Großonkel hatte übernehmen dürfen. In dem großräumigen Kofferraum lag bereits mein Fahrrad. Ich lästerte natürlich immer über den Benzinverbrauch des Autos, der bei gut zehn Litern lag, aber wie so oft stellte Max dann auf Durchzug.
Ich gebe zu, Max und mich würde man nicht sofort als Traumpaar einstufen. Dazu waren wir zu gegensätzlich. Vielleicht stimmte bei uns das Sprichwort von den Gegensätzen, die sich anziehen. Immerhin waren wir nun schon seit gut eineinhalb Jahren zusammen – ein Rekord sowohl für ihn als auch für mich. Und wenn man sich nicht auf die Unterschiede konzentrierte, dann konnte man auch sagen, wir ergänzten uns ziemlich gut. Ich war spontan und unternehmungslustig, er sorgte für die nötige Ruhe in meinem Leben. Er machte Witze, ich war fürs Diskutieren zuständig. Ich nahm vieles ernst, er das meiste auf die leichte Schulter. Er erdete mich, ich zog ihn hoch. Ich regte ihn auf, er mich ab. Außerdem war er in mancher Hinsicht empfänglich für meine Versuche, einen besseren Menschen aus ihm zu machen, und ich war darüber glücklich. Meinetwegen hatte er mit dem Rauchen aufgehört (na gut, sagen wir mal: in meiner Gegenwart!), er war deutlich pünktlicher geworden (okay, er ruft an, wenn er sich mehr als eine halbe Stunde verspätet) und – und da bin ich wirklich stolz drauf – er zog seine Lehre zum Assistenten für Geovisualisierung ziemlich ehrgeizig durch. Der Umgang mit Geodaten machte ihm großen Spaß. Außerdem hatte er nach den drei Jahren Ausbildung, wenn er gut war, die Möglichkeit, seine Fachhochschulreife zu machen und dann zu studieren. Allerdings würde er sicher nie von München weggehen wollen, während ich schon mal von einem Studienplatz in Berlin, Hamburg oder gar London träumte.
Jetzt aber saßen wir in seinem Wagen, er redete immer noch ins Handy, das er zwischen Hals und Schulter eingeklemmt hatte, seine rechte Hand lag auf meinem Knie. Ich stierte zum Fenster hinaus und nahm nicht wahr, was hinter der Scheibe zu sehen war. David. Türkisblaue Augen. Wundervolle Locken. Durchtrainiert. Schmale Nase. Sanfte Lippen. Lässig unauffällige Klamotten. Ach, diese sanften Lippen …
»... auf dem Ausflug?«, fragte Max und schüttelte mein Knie hin und her. »Hallo? Jemand zu Hause?«
Ich legte meine Hand auf seine, versuchte, zu lächeln und ohne ein Räuspern zu antworten. »Das Gewitter hat uns ziemlich überrascht. Fast wären wir vom Blitz erschlagen worden.«
»Echt? Wow! Gut, dass nichts passiert ist.«
»Allerdings.«
»Sollen wir vielleicht lieber zu Hause bleiben heute Abend? Wir können doch auch das Bundesligaspiel gucken, wenn du Lust hast?«
Ich schüttelte den Kopf. Daheim hätte ich nur gegrübelt. Außerdem wäre Max irgendwann vielleicht zärtlich geworden und hätte … Nein, das ginge heute gar nicht.
An der nächsten roten Ampel zog Max meinen Kopf zu sich hinüber und küsste mich. Sehr bewusst küsste ich ihn zurück.
»Gut, dass du nicht flambiert worden bist«, sagte er und kraulte mich am Ohr, als sei ich sein Hund. »Ich hätte dich doch vermisst …!«
»Echt?«, entfuhr es mir. Gestern noch hatten wir uns gestritten. Ich wollte morgen, am Samstag, zu einer Occupy-Demo gehen, er in die Riem-Arkaden zum Shoppen. Wieso wurde mir mit einem Mal so überlebensgroß deutlich, wie wenig wir zusammenpassten? Annika, meine nächstjüngere Schwester, hatte sich schon das erste Mal halb totgelacht, als sie uns zusammen sah.
»Der sieht aus wie ein Shiba«, hatte sie gesagt. »Du weißt schon, diese japanischen Hunde mit den breiten Köpfen, schräg stehenden, schmalen Augen, den kurzen Haaren, so ganz hellbraune. Ähnlich wie Chow-Chows, nur kurzhaarig und sportlicher.« Ganz unrecht hatte sie nicht: Max hatte einen ziemlichen Quadratschädel, raspelkurze blonde Haare, hellblaue, lebendige Augen, allzeit rote Wangen und eine ziemlich breite Stupsnase. Es war nicht sein Aussehen, in das ich mich verliebt hatte. Er hatte so eine Beständigkeit ausgestrahlt. Er war mein Fels in der Brandung. Der Garant dafür, in dieser Welt nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren.
Aber jetzt, das merkte ich gerade genau, wollte ich nichts lieber als das: den Boden unter den Füßen verlieren und fliegen. Mit David in den Himmel fliegen. Scheiße, ich war echt dabei, mich zu verlieben.
Er wird Repressalien walten lassen. Das Ungeziefer muss vom Antlitz der Erde verschwinden, es muss beseitigt und ausgelöscht werden. Die Aufgabe liegt klar und deutlich vor ihm. Er muss sie nur umsetzen. Bemühe deine Intelligenz, denkt er und betrachtet sich im Spiegel. Alles in Ordnung. Die Augen blitzen blau. Das Haar nicht zu kurz, nicht zu lang. Der Schnurrbart passend getrimmt. Endlich verschwindet das Jungenhafte aus seinen Zügen, das er immer so gehasst hat. Er ist hart – gegen die andern, aber auch gegen sich. Und endlich fängt man an, ihm dies anzusehen. Die weichlichen, weibischen Züge verschwinden. Sein wahres Ich kommt zum Vorschein. Jeder soll sehen, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Dass man mit ihm rechnen muss. Dass die Rechnung nicht ohne ihn gemacht werden kann. Er ist der Herr über Leben und Tod. Da hilft es auch nichts, wenn man sich versteckt. Ich werde ihn finden und ihn ausmerzen wie eine räudige Ratte. Winselnd wird er vor mir im Staub liegen und um Gnade betteln. Aber er hat seine Chance verspielt – seit Langem schon, denkt er.
Er zieht die Krawatte gerade. Ein ordentliches Äußeres ist ihm wichtig. Sonst wird man so schnell in Schubladen gesteckt und da würde er sich unwohl fühlen. Er ist Individualist, auch wenn er die Gruppe braucht. Aber die Gruppe braucht ihn noch viel mehr. Er wird sich den Herausforderungen stellen und sie führen bis zum Sieg. Das Wort »Niederlage« kommt in seinem Wortschatz nicht vor. Vorher wird er aufräumen mit diesen Schmeißfliegen, die meinen, sie können ihn vernichten. Gnade mit denen, die meinen, sie können diese Tatsache hinter sich lassen und vergessen. Es geht um eine große Sache, eine ganz große Sache, bei der der Einzelne völlig unwichtig ist. Außer er versucht, die große Sache zu untergraben. Aber das wird ihm nicht gelingen. Und er weiß auch schon, wie er ihn kriegt. Er kennt seinen Schwachpunkt. Er muss nur geduldig sein und abwarten. Weiter Angst machen. Die Angst steigern. Von Monat zu Monat. Von Woche zu Woche. Von Tag zu Tag. Seine Stunde wird kommen. Schon bald. Er weiß es, denn er ist der Herr über Leben und Tod.
2. Kapitel
Ich kann mich nicht erinnern, wie ich das Wochenende überstanden habe. Wie ferngesteuert lief ich im Modus »Max’ Freundin« herum. Ich saß beim Geburtstagsfest von Schmolzi dabei und ertrug es nur, weil ich viel Caipirinha trank und an den Kuss dachte. Die Küsse. Ich hatte ihn schon zwei Mal geküsst!
Na und?, dachte ich dann. Max hatte mir doch neulich selbst gestanden, dass er auf einer Fete bei Roland mit Alex rumgeknutscht hat. Ausgerechnet mit Alex – dieser großen, langbeinigen Möchtegern-Heidi-Klum. Deren Hobby es ist, die Kollektion von H & M auswendig zu lernen. »Ich war angesäuselt, hatte Sehnsucht nach dir und dann kam die Alex und hat mich blöd angebaggert«, hatte Max zur Verteidigung angebracht. Und ich hatte ihm großmütig verziehen. Warum war ich auch nicht mitgegangen auf die Party? Warum hatte ich ins Kino gehen müssen, um mir einen Dokumentarfilm über die Ausbeutung der peruanischen Landbevölkerung anzusehen mit anschließender Diskussion? Selbst schuld!
Irgendwie spürte ich, dass es mit David anders war. Das war kein Ausrutscher gewesen. Das war pure Anziehungskraft! Ich wollte mich nicht einfach mal so mit ihm amüsieren. Ich wollte wissen, wer er war, wer sich hinter dieser zurückhaltenden Fassade verbarg. Seine Melancholie zog mich an. Ich wollte bestätigt sehen, dass er der sensible, anteilnehmende, gute Junge war, für den ich ihn hielt. Dem ich ein Lächeln entlocken konnte. Und mit dem ich gemeinsam die Welt würde retten können. Max war plötzlich nur noch ein Handwerker, während David mein Künstler war. Sein Kuss hatte mich beseelt.
Am Montagmorgen, als ich den Kindergarten betrat, pochte mein Herz bis zum Hals. Ich wusste nicht einmal genau, ob er diese Woche bei uns wäre. Vielleicht war Annegret ja wieder da?
Aber er saß tatsächlich in der Lego-Gruppe, die als einzige so früh geöffnet hatte, und fütterte Berivan mit Apfelstückchen. Sie saß auf seinem Schoß und schnappte wie ein Seehund nach den Schnitzen, die er knapp über ihren Mund hielt. Ich war so versunken in den Anblick, dass ich erschrocken zusammenfuhr, als mich Regine mit ihrem üblichen lauten »Guten Morgen« begrüßte.
»Schon wach?«, setzte sie nach. »Hallo, das Wochenende ist rum!« Angesichts ihres groß gemusterten grellbunten T-Shirts musste ich mir die Augen reiben. Ich gähnte demonstrativ und verschwand in Richtung Personalraum. Mit dem Finger strich ich über den Türrahmen. Hier hatten wir uns am Freitag geküsst.
»Alles klar?«, hörte ich plötzlich seine Stimme hinter mir. Bis ich mich umdrehte, war ich schon hochrot im Gesicht. Ich nickte ihm lächelnd zu. Er lächelte zurück, holte ein Päckchen Taschentücher aus einem der Regale und mit einem »Die sind schon fast wieder aus!« verschwand er.
Ich war enttäuscht. Kein verschwörerischer Blick. Kein kurzes Berühren, wenigstens an der Schulter. Keine … Verbindlichkeit. Nur ein kleines Lächeln unter Kollegen. War er doch von der Sorte, die mit Mädchen spielte? Kurz entflammen, schnell verglühen?
»Tabea, kommst du? Morgenkreis!«, rief Jessica.
David und ich saßen uns gegenüber. Ich glaube nicht, dass einer von uns hinterher hätte sagen können, welches Lied wir gesungen hatten. David starrte ausdruckslos auf den Boden, er überließ Cuchelo, die nun auf seinem Schoß saß, seine Hände zum Mitklatschen und bewegte den Mund, ohne dass ein Laut herauskam. Hoffentlich ging das nicht den ganzen Tag so weiter! Oder die ganze Woche! Das würde ich nicht ertragen, ich musste mit ihm reden, unbedingt!
Doch der Montag schien nicht der richtige Tag dafür zu sein. Es war so viel zu tun, ständig lagen sich irgendwelche Kinder in den Haaren und wir mussten Streitereien schlichten, trösten und ablenken, sodass wir kaum eine Minute zum Durchatmen kamen. Nicht einmal die Mittagspause konnten wir gemeinsam verbringen. Während David in der Küche half, ging ich in die Pause, er erholte sich, während ich Schlafwache bei den Kleinen hielt. Und als ich um fünf Uhr ging, stand schon wieder Max draußen. Er hatte gerade Berufsschule und daher früher frei als üblich. Fast war ich froh, denn ich spürte auch, dass ich Angst hatte, David anzusprechen – und inständig hoffte, er würde den ersten Schritt tun.
Am Ende des Tages saß ich unbeweglich auf Max’ Bett und versuchte, die Tränen herunterzuschlucken. Er betrachtete mich irritiert.
Ich spürte, dass unsere Zeit zu Ende ging. Und ich glaube, das wäre auch ohne David so gewesen. Nur hatte mir David geholfen, dieses Ende wahrzunehmen.
»Max, ich weiß nicht«, stotterte ich leise. »Irgendwie, im Moment, also …«
»Klare Ansage«, sagte Max schmunzelnd. »Schatzi, du bist überarbeitet.« Er legte den Arm um mich. »Morgen sieht alles gleich wieder viel besser aus. Und jetzt lass uns schlafen gehen.«
Ich weiß nicht, wie lange ich überlegte, aber irgendwann nachdem er eingeschlafen war, entwand ich mich ihm, zog mich an und lief leise durch das nachtstille Haus seiner Eltern. Mein Fahrrad stand noch in der Garage und ich brauchte keine zehn Minuten, um nach Hause zu radeln.
Wie ein geborgenes Nest erschien mir das weiße, zweistöckige Haus mit dem ausgebauten roten Satteldach. Manchmal fand ich es spießig mit seinen braunen Fensterläden, dem braunen Zaun mit dem Tor darin und der Haustür aus Holz. Die Unordnung, die sich durchs ganze Haus zog, machte mich manchmal fuchsig, auch wenn ich wusste, dass uns allen zu wenig Zeit blieb, um den vielen Plunder auszusortieren oder wegzuräumen. Und so stolperte man eben immer wieder über Gartengerätschaften, Pflanzen, die dringend eingetopft werden mussten, leere Wasser- und Bierkästen, Hundefutter, alte Kartons, Zeitungen, Plastikflaschen und so weiter. Trotzdem war es gemütlich bei uns. Viele honigfarbene Holzmöbel waren mit Erinnerungsstücken vollgestellt, die Zeugen eines bunten, intensiven Familienlebens waren. Seien es Fotos und Kinderzeichnungen von uns oder gar noch die ersten Basteleien aus dem Kindergarten – jedes Stück hatte seinen Platz.
Als ich die Haustür aufsperrte, scheuchte ich Socke aus ihrem Korb auf, aber immerhin winselte die portugiesische Kuhhündin so leise, dass niemand geweckt wurde. Ich klopfte ihr das kurzhaarige braune Fell und sie drückte ihren Kopf erfreut an meine Oberschenkel.
»Hallo, Tabi«, sagte da eine vertraute Stimme und ich sah erstaunt zu Juli, meiner 14-jährigen, jüngsten Schwester auf.
»Du bist ja noch wach!«
»Konnte nicht schlafen. Hatte Durst. Wo warst du? Bist du traurig?« Wie so oft wischte sie sich Haarsträhnen aus dem Gesicht, die sofort wieder zurückfielen.
Ich zog sie mit mir in die Küche, wo noch die offene Orangensaftflasche neben der Spüle stand. Ich drehte sie zu und stellte sie zurück in den Kühlschrank.
»Ups, vergessen«, lachte Juli und warf mir ihr unglaubliches, herzwärmendes Lächeln zu. Dann kam sie zu mir und legte ihre weichen Arme um mich.
»Schön, dass du da bist.« Ich streichelte über ihre langen blonden Haare, ganz schlafzerzaust waren sie.
»Jetzt müssen wir aber wieder ins Bett gehen, Juli«, sagte ich sanft. »Bald klingelt der Wecker.«
»Okay.« Sie fasste mich eng um die Taille, wir stiegen die Treppe ins obere Stockwerk hinauf und ich brachte Juli zurück in ihr Bett. Unter ihren Pferde- und Hundepostern schlief sie schnell wieder ein. Ich betrachtete noch eine Weile ihr entspanntes rosiges Gesicht und wunderte mich wieder einmal. Wieso hatte sie sofort gespürt, dass ich traurig war? Annika würde nicht mal was merken, wenn ich mir das Wort »traurig« auf die Stirn tätowieren würde. Annika war 16 und alle drei Tage in einen andern verliebt. Da blieb nicht viel Zeit, sich um die große Schwester Sorgen zu machen. Was sie ja auch gar nicht sollte. Aber Juli? Unsere Juli, der Liebling der Familie.
Als die Ärzte ziemlich schnell nach ihrer Geburt mit der Diagonse »Downsyndrom« kamen, waren meine Eltern völlig geschockt. Meine Mutter Monika war gerade mal Anfang 30 und hätte nie gedacht, dass sie ein behindertes Kind bekommen könnte. Ich war damals etwas über vier, Annika gerade zwei. Wir freuten uns einfach über diese kleine, runde Schwester, die wir bemuttern konnten. Uns wäre niemals aufgefallen, dass sie anders war als wir. Uns war es egal, dass sie erst mit gut drei Jahren einigermaßen laufen konnte und zu diesem Zeitpunkt nur wenige Worte sprach – während sie heutzutage die größte Plapperliese von uns dreien ist. Sie spricht in kurzen, knappen Sätzen – gerne viele und oft mit wiederkehrendem Inhalt. Mit ihrem wunderschönen Lächeln hatte sie die ganze Familie sofort verzaubert. Meine Eltern taten alles, damit Juli ein so normales Leben wie möglich führen konnte. Na ja, was hieß in einer Familie mit drei Mädels schon normal? Immer war irgendwer beleidigt, laut, albern, zickig, verträumt, krank, zu spät dran oder hungrig. Und da meine Mutter die Gärtnerei ihrer inzwischen verstorbenen Eltern übernommen hatte, war sie viel beschäftigt. Der einzige Vorteil war, dass unser Haus gleich hinter der Gärtnerei lag und sie keine großen Wege zurückzulegen hatte. Außerdem waren wir Mädchen, solange wir noch nicht zur Schule gingen, einfach immer dabei. Im Sommer wühlten wir in der Erde und pflückten Blumen, Obst und Gemüse. Schnell hatte meine Mutter uns beigebracht, beim Säen, dem Ziehen und Pikieren von Setzlingen, Ernten und allen möglichen anderen Dingen, die in der Gärtnerei anfielen, mitzuhelfen. In der kühleren Jahreszeit hielten wir uns viel im Gewächshaus auf, bastelten für die Weihnachtszeit oder für Ostern und waren meist sehr zufrieden damit. Mein Vater Harald war Lehrer an der städtischen Berufsschule für Gartenbau und hatte daher glücklicherweise relativ viel Zeit, sich um uns zu kümmern und meine Mutter zu unterstützen.
Als Baby und Kleinkind hatte Juli mehrere Herzoperationen zu überstehen und benötigte natürlich sehr viel Aufmerksamkeit meiner Eltern. Später kam Förderung durch Physiotherapeuten und Logopäden hinzu. Aber wenn es eng war, beschäftigten meine Eltern immer wieder Gerda, die als Haushaltshilfe bald unersetzlich wurde. Inzwischen war sie über 70 und kam nur noch zu Besuch zu uns. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich durch Juli bei irgendetwas zu kurz gekommen wäre oder auf etwas hätte verzichten müssen – im Gegenteil, diese Schwester war das größte Geschenk, das man uns hatte machen können. Wir lernten alle schnell, uns auf die wesentlichen Dinge im Leben zu konzentrieren und nicht immer rumzujammern, nur weil mal etwas nicht funktionierte oder ein Wunsch nicht erfüllt wurde. Juli war einfach ein Sonnenschein, die uns alle von dem Moment an, in dem sie morgens die Augen aufschlug, zum Lachen brachte. Außerdem war sie es, die einen am besten trösten konnte – einfach weil sie sofort spürte, wenn was nicht stimmte. Ohne groß zu fragen, nahm sie einen in den Arm, streichelte einem die Hand und summte manchmal eine einfache Melodie dazu. Da fühlte man sich gleich so geborgen und geliebt, dass man jeden Kummer schnell vergaß. Ich jedenfalls war sehr empfänglich für Julis Trostspenden. Annika entzog sich da eher mal. Sie hatte früh versucht, möglichst unabhängig von unserer Familie zu sein, ihren Kopf durchzusetzen und ihre eigene Sache zu machen – je mehr es gegen unsere Familienkonventionen verstieß, umso besser. Im Gegensatz zum Rest der Familie war Annika sehr ordentlich. Sie sah immer wie aus dem Ei gepellt aus und ihr Zimmer war jederzeit aufgeräumt. Auch sonst war sie sehr klar und rational – außer wenn sie für Jungs schwärmte. Da konnte sich schon mal ein Klassenstreber oder ein Muttersöhnchen unter die Objekte ihrer Begierde verirren. Wie erstaunt war ich gewesen, als sie nach dem Realschulabschluss tatsächlich mit einer Gärtnerei-Ausbildung bei meiner Mutter begonnen hatte. Aber sie hatte eben auch den grünen Daumen unserer Ma geerbt. Alles in allem hingen wir fünf sehr aneinander – und natürlich auch an Socke, der Hündin, die eigentlich Cassandra hieß. Aber weil sie sich als Welpe immer auf alle Socken gestürzt hatte, um sie mit ihren kleinen, spitzen Zähnen zu zernagen, hatte sich irgendwann der Name Socke für sie durchgesetzt. Ich glaube, Juli war darauf gekommen.
Am Mittwoch wurden David und ich losgeschickt, um das wöchentliche Frischobst und -gemüse abzuholen, das es zwischendurch für die Kinder gab. Es war nicht weit zu dem Biobauern, aber weil wir viel zu tragen hatten, nahmen wir den kleinen Transporter, der dem Verein gehörte. Ich befürchtete, die Beifahrertür nicht zuzukriegen, so sehr zitterten meine Hände. War ich dabei, verrückt zu werden? Okay, ich war in Max am Anfang auch ziemlich verknallt gewesen – aber so was? Noch dazu, wo ich es doch gar nicht wollte.
Schweigend saß ich im Bus. Sollte ich von unserem Kuss reden? Ihn fragen, ob er etwas für mich empfand? Oh my god! Ich brachte es einfach nicht übers Herz. Mehrmals öffnete ich den Mund. Und schloss ihn sofort wieder. Auch David schwieg eisern. Er musste sich wohl sehr auf das Fahren konzentrieren.
Recht wortkarg nahmen wir das Obst und Gemüse entgegen und packten es in den Laderaum des Transporters. David schloss schwungvoll die Hecktür. Da ich links von ihm stand, musste ich an ihm vorbei, um zur Beifahrertür zu gelangen. Im selben Moment gingen wir los, tänzelten umeinander herum, weil jeder den anderen vorbeilassen wollte, und endlich lächelte er. Da nahm ich seine Hand. Seine große, etwas rissige Hand. Und hielt sie einfach fest. Er erwiderte den Druck und ich sah, dass er schluckte.
»Ist die Tür richtig zu?«, fragte er plötzlich, lehnte sich mit dem Rücken dagegen und drückte noch mal. Alles okay.
»Äh, ich … du …«, stammelte ich los, ohne auch nur die leiseste Idee davon zu haben, welche Buchstaben meine Zunge als Nächstes formen würde.
»Ja, du … ich … auch«, stotterte er genauso und wurde tatsächlich rot. Plötzlich musste ich lachen.
»Was – du auch?«, fragte ich nach.
»Ich träume jede Nacht, dass wir uns küssen. So einen schönen Traum hatte ich seit Jahren nicht mehr.« Schnell sagte er das, als hätte er Angst, die Worte zu verschlucken, wenn er sie nicht gleich aussprach. Ich konnte ihm endlich in die Augen sehen.
»Ich träume jede Nacht und jeden Tag davon«, sagte ich. Und da beugte er den Kopf zu mir herunter und endlich, endlich spürte ich seine Lippen auf meinen. Wie zwei Puzzleteile, die perfekt zueinanderpassten.
»Könnt’s ihr ned mal den Wagen da wegfahren«, holte uns jemand zurück auf die Erde. »Der steht total im Weg, da kommt der Traktor ned durch!«
Auf der Rückfahrt ließen wir unsere Hände nicht los. Wir umfassten sogar gemeinsam den Gangschaltungsknüppel. Erst als wir ausstiegen und die Gemüse- und Obstkisten in den Kindergarten brachten, lösten wir uns voneinander.
Die Realität hatte uns grausam schnell wieder. Aber irgendwie hörten sich die Kinderschreie leiser an als sonst, die Kleinen waren leicht wie Federn, wenn man sie herumtrug, und mir schien, sie beschäftigten sich länger als sonst mit einer Sache – und ließen uns in Ruhe. Vielleicht schwebte mein Kopf, mein Herz, mein ganzer Körper so weit oben in Wolke sieben, dass ich nicht mal mitbekommen hätte, wenn der Kindergarten von einem riesigen grünen Drachen verschluckt worden wäre.
Glücklicherweise war das Wetter herrlich und die Kinder konnten durch den Garten toben. Wir saßen still auf einer Bank und beobachteten sie. Unsere Fingerspitzen berührten sich. Keiner würde es bemerken. Wir glühten innerlich, alle beide. Nur die Zeiger der Uhr hatten sich gegen uns verschworen – sie krochen so langsam wie noch nie.
Aber irgendwann hatte auch dieser Arbeitstag ein Ende. Wie immer kam Moritz’ Mutter um fünf Minuten nach fünf, entschuldigte sich wortreich für ihre Verspätung und um viertel nach fünf konnten wir den Kindergarten endlich absperren.
Langsam ging ich zu meinem Fahrrad. Von Trudering, wo meine Eltern wohnten, bis hierher zum Kindergarten in der Messestadt brauchte ich durch den Park gerade mal eine Viertelstunde. Wo David wohnte, darüber hatte ich mir nie Gedanken gemacht. Ich wusste nur, dass er mit dem Bus kam.