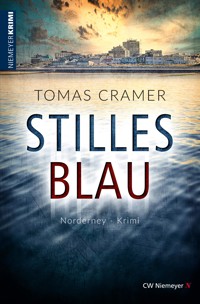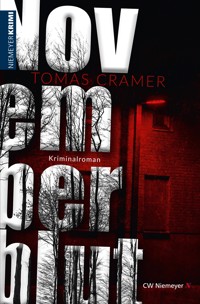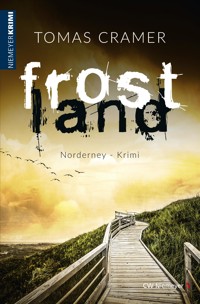
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CW Niemeyer
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Norderney im Winter. Zwei grausame Morde erschüttern die Insel. Mordopfer sind der ehemalige Chefarzt der Inselklinik und der örtliche Gemeindepfarrer. Als die polizeilichen Ermittlungen ins Stocken geraten, wird Privatermittler Frank Gerdes von seiner Jugendfreundin Antje gebeten, eigene Nachforschungen anzustellen. Gerdes stößt auf Korruption und den schleichenden Ausverkauf der Insel. Seine unorthodoxen Ermittlungsmethoden führen ihn auf eine dreißig Jahre alte Spur aus Missbrauch und Affären. Während Gerdes Stück für Stück das Geflecht entwirrt, gerät er selbst in Lebensgefahr … »Frostland« ist ein feinsinniger Roman über erlittenes Unrecht und versäumte Gelegenheiten. Ein berührender Inselkrimi mit präzisem Blick auf die Wirklichkeit – im besten Sinne gute Unterhaltung. Nach dem Erfolg des Kriminalromans »Novemberblut« legt Tomas Cramer mit »Frostland« den zweiten Fall des Hamburger Privatermittlers Frank Gerdes vor. Erneut trifft Gerdes auf seine Jugendliebe Antje; der grantige Hauptkommissar Deeken und sein junger Kollege Vaske führen auch in diesem Fall die polizeilichen Ermittlungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Für meine Familie, Freunde und alle Norderney- und Nordsee-Fans.
Die Handlung dieses Buches ist frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit realen Personen wäre zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über www.dnb.de© 2020 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hamelnwww.niemeyer-buch.deAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: C. RiethmüllerEPub Produktion durch CW Niemeyer Buchverlage GmbHeISBN 978-3-8271-8381-1
Tomas CramerFrostlandNorderney-Krimi
Tomas Cramer (*1967), aufgewachsen in der niedersächsischen Stadt Cloppenburg, ausgebildeter Bankkaufmann, absolvierte diverse theologische und trauerbegleitende Seminare, zudem die Workshops „Kreatives Schreiben“, „Buchgestaltung und -vermarktung“, „Schreibwerkstatt“. Aufnahme in der Autorendatenbank des Literaturhauses Niedersachsen (Nds. Ministeriums für Wissenschaft und Kultur).Mitgliedschaft im „Syndikat“ – der Autorengruppe für deutschsprachige Kriminalliteratur.Cramer veröffentlichte mehrere Jugend- und Sachbücher sowie Romane und Bildbände. Zudem liegen Publikationen zu theologischen Themen in einer Missionszeitschrift und im Internet vor. Tomas Cramer ist kirchlich-ökumenisch engagiert, verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Er lebt seit 1991 in der Mittelweser-Region, im Landkreis Nienburg (Weser).
Kapitel 1
Sommer 1989
Zitrusgelbe Vorhänge hoben und senkten sich im Rhythmus der brandenden See. Sie gebaren gut durchmischte Luft, durch schmale Fenster gelangte sie in Julias Zimmer. Draußen verebbte langsam die Sommerglut der letzten Tage, doch hier unter dem Dach brüllte die Hitze noch immer backofengleich. Irgendjemand hatte den Ofen auf die höchste Stufe gestellt, den Knopf abgezogen und tief ins Riffgat gesteckt.
Julia Heymann zog einen Vorhang beiseite, sah hinaus, kniff die Augen zusammen. Das Licht war grell, die Luft flirrte, tanzte in der Ferne. Ihr Blick sank hinunter bis in den Garten. Ein paar Gäste waren schon da, das Gelächter ihrer Mutter klang dann affektierter. Wieder ließ Mutter sich feiern – sich selbst und insgeheim ihren ... Beichtvater.
Julia zog den Vorhang wieder zu, durchquerte barfuß ihr Zimmer und öffnete die Tür für einen Luftzug – aber nicht mehr. Von unten drangen Musikfetzen sowie das penetrante Gelächter ihrer Mutter herauf. An der veränderten Stimmlage erkannte Julia, dass Pfarrer Martin Sander eingetroffen war. Alle himmelten ihn an. Sogar Mutter war geil auf ihn – das spürte sie. Nie durfte so etwas ausgesprochen werden, mit einem Knacks im Heiligenschein lebte es sich nicht gut. Julia war nicht verborgen geblieben, dass auch der Pfarrer ein Auge auf Mutters Hintern geworfen hatte, meistens sogar beide. Papa bekam davon nichts mit, der merkte sowieso gar nichts! Ma und Pa redeten kaum noch miteinander, aber die Fassade blieb gewahrt – vor Freunden, Verwandten und natürlich der Kirche. Regelmäßig schaute Mutter sich „Die Dornenvögel“ an, und jedes Mal heulte sie sich die Augen wund. Erst vor wenigen Wochen kaufte sie sich die Spezial-Video-Edition im Metallschuber, inklusive Begleitbuch und Stofftaschentüchern mit aufgesticktem Konterfei Pater Ralphs. Die alte VHS-Kassette war unbrauchbar geworden, war durchgenudelt. Und je länger Julia darüber nachdachte, desto mehr wurde ihr klar, dass es zwischen Pfarrer Martin Sander und diesem ätzenden TV-Pater Ralph tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit gab. Vermutlich wartete Mutter nur darauf, bei nächster Gelegenheit mit Sander durchzubrennen. Eine stille Sehnsucht, die sie womöglich mit anderen frustrierten Ehefrauen Norderneys teilte.
Julia wollte den Gästen heute nicht begegnen, auf keinen Fall. Der hektische Aufriss am Vormittag hatte das erforderliche Maß an Kooperation überschritten. Kuchen backen, Kaffee kochen, Tisch decken. Jetzt waren ihre Eltern an der Reihe, und auch heute würde es Mutter gelingen, die gesamte Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Eigentlich sollte Vaters Beförderung zum Leiter des Ordnungsamtes gefeiert werden, doch Mutter war talentiert darin, solche Anlässe für ihre eigenen Zwecke zu missbrauchen.
Nach dem Mittagessen nahm Julia den dicken Brief vom Küchenschrank und meldete sich ab. Sie verschwand nach oben ins Zimmer, zog sich aus, streifte sich ein übergroßes Shirt über, warf sich aufs Bett und griff nach dem Kassettenrekorder. Kenos Kassette war endlich da, hoffentlich mit guten Nachrichten, er hatte das Band bereits an die richtige Stelle gespult. Julia öffnete den Schacht des Rekorders, schob die Kassette hinein, schloss die Klappe und drückte auf „Play“.
Zwei, drei Sekunden Stille, dann: „Liebste Julia ...“
Wie sehr hatte sie sich auf seine sanfte Stimme gefreut. Sie war auf der Kassette klar, unmittelbarer als am Telefon. Gerade jetzt, wo Julia sich wegen der Ereignisse der letzten Woche sehr ängstigte, benötigte sie seine Nähe umso dringender.
„... ich vermisse dich.“
Eigentlich wäre es Zeit für ein Telefonat gewesen. Der Vorteil der Kassettenaufnahme war: Sie konnte seine Worte immer wieder zurückspulen und sich alles noch einmal von vorne anhören. Sicher würde sie das heute tun.
„Ich kann es gar nicht erwarten, dich endlich wiederzusehen ...“
Dies war Julias Möglichkeit, ungestört mit Keno zu kommunizieren. Unten am Telefon stünde sie unter Beobachtung. Manchmal telefonierte sie von Fenja aus, aber vor Lauschern war sie auch dort nicht sicher – und sie wollte ihre Freundin nicht ständig mit ihrem Liebesleben nerven.
„Ich muss dir unbedingt erzählen, was ich in den letzten zwei Wochen erlebt habe ...“
Apropos, auch Julia selbst hatte so etwas wie Dornenvögel erlebt, mit der Betonung auf Dornen. Jan Gronewold, Sohn des Chefs, war ihr bei der Abschlussparty dermaßen an die Wäsche gegangen, dass sie ihm eine geknallt hatte. Jan, drei Jahre älter als sie, hatte auf der Schulparty nichts verloren. Er war nicht mal eingeladen gewesen. Das war ihm scheißegal, er machte Jagd auf sie. Jeder Norderneyer wusste das, es sorgte schließlich für Gesprächsstoff, trotzdem hielt niemand zu ihr – außer Fenja vielleicht.
„... da meinte der Kollege ...“
Julia war bei Keno nur mit einem Ohr, mit ihren Gedanken war sie bei Jan Gronewold. Der Typ machte ihr Angst. „Pass auf, Schlampe“, hatte er ihr zugezischt, als er sich ihr draußen breitbeinig in den Weg gestellt hatte. „Meinst wohl, du kannst mir entwisch’n, hä?“ Er streckte ihr den Mittelfinger entgegen. „Uns Gronewolds gehört hier die ganze Insel, vielleicht kapierst du’s nicht ... du Nutte gehörst mir!“ Auf einmal griff er ihr zwischen die Beine, mit der anderen Hand bohrte er ihr einen Finger in den Mund, reflexartig biss sie zu, er boxte ihr dafür in den Bauch. Wenn sie jetzt daran dachte, kroch der Schmerz wieder hoch, es war ihr kaum möglich, sich auf Kenos Worte zu konzentrieren. Vielleicht sollte sie das Band zurückspulen und von vorn beginnen ...
„... ist es nicht toll, dass die Firma mich übernehmen will?“
Kenos Stimme gab Julia ein gutes Gefühl, so etwas wie Trost. Er war so ganz anders als der Drecksack Jan, dachte sie. In ein paar Wochen würde sie Keno wiedersehen, und in zwei Jahren war für sie beide Abschlussprüfung. Julia war dann volljährig. Sie würde zu Keno aufs Festland ziehen, auch wenn Mutter das nicht akzeptierte.
Nach dem Ende der Sprachaufnahme spulte Julia das Band zurück, startete es erneut. Dieses Mal konzentrierte sie sich ganz auf Kenos positive Worte. Von Jan Gronewold, dem Arsch, sollte er nichts erfahren, sie wollte ihn nicht damit belasten. Julia wollte das mit sich ausmachen ...
Nach dem zweiten Durchlauf ließ sie sich durch den Kopf gehen, was sie Keno alles sagen wollte. Dann drückte Julia die Tasten „Rec“ und „Play“, wartete zwei Sekunden und legte los.
Vom Erdgeschoss drangen die Bassläufe und Akkorde des Songs „Good Times“ durch den Türspalt, und mit ihnen das Knarren der Stufen ...
Kapitel 2
Die Sonne hing wie ein Brennglas über der Insel. Eine Brise brachte Staub in Bewegung, der sich als feiner Schleier auf alles gelegt hatte. Jan Gronewold rauchte die Fluppe zu Ende, schnippte den Rest in der Fahrt aus dem Wagen – Brandgefahr hin oder her. Er, gekleidet in einen weißen Anzug mit schmaler, türkisfarbener Krawatte, im Fond des mintfarbenen 64er-Chevy-Impala-Cabrio seines Vaters. Beide Arme auf der hellen Lederpolsterung seitwärts ausgestreckt, das dünne, blonde Haar vom Fahrtwind durchgewirbelt. Gronewold junior genoss es. Sein Kopf sank auf die Lehne zurück, er schloss die hellblauen Augen. Heute endlich sollte der Tag sein. Eine Aktion, die den Pegel seines Adrenalinspiegels höher hielt als den der See. Schon die Vorstellung ließ seine Buntfaltenhose im Schritt anschwellen. Jan schwindelte der Kopf beim Gedanken, sein Ziel in wenigen Minuten erreicht zu haben. Seine Wangen zeigten bei Erregung immer rote Flecken, das hasste er. Jetzt cool zu bleiben, forderte alles von ihm ab. Er ging seinen Plan noch einmal durch, dabei verhärtete sich sein kantiges Gesicht mit Stupsnase und dem Strich als Mund zu einer grotesken Maske. In der Gartenstraße würde er gleich zu Patrick rübergehen, um ihm die Videokassette zurückzubringen. Wenn seine Alten im Haus von Julias Eltern verschwunden waren, würde er durch den Fahrradschuppen nachkommen. Er kannte den inoffiziellen Zugang durch den Außenkeller von Besuchen aus Kindertagen. Und wo Julias Zimmer war, wusste er noch ganz genau. In einem passenden Moment würde er ihr einen netten Besuch abstatten ... und dann ...
Bei diesen Gedanken verfiel Jan Gronewold fast in einen Rausch, er stöhnte kurz auf, hatte sich aber augenblicklich wieder in der Gewalt. Vater blickte ihn mit hochgezogenen Augenbrauen vom Fahrersitz aus an.
„Alles klar, Junge?“
Jan hob den Kopf, schob die Beine zusammen. „Ja, klar!“, antwortete er gelangweilt, nickte und behielt den Blick auf den Hinterkopf seines alten Herrn gerichtet, der wieder die Straße anvisiert hatte. Vater, Quaderkopf, Stoppelfrisur, Oberlippenbärtchen mit einem Lineal abgezogen. Gekleidet in einen hellen Leinenanzug, Sonnenbrille, Modell Kid Creole für Norddeutsche – was fehlte, waren der Hut und die Coconuts. Hin und wieder schenkte er Mutter auf dem Beifahrersitz einen gequälten Blick. Mutter in ein weißes Sommerkleid gezwängt, knallrote Lippen aus der Murano-Glasbläserei, leichter, heller Hut mit breiter Krempe, der ihr wegen des Fahrtwindes fast vom Kopf flog. Sie hielt ihn mit einer Hand. Sonnengegerbte Haut, dünnes Goldkettchen, dünne Ärmchen, dünner Hals, Stimmchen ebenso dünn.
„Musst du immer so rasen, Willi?“, war Mutters Standardfrage ohne Aussicht auf Erwiderung, denn Vater antwortete nur, wenn es Sinn hatte. Willi Gronewold reagierte ohnehin nur noch, wenn es ihm etwas einbrachte. Es kümmerte den Bau- und Immobilienmogul nicht, was der gemeine Insulaner tat, er stand drüber – darin war er Jan ein großes Vorbild. Vater brauste mit dem Chevy auch durch jene Viertel, die für den Autoverkehr gesperrt waren. Für die meisten Beschränkungen erhielt er Sondernutzungsgenehmigungen, „Ausnahme“ war sein zweiter Vorname. Wer ihm blöd kam, sollte aufs Festland ziehen. Dort gehörten „Loser“ hin, die es nicht mit ihm aufnehmen konnten. Gronewold senior war auf der Überholspur des Lebens unterwegs, und es gab immer jemanden, der ihm eine neue asphaltieren würde.
Der Weg führte sie vom ruhigen Nordosten ins westlich gelegene Herz der Insel, ausgehend von der Villa Gronewold, vorbei am Leuchtturm und dem Golfplatz, durch Deich- und Hafenstraße. Unterwegs genoss Junior die bewundernden Blicke der Mädchen, mit Kühltaschen und Badesachen bepackt auf dem Weg zum Strand. Das Licht gleißend hell, ein ums andere Mal plötzlich auf- und abschießende Möwen, kreischende Jäger zwischen Salzwiesen, Stadt und Strand. Die Sonne verstreute scharfe Ecken grellen Lichts in der für Norderney typischen Bäderarchitektur mit den weißen Häusern. Es war einer dieser Tage, an denen alles schwebte, dafür war Jan Gronewold aber kaum empfänglich. Einzig der Gedanke, sich in wenigen Minuten seiner Lust hingeben zu können, löste so etwas wie Erleichterung in ihm aus – alles andere war dem untergeordnet.
In der Gartenstraße endete die Fahrt, in unmittelbarer Nähe des Parks. Jan griff nach der „Miami Vice“-Videokassette, schwang sich aus dem Wagen und sah sich um. Der Chevy war der einzige Wagen hier in dieser Straße. Seine Eltern trabten schon zum hell verputzten Einfamilienhaus der Heymanns, Jan steuerte links den Backsteinbau an. Fast synchron drückten sie die Knöpfe der jeweiligen Türglocken. Junior sah seine Eltern in der Tür verschwinden, kurz darauf öffnete Patrick die Tür, vor der Jan stand.
„Na endlich.“ Jan sah in ein ausdrucksloses Gesicht. Patrick streckte die Hand aus, nahm die Kassette entgegen, grummelte etwas und drückte die Tür wieder zu. Jan sagte nichts. Danke fürs Alibi, Schwachkopf, dachte er und grinste in sich hinein. Jan vollzog eine gekonnte Rechtsdrehung, ging zum Fahrradschuppen der Heymanns, zog an einem Griff, blickte sich kurz nach allen Seiten um und verschwand hinter der schmalen Tür. Der Raum dahinter war fast dunkel, aber Jan wusste ungefähr noch, wo die Betontreppe hinunter in den Keller führte. Er ging tiefer in den Raum hinein, bis ganz hinten rechts, dort ging es abwärts. Unten war der Zugang zur Wohnung mit aufeinandergestapelten Getränkekisten versperrt, die Jan zur Seite wuchtete, bis er daran vorbeischlüpfen konnte. Weiter ging es durch den Keller, unterwegs bediente er sich an Schnittchen unter Folie auf silbernen Servierplatten mit Lachs, Schinken, Heringssalat und Käse. Er schob sie sich zwischen die Zähne, tänzelte fast bis zur Kellertreppe, blieb stehen und horchte. Klappern in der Küche, Öffnen und Schließen des Kühlschranks, Schritte durch einen Glasperlenvorhang hinaus in den Garten, Gelächter, Musik, ABBA. Keine Menschenseele im Parterre, Stimmen allesamt draußen. Jan stieg die Kellertreppe hinauf, weiter scharf rechts durch den Flur. Die Musik wechselte auf „Good Times“ von „Chic“. Triumphale Umrundung der Treppenbrüstung, und zum Spaß weiter tänzelnd die leicht knarrenden Holzstufen hinauf ins Obergeschoss. Aufstieg im Takt der Musik ... er fühlte sich gut. Es rauschte in seinen Ohren. Je näher Jan seinem Ziel kam, desto heißer wurde es. Die Flecken auf seinen Wangen hatten sicher schon den Hals erreicht. Unter den Achseln triefte es, er zog das Jackett aus, legte es oben über die Treppenbrüstung. Jans Puls hämmerte gegen die Schläfen, auch im Schritt, jeweils zu gleichen Teilen. Ihm schwindelte, er zog an der Krawatte. Es gab nichts mehr, das ihn aufhalten konnte ...
Jan beobachtete sie durch einen Türspalt, wie sie bäuchlings auf dem Bett mit einem Kassettenrekorder herummachte. Das T-Shirt etwas hochgerutscht, lange Beine bis zum Hals. Sie streckten sich ihm entgegen, und er sah, dass sie kein Höschen trug, was seine Erwartung bis zur Ekstase steigerte. Genau so soll es sein! Das ist ja ... der ... absolute Traum! Jan Gronewold verlor jegliche Kontrolle, war bereit zur Explosion, sowohl im Kopf als auch ein paar Etagen tiefer. Die Schlampe kriegt das, was sie verdient! Die langen Beine ... die Bahn ist frei, frei zur Landung.
Gronewold öffnete Gürtel und Reißverschluss seiner Hose, schob die Tür auf. Er ging ins Zimmer, drückte die Tür hinter sich zu, schloss ab. Julia nahm eine Bewegung wahr, fuhr herum und zog gleichzeitig ihr Shirt herunter. „Jan, was machst du hier?“, rief sie entsetzt. „Wie bist du hier reinge...?“
Noch bevor sie sich ganz aufrichten und den Satz beenden konnte, warf er sich auf sie, hielt ihr den Mund zu. Julia schrie in seine Hand hinein, bäumte sich wild auf, wollte ihn wegstoßen, ihn treten, beißen, kratzen. Jan umklammerte ihren Kopf mit seinen Händen, drückte ihren schmächtigen Körper mit vollem Gewicht aufs Bett. „Jetzt bist du fällig, Schlampe. Hast du’s vergessen? Du gehörst jetzt mir“, stieß er wild hervor. Dabei presste er seine Knie gegen die Innenseite ihrer Beine, mit ganzer Kraft drückte er sie auseinander.
Hektisch bewegte Julia ihren Kopf hin und her, um sich seinen eisernen Pranken zu entziehen. Für einen Moment gelang es ihr. Sie atmete hektisch, ein Schrei durchbrach ihre Kehle: „Nein, lass mich! Neeeeeiiiin, neeeeeeeiiiiiiiiinnn ...!“
Jan lachte, stöhnte. Nachdem er ihre Abwehr gebrochen hatte, drang er in sie ein.
Kapitel 3
20. Dezember 2017
Einer dieser unerbittlichen Herbststürme hatte Norderney fest im Griff. Feuchtkalte Böen fegten durch die Stadt, sie versiegelten Dächer und Straßen mit glänzendem Lack. Für die Nacht war Sturm der Stärke neun angekündigt worden. Küsterin Bärbel Saathoff wusste sehr genau, wie es um die Einwohner Norderneys bestellt war: Die vielen Stürme konnten nur Vorboten des großen Gerichts über die Insel sein, deren gewählte Vertreter nichts gegen das schamlose Treiben der Touristen in Bars und sogar in Ferienwohnungen unternahmen. Das ostfriesische Sodom und Gomorra würde bald untergehen dessen war sie sich ganz sicher. Die Dämmerung hatte eingesetzt. Befriedigt blickte Bärbel in scheinbar ausgestorbene Straßen, als sie den Weg zur St.-Ludgerus-Kirche antrat, um die Vorabendmesse mit Eucharistie für ihren innig geliebten Pfarrer Martin Sander vorzubereiten. Das war ihre Aufgabe seit etlichen Jahren, und sie erfüllte sie stets pünktlich und zuverlässig. Bärbel war die gute Seele der Gemeinde – vielleicht sogar die reinste in ganz Ostfriesland. Und wenn sie im Gebet ein gutes Wort für die Insulaner einlegte, wäre die kommende Katastrophe womöglich noch abwendbar, wenn man Bärbel darum bitten würde – vielleicht.
Pfarrer Martin zeigte sich bei verschiedenen Anlässen überaus zufrieden mit ihrer Arbeit. Nie gab es ein Wort der Klage, und beim letzten Seniorenkaffee hatte er sie ausdrücklich für ihre treuen Dienste gelobt. Oft schenkte er ihr ein charmantes Lächeln – für dieses Lächeln hätte sie alles getan, für ihn möglicherweise sogar ihr zölibatäres Leben aufgegeben. Bärbel hatte sich nie getraut, diesen Gedanken zu Ende zu denken – wohl des Gerichts wegen ...
Die ersten Jahre ihrer Gemeindetätigkeit wirkte Bärbel unter Pfarrer (Suffkopp) Weerts. Es wollte keine echte Freude aufkommen, denn wiederholt musste sie den Herrn Pfarrer daran erinnern, den Kelch nicht neu aufzufüllen, wenn er ihn während der Messe bereits geleert hatte. Bärbel konnte so etwas unmöglich verzeihen. Ein paar Jahre später – das müsste um 1989 gewesen sein – wurde Weerts vom schönen Pfarrer Martin Sander abgelöst. Aus Altersgründen, hieß es offiziell, dabei war der erst achtundfünfzig. Gleichwohl begann ab diesem Zeitpunkt die segensreiche Zeit ihrer Kirchenarbeit, die sie hoffentlich noch lange würde fortführen können. Bärbel Saathoff wurde wehmütig ums Herz. Würde der liebe Martin eines Tages in den Ruhestand treten, wäre der Sinn ihres Wirkens mit einem Male dahin – schließlich tat sie das alles nur für ihn. Der Pfarrer war so schön anzusehen: mit Lachgrübchen in den Wangen, die strahlenden Augen, das grau melierte Haar und dann seine schönen Hände – ein Bild von einem Mann ...
Von Norden zogen schwarze Wolken auf, sie schickten peitschende Winde durch die Straßen. Auf ihrem Fußmarsch durch die Friedrichstraße war Bärbel keiner Menschenseele begegnet. Dafür gab es dank ihres theologisch geschulten Urteilsvermögens einen triftigen Grund: Das verderbte Geschlecht der Norderneyer fürchtete sich vor der Verdammnis, die beizeiten auch in winterlichen Sturmnächten daherkam. Bärbel war in Gedanken versunken, als auf einmal der neogotische Kirchenbau aus dem neunzehnten Jahrhundert vor ihr stand. In den dunklen Monaten fürchtete sie sich, in den Glasvorbau zu treten. Hin und wieder war ihr dort die ein oder andere gestrauchelte Seele begegnet, die um Beichtgelegenheit bat. Dann wäre es an ihr gewesen, den Notfallseelsorger zu informieren, und das hätte ihr heute Abend gerade noch gefehlt! Bärbel war gerne allein, um ihrer Arbeit ungestört nachgehen zu können. Mutig trat sie in die leere Saalkirche, vermied es aber, das volle Licht einzuschalten – es würde die Leute nur anlocken wie Motten. Stattdessen entzündete die Küsterin ein paar Kerzen, nahm eine vom Standleuchter und ging mit festen kleinen Schritten auf die Sakristei zu. Das Klacken ihrer Absätze hallte, Schatten tanzten, eine Atmosphäre zum Fürchten. Etwas Seltsames hing in der Luft, das spürte sie – und das war nicht der angekündigte Sturm. Bärbel Saathoff spürte ein atmosphärisches Ungleichgewicht. Sie fühlte sich unwohl bei dem Gedanken, jemand könnte ihr auflauern. Das Herz schlug ihr bis zum Hals. Plötzlich blieb sie stehen. Irgendetwas hinderte sie daran, weiterzugehen. Bärbel schaute auf die Steinplatten direkt vor ihren Füßen. Der Fußboden war an dieser Stelle besudelt mit Flecken unterschiedlicher Größe. „Wer zum Teufel hat denn hier so herumgesaut?“, zischte sie. In Gedanken hatte sie Eimer und Feudel bereits parat, die Küsterin war auf hundertachtzig: „Eine einzige Schweinerei ist das!“ Bei diesen Worten bewegte sie ihren Arm mit der Kerze in der Hand abwärts. So verharrte sie in der Bewegung, wenige Zentimeter über dem Boden, als auf einmal dunkle Flecken wie Tinte in das Wachs platschten oder an der Kerze herunterliefen – doch diese Tinte war blutrot! Verwundert hob sie den Blick zum Zenit, direkt über ihr. Bärbel Saathoff erschrak fürchterlich! Etwas großes, schwarzes Gewaltiges hing schwankend an der offenen Dachkonstruktion. „Um Himmels willen, was ...?“, sagte sie, dabei richtete sie sich auf, hob die Kerze an. „Was ...? Nein ...!“, rief sie laut aus. Bärbel traf der Schlag. Das ... konnte nicht sein ... oder doch? Sie blickte in die verdrehten Augen eines verzerrten Gesichts. „Ein menschlicher Körper, in Schwarz gekleidet, hing kopfüber am Ende eines Seilzugs direkt über ihr. Küsterin Bärbel kannte dieses Gesicht und das grau melierte Haar, aus dem die blutrote Tinte triefte ... Ein unkontrollierter Schrei des Entsetzens entfuhr ihrer Kehle, der zwischen den Mauern zu einem fürchterlichen Klagegeschrei anschwoll: „Neeeeeiiiiiiiinnnnnn ... Maaaaaaartttiiiiiiiiiiiiiinnnn!“
Kapitel 4
16. Januar 2018
Mit versteinerter Miene legte Gesa Jacobs ihrem Mann Menno den Telefonhörer in die Hand, den er nur widerwillig ergriff. Träge führte er ihn zum Ohr, als wäre er so schwer wie eine Hantel. Mit der anderen Hand beförderte er das Lifestyle-Magazin Sportcars & Watches auf den gläsernen Wohnzimmertisch und schaute auf seine Armbanduhr, es war einundzwanzig Uhr fünf. „Hier Doktor Jacobs“, sagte er in den Hörer.
Eine dünne, krächzende Stimme antwortete zögerlich: „Doktor Jacobs, guten Abend! Bitte entschuldigen Sie die Störung. Ich ... habe Ihre Nummer vom Vorsitzenden des Seglervereins.“
„Nun, gut. Was gibt es denn?“ Es war ihm zuwider, wenn man nicht zur Sache kam.
„Ich möchte Sie bitten, zum Jachthafen zu kommen. Beim Transport eines Flügels für die Offshore-Windkraftanlage ist es zu einem ... Missgeschick gekommen. Leider wurde dabei Ihre Jacht, die Ney-Cruiser, beschädigt. Sie steht doch auf dem Gelände hinter der Halle A? Die Jacht ist zwar abgedeckt, aber ...“
Um Himmels willen, dachte Menno Jacobs, erst der verheerende Brand in der Bootshalle und jetzt das. Die aufsteigende Verärgerung verschlug ihm fast die Sprache. Er räusperte sich und sagte: „Ja, das ist ... meine Jacht. Was genau ist denn passiert, wie groß ist der Schaden?“
„Es wäre gut, wenn Sie gleich kommen könnten, um sich das mal anzusehen. Alles Weitere können wir gern hier besprechen.“
Dr. Jacobs ließ seinen Blick über die helle Wohnzimmereinrichtung im Landhausstil mit diversen Tisch- und Stehlampen sowie den hochwertigen Gemälden von Poppe Folkerts schweifen. Dieser heimeligen Atmosphäre mochte er sich heute Abend kaum mehr entziehen. Zudem peinigten ihn erneut Rückenschmerzen auf eine Weise, die seinen verdienten Ruhestand seit Wochen vergiftete, ganz zu schweigen von den dunklen Schatten der Vergangenheit, die ihm des Nachts kaum mehr Ruhe gönnten.
Er sah zum Fenster. Jetzt noch raus in die Dunkelheit?, fragte er sich. Seine Augen spielten im Dunkeln nicht mehr so gut mit. Dem Kapital, der Jacht und dem Verein zuliebe wollte er das Risiko, im Dunkeln zu fahren, doch eingehen. „Na schön“, gab er der Bitte des Anrufers nach, „bin unterwegs. In etwa fünfzehn Minuten bin ich bei Ihnen.“ Er legte auf und bereute es dann doch, zugesagt zu haben.
Dr. Menno Jacobs informierte seine Frau über den Inhalt des Telefonats, nahm Jacke und Autoschlüssel, ging zur Garage hinüber, stieg in den silberfarbenen Mercedes SL Coupé und startete. Die Fahrt ging ein kurzes Stück über freies Gelände, dann links auf den Karl-Rieger-Weg. Ab Höhe Birkenweg setzte sich ein dunkler SUV hinter Dr. Jacobs, der ihm auch auf der Richthofenstraße folgte. Erst als er die letzte Kurve hinunter zum Hafen nahm, wuchs seine Skepsis. Dr. Jacobs trat die Kupplung, schaltete runter in den zweiten Gang und bog scharf links in den Jachthafen ein. Der Verfolger erhöhte kurz das Tempo, folgte im halben Meter Abstand. Dr. Jacobs bremste ab, der Verfolger fuhr so dicht auf, dass es eigentlich hätte knallen müssen – aber der Knall blieb aus. Im Schritttempo ging es am Hafenbecken entlang. Links in einer Reihe das Hafenamt, ein Getränkeshop und die Seenotretter, Gebäude allesamt unbeleuchtet. Keine Menschenseele, nicht der geringste Hinweis auf ein Windkraftanlagen-Desaster – nichts! Was sollte das? Wer steckt hinter dem Anruf? Vielleicht sollte ich jetzt besser umkehren, dachte er, als das Fernlicht des SUV hinter ihm in kurzen, unregelmäßigen Intervallen aufflackerte. Dr. Jacobs stoppte seinen Mercedes. Im Rückspiegel sah er, wie die Fahrertür des SUV geöffnet wurde. Eine dunkle Vorahnung ließ ihn wie gelähmt dasitzen. Die Geister der Vergangenheit waren zurück, und sie würden sich wohl nicht mehr vertreiben lassen ...
Eine vermummte Gestalt entstieg dem dunklen Wagen, sie ging zwischen den beiden Fahrzeugen hindurch, um das silberne Coupé herum bis zur Beifahrertür. Sie wurde geöffnet. Der Unbekannte setzte sich neben Dr. Jacobs auf den freien Sitz. Der Doktor protestierte nicht, er schloss die Augen, atmete schnell und schwer. Noch ehe er einen klaren Gedanken fassen konnte, hatte ihm der Unbekannte die rechte Hand mit einem Kabelbinder ans Lenkrad fixiert. Der Schlüssel wurde blitzschnell abgezogen, das Lenkrad nach rechts eingerastet, der Gang herausgenommen.
Der Vermummte stieg aus und beugte sich noch einmal halb zu Dr. Jacobs herab: „Du hast es verdient – Arschloch!“
Die Tür flog zu, der Unbekannte ging zurück, stieg wieder in den SUV. Der setzte sich wieder in Bewegung, dockte an, schob das Mercedes-Coupé langsam, aber stetig in Richtung Hafenbecken. Dr. Menno Jacobs erkannte, dass es keinen Sinn hatte, weiter vor seiner Verantwortung zu fliehen. Die Schatten der Vergangenheit hatten ihn endgültig eingeholt. Dies war sein Ende und er würde es hinnehmen müssen. Wie würdelos. Und was ist mit Gesa, mit den Kindern und den Enkeln? Und was ist mit Sabine? Sie alle wollen, dass ich lebe! Sie ... brauchen mich!, kam ihm in den Sinn. Mit letzter Kraft ein Aufbäumen: Er trat auf die Bremse, öffnete die Fahrertür, die aber von einer Dalbe, die linksseitig am Wagen entlangschrammte, wieder zugedrückt wurde. Mit der linken Hand ein Übergreifen zur Handbremse, er zog, doch zu spät. Das erste Drittel des Mercedes hing über der Spundwand. Das schiebende Fahrzeug stoppte, setzte zurück, nahm Anlauf und rammte das Coupé mit voller Wucht, Glas splitterte. Dr. Jacobs schrie panisch, sein Wagen hüpfte vorwärts, rutschte ein Stück weit auf dem Bodenblech, bis er nach einem kurzen Wippen ins Hafenbecken kippte und versank.
Kapitel 5
Februar 2018
Die Luft war feucht und kalt. Über der Fähre hing die Wolkendecke wie ein fahles Tuch, bald würde sie aufreißen. Für Norddeutschland sollte es Frost geben, so war die Ansage. Es war Viertel nach zwölf. Auf der Frisia III tummelten sich ein paar Touristen, hochmotivierte Geschäftsleute, unmotivierte Arbeiter und das Fährenpersonal mit freundlichen Gesichtern. Wir alle wurden mitgezogen durch das anfänglich enge Siel, hinaus auf die offene See, wo Wogen uns huckepack nahmen. Tief im Bauch der Fähre dröhnte ein Dieselmotor, er erzeugte wohliges Vibrieren. Eine Etage darüber und auf dem Zwischendeck gab es Kaffee, belegte Brötchen und Würstchen mit Fensterblick. Auf dem Oberdeck standen Fahrzeuge und ein paar Frischluftfanatiker. Über mir die Brücke, ein gläserner Verschlag für die Captain’s Crew. Der kühle Wind wirbelte meine Haare durcheinander, ich zog den Schal enger, knüpfte den obersten Knopf meiner schwarzen Cabanjacke zu und stellte den Kragen hoch. Der Blick über die Nordsee war fantastisch, ich hatte ihn über die Jahre ganz vergessen. Mein letzter Norderneybesuch lag fast achtunddreißig Jahre zurück, damals noch mit meinen Eltern, nur wenige Jahre vor ihrem Verkehrsunfall, der beiden das Leben entriss. Es war eine dunkle Zeit damals, ich vermisste meine Eltern unsagbar. Der Inseltrip nun gab mir das Gefühl, auf eine ganz besondere Art wieder mit ihnen verbunden zu sein.
Beim Anblick der Weite und des Horizonts spürte ich ein schmales Band, das uns Menschen mit einer wie auch immer gearteten Ewigkeit verbindet. Eines jener Phänomene, das sich vielleicht tief in unser kollektives Unterbewusstsein gegraben hat, und ich fragte mich, ob es den täglichen Pendlern auf der Fähre auch noch so erging.
Der Wind brandete in Böen auf, weiße Gischtkämme schäumten direkt am Schiffsrumpf entlang. Mein Blick ruhte mal auf der Gischt, dann wieder hoch oben bei den Möwen, die der Fähre kreischend folgten. Ich schaute ein Stück weit entfernt aufs Wasser. Dort gab es glatte, lange und gleichmäßige Wogen ohne Schaumkronen. Senken und Heben hatten genau die richtige Balance, dass einem nicht übel wurde. Ich schaute zum Horizont in Richtung Norderney. Die Insel war als dunstiger Strich auszumachen. Eine separate Welt, ähnlich einer sich selbst organisierenden Zelle, darauf abgestimmt, sowohl Einkommen als auch Erholung zu generieren. Tourismus ist der Kleber, der beide Interessen zusammenhält – und gleichwohl vor Probleme stellt ...
Februar war vielleicht nicht der aufregendste Monat, um eine Insel des Nordens zu besuchen. Februar ist ein grauer Monat, ähnlich dem November. Aber beide haben so etwas wie Erwartungen im Gepäck, zumindest in touristischer Hinsicht: der November die Advents- und Weihnachtszeit, der Februar Flüchtlinge aus Karnevalshochburgen. Was würde mich erwarten? In Hamburg las ich von den Kapitalverbrechen an einem katholischen Geistlichen der Kirchengemeinde Norderney und dem ehemaligen Chefarzt einer Norderneyer Klinik. Das blieb haften, denn ich war ja vom Fach, wie man so sagt. Studiert hatte ich am Kriminalwissenschaftlichen Institut in Hamburg, dann der Wechsel in die Fakultät für Rechtswissenschaften, Schwerpunkt Ökonomie. Mit dem Diplom zum Wirtschaftsjuristen in der Tasche setzte ich alles auf eine Karte und eröffnete eine Detektei für Wirtschaftskriminalität, mietete ein Büro in der Speicherstadt an, später noch eines in Wilhelmshaven. Der Terminkalender war von Anfang an voll, wenngleich unausgewogen, denn freie Zeit gab es kaum noch, und das brachte unsere Ehe zum Stillstand. Es war die klassische Ehefalle, der Susanne und ich auf den Leim gegangen waren. Wir hatten uns immer weniger zu sagen, jeder lebte sein Leben, es gab keine gemeinsamen Unternehmungen, keine gemeinsamen Inhalte mehr. Bevor uns das richtig klar wurde, überschlugen sich die Ereignisse. Ich wurde von meiner verschütteten Vergangenheit eingeholt, kam ohne psychologische Hilfe nicht mehr auf die Beine. Der erfolgsverwöhnte Privatermittler Frank Gerdes war unten, ganz unten. Es war eine wertvolle Erfahrung, denn ich begann zu ahnen, worauf es im Leben ankommt.
Der Himmel wölbte sich hell schimmernd über der See wie Perlmutt. Die Sonne zeichnete sich als weißer Fleck hinter silbrigen Wolken ab, gleich wollte sie durchbrechen. Ich zog die kleine Flasche Coke Zero aus der Tasche und nahm einen Schluck. Ich dachte zurück an das Wiedersehen mit meiner Jugendfreundin Antje nach fünfundzwanzig Jahren. Antje Meiners unterstützte mich nach Kräften bei meinen Ermittlungen vor vier Jahren in der Südoldenburg-Region. Und sie war es auch, die mir half, mich meiner Vergangenheit zu stellen, wenngleich am Ende alles erlosch, was zwischen uns neu entflammt war. Seitdem gingen wir wieder getrennte Wege, bis vor vierzehn Tagen, als mich ihre Mail erreichte. Es war ein knapper, aber dringlicher Text. Was mich verwunderte, war, dass sie sich von Norderney aus gemeldet hatte. Gehörte Antje doch für mich zu jenen Menschen, die ihre Heimat nie verlassen würden, aber so ist das nun mal mit den Annahmen. Antjes Privatleben war wegen der schwierigen Pflegesituation der Mutter einige Jahre auf der Strecke geblieben, womöglich hatte sich das nach dem Tod ihrer Mutter vor vier Jahren geändert.
Ich war Antjes Bitte, auf die Insel zu kommen, gern gefolgt. Genau genommen war es nicht Antje, die meine Hilfe benötigte, vielmehr ihre Kollegin und Freundin Sabine Bakker. Frau Bakker war die inoffizielle Geliebte des getöteten Chefarztes, der vor einem Monat ans Lenkrad gefesselt mit seinem Wagen im Hafenbecken versenkt wurde und dabei ums Leben kam. Offenbar war die Polizei bei ihren Ermittlungen kaum vorangekommen. Bereits einen Monat vorher fand man den erstochenen Leichnam eines beliebten Pfarrers kopfüber in seiner Kirche baumelnd. Und auch hier habe die Polizei keine nennenswerten Ergebnisse vorweisen können, schrieb Antje. Sabine Bakker konnte nicht länger nichts tun. Auf Antjes Empfehlung hin wollte sie mich beauftragen, in Bezug auf den ermordeten Chefarzt private Ermittlungen anzustellen.
Das Silbergrau der See lag in Verhandlungen mit dem Himmel, als Ergebnis bekam das Wolkentuch Risse, die Sonne fiel in schmalen Streifen auf das Wasser und auf eine kleine Sandbank, die an ihren Rändern mit Seehunden bevölkert war. Ein einsames Segelboot steuerte um die Westspitze der Insel, es kreuzte in weiter Entfernung unseren Fahrweg.
Wenn ich an Norderney dachte, musste ich auch an Nele Hansen denken, eine gute Freundin aus Studientagen, die später im Innendienst für die Direktion Polizeikommissariat Hamburg-Bergedorf arbeitete. Wir waren drei Monate ein Paar, es war eine On-off-Beziehung, ziemlich kompliziert, und ich war erleichtert, als es vorüber war. Unmittelbar darauf lernte ich Susanne kennen. Soviel ich wusste, war Nele der Liebe wegen nach Norderney gezogen. Für den Fall, dass wir uns auf der Insel begegnen sollten, würde ich sie vielleicht nicht einmal wiedererkennen. An ihr Gesicht konnte ich mich nur noch schemenhaft erinnern, es gab nicht mal mehr Fotos aus der Zeit. Geblieben war eine kurze, aufflackernde Hitze, die sich tiefrot in mir ausbreitete, wenn ich an sie dachte.
Wir erreichten die Insel nach einer Stunde Fahrt. Wie eine schüchterne Geliebte schipperte die Frisia III in weitem Bogen auf den Anleger zu, bereit für den Inselkuss. Ein futuristisch anmutendes Terminal empfing uns, der Anleger hatte sich herausgeputzt. Wir legten an. Zwei Fährleute mit gelben Westen positionierten sich am Ausgangsschott, einer warf das Tauende über die Dalbe, fuhr die Fußgängerbrücke aus, der andere gab Zeichen zum Aussteigen. Die Passagiere gingen rasch die Gangway hinauf, ich folgte den anderen ins Empfangsgebäude.
Antje stand am anderen Ende der Wartehalle, in der Nähe des Ausgangs. Als sie mich sah, sandte sie mir ein Lächeln per Eilboten. Wir begrüßten uns als alte Freunde. Sie küsste mich leicht auf die Wange und wir umarmten uns, dabei strich sie mir mit beiden Armen über den Rücken. Ich genoss es und es versagten alle Worte. Wir schauten uns in die Augen. Sie hatte sich kaum verändert. Antje gehörte zu den Frauen mit zeitloser Schönheit, nicht der Kleidung, sondern der Ausstrahlung wegen. Mittelgroß und schlank, schulterlanges, braunes Haar, mit vereinzelt grauen Fäden. Der sorgenvolle Zug um ihren Mund, den ich vor vier Jahren noch bei ihr ausmachte, war gänzlich verschwunden. Antjes Mandelaugen strahlten, und dieses Strahlen war nicht aufgesetzt, es kam tief aus ihrem Inneren.
„He!“, grüßte ich sie mit dem Norderneyer Gruß.
„He!“, gab Antje zurück. Sie umfasste meine Hände, drückte sie kurz. „Frank, es ist so schön, dich hier zu haben!“ Sie seufzte tief. „Danke, dass du es einrichten konntest!“ Bei diesen Worten löste sie eine Hand, führte eine meiner langen, dunkelblonden Haarsträhnen hinters Ohr, auf dem Rückweg strich sie mir mit der flachen Hand über die stoppelige Wange. Eine ihrer liebenswerten Gesten, die ich vermisste hatte.
Ich sagte: „Ich hatte sowieso etwas Luftveränderung nötig, Antje. Deine Anfrage kam wirklich nicht ungelegen.“ Antje trug einen anthrazitfarbenen Dufflecoat, darunter Bluejeans und weinrote Stiefel. Sie hatte noch immer keinen Ring am Finger. Ich lächelte sie offen an. „Es ist schön, dich wiederzusehen, Antje. Du siehst sehr gut aus.“
Hinter ihren sinnlich geschwungenen Lippen wurde eine Reihe makelloser Zähne sichtbar. Sie lächelte, und die Milchstraße sanfter Sommersprossen auf ihrem Nasenrücken kräuselte sich leicht. „Danke, du Schmeichler. Es geht mir wirklich gut, aber es hat sich so vieles verändert ...“ Ihre Augen schienen nach etwas zu suchen, sie blieben an meinen Lippen hängen. „Nach unserem plötzlichen und harten Abschied vor vier Jahren sah es so aus, als ... würden wir uns nie wiedersehen, Frank.“
Ich wusste nicht recht darauf zu antworten, ich versuchte es: „Wenn ich mich recht erinnere, ... war ich ... völlig außerstande, überhaupt einen klaren Gedanken zu fassen. Ich war ... gefangen in dem Trauma, das mich eingeholt hatte. Lass uns jetzt nicht darüber reden, Antje.“
Sie nickte, sagte nichts mehr dazu. Wir lösten uns, und Antje sah mich von oben bis unten an. „Hey, du trägst ja deine Schimanski-Jacke nicht mehr ...“ Sie unterbrach sich abrupt, ihre Wangen bekamen Farbe, schnell schob sie nach: „Ach was, das war dumm von mir, bitte entschuldige.“ Ich wollte auch dazu nichts erwidern. Es war ihr bewusst geworden, dass unser letzter gemeinsamer Fall gewissermaßen mit meiner hellen US-Feldjacke in Verbindung stand, die hinlänglich auch als „Schimanski-Jacke“ bekannt ist. Aber seit meinem Zusammenbruch trug ich konsequent schwarze Kleidung.
Ich nahm meinen Trolley, wir traten aus dem Terminal hinaus ins Freie. Der Himmel war komplett verhangen. Auf dem Parkplatz verteilten sich die Ankömmlinge auf Busse, Taxis, und ein paar Leute machten sich zu Fuß auf den Weg. Links, direkt am Empfangsgebäude, hielt eine rüstige Rentnergang eine Bank besetzt, den ganzen Rummel beobachtend, als hätte sie ihr komplettes Leben auf diese Weise verbracht. Käme man in zehn Jahren wieder, würden dieselben Herrschaften wohl noch immer hier sitzen und beobachten.
Meinen Koffer übergab ich einem Taxifahrer, für den Transport zum Hotel am Denkmal. Antje und ich setzten unseren Weg zu Fuß fort, sie hakte ihren Arm unter meinen. Rechts hinter den geparkten Fahrzeugen gab eine neue Sichtachse den Blick hinunter zum Jachthafen frei, wo sich Möwen gegen den grauweißen Himmel warfen und wieder hinabsegelten. Es roch nach Tang und Salz. Auf unserem Weg in die City sprachen wir über Belangloses. Antjes Unruhe verriet mir, dass sie etwas auf dem Herzen hatte. Ich schaute sie demonstrativ von der Seite an, ihr Blick war stur nach vorn gerichtet. Unvermittelt blieb sie stehen und sagte mit einer Stimme, die mir fremd war: „Frank, damit ich es besser verstehe, muss ich das ansprechen: Vor vier Jahren wolltest du zu deiner Susanne zurück, das war mir klar. Und mit dem Schock, dass du selbst in den Mordfall verwickelt warst, musstest du erst mal fertigwerden.“
Ich nickte. „Das ist wahr, mein Leben hatte sich mit einem Schlag verändert. Ich wusste nicht, ob ich meinen Beruf weiter ausüben konnte, und meine Ehe wurde mit dieser neuen Belastung erneut auf die Probe gestellt. Alles stand mit einem Mal zur Disposition, sämtliche Planungen und Vorsätze zerplatzten wie Seifenblasen, und nichts war mehr wichtig“, sagte ich mit belegter Stimme.
Antje sah mit hochgezogenen Augenbrauen zuerst mich an, dann wieder nach vorn. Nach ein paar Sekunden des Schweigens senkte sie das Kinn, funkelte mich kurz an, blickte wieder geradeaus und fragte: „Und ich war eine dieser Seifenblasen, die nicht mehr wichtig war für dich?“
„Was meinst du?“, fragte ich vorsichtig.
Antje sah mir direkt in die Augen. „Kam ich in deiner Zukunft gar nicht mehr vor? War ich für dich abgeschrieben?“, fragte sie mit bebender Stimme.
„Es tut mir leid, ich ... ich kann es nicht anders beschreiben: Es gab gar nichts, was mir noch etwas bedeutet hätte, und das war nicht gesund. Ich weiß es. Und es wäre jetzt falsch, den damaligen Zustand nach heutigen Kriterien beurteilen zu wollen. Ich ...“
Sie unterbrach mich, und ich spürte, wie sie einem angestauten Druck nachgab, der sich über zu lange Zeit aufgebaut haben musste. „Ganze vier Jahre lang gab es keinen einzigen Gedanken an mich?“ Ihre Augen wurden feucht, und das lag nicht an der kalten Luft.
Ich hob eine Hand flach an, wie um das Gesagte zu unterstreichen. „Antje, alles hing am seidenen Faden ... Ja, ich gebe zu, es gab keinen Platz für dich, weil ich alle Mühe hatte, mein Leben und meine Ehe wieder auf die Kette zu kriegen.“
Sie nickte entschieden, als wollte sie mir ein genau das habe ich mir gedacht! entgegenschleudern. Ihr Blick ließ mich sofort los, der Winter strich mit kaltem Finger über ihre Stirn und hinterließ eine frostige Stimmung. Eine ganze Weile gingen wir schweigend nebeneinander her, dann taute es. Antje sagte: „Ich kann es mir heute noch nicht verzeihen, dass ich dich einfach so wegfahren ließ.“ Hinter ihren Augen lauerten Tränen, aber sie fügte fest hinzu: „Du warst in einem labilen Zustand, es hätte wer weiß was passieren können.“
Wir blieben kurz stehen, stellten uns voreinander hin, ein paar endlose Sekunden sahen wir uns an. Ich flüsterte fast: „Antje, es war gut, dass du die Kraft hattest, mich gehen zu lassen. Ich hatte Susanne erzählt, was sich ereignet hatte, gleich darauf habe ich mich bis in die letzte Konsequenz meiner Vergangenheit gestellt. Und Susanne stand mir in allem bei, sie hat mich durch Untiefen begleitet. Erst die Selbstanzeige, dann die Psychotherapie – das alles brauchte seine Zeit.“
Wir drehten uns wieder auseinander und setzten unseren Weg fort. Langsam, als wäre eine Krise überstanden, besserte sich Antjes Laune. „Das habe ich alles nicht gewusst, weil du dich mit keinem Wort gemeldet hast. Es kostete mich ungeheure Überwindung, dir überhaupt zu schreiben.“ Es klang wie ein Vorwurf, ich hoffte aber, dass es keiner war. Mittlerweile erreichten wir die Bülowallee. Antje lud mich ins Tide zum Essen ein. Sie hatte einen Tisch reservieren lassen, wir wurden an unseren Platz geführt. Es war ein modernes Ambienterestaurant mit Panoramafenstern, hellem Parkett, Sonnenterrasse und Showküche. Die Musik aus der unsichtbaren Anlage war leise und einschmeichelnd, wir kamen zur Ruhe. Der Kellner kam angeschwebt, nahm die Bestellung auf und legte sich ins Zeug. Für mich gab es nach der Cremesuppe mit Seeluftschinken einen Seesaibling mit Safransoße, für Antje Entenbrust auf Preiselbeerjus mit frischen Beilagen und einen trockenen Chardonnay für uns beide. Es schmeckte herrlich. Dann sprachen wir über die alten Zeiten, ganz besonders über jene Abschnitte, die wir beide als „nett“ in Erinnerung hatten. Nach dem Dessert, dem Pistazien-Mandelparfait an warmen Waldbeeren, fragte ich: „Weißt du noch unser letztes gemeinsames Essen?“
Antje antwortete mit einer Gegenfrage: „Du meinst doch nicht die Pizza, oben in deinem Loft?“
„Nein, es war dieses Restaurant ...“, ich schnipste mit den Fingern, „ich glaube, Agrarlobby hieß es.“
„Du meinst das ,Agora‘“, korrigierte sie mich. „Ich erinnere mich sehr gut. Der Wein war staubtrocken und die Stimmung zwischen uns war auf Grundeis. Ein paar Grad kühler, und man hätte uns als Trockeneis abfüllen können.“
„Und der Kellner brachte uns die Rechnung auf einer Warmhalteplatte“, schob ich nach.
„Nachdem er die Eiskarte vor uns versteckt hatte!“, ergänzte Antje.
Wir lachten. Es war ein erleichterndes Lachen. Es war jenes Lachen, das man gern lacht, um Belastendes zu vergessen. Es wollte nicht recht gelingen, nach ein paar Schlenkern kamen wir zu unserem Thema zurück.
„Frank, du sprachst vorhin von einer Selbstanzeige. Was wurde daraus?“, wollte Antje wissen.
Ich nahm einen Schluck aus dem Weinglas und sagte: „Die Selbstanzeige ... sie kostete mich viel Überwindung. Schließlich stand meine berufliche Existenz auf dem Spiel. Aber dann kam alles ganz anders: Das Verfahren wurde nach § 153 Absatz 1 der Strafprozessordnung eingestellt, weil schon während des Ermittlungsverfahrens glaubhaft dargelegt werden konnte, dass ich zur Tatzeit aufgrund des Schocks nicht im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte war. Zudem hatte ich mich, nachdem mir das bewusst geworden war, unverzüglich gestellt. Es lag keine Tötungsabsicht vor und es bestand nicht die Gefahr einer Wiederholungstat. So etwas wird als Erstverstoß im Bereich geringer Schuld behandelt, es gab auch keine Nebenkläger.“
Eine Denkerfalte erschien auf Antjes Stirn. „Du bist damit aber nicht wirklich zufrieden, wenn ich deinen Tonfall richtig deute?“
Ich nickte zustimmend. „Darum die Therapie. Ich weiß jetzt, dass ich mir nichts mehr vorzuwerfen brauche, und ich habe gelernt, mit diesem dunklen Kapitel in meiner Biografie umzugehen. Die Vergangenheit lässt sich nicht korrigieren, aber sie lässt sich aufarbeiten. Das ist ein Prozess, der noch anhält.“
Während des Gesprächs gelang es, unsere Beweggründe verständlich zu machen, ohne uns gegenseitig anzuklagen. Die Stimmung wurde zusehends lockerer, die Lacher waren deutlich in der Überzahl, wir ernteten entrüstete Blicke. Genau wie beim letzten Mal erkundigte sich Antje nicht nach dem Status meiner Ehe. Sie war sich in ihrer zurückhaltenden Art treu geblieben. Aber sie erkundigte sich nach meinem Job – nach der Auftragslage, nach der Aufklärungsquote. „Was ich schon immer mal wissen wollte: Wie macht man das als privater Ermittler, wie kommst du an deine Informanten, wie kriegst du die Leute dazu, sich dir gegenüber zu öffnen?“
Nicht undankbar für dieses Thema, begann ich zu erzählen: „Es ist ein Unterschied, ob ich professionell in Wirtschaftsangelegenheiten unterwegs bin oder als privater Ermittler. Professionell warte ich mit verifizierbaren Fakten auf, die im Grunde nicht widerlegt werden können. Es gibt da keinen großen Spielraum, die Beweislage spricht für sich. Oft treten ehemalige oder geschasste Mitarbeiter an mich heran, sie präsentieren mir von sich aus Unterlagen, aus denen die Sachverhalte eindeutig hervorgehen – und wenn nicht, bohre ich nach. Das gestaltet sich recht unkompliziert. Unmittelbar nach dem Einschalten der Behörden werden Anwälte beauftragt, die die Anklage im Interesse des Beschuldigten auszuräumen versuchen. Der Ausgang dieser Verfahren ist durch die Gesetzgebung gewissermaßen vorgezeichnet. Beide Seiten wissen, was sie erwartet. Dafür gibt es Anwälte. Bei meinen privaten Ermittlungen – wie hier – bin ich auf eine vertrauensvolle Basis angewiesen. Der persönliche Kontakt und das vertrauensvolle Auftreten stehen dabei im Vordergrund. Wenn es gelingt, wollen die Leute erstaunlich gern erzählen. Endlich ist da jemand, der zuhört, der ein Interesse daran hat, die Dinge zurechtzurücken. Und noch was: Solange ich nicht als Ermittlungsbehörde auftrete, ist klar, dass die Leute nichts riskieren, falls sie sich vergaloppieren. Wenn es hart auf hart kommt, können sie einfach alles abstreiten.“
Antje dachte über das Gesagte nach, sie sagte: „Umgekehrt kann es aber auch bedeuten, dass du nichts in der Hand hast.“
„Zunächst sieht es so aus, da gebe ich dir recht.“ Ich hob leicht die Schultern. „Wenn ich auf diese Weise aber an Beweismittel gekommen oder mir sicher bin, dass die Indizien ausreichen, übergebe ich den Fall den Ermittlungsbehörden. Die kümmern sich um den Rest, weil nur sie mit den nötigen Befugnissen ausgestattet sind.“
Als wir merkten, wie sehr am Nebentisch der Kreis der Zuhörer angewachsen war, beschlossen wir zu gehen. Die Bedienung kam mit der Rechnung, Antje zahlte. Wir verließen das Tide und gelangten zum Kurplatz, dem hellen Conversationshaus mit Arkadengang und Uhrentürmchen in der Mitte, nebst Spielcasino, Bibliothek, Café und Touristeninfo. Rechts daneben das imposante Badehaus mit Wellenplanschbecken, Solebad und Thalasso-Anwendungen. Gegenüber das markante Zinnentürmchen des Inselhotels König. Wir überquerten den Kurplatz in Richtung Weststrand. Antje erzählte, sie habe für den Nachmittag ihre Kollegin und Freundin Sabine Bakker zum Kaffee eingeladen. Wir steuerten also Antjes Wohnung in Strandnähe an. Auf dem Weg zum Damenpfad wollte ich wissen, warum es Antje nach Norderney verschlagen hatte. Grübchen erschienen auf ihren Wangen und die Nasenspitze bewegte sich leicht, als sie erzählte: „Du weißt vielleicht noch von meinem Interesse an der Psychologie, daraus wurde tatsächlich mehr. Ich schrieb mich als Gasthörer an der Uni Oldenburg für Allgemeine Psychologie ein, weitere Seminare folgten. Zwei Jahre später hielt ich mein Zertifikat zur psychologisch-technischen Assistentin in den Händen, und damit habe ich mich hier beworben.“
Ich sah sie anerkennend an. „Glückwunsch! Und, warum Norderney?“
Sie lächelte wehmütig. „Es ist die Insel meiner Kindheit, ich war ja oft mit meiner Oma hier. Die Insel, das Meer, die Architektur und das ganze Flair habe ich immer sehr gemocht. Und als ich vor eineinhalb Jahren meine Bewerbungen verschickte, war die Altenpflegeeinrichtung Casa Vitalis auch darunter. Es hat geklappt, und ich bereue es kein bisschen.“ Ihre Augen leuchteten. „Und eine tolle Wohnung habe ich auch gefunden, gleich hier im Damenpfad.“
„Wie passend.“
Wir gingen links in die Wilhelmstraße, schlugen Haken und erreichten Antjes Wohnung, in Sichtweite des Weststrands. Wir stiegen in die zweite Etage hoch, Antje schloss auf, wir gelangten in eine gemütliche Wohnung mit Aussicht. Eine kleiner, quadratischer Flur, die Küche mit glänzend hellen Schränken, das Wohn- und Esszimmer mit dunkelgrauen und verchromten Möbeln, Couches im Loungedesign, auf denen weiche Kissen lagen. An den hellen Wänden waren Bilder in natürlichen Farben, und die Fenster, die zum Meer hin wiesen, waren Lichtschächte in die Unendlichkeit. Meinem Blick hinaus auf die See folgend sagte Antje: „Toll, nicht? Das habe ich mir immer gewünscht, freie Sicht aufs Meer. Und das Beste daran ist, nicht mal Touris können mir das Panorama vermiesen!“ Antje lachte. „Die gehen brav auf der Promenade spazieren – und die ist auf der anderen Seite des Deiches, etwas tiefer gelegen.“
„Die Aussicht ist wirklich umwerfend!“, bestätigte ich. Während Antje den Kaffeeautomaten startklar machte, schaute ich mich um. Das Wohnzimmer verbreitete Behaglichkeit. An der Wand ein großes Bücherregal mit Sachbüchern zu Psychologie und Gerontologie, aktuelle Romane, Lyrik und Bildbände. Auf dem kleinen Wohnzimmertisch lag ein angesagter Kriminalroman mit Lesezeichen etwa in der Mitte des Buches. Ich nahm es, las den Rückentext durch. Es ging um einen kauzigen Kommissar mit Eheproblemen – hm, das klang vertraut. Manchmal braucht man Bücher nicht mehr zu lesen, wenn man die Rückseite durchhat. Auf diese Weise kriegt man ein gewisses Gespür, auch wenn es letztlich oberflächlich bleibt. Man verschafft sich ein kleines Update und ist ein informierter Gesprächspartner auf Cocktailpartys, wenn man trotz der Oberflächlichkeit noch eingeladen wird.
Es klingelte an der Haustür. Antje drückte den Summer, Sabine Bakker kam die Treppe herauf. Antje umarmte die schlanke Frau, bat sie herein, nahm ihr den Trenchcoat ab und parkte ihn an der Garderobe. Frau Bakker blieb unschlüssig stehen, als sei sie wegen einer freien Stelle gekommen. Wir gaben uns die Hand, nachdem Antje uns einander vorgestellt hatte, und sie lotste uns in ihr Wohnzimmer. Frau Bakker war eine Frau von Mitte bis Ende fünfzig, etwa so groß wie ich. Sie hatte schöne, freundliche Gesichtszüge und große, braune Augen. Hohe Wangenknochen ließen sie jünger wirken, so auch ihre schmale Nase. Das braune Haar reichte ihr bis zu den Schultern, es war voluminös und in der Mitte gescheitelt. Sabine Bakker war stimmig gekleidet, ihr Anblick war Ausdruck klassischer Eleganz, Make-up und Nagellack hätten das womöglich entwertet. Wir setzten uns, sprachen kurz über die prognostizierte Kälte, die bald den ganzen Norden erfassen würde, und gaben unsere Wünsche bezüglich Tee oder Kaffee an Antje ab, die damit in die Küche verschwand. Frau Bakker hatte ein offenes, ehrliches Wesen, aber ein Lächeln, das von Traurigkeit gezeichnet war. Vielleicht lag es an den Augen, die sich weigerten, mitzulächeln. Rasch entwickelte sich ein Gespräch über ihre und meine Tätigkeit. Ich gab Frau Bakker einen Überblick über mein Tagesgeschäft als Ermittler, während Antje uns mit Kaffee und Sanddorngebäck versorgte und sich dazusetzte. Es war an der Zeit, etwas über Sabine Bakkers Anliegen zu erfahren, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass Antjes Freunde auch meine Freunde seien, denen ich meine Dienste diskret und unentgeltlich zur Verfügung stellte.
Ich sagte: „Frau Bakker, Antje erzählte mir vom gewaltsamen Tod Ihres Geliebten und Ihrer Trauer, die Sie nicht zeigen können, weil Ihre Beziehung zu Doktor Jacobs nicht öffentlich war.“ Sabine Bakker nickte mit zusammengepressten Lippen, ich sprach weiter: „Wir wollen hier über die Dinge sprechen, die bisher nicht nach außen gedrungen sind, die Sie den Ermittlungsbehörden wahrscheinlich vorenthalten haben, sofern die überhaupt von Ihrer Existenz wissen ...“
Frau Bakker schüttelte energisch den Kopf, sie sagte mit ihrer tiefen Stimme: „Nein, nein, die Polizei weiß nichts von mir ... und sie weiß auch nichts von dem Verhältnis zwischen Menno und mir. Ich habe niemandem außer Antje davon erzählt, weil sie eine Herzenskennerin ist. Sie hat gespürt, dass ich ... verzweifelt bin.“
Als ahnte ich nicht schon die Antwort, fragte ich: „Was, wenn ich fragen darf, ist der Grund, dass Sie sich den Behörden gegenüber nicht offenbaren? Sie müssen wissen, dass, sollte Ihr Verhältnis nachträglich bekannt werden, Sie automatisch zum Kreis der Verdächtigen gehören.“
Frau Bakker sah mich ratlos an. „Wie ... warum das?“, fragte sie aufgebracht, mit einer Stimme, die Verzweiflung und Empörung zugleich ausdrückte.
„Aus dem einfachen Grund, dass Sie durch Ihr Schweigen die Ermittlungen behindern beziehungsweise erschweren.“ Ich machte eine Pause, dazu ein kritisch abwägendes Gesicht. „Weshalb wollen Sie die Behörden bei der Aufklärung nicht unterstützen?“
„Also, nein. Ich will da nicht mit hineingezogen werden.“ Sie sprach jetzt lauter und schüttelte den Kopf, langsam und nachdrücklich. „Fast zwanzig Jahre waren wir ... ein Paar. Wir haben es so lange geschafft, unsere Beziehung geheim zu halten. Niemand hat etwas bemerkt. Menno war so geschickt darin, Treffen und sogar Urlaube mit mir zu arrangieren.“ Frau Bakker zögerte etwas, sie sprach leiser weiter: „Mein Mann Rudolf und Mennos Frau Gesa sind ja vollkommen ahnungslos, und ich möchte, dass das so bleibt. Wenn die beiden jetzt nach so vielen Jahren von unserer ... Verbindung erführen, würde für sie die Welt einstürzen.“ Ihre Stimme rutschte in eine höhere Tonlage. „Wissen Sie, Herr Gerdes, was dann los wäre?“ Sie sah mich abwartend an. Ich nickte, sagte aber nicht, was dann los wäre. Etwas Düsteres zog in ihren Blick, was vorher nicht da gewesen war. Ihre Stimme bekam einen gereizten Unterton: „Nein, das werde ich auf keinen Fall tun. Ich betrachte das als eine Art Vermächtnis, als ein Erbe, das ich aufrechterhalten möchte. Mennos ganzes Bemühen, all die Jahre sollen nicht umsonst gewesen sein. Bitte, verstehen Sie mich!“ Dann nahm sie eine Tasse in die Hand, lehnte sich etwas zurück und betrachtete mich mit forderndem Blick.
Ich nickte und sagte ruhig: „Ich respektiere Ihre Entscheidung selbstverständlich.“ Ich lächelte, als würde ich sie vollkommen verstehen. „Ich möchte Ihnen dennoch empfehlen, dass jetzt, wo ... die Polizei auf der Stelle tritt ...“
„Auf gar keinen Fall!“, fuhr sie dazwischen, dabei füllten sich ihre Augen mit Tränen. Sie wagte es kaum, ihren Blick irgendwo ruhen zu lassen.
„... jetzt, wo die Polizei auf der Stelle tritt, es an der Zeit wäre, die ganze Wahrheit zu erzählen“, beendete ich meinen Satz.