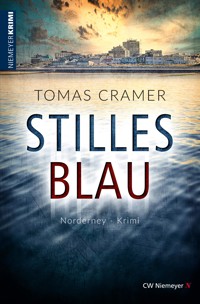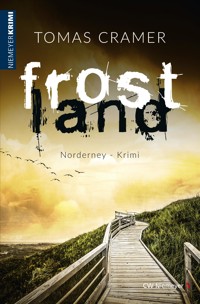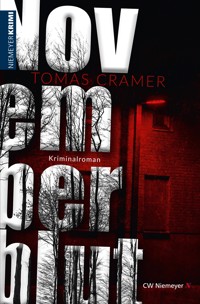
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CW Niemeyer
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Es sind neue Indizien aufgetaucht, die in einer norddeutschen Kleinstadt zur Aufklärung eines Disco-Mordes in den 80er-Jahren führen könnten. Der Ermittler Frank Gerdes stellt sich dieser Herausforderung, als ihm ein Foto zugespielt wird, das ihn mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert. Ein Geflecht aus Missbrauch, Eifersucht, Erpressung, aber auch das kleinstädtische Milieu, lassen seine Bemühungen fast scheitern, als sich Gerdes persönlichen Übergriffen ausgesetzt sieht ... "Novemberblut" ist ein aufwühlender Kriminalroman um Verfehlungen, verdrängte Schuld und späte Vergeltung – ein Klassentreffen in der Provinz, zu dem man nicht eingeladen wurde, und erst recht nie vorhatte zu erscheinen. Frank Gerdes 1. Fall nun bei CW Niemeyer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Die Handlung dieses Buches ist frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit wahren Begebenheiten und Personen ist zufällig und nicht beabsichtigt (von wenigen genehmigten Ausnahmen abgesehen).
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über www.dnb.de© 2020 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hamelnwww.niemeyer-buch.deAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: C. RiethmüllerEPub Produktion durch CW Niemeyer Buchverlage GmbHeISBN 978-3-8271-8383-5
Tomas CramerNovemberblut
Tomas Cramer (*1967), aufgewachsen in der niedersächsischen Stadt Cloppenburg, ausgebildeter Bankkaufmann, absolvierte diverse theologische und trauerbegleitende Seminare, zudem die Workshops „Kreatives Schreiben“, „Buchgestaltung und -vermarktung“, „Schreibwerkstatt“. Aufnahme in der Autorendatenbank des Literaturhauses Niedersachsen (Nds. Ministeriums für Wissenschaft und Kultur).Mitgliedschaft im „Syndikat“ – der Autorengruppe für deutschsprachige Kriminalliteratur.Cramer veröffentlichte mehrere Jugend- und Sachbücher sowie Romane und Bildbände. Zudem liegen Publikationen zu theologischen Themen in einer Missionszeitschrift und im Internet vor. Tomas Cramer ist kirchlich-ökumenisch engagiert, verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Er lebt seit 1991 in der Mittelweser-Region, im Landkreis Nienburg (Weser).
Kapitel 1
Freitag, 15. November 1985 – 23.20 Uhr
Kalt und sternenlos war die Nacht – der Frost hatte seine Visitenkarten in die Atmosphäre gestreut, wie finstere Vorhersagen. Das Novemberdunkel war in ein lausig kaltes Tuch gehüllt. Wenn es in dieser Nacht Niederschläge geben würde, dann als Schnee. Hinter einigen Häuserfenstern sah man den bläulichen Schein der Fernseher flackern wie den Widerschein blutarmer Kaminfeuer. Die meisten Fenster waren jedoch dunkel. Harte Bässe wummerten vom Szeneschuppen über den rückwärtig gelegenen Parkplatz; sie brandeten bei jedem Öffnen der Tür auf. Sound und Rhythmus verschmolzen zu einem wild hämmernden Klangbrei, dessen Beat zugleich Off-Beat geworden war. Drei junge Männer lungerten im Schutz der Dunkelheit zwischen einem halbhohen Maschendrahtzaun und der Schweinehalle herum. Zwischen ihnen und dem Eingang des Pogo lag ein geteerter, löchriger Weg, der ursprünglich als Straße gedacht gewesen war. Er stellte eine Trennungslinie zwischen dem Gelände der Münsterlandhalle und dem Pogo dar. Das Licht des dampfenden Strahlers erreichte gerade noch den unscharfen Rand des Weges.
Der Bereich, in dem sich die drei jungen Männer aufhielten, bekam davon nichts ab. Nervös lehnte einer an der Mauer aus Backstein. Er zog gierig an seiner Zigarette, als steckten aufputschende Substanzen zwischen den Tabakkrümeln, die er für die Aktion heute Nacht dringend benötigte. Ganz kurz flackerten Erinnerungen auf, an das geniale Konzert von Nuala, Kennzeichen D und Tango im Exil vor drei Jahren – etwas Vergleichbares hatte es seither nicht mehr gegeben. Er legte seine Hand flach an die Wand, als könne er ihr auf diese Weise die versickerten Beats und Riffs noch einmal entlocken. Mit einem Mal wurde ihm klar, wie sehr sich sein Leben seitdem verändert hatte. Verdammt! Er wusste nicht, wie lange er seinen Alten noch etwas vormachen konnte. Sollte diese Aktion hier nicht so klappen, wie er sich das vorgestellt hatte, wäre alles zum Teufel.
Die anderen Beiden rissen ihn mit ihrer Unruhe aus seinen Gedanken. Sie zuckten rhythmisch zu den Bässen eines ,Prince Of The Blood‘-Stückes, den Eingang des Pogo fest im Blick. Gleich hinter der Tür schirmte ein schwerer dunkelbrauner Vorhang das Innere der Szene-Disco vor der kalten Nachtluft ab. Links vom Vorhang, von außen nicht sichtbar, saß auf einem Barhocker der Kassierer mit Geldkassette und Eintrittstempel.
Heute war nichts los. Die Leute waren vermutlich in der Destille in der Kirchstraße oder im Circus Musicus in Märschendorf. Man konnte davon ausgehen, dass sich um diese Zeit vor allem die Neue Heimat in Thüle mit Besuchern füllte.
Vier junge Frauen mit viel Haar, Neonrouge und bunten Leggins kamen um ein altes Haus rechts neben dem Parkplatz herum. Hüft- und täschchenschwingend eierten sie auf High-Heels quer über den Platz, bis sie von der Schiebetür eines schwarzen VW-T3 mit dunklen Scheiben verschluckt wurden. Der Raucher konnte sich ein höhnisches Grinsen nicht verkneifen.
Er wandte sich an seinen Kumpel: „Hey, gib mir ’ne Fluppe!“
„Ich hab nur noch eine.“ Eine demonstrative Pause. „Morgen bist du dran!“ Er wischte sich die Nase am Ärmel ab, und nachdem er die Vorletzte herausgezogen hatte, reichte er ihm die Schachtel.
„Klar, morgen.“
Der Dritte wühlte mit seiner Fußspitze im Dreck herum, tat genervt. „Mann, mir is arschkalt! Wann kommt der Sack endlich raus? Ich geh mal gucken.“
„Was!?“ Der Schnorrer zündete sich die Zigarette an. Die Flamme des Feuerzeugs beleuchtete sein Gesicht; in einem Ausdruck der Verzweiflung verengten sich seine Augen. „Mach das, wenn du unser Alibi in die Tonne kloppen willst – Vollidiot!“, blaffte er, nachdem er einen Zug gemacht hatte.
Er ging alles noch mal ganz genau durch. Es war perfekt organisiert: Saubere und helle Klamotten à la Sonny Crockett lagen unter der Krankenhausauffahrt in dem Ford Escort für sie bereit. Für diese Aktion hatten sie sich allesamt erst einmal dunkle Sachen angezogen. Mehrere Leute würden bezeugen können, alle drei am frühen Abend in der Schickimicki-Disco White Horse und dann spät in der Nacht im Big Ben gesehen zu haben. Und als Finale würden sie sich im besoffenen Kopp von den Bullen abführen lassen und den Rest der Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen – wegen nächtlicher Ruhestörung … alles ganz easy! Aber es stimmte: Wenn nicht bald etwas passierte, ging das auf Kosten des Alibis.
Die blauen Kaminfeuer hinter den Fenstern waren vollends erloschen, als plötzlich die Tür aufflog. Ein schlaksiger junger Mann mit kurzen blonden Haaren und runder Brille huschte hindurch, und mit ihm einige Klangfetzen von ‚Alive and Kicking‘ von den Simple Minds. Die Tür schwang zurück. Das Dröhnen der Bässe hielt an, die Hochtöne blieben zwischen Tür und Angel stecken.
„Jetzt ist die dumme Sau fällig!“
„Hey, Leute, es soll aber nur eine Abreibung sein. Mehr nicht, okay?“ Die Stimmlage des fröstelnden Dritten ließ eine Mischung aus Besorgnis und Unschlüssigkeit erkennen.
„Wie wir es besprochen haben, Weichei!“ Der Raucher bereute es jetzt definitiv, ihn überhaupt eingeweiht zu haben.
Für die drei jungen Männer war klar, dass die dumme Sau auch heute den Nachhauseweg über den Marktplatz wählen würde. Die Dreierformation ging in Richtung Eschstraße, der Schein einer Hausbeleuchtung erfasste sie kurz. Sie stiefelten quer über den Marktplatz, der den Namen nicht verdiente. Der lag vollkommen dunkel da, einige breit gepflasterte Wege überzogen den Platz aus verdichtetem Splitt; ein Refugium für verirrte Einkaufswagen.
Etwa in der Mitte näherten sie sich ihrer Zielperson. Die Attacke geschah unvermittelt und zu plötzlich für jeden Schutzreflex. Der Raucher spurtete los, sprang dem Blonden mit voller Wucht von hinten ins Kreuz. Der knallte der Länge nach ungeschützt auf den Schotter. Gesicht und Handflächen schürften auf, ein unkontrollierter, fremdartiger Laut des Schmerzes durchbrach seine Kehle. Er wollte aufspringen, der Raucher hielt ihn mit ganzer Kraft am Boden.
Schläge auf die Arme und Oberschenkel verhinderten ein Aufrichten. Der zweite Angreifer traktierte ihn mit heftigen Tritten seiner schweren Stiefel in den Unterleib, gegen Brust und Kopf.
„Du Sau! Was glaubst‘n, wer du bist? Von dir lassen wir uns nicht länger verarschen! Hier ist die Antwort! Hast es nich anders gewollt!“
Der Dritte hielt sich zurück, stand abseits in der Dunkelheit, ermahnte die anderen, endlich abzulassen – doch vergebens. Sie traten sich in einen Rausch; einer grauenhaften Mischung aus Wut, Aggression und Wahn. Hitzig, blind und taub für alle Eindrücke und Ermahnungen traten und bespuckten sie ihn. Knochen zerbarsten im Brust- und Lendenbereich; Darm und Blase entleerten sich geräuschvoll.
Der am Boden liegende junge Mann schrie nicht mehr, stöhnte nur noch. Als Erwiderung auf ihre Tritte entwich die Luft stoßweise aus seinen Lungen, bis auch sie ausblieb.
‚Oh, alive and kicking – stay until your love is, love is, alive and kicking …‘ *
Kapitel 2
Freitag, 31. Oktober 2014 – 16.15 Uhr
„Zugriff!“ Besonnen sprach Zolloberinspektor Rolf Hansen von der Zollfahndung Hamburg-Hafen die Anweisung an das Sondereinsatzkommando ins Funkgerät. Dann folgte die übliche Routine. Schwarz gekleidete und behelmte Einsatzkräfte des SEK drangen mit Schnellfeuergewehren im Anschlag zum Tatort vor; gleichzeitig ertönten Warnhinweise aus dem Megafon. Grelles Scheinwerferlicht und die blauen Stroboskopblitze der Einsatzwagen ließen die Szenerie irreal erscheinen. Verschreckte Täter blickten sich nach allen Seiten um, versuchten zu fliehen. Die Erfahrenen verschränkten unaufgefordert ohne zu zögern die Arme hinter ihre Nacken und stellten sich breitbeinig gegen die Container.
Innerhalb einer halben Minute war der Spuk vorbei, Schusswechsel oder Verfolgung gab es glücklicherweise nicht.
Neu für mich war, dass die Aktion nicht wie sonst zur nächtlichen Stunde, sondern bereits am späten Nachmittag durchgeführt werden konnte. Der Schmuggel von gefälschten Luxusgütern aus Fernost nahm immer größere Ausmaße an, und der richtete sich nicht nach Tages- oder Nachtzeit, vielmehr nach den Fahrplänen der Containerschiffe.
Aus dem Funkgerät ertönte zufriedenes Gemurmel, ein Knacken, ein kurzer Piepton. Rolf bestätigte und legte das Gerät zurück auf das Armaturenbrett. Er lächelte zufrieden und reichte mir seine Hand. „Gut gemacht, Frank! Ein herzliches Dankeschön von uns allen!“
Ich ergriff sie. „Keine Ursache. Der Dank gebührt meinem Auftraggeber und einer kleinen Gruppe von Informanten.“
Jemand klopfte aufs Autodach. Rolf ließ die Scheibe herunter, ein Zollbeamter mit schmalem Gesicht und ovaler Brille beugte sich halb zu uns herab. „Der Sack ist zu. Die Ware ist beschlagnahmt und wird noch heute Abend ausgewertet. Nach ersten Schätzungen, würde ich sagen, ist das einer der dickeren Fische, der uns ins Netz gegangen ist!“
Noch bevor Rolf antworten konnte, meldete sich aus dem Fond des Wagens die Zollanwärterin Inga Bergholz: „Rolf, wenn du erlaubst, werde ich mir das mal vor Ort ansehen.“
Rolf erlaubte es, er erlaubte es uns beiden. Wir kletterten aus dem Auto und näherten uns dem grünen, offen stehenden Container, von denen hier am Pier mehrere hundert herumstanden.
„Weißt du, Inga“, Rolf blickte sie kurz an und setzte im Gehen seine Mütze auf, „mitten in Hamburg existierte hundertfünfundzwanzig Jahre lang eine echte Grenze, mit achtzehn Kilometer langen meterhohen Zäunen, sieben Grenzstationen und Zollkontrollen, zwischen der Stadt und dem Freihafen. Und zum Jahreswechsel 2012/2013 endete diese Ära, die für die wirtschaftliche Entwicklung der Hansestadt eine enorme Bedeutung hatte …“
„Ich weiß, Rolf“, unterbrach sie ihn sanft, „das war im letzten Monat Stoff in der Akademie und vorige Woche Teil der Klausur.“ Vor dem geöffneten Container der Firma Evergreen blieben wir stehen. Inga lächelte uns an und vergrub ihre Hände in den Hosentaschen.
„Rolf, du kannst einpacken. Inga wird ihre Hausaufgaben gemacht haben“, bemerkte ich leicht spöttisch.
Er lächelte säuerlich, nicht ganz glücklich darüber, sein Fachwissen nicht an die Frau gebracht zu haben.
Das sollte nicht mein Problem sein. Meine Aufgabe war es, den Fall heute zum Abschluss zu bringen und meinem Auftraggeber sichere Erträge zu bescheren. Nach Ermittlung der Fakten übergab ich meine Unterlagen den Behörden. Die Exekutive erledigte den Rest und ich war froh, mich aus dem gefährlichen Teil raushalten zu können. Rolf war aber stets so freundlich, mich zum Finale einzuladen – ich brauchte nicht um Freikarten zu betteln.
Ich löste mich von den beiden, ging zum Containerschiff Maersk Semarang, dessen Ladung erst zum Teil gelöscht worden war und auf dem Predöhlkai auf Abfertigung wartete. Im Nordwesten drehten die Boote der Wasserschutzpolizei Waltershof ab, sie waren offensichtlich zurückbeordert worden. Von hier wirkte die Szenerie weniger bedrohlich, fast wie ein experimentelles Bühnenstück, in dem die Container wie riesenhafte Legosteine teilweise übereinandergestapelt auf der Bühne herumstanden. Die Schmuggler wurden zu den Transportern geführt, an den Mannschaftswagen der Einsatzkräfte wurde Tee aus Thermoskannen ausgeschenkt.
Bis zum Sonnenuntergang war es vielleicht noch eine halbe Stunde. Die Luft war kühl und trocken, der Himmel klar. Von Westen zogen einige Wolkenbällchen auf; sie wurden von der Sonne illuminiert, erinnerten an glühende Brötchen. Der Wetterdienst hatte für heute Nacht ein Unwetter angekündigt, was man nicht recht glauben konnte. Jedenfalls war es gut, dass die Polizeiaktion bereits beendet war.
Rolf und Inga kamen auf mich zu.
„Frank, das wird dich interessieren …!“ Er steckte seinen Schreiber in die Hemdtasche und blätterte Papiere durch. „Es läuft gut. Einer der Verhafteten hatte die Hosen gestrichen voll. Er bot sich als Informant an und ließ durchblicken, dass weitere Plagiate auf dem Weg nach Hamburg seien.“ Er wies auf den Container hinter sich. „Darin befände sich wohl nur ein Bruchteil, dabei ist dieser Container schon randvoll. Das könnte ’ne lange Nacht werden.“
Ich nickte und merkte, wie Ingas Aufmerksamkeit plötzlich nachließ, sie biss sich auf die Unterlippe.
Rolf war das ebenfalls nicht entgangen. „Frank, könntest du Inga in Osdorf absetzen? Es liegt doch auf deinem Weg, oder?“
Ihr Blick hellte sich auf.
„Selbstverständlich! Vorher muss ich kurz mit meinem Klienten telefonieren.“ Ich zog das Smartphone aus der Tasche, entfernte mich erneut von den beiden Beamten und brachte meinen Auftraggeber auf den aktuellen Stand. Dann nickte ich den beiden zu, als Zeichen, dass es losgehen konnte. Rolf hob die Hand, Inga kam angelaufen. Wir unterquerten einen der dreiundzwanzig Containerkräne in Richtung Eurogate Container Terminal. Dort stand mein silberfarbener Volvo. Der Löschbetrieb, der wegen der Zollaktion eingestellt worden war, kam wieder in Gang.
Inga strich sich eine Locke ihrer hellblonden Haare hinters Ohr, warf mir einen fragenden Blick zu.
„Woher kennen Sie und Rolf sich, wenn ich fragen darf?“
Der Druck auf den Funkschlüssel entriegelte die Türen, wir stiegen ein.
„Rolf habe ich während des Studiums am Institut für Kriminalwissenschaften kennengelernt, Ende der achtziger, Anfang der neunziger Jahre.“ Wir fuhren los, bogen auf die Zellmannstraße in Richtung A 7. „Die ersten beiden Semester haben wir es da gemeinsam ausgehalten, dann wechselte ich zur Fakultät der Rechtswissenschaften, während Rolf beim Zoll anheuerte. Er war die blanke Theorie satt, wollte näher am Ort des Geschehens sein.“
„Das passt zu ihm“, warf sie ein.
„Stimmt, er traf damals die für ihn richtige Wahl. Ich mag ihn, er ist ein Pfundskerl! Ursprünglich waren wir beide Teil eines Dreiergespanns, zu Beginn des Studiums haben wir noch zusammengehalten wie Pech und Schwefel. Vielleicht kennen Sie ihn, Thomas Deeken. Er wechselte später zur Kripo.“
„Thomas Deeken … Ja, natürlich, Hauptkommissar Thomas Deeken, Kripo Wandsbek“, gab sie leicht zögernd von sich.
Ich blickte sie kurz an, um in ihrer Miene einen Grund für dieses Zögern zu entdecken, aber ich fand keinen. „Ist irgendetwas mit Thomas?“
„Was passiert ist, weiß ich nicht …“ Eine Pause. „Er … er wurde vor kurzer Zeit versetzt oder hat sich versetzen lassen …“ Neue Pause. „Es war jedenfalls von einem Versetzungsantrag die Rede. Deeken arbeitet jetzt irgendwo in der Provinz. Keine Ahnung, wo.“
Ich nickte, ließ es aber unkommentiert. Deeken war immer der spaßige Typ gewesen, mit einem gehörigen Hang zum Sarkasmus; daraus erwuchs irgendwann schwer zu ertragener Zynismus. Auf Dauer konnte man das nicht ignorieren und nicht jeder war in der Lage, sich gegen die giftigen Pfeile zu wehren, mit denen er verbal um sich schoss. Manchmal waren die Verletzungen so gravierend, dass sie nicht mehr heilen wollten, und sie hatten auch mich getroffen. Von mir aus konnte Deeken arbeiten, wo der Pfeffer wächst.
Ich lenkte den Wagen über die Finkenwerder Straße zur Autobahnauffahrt.
Inga blickte mich mit schräg geneigtem Kopf an. „Und wie ging es dann mit Ihnen weiter? Wie wird man eigentlich privater Ermittler?“
Nach dem Einfädeln in den Feierabendverkehr antwortete ich: „Danke, dass Sie nicht ‚Privatdetektiv‘ sagen. Dieser Begriff impliziert im Allgemeinen die Beschattung treuloser Ehepartner, das Anbringen von Abhöranlagen, das Waschen schmutziger Wäsche, und andere Klischees …“
Wir warfen rechts einen kurzen Blick auf die Köhlbrandbrücke, die sich dem abendlichen Horizont entgegenschlängelte.
Ich fuhr fort: „Mir wurde relativ schnell klar, dass ich auf eigenen Beinen stehen wollte. Nach meinem Abschluss zum Diplom-Wirtschaftsjuristen habe ich mein Gewerbe angemeldet und mir ein Büro in der Speicherstadt gesucht.“
Ingas Augen schweiften in die Ferne, dann waren sie wieder auf mich gerichtet. Sie räusperte sich. „Und davon kann man leben? Ich meine, lassen Ihnen die Behörden genügend Spielraum, um überhaupt tätig werden zu können?“
Ich musste überlegen, wo ich anfangen sollte. „In diesen Zeiten immer knapper werdender Mittel und immer umfangreicherer Ermittlungsverfahren in Bereichen wie zum Beispiel der Produktpiraterie stoßen die Behörden häufig genug an ihre Grenzen. Notwendige Ermittlungen werden nicht weitergeführt, weil die Personaldecke zu dünn ist und die finanziellen Ressourcen überstrapaziert wurden.“ Ich setzte den Blinker und wechselte auf die linke Spur. „Nicht selten fehlt den Behörden der Verfolgungswille. Wenn es, wie bei Urheberrechtsverletzungen, nur um die wirtschaftlichen Interessen eines Unternehmens geht und die rechtliche Materie sehr komplex ist, springe ich ein. Sie glauben nicht, was sich da gerade für Märkte auftun. Private Ermittler erbringen oft entscheidende Beiträge zur Aufklärung von Straftaten. Der heutige Nachmittag hat es wieder gezeigt.“
Der Verkehr war dichter geworden, mit gemächlichen sechzig Stundenkilometern fuhren wir in den Elbtunnel. Ein kontinuierliches Licht- und Schattenspiel, hervorgerufen durch die orangefarbene Tunnelbeleuchtung, erschien auf Ingas Gesicht.
Sie gab sich nicht zufrieden: „Aber Sie werden nicht von sich aus tätig, sondern nur, nachdem Sie beauftragt wurden?“
„Ganz genau. Sollte ich aber im Rahmen meiner Ermittlungen zufällig über kriminelle Sachverhalte stolpern, die mit meinem eigentlichen Auftrag nichts zu tun haben, wende ich mich an die Polizei oder den Zoll, also an Rolf.“ Ich lächelte sie offen an und streifte mir eine Haarsträhne aus dem Blickfeld.
Inga lächelte auch.
Als wir das Ende des Tunnels erreicht hatten, schaute ich in den Himmel. Die glühenden Brötchen waren verbrannt und von Westen näherte sich eine dunkle Wolkenfront. Die Meteorologen hatten nicht gelogen …
„Und Sie haben heute Abend noch etwas vor, wenn ich Ihren Gesichtsausdruck vorhin richtig gedeutet habe?“ Im selben Moment bereute ich diese Frage, mit der ich von der beruflichen auf die private Ebene wechselte.
Sie schaute mich verwundert an. „Ja, das ist richtig. Ich belege einen Abendkurs in Finanzkontrolle und Fahndung bei Schwarzarbeit.“
Unmittelbar vor der Abfahrt Bahrenfeld kam der Verkehr gänzlich zum Erliegen. Von hinten näherte sich ein Rettungswagen im Einsatz, brauste an uns vorbei. Eine Viertelstunde später erreichten wir die Ausfahrt.
Inga streckte ihre Beine aus und fragte: „Sie wohnen auch hier in der Nähe?“
Willkommen zurück im Privaten; nun war ich es, der zögerte. „Mein … unser Haus steht in Iserbrook, also noch etwas weiter westlich von Osdorf.“ Ich stockte, wusste nicht recht, ob ich weitersprechen sollte. Sie schien das zu bemerken und blickte mich fragend an. Ich sprach weiter: „Zurzeit wohne ich allerdings in meinem Büro in der Speicherstadt. Meine Frau und ich leben … getrennt – also nur vorübergehend. Es ist gerade etwas schwierig für mich … für uns. Ich … Die viele Arbeit hat unserer Partnerschaft nicht gerade gut getan.“
Sie sah mich wachsam an. „Und, wo liegt Ihre Priorität? Im Beruflichen oder im Privaten?“
Ich lächelte ertappt und machte eine entschuldigende Handbewegung. „Also, ich weiß nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass Beides nebeneinander funktioniert.“
„Und wenn es mal hart auf hart käme, wenn Sie sich entscheiden müssten?“, fragte sie.
„Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Wenn ich jetzt spontan darauf antworten soll, vermute ich, dass es da keine Patentlösung gibt. Das Leben hält viele Unwägbarkeiten bereit. Ich würde jede Situation individuell betrachten und immer neu entscheiden, abhängig von den Lebensumständen, wie Familienstand, berufliche Perspektiven und – ganz wichtig – ob man Kinder hat oder nicht.“ Ich schaute sie an, um zu sehen, wie meine Worte bei ihr ankamen. Sie schien nicht zufrieden, spitzte die Lippen und blickte nach vorn.
„Und, haben Sie Kinder?“, fragte sie freundlich, aber bestimmt.
„Nein.“
Funkstille.
Ich versuchte, ein unbehagliches Gefühl zu unterdrücken, schaffte es aber nicht. Man hofft, sämtliche Parameter der Lebensplanung ausgelotet zu haben, und dann stellt man mit einem Male fest, dass solche Überlegungen vernachlässigt wurden. Diesem Gedanken folgte die Erkenntnis, dass das auf viele Situationen im Leben zutrifft. Alles bleibt, wie es ist, solange es gut läuft; und wehe, wenn nicht.
Zwischen Susanne und mir war es längst zu einer solchen Hart-auf-hart-Situation gekommen, wie Inga es nannte. Und wir waren nicht darauf vorbereitet, auf unsere Bedürfnisse einzugehen; uns um unserer Liebe willen zusammenzuraufen.
Die jüngere Generation schien da auf einem anderen Weg unterwegs zu sein, Glück war mittlerweile Bestandteil des Lehrplans geworden. Und jetzt raubte Inga mir mit einer einzigen Frage die dämlich-alte Illusion meines Lebensentwurfes. Auf ihre Direktheit war ich nicht gefasst gewesen, aber die Berechtigung musste ich innerlich anerkennen, denn ich hatte in letzter Zeit solche Überlegungen vernachlässigt. Es gab einiges, über das ich neu nachzudenken hatte.
Was Susanne anging, so musste etwas mehr Zeit verstreichen. Zu frisch waren die Verletzungen, die wir uns gegenseitig zugefügt hatten. Wie bei so vielen hatten auch bei uns die fehlende Aufmerksamkeit, dass wir uns zu wenig Zeit füreinander genommen hatten, und Respektlosigkeit zum vorübergehenden Bruch geführt. Ob diese Trennung auf Zeit letztendlich zur Lösung der Probleme reichen würde, konnte ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Jedenfalls war es eine Art Notbremse, um nicht noch mehr Porzellan zu zerschlagen.
Die Sonne hatte sich verkrochen, unter die Wolkendecke gelegt. Es konnte nicht mehr weit sein.
„Sagen Sie mir, wo ich halten soll.“
„Okay. Sehen Sie das Haus da vorne?“
Der Schein der Straßenlaternen gab die Sicht auf ein schmuckes Mehrfamilienhaus frei.
Ich versuchte, das Gespräch schlussendlich wieder auf die berufliche Ebene zu heben. „Wenn Sie heute noch zur Akademie müssen, dann haben Sie ja noch einen weiten Weg vor sich.“
„Der Kurs findet in der Führungsakademie der Bundeswehr statt. Also gleich hier um die Ecke. Ach, da fällt mir ein, wenn Sie zur Speicherstadt wollen, dann sind Sie wegen mir ja einen riesigen Umweg gefahren …“
„Das ist überhaupt kein Problem!“ Ich hob die Hand. „Jedenfalls wünsche ich Ihnen alles Gute für die Zukunft und viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Es war nett, Sie kennengelernt zu haben. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder.“
„Das ist gut möglich. Ab nächster Woche bin ich bei unseren Kollegen in Fuhlsbüttel, am Flughafen, eingesetzt.“ Sie stieg aus, lächelte und ging.
Ich fuhr zur Bundesstraße zurück, vorbei am Musicaltheater Neue Flora und der Reeperbahn bis zur Brandstwiete, dort bog ich rechts ein. In der Speicherstadt fiel mir ein, dass ich es versäumt hatte, die Tagespost aus der Agentur zu holen. Statt links in den Alten Wandrahm einzubiegen, fuhr ich zwei Straßen weiter.
Es war eine magere Ausbeute, die ich aus dem Postfach zog: zwei Fensterbriefumschläge, ein brauner C5-Umschlag ohne Absender, Werbung und ein Katalog für Bürobedarf. Auf dem Weg zurück zum Auto zuckten still die ersten Blitze über den zum Teil liebevoll restaurierten Häusern der Speicherstadt – dem Tourismusmagnet schlechthin, mitsamt der vielen neuen Shops und Start-Ups, die sich hier eingenistet hatten, nordöstlich der Hafen-City mit ihren wuchtigen und klar strukturierten Gebäuden, die die ehemaligen Piers umsäumten, im Schatten der wohl nie endenden Baustelle der Elbphilharmonie.
Der Wagen brachte mich zum Alten Wandrahm zurück, ich bog rechts ab und parkte. Ich betrat das Haus über den rückwärtigen Eingang und stieg die Treppe hinauf bis in die dritte Etage. Oben schloss ich auf, schaltete das Licht ein, warf die Post auf den Schreibtisch. Die Raumluft roch abgestanden, ich öffnete das Fenster. Über dem Zollkanal blitzte es heftig, begleitet von launischem Donnergrollen.
Das Büro sah – dank der Reinigungskraft Gerda – tipptopp aus. Einen Raum weiter fand ich meine Wäsche gewaschen, getrocknet und gebügelt vor. Gerda war begabt darin, meine veränderten Lebensgewohnheiten wahrzunehmen und dementsprechend zu handeln, ohne dass ich ihr irgendetwas hätte erklären müssen.
Ich ging ins Bad. Beim Blick in den Spiegel sah ich, dass mein Dreitagebart seine Gültigkeitsdauer überschritten hatte. Nach dem Duschen setzte ich mich an den Schreibtisch und schaute die Post durch.
Die beiden Fensterbriefumschläge enthielten Rechnungen, Werbung flog vom Tisch ins Altpapier, der Katalog ins Ablagefach. Jetzt war der braune C5-Umschlag ohne Absender an der Reihe. Die Anschrift war mit großen Druckbuchstaben geschrieben, die mal in die eine, dann in die andere Richtung geneigt waren, so als fürchte der Absender, anhand der Schrift identifiziert zu werden – professionell war das nicht.
Draußen knallte es gewaltig. Es brach ein Gewitter los, als steckten sabotierende Teufelchen kleine Dreizacke in himmlische Steckdosen.
Der Umschlag enthielt ein etwa zehn mal sechzehn Zentimeter großes Bild, offensichtlich aus einem Farbdrucker, auf stärkerem Papier als gewöhnlich. Es lag falsch herum vor mir auf dem Tisch. Die Farben waren blass. Das Bild wies hauchdünne Streifen auf, etwa so, als wäre das Motiv von einem älteren Fernsehgerät abfotografiert worden. Ich drehte es um hundertachtzig Grad und betrachtete es genauer: Es war eine Nachtaufnahme, allein das Licht einer einzigen Glühbirne ließ Einzelheiten erkennen. Das Bild zeigte eine schmuddelige Hauswand aus erhöhtem Blickwinkel. Unter der Glühbirne eine schmale Eingangstür, rechts ein altmodisches, zweiflügeliges Fenster. Erst auf den zweiten Blick sah ich die junge Frau hinter dem Fenster stehen. Sie hatte langes blondes Haar, trug vermutlich einen Parka und auf der Nase eine Brille mit großen Gläsern, wie man sie in den achtziger Jahren gehabt hatte. Sie schaute zum linken Bereich des Bildes, der im Dunkeln lag. In ihrem Gesicht spiegelte sich eine Mischung aus Erstaunen und Besorgnis wider.
Es begann zu regnen, es knallte und es schien, als hätten sich die Blitze – jenseits des Kanals – auf den Hauptbahnhof eingeschossen. Der Regen prasselte auf das Fensterbrett. Ich schob den Fotoausdruck zur Seite und schloss das Fenster. Plötzlich zitterten meine Hände und die Knie wurden weich. Dieses Bild bewirkte etwas in mir, aber ich wusste nicht, was es war.
Es lag dort auf dem Tisch und ich wagte nicht, es wieder in die Hand zu nehmen. Ein paar Sekunden der Regungslosigkeit, dann ein tiefes Durchatmen. Ich setzte mich wieder, nahm das Papier und schaute auf die Rückseite. Was ich dort las, traf mich wie einer dieser Blitze da draußen.
Dort stand in blasser Handschrift: 15. November 1985
Kapitel 3
Montag, 3. November
Unmittelbar vor der Abreise nach Cloppenburg versuchte ich meiner Frau Susanne telefonisch darzulegen, warum ich Hamburg verließ und worum es mir ging. Für meinen Geschmack klang es überzeugend, auch mir selbst gegenüber. Sie gab dazu wieder keinen Kommentar ab, ich hatte auch nichts anderes erwartet, weil ich auf ihre Mailbox sprach. Gerda legte ich eine entsprechende Notiz auf den Schreibtisch. Ich überlegte zudem, eine Freundin aus Jugendtagen anzurufen, um sie um ein paar kleine Gefallen zu bitten. Ich wagte es – sie sagte zu. Wir verabredeten uns mittags vor der Cloppenburger Tageszeitung, bei der sie als Journalistin tätig war.
Ab dem Buchholzer Dreieck unterschied sich die A1 nicht wesentlich vom Canale Grande. Riesenhafte Vaporetti auf Rädern lieferten sich Elefantenrennen, deren geduldige Verfolger in Nebeln von Spritzwasser zu versinken drohten. Seit meiner Überquerung der Elbbrücken verwandelte sintflutartiger Regen die Straßen in Wasserspiegel. Vom sommerlichen Herbst war nichts übriggeblieben. Die Scheibenwischer rotierten, zogen dünne, nasse Streifen über die Windschutzscheibe. Eine halbe Stunde später ließ der Regen nach. Bei Wildeshausen sah ich am Rande eines Feldes einen wuchtigen Bau, ein Holzhaus, dessen Zimmerleute dem Wetter trotzten. Ich glaubte, ein Schild mit der Aufschrift Arche 2 gesehen zu haben, will mich da aber nicht festlegen.
Etwa ab dem Ahlhorner Dreieck gab der Himmel die Sicht auf etwas Blaues frei, wenngleich die Hoffnung auf schöneres Wetter durch einen Wolkenbruch jäh zunichte gemacht wurde.
Ich fühlte mich weder frisch noch ausgeruht. Der anonyme Brief vom vergangenen Freitag hatte mich aus der Spur gekegelt und in den Nächten keine Ruhe finden lassen. Die monotone Fahrt durch den Regen bewirkte, dass die Ereignisse des November 1985 vor meinem geistigen Auge wieder auflebten, wie in einem Super-8-Film mit Sprüngen, Farbschlieren und Staubpartikeln auf der Linse.
Der Monat November 85 war untrennbar mit der Geschichte der Stadt verwoben, hatte sich ins kollektive Gedächtnis der Cloppenburger gebrannt. Wir waren wie paralysiert gewesen damals, als Michael Ostermann, Schüler des Clemens-August-Gymnasiums, auf dem Cloppenburger Marktplatz brutal zusammengetreten worden war und an den Folgen verstarb. Die Tat war nie aufgeklärt worden, trotz jahrelanger, intensiver Ermittlungen. Es hatte unzählige Befragungen und Untersuchungen gegeben, sowohl in der Nähe des Tatorts als auch in den Schulen. Indizien und Aussagen wurden gesammelt, verglichen und auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft, vor allem durch die Bevölkerung.
Die Folge waren Mutmaßungen über Täter, Motiv und Tathergang, so unterschiedlich wie es Weltanschauungen gab. Es war der Versuch, das Unerklärliche begreifbar zu machen. Das Grauen über das, was Menschen sich antun können, sollte durch Worte gezähmt werden; letztlich überwog jedoch die Sprachlosigkeit. Es gab keinerlei Antworten auf derartige Grausamkeiten, lediglich Sorge und Hilflosigkeit. Hieraus erwuchs Trauer, aus der Traurigkeit Empathie, und aus dem Mitgefühl tätige Anteilnahme den Angehörigen gegenüber. Schulen, Verbände und Vereine leisteten aktive Trauerarbeit durch gemeinsame Projekte und öffentliche Kundgebungen gegen Gewalt und für mehr Mitmenschlichkeit. Mehrere Wochen war der Marktplatz abgesperrt gewesen und als er endlich freigegeben wurde, wagte sich niemand darauf – ob aus Respekt oder Furcht, konnte keiner mit Gewissheit sagen.
Michael Ostermann war mir nicht persönlich bekannt gewesen. Er war Schüler des CAG, während ich das G II im Schulzentrum am Cappelner Damm besuchte. Interdisziplinäre oder schulübergreifende Projekte gab es damals kaum, jeder war mit seinem persönlichen Umfeld beschäftigt.
Ich schrak auf, als ich von einem dröhnenden Lastwagen überholt wurde, wobei sich Wasserkaskaden über mein Auto ergossen – es geriet ins Schlingern, blieb aber in der Spur. Ich musste unbewusst langsamer geworden sein. Das eintönige Wummern meines Sechszylinders wirkte einschläfernd, ich weckte das Smartphone aus dem Standby und startete aus der Achtziger-Jahre-Compilation den Song ‚Shout‘ von den Tears For Fears.
Der Abend des fünfzehnten November war damals komplett aus meiner Erinnerung gefallen. Ich hatte in der Szene-Disco Neue Heimat einen über den Durst getrunken; jedenfalls holte man mich tags darauf aus den Büschen, mit Raureif an den Ohren. Und als ich einigermaßen aufgetaut war, erzählte man mir, was sich im zwanzig Kilometer entfernten Cloppenburg zugetragen hatte. Die Leute waren verunsichert, niemand wagte sich mehr abends allein durch die Stadt. Es vergingen mehrere Monate, bis wieder so etwas wie Normalität einkehrte. Die Tatsache, dass der Täter nie gefasst wurde, hinterließ ein dumpfes Gefühl, insbesondere Furcht vor einer Wiederholungstat.
Ich setzte den Blinker und steuerte den Wagen in Richtung Cloppenburg, über die Bundesstraße 72, die weit nach ihrer Fertigstellung Mitte der achtziger Jahre zu einer Schnellstraße ausgebaut worden war und damit ein Großteil der Spannung herausnahm. Früher wusste man nie, mit wem man in der nächsten Kurve kollidieren würde, jetzt konnte man auf hundertfünfzig Kurvenmeter genau zielen.
Mir wurde plötzlich übel. Ich hielt am Rastplatz Emstek und übergab mich, danach ging es wieder. Es war nicht das Frühstück; es waren die Erinnerungen und Bilder, die mir auf den Magen schlugen. Ich atmete tief die feuchte Luft ein und schaute den vorbeifahrenden Autos zu.
In Zusammenhang mit dem anonymen Brief tauchten Fragen auf: Weshalb hatte ausgerechnet mir jemand dieses Foto zukommen lassen, und wo war es auf einmal hergekommen? Für mich bestand nicht der geringste Zweifel daran, dass das Foto etwas mit dem Mord in Cloppenburg zu tun hatte – das Datum auf der Rückseite sprach für sich. Das Bild war definitiv ein neues Indiz, es war damals nie erwähnt worden, und es forderte mich heraus, eigene Ermittlungen anzustellen.
Es gab nichts, was dagegen sprach. Mein letzter Fall war abgeschlossen, und ich benötigte Abstand zu den Dingen, die mich in Hamburg umgaben. Abstand von Susanne, Abstand vom Job, Abstand, um eine neue Sicht auf die Dinge zu bekommen. Es war keine Aufgabe, die meiner üblichen Tätigkeit entsprach, vielleicht würde sie mich sogar überfordern. Aber eins wusste ich genau: Ließe ich es bleiben, würde ich es eines Tages bereuen.
In der Stadt gelandet, bugsierte ich meinen Wagen in eine der freien Parklücken in der Bürgermeister-Heukamp-Straße, direkt an der Soeste mit Blickrichtung auf das St.-Josefs-Hospital. Der Anblick war mir nach all den Jahren noch erschreckend vertraut. Im Schlepptau dieser Vertrautheit gerieten unvermittelt weitere Bilder an die Oberfläche. Es waren schwermütige, negativ besetzte Bilder, koloriert mit den gedeckten Farben verletzter Empfindungen, die mich beunruhigten; die Suche nach Orientierung, die Suche nach Schutz und Geborgenheit, nachdem meine Eltern Anfang der achtziger Jahre durch einen Autounfall ums Leben gekommen waren. Erinnerungen an die erste erfüllte und – nach einer Zeit der Ernüchterung – verflossene Liebe. Aber auch Erinnerungen an den Aufbruch, mit einem wütenden Gefühl in der Brust, einer Mischung aus Anarchie und Abenteuerlust. Es gab nichts, was mich noch hielt.
Es war zwanzig nach zwölf. Ich nahm meine Jacke vom Beifahrersitz und stieg aus dem Volvo. Nach ein paar Schritten zog ich die Jacke über. Der Regen hatte ganz aufgehört, die Luft blieb aber nass und kalt. Ich sah mich um. Es war nicht mehr die Stadt, die ich damals so wütend hinter mir gelassen hatte, und ich glaubte kurz, eine Kulisse zu durchschreiten, die allein dem Zweck diente, mich zu verunsichern. Bei jedem Schritt wurden Erinnerungen durch neue Eindrücke abgelöst.
Eine kurze Passage mit Shops, Bar und Restaurant führte mich direkt in den Fußgängerbereich. Hier hatte sich vieles getan: zeitgemäßes Straßenpflaster, ansprechende Hausfassaden, gepflegtes Grün – die Stadt war auf der Höhe der Zeit, wenngleich sie sich auf den ersten Blick nicht wesentlich von anderen norddeutschen Städten dieser Größe unterschied. Was sie für mich einzigartig machte, waren die Erinnerungen, die unter dem neuen Pflaster verborgen lagen. Ich schaute nach rechts. Die Buchhandlung Terwelp war noch immer an ihrem angestammten Platz. Das Redaktionsgebäude der Cloppenburger Tageszeitung gegenüber überraschte durch ein komplett neues Gesicht.
Dann sah ich sie. Ich hatte Antje Meiners nicht aus dem Redaktionsgebäude kommen sehen, sie stand plötzlich da. Antje war nach wie vor eine schöne Frau; groß, schlank und die Kurven an den richtigen Stellen. Als ich auf sie zuging, registrierte ich, dass die Zeit auch an ihr nicht spurlos vorübergezogen war. Sie hatte einen sorgenvollen Zug um den Mund und dünne Linien zwischen und über den Augenbrauen. Ihr schulterlanges braunes Haar wies vereinzelt ein paar graue Fäden auf. Sie trug einen halblangen dunklen Mantel, darunter Bluejeans und dunkelbraune Wildlederstiefel. Mit einer Hand hielt sie sich den Kragen zusammen, während sie mal in die eine, dann in die andere Richtung blickte. Sie entdeckte mich, lächelte. Ich kam näher, und als wir uns gegenüberstanden, umarmten wir uns.
„Mensch, Frank …!“, eine bewusste Pause, während sie mir in die Augen schaute. „Es ist schön, dich zu sehen! Wie lange ist das jetzt her?“ Antjes mandelförmige braune Augen sahen mich fragend und erfreut zugleich an. Sie umfasste meine Hände.
„Es sind wohl um die fünfundzwanzig Jahre“, antwortete ich.
„Was feiert man denn, wenn man so lange Zeit nicht zusammen war?“, wollte Antje wissen.
Ich hob die Schultern und ignorierte die Anspielung auf unsere gescheiterte Beziehung. „Es ist schön, dich wiederzusehen! Danke, dass du dir Zeit für mich genommen hast. Du siehst einfach umwerfend aus!“
Ihre Lider senkten sich für einen Moment als stumme Antwort auf das ehrlich gemeinte Kompliment.
„Du hast dich aber auch gut gehalten, mein Lieber! Vielleicht solltest du dich mal beim Friseur blicken lassen …“ Antje fing wieder das Sticheln an, wie früher. Aber es stimmte, mein Haar war eindeutig zu lang, es fiel mir ständig in die Augen. Sie hob die Hand und führte eine meiner dunkelblonden Strähnen hinter das Ohr, auf dem Rückweg strich sie mir mit der flachen Hand über die stoppelige Wange. Ihre Hand war warm und es fühlte sich gut an. Es kam etwas überraschend. Ich betrachtete unauffällig ihre Hände, sie trug keinen Ring. Dann ihr feines Gesicht: die schmale Nase, die ein ganz klein wenig vorsprang, klare Augen, die Farbe wie polierter dunkelbrauner Jaspis, es lag ein schimmernder Schleier darüber wie Nebel in der Morgendämmerung. Der ungeschminkte Mund, mit sinnlich geschwungenen Lippen. Ein übriggebliebener Hauch von Sommersprossen als schwaches Muster auf dem Nasenrücken und in sanften Bögen unter den Augen. Ich hatte diesen Anblick fast vergessen.
Wie dem auch sei, ich hatte einen Sack voll mit Aufgaben dabei. Antje bemerkte die Veränderung meines Blickes, sie bewegte sich leicht zurück und schaute amüsiert an mir herunter. „Trägst du noch immer diese alte Schimanski-Jacke? Ich kann es nicht glauben!“
„Das ist keine Schimanski-Jacke, sondern die Feldjacke M-65!“ Ich tat ebenso empört wie sie. „Sie ist außerdem nicht alt, sondern mein viertes Modell, gerade mal ein halbes Jahr. Die Jacken wachsen mit ihren Aufgaben.“
Antje lachte. „Oder mit deiner Körperfülle, wolltest du wohl sagen!“
Dass bereits Robert De Niro in dem Film Taxi Driver eine solche Jacke getragen hatte und ich sie mir deshalb einst zugelegt hatte, verschwieg ich. Ich hatte es ihr damals schon erklärt. „Wie lang ist eigentlich deine Mittagspause?“, machte ich sie auf etwas aufmerksam, das wir telefonisch vereinbart hatten.
Antje legte ihre schlanken Finger auf den Mund, ihre Augen weiteten sich. „Ach du Schande, wir müssen los. Ich habe dir eine Absteige besorgt, die du nicht so schnell vergessen wirst. Lass uns gehen.“
Der Sarkasmus in ihrer Stimme war unüberhörbar und ich spielte ihr Spiel mit. „Ich sagte dir zwar ‚Nicht zu teuer‘, aber das Bett sollte zumindest frisch bezogen und das Frühstücksei genießbar sein.“
„Keine Sorge, es wird dir gefallen. Vertrau mir!“
Wir gingen zur Stadtmitte, dann links in die Mühlenstraße. Sie hatte nur noch wenig gemein mit jener Mühlenstraße, wie ich sie kannte. Markante Fixpunkte waren das Haushaltswarengeschäft Bley, das Bekleidungsgeschäft Berssenbrügge und die Soestenbrücke. Daran konnte ich mich orientieren, der Rest war in gewisser Weise Neuland. Das alte, prachtvolle Heukamp‘sche Haus mit seinem verwunschenen Garten war einem hellen Büro- und Geschäftskomplex gewichen. Unmittelbar vor der Brücke bogen wir rechts ein, an einer Stadthalle vorbei, weiter in Richtung Stadtpark zum Landkreisgebäude.
„Was wollen wir beim Landkreis, etwa Wohngeld beantragen?“, zog ich Antje auf und blieb stehen.
Sie schaute mich leicht verwirrt an. „Mann, wie lange warst du schon nicht mehr hier? Die Landkreisverwaltung ist heute an der Eschstraße, direkt am Marktplatz. Hier ist jetzt das ParkHotel.“
Ich stutzte. „Hm, sagte ich nicht ‚Bitte nicht zu teuer‘?“
„Einfach mal mitkommen und die Klappe halten!“, befahl Antje. Sie hakte sich bei mir ein, wir betraten das Hotel wie ein altes Ehepaar.
Die Dame an der Rezeption rückte mit der eigentlichen Überraschung heraus. Aufgrund von Renovierungsarbeiten sollte mir ein gerade fertiggestelltes Loft in der Mühlenstraße zur Verfügung gestellt werden. Zwei Zimmer mit Küchenzeile und Bad, zu einem Preis, den ich nicht ablehnen könne. Für die Mahlzeiten stünde das Hotel-Restaurant zur Verfügung. Ich lehnte tatsächlich nicht ab. Wir erledigten die Formalitäten. Antje bat darum, mitkommen zu dürfen, wie um sich zu überzeugen, dass sie die richtige Wahl getroffen hatte.
Auf dem Weg zum Loft zeigten sich endlich ein paar Sonnenstrahlen, Wolken hingen wie zerfetzte Croissants über uns. Es war fast windstill, die Luft nasskalt; beileibe kein Wetter, um draußen Wäsche zu trocknen. Im Haus gab es einen Fahrstuhl, wir entschieden uns für die Stufen, über die wohl noch kein anderer Hotelgast gegangen war. Der Treppenaufgang war aus schwarzem Marmor, mit Handläufen aus gebürstetem Edelstahl, die Wände in anthrazitfarbenem Anstrich. Das künstliche Licht ließ das Treppenhaus klinisch wirken, es roch neu wie auf einer Säuglingsstation. Wir schienen hier die Einzigen zu sein, es rauschte nicht einmal in verborgenen Rohren. Ganz oben im vierten Stock öffnete ich die Tür mit edlen Chrombeschlägen.
Im dunklen Eingangsbereich schaltete sich kalte LED-Beleuchtung ein, im daran anschließenden Wohnbereich konnte auf künstliches Licht verzichtet werden. Großflächige Fenster mit Blick auf einen imposanten, fast malerischen Himmel im Osten, markante Gebäude darunter, wie das Amtsgericht, die St.-Augustinus-Kirche, die Flügel einer Mühle des Museumsdorfes und der Pfanni-Turm, dazu ein Wechselspiel von Licht und Schatten, von Sonne und Wolken. Wir schauten uns um. Sitzmöbel aus dunklem Leder, edel verchromt, allesamt Design-Klassiker. Schnörkellose, schlichte Wandregale aus dunklem Holz, helle Wände, an denen ein paar Werke regionaler Künstler wie Körtzinger, Lake und Berges hingen, zudem ein riesenhafter Flachbildschirm auf einer Anrichte.
„Respekt, Antje! Alles ganz nach meinem Geschmack“, stellte ich fest.
Antje schien zufrieden, allerdings zeigte sich eine schmale, gekräuselte Linie auf ihrer Stirn. „Hier fehlt etwas Lebendes, wie wäre es mit Pflanzen?“, sagte sie in einem Tonfall, als könne ich aus einem Wellness-Programm wählen. Ich nickte. Sie schaute auf die Uhr, ihre Augen weiteten sich. „Frank, meine Mittagspause ist um. Ich muss los. Vielleicht können wir uns mal treffen, um ein bisschen zu plaudern oder die alten Zeiten aufleben … äh, Revue passieren zu lassen …“ Der Fauxpas war ihr sichtlich unangenehm.
Ich tat, als hätte ich ihn nicht bemerkt. „Das ist eine gute Idee, ich lade dich zum Essen ein, als Wiedergutmachung für deine Mühe. Wie wäre es morgen Mittag?“
„Sehr gern.“ Antje machte Anstalten, zu gehen.
Mir war allerdings nicht klar, wohin ich sie hätte einladen können; ich war auf einen Tipp angewiesen. „Kennst du ein nettes Lokal?“
Sie hielt kurz inne. „Sicher, lass dich noch einmal überraschen.“
Überraschungen wie diese hier gehörten offensichtlich zu Antjes Stärken. Ich begleitete sie nach unten. An der Tür verabschiedeten wir uns mit einer Umarmung, dann ging ich weiter über die Fußgängerbrücke zum Parkplatz, nahm meine Sachen aus dem Auto und richtete mich im Loft ein. Erst blickte ich auf die Uhr, dann in den Himmel. Das Wetter erlaubte einen Spaziergang durch die Stadt, um mich wenigstens ansatzweise mit den Veränderungen der letzten zweieinhalb Jahrzehnte vertraut zu machen. Doch zunächst griff ich zum Telefon. Es war Zeit, meine Ermittlungen in Gang zu bringen. Ich musste mit jemandem sprechen, der damals nahe dran gewesen war am Geschehen, im November 1985.
Kapitel 4
Nach einem ausgiebigen Spaziergang und dem Abendessen im Hotel begab ich mich auf beleuchteten Pfaden durch den nächtlichen Stadtpark zum Briefkasten; einer Traditionskneipe, die neben der Buchhandlung Terwelp und dem Musikalienladen Witte in meiner Jugendzeit zu den wichtigen Anlaufstellen gerechnet worden war. Das lag nicht zuletzt an Felix Viegener – dem Jahrhundertwirt – der dem Briefkasten wenigstens zu Lebzeiten seine gute Seele eingehaucht hatte, achtzehn Jahre lang. Für seine Gäste hatte er stets ein offenes Ohr gehabt, und für die Schüler, die vor und nach dem Unterricht dort ein- und ausgegangen waren, sogar beide. Überdies war er ein Gönner, ein Förderer regionaler Bands. Bedurfte es eines Probenraums, stellte er unbürokratisch den Kneipenkeller zur Verfügung. Felix war als Vertrauensperson beliebt und geachtet, eine Seele von Mensch, väterlicher Freund, Tröster bei Schulsorgen und Liebeskummer, und überdies Kosmopolit mit bewegter Vergangenheit. Hitzige Wortgefechte, an denen er teilnahm, fanden mit seiner Beschwichtigungsformel „Was soll denn der ganze Quatsch“ ein gütliches Ende. Wenn uns Schülern in den Sinn kam, mit Freunden eine gute Zeit im Briefkasten zu verbringen, hieß es schlicht: „Wir treffen uns bei Felix“ – damit war alles geregelt.
Und nun, nach einer gefühlten Ewigkeit, traf ich wieder jemanden ‚bei Felix‘: Es war Peter Blase, der Betreiber der ehemaligen Szene-Disco Pogo sowie der Musikkneipe Bebop, der nach Felix‘ Ableben die Federführung des Briefkastens übernommen hatte. Peter war schon in jungen Jahren so etwas wie ein Garant für Erfolg im gastronomischen Gewerbe gewesen.
Ich näherte mich der Kneipe vom Amtshausweg her, an den Bekleidungsgeschäften Ceka-Többens und Werrelmann vorbei. Das Lokal nahm sich neben dem alten Postamt aus wie ein riesenhafter belebter Briefkasten: hohe, erleuchtete Fenster mit massiven postgelben Rahmen. Beim Eintreten verspürte ich ein gewisses atmosphärisches Vibrieren, das wohl von unzähligen Partys wilder, vergangener Tage herrühren dürfte; das Gefühl, nach einer langen Reise nach Hause gekommen zu sein, in der Erwartung, das ein oder andere bekannte Gesicht wiederzusehen.
Mein Blick fiel auf einen gut gelaunten Peter hinterm Tresen, Pils zapfend und sich angeregt unterhaltend. Er trug ein schwarzes T-Shirt und Bluejeans. Quer über seiner Brust stand in weißen Lettern Peter & der Rolf. Ich öffnete meine Feldjacke und steuerte einen freien Platz am Tresen an; dabei schaute ich mich um.
In der linken Ecke, direkt am Fenster, saß eine gemischte Gruppe aus feuchtfröhlichen Alt-68ern und verwelkten Blumenkindern, die vielleicht gemeinsam den Jahrestag der Befreiung Vietnams von der französischen Kolonialmacht durch Ho Chi Minh nachfeierten. Dann ein paar unbesetzte Tische. Weiter mittig im Raum saß ein verliebtes Pärchen mit ineinander verschlungenen Händen und Blicken, am Tisch rechts davon ein Geschäftsmann, dessen Gesicht mit einem Tablet-PC verwachsen war. Einen Raum weiter, hinter der offenen, bleiverglasten Eichentür, stand vermutlich noch der Billardtisch, auf dem wir als Jugendliche das Spiel geübt hatten. An den Wänden hingen neben einer Tuba noch ausrangierte Gitarren, rechts von mir ein goldfarbener Signature-Bass von Jack Casady. Aus dem verborgenen Soundsystem plärrte das wehleidige Schmachten von Mick Hucknall und seiner Band Simply Red, mit dem Stück ‚Holding Back The Years‘.
Peter Blase drehte seinen Kopf zufällig in meine Richtung, hielt in der Bewegung inne und blickte nachdenklich. Er löste sich von seinem Gesprächspartner an der Theke und kam auf mich zu.
Ich nickte und streckte ihm meine Hand entgegen. „Moin! Mein Name ist Frank Gerdes, wir haben vorhin telefoniert …“
Peter ergriff die Hand, doch die Nachdenklichkeit in seinem Gesicht blieb. „Einen Augenblick bitte.“ Er setzte einen Strich auf den Rand eines Bierdeckels, dann schenkte er mir seine volle Aufmerksamkeit.
Er hatte sich gut gehalten, wie man so sagt. Sein dünnes graues Haupthaar gab keine kahlen Stellen preis, war kurz geschnitten und stand nach vorn ab. Das glänzende Gesicht und sein Dauerlächeln ließen einen feuchtfröhlichen Hintergrund vermuten, obgleich seine Augen keine Spur von Wässrigkeit aufwiesen. Er war eine ausgemachte Frohnatur. Nun sah er mich über den Rand seiner Brille direkt an, mit einem Blick, der nicht mehr so nachdenklich wirkte, dafür eine Spur wachsamer. „Was kann ich für Sie tun?“, wollte er wissen.
Ich konnte nicht sofort antworten, weil aus der 68er-Ecke dreckiges Gelächter aufbrandete; volkseigene Ferkeleien machten die Runde.
„Ich bin hier wegen der Tragödie im November 85, dem Mord an Michael Ostermann …“ Ich ließ den Satz eine Weile zwischen uns in der Luft hängen, bevor ich fortfuhr. „Sie erinnern sich daran?“
Er nickte kurz, schaute ernst und gedankenverloren, aber seine Hände begannen wie automatisch leere Gläser vom Tresen aufzusammeln. Als seine Augen wieder auf Empfang schalteten, meinte er: „Sicher. Wer wüsste das hier nicht … Sind Sie von der Polizei, oder so was?“ Er wurde eine Spur reservierter.
Ich räusperte mich. „Eher‚ oder so was‘. Ich trage die Fakten zu dem alten Fall zusammen und werfe einen frischen Blick darüber. Nichts Behördliches, das ist reine Privatsache. Ich bin in dieser Stadt aufgewachsen, mit den Örtlichkeiten vertraut. Das Pogo kannte ich wie meine Westentasche, und New Wave war in den Achtzigern mein zweiter Vorname, damals war ich achtzehn Jahre alt …“
Peter schürzte die Lippen, atmete tief ein und nickte knapp. „Ich glaube, ich erinnere mich an Sie … Ich bin mir nicht sicher.“ Ein leeres Glas hebend, blickte er mich fragend an.
Das hätte ich beinahe vergessen. „Ein Pils bitte“, sagte ich.
Peter zog am Hahn. „Ich hatte der Polizei damals alles erzählt, und es stand hinterher breit in der Zeitung.“
Ich gab mich begriffsstutzig. „Wie der Poet sagte: ‚Ich war aufm Klo, da hab ich’s verpasst …‘ Helfen Sie mir auf die Sprünge, ich war jung damals, habe einiges vergessen und kenne vieles nur vom Hörensagen.“
Bevor er antwortete, kam auf einmal Bewegung in den Laden. Zwei Pärchen um die fünfzig zwängten sich durch die Schwingtür und begaben sich auf die Suche nach einem geeigneten Platz, von dem aus sie alles gut im Blick hatten. Derweil faltete der Geschäftsmann sein Tablet zusammen, legte die Zeche auf den Tisch und bedeutete Peter mit einer Geste, dass es so stimmte.
Peter hob lächelnd den Kopf, nickte und wandte sich mir wieder zu. „Also gut. Gleich zu Beginn der Ermittlungen hatten sich die Bullen auf zwei Jungs eingeschossen. Nun ja, natürlich nicht wörtlich.“ Er schmunzelte, ich auch – ein echter Scherzbold. „Einer davon war Christoph Wessels. Er saß damals bis spät in die Nacht zugedröhnt im Pogo. Und das war kein Alk, sondern irgendwas Illegales – Marihuana, glaube ich. Das warf natürlich ein schiefes Bild auf meinen Laden, aber bei den Bullen war bekannt, dass ich das nicht duldete. Bei mir wurde nichts Derartiges konsumiert und natürlich nicht gedealt, da war ich konsequent. Wer sich nicht daran hielt, flog raus. Wessels musste das Zeug schon vorher irgendwo geraucht haben.“ Er verstummte, und sein Blick zeigte mir, dass er in Gedanken wieder woanders war.
Ich ließ ein paar Sekunden verstreichen, räusperte mich.
Peter kehrte in die Gegenwart zurück und stellte das fertige Pils auf den Tresen, dann erzählte er weiter: „Christoph hatte zunächst kein Alibi und konnte sich nicht daran erinnern, was er ein paar Stunden zuvor gemacht hatte. Seine Mitschüler sagten übereinstimmend aus, dass er und Michael Ostermann sich auf den Tod nicht ausstehen konnten, sie gerieten oft heftig aneinander. Das machte ihn natürlich verdächtig, aber niemand konnte ihm etwas nachweisen. Sie können sich vorstellen, dass so ein Verdacht an einem kleben bleibt wie Kuhscheiße an Chucks. Erst sehr viel später bestätigte jemand, dass Christoph zur Tatzeit im Big Ben war.“
„Warum erst so spät?“
„Die Person verunglückte in derselben Nacht mit dem Auto und lag ein paar Monate im Krankenhaus.“
Aus der 68er-Kommune wurde mit erhobenen Fingern eine Sammelbestellung aufgegeben: Whisky-Cola; sozialistischer ging es kaum.
Peter zählte durch, und während er entsprechend viele Gläser füllte, fuhr er fort: „Der andere Verdächtige war Wolfgang Sieverding. Ihn hatten sie mal beim Verteilen kleiner Mengen Drogen erwischt – aber nicht bei mir!“, schob er sofort nach. „Wolfgang Sieverding hatte allerdings ein Alibi, darum war er raus aus der Nummer.“ Er stellte die vollen Gläser auf ein Tablett und brachte sie dem 68er-Kollektiv, auf dem Rückweg sammelte er jene Zeche ein, die der Geschäftsmann hatte liegenlassen.
Ich nahm ein paar kräftige Züge aus dem Glas und lauschte dabei dem Stück ‚Drive‘ von The Cars … aber es klang seltsam. Da waren Soundeffekte, die ich noch nie zuvor gehört hatte, etwa wie ein Martinshorn. Zwei, drei Sekunden später nahm ich blaues Blitzlichtgewitter wahr, das sich in den Kneipenfenstern brach. Ein Polizeiwagen, Rettungswagen und zwei Feuerwehrzüge rasten mit voller Geschwindigkeit durch die Bahnhofstraße in Richtung Stadtmitte. Zwei Herrschaften aus der 68er-Kolchose hielt es nicht länger auf den Stühlen; sie erhoben sich, strebten sensationsgierig dem Ausgang entgegen. Mit runden Augen und heruntergezogenen Mundwinkeln begab sich Peter wieder hinter den Tresen, wohl wissend, dass bei derartigen Vorkommnissen schon mal die Zeche auf der Strecke blieb. Das Tablett stellte er ab, warf das eingesammelte Geld in die Kasse.
Als er weitersprach, wechselte er zum vertraulichen Du: „Gibt es noch etwas, was du wissen willst?“ Er behielt die beiden Sputniks im Auge, die inzwischen vor die Tür getreten waren.
„Was mich besonders interessiert, ist, was damals nicht in den Zeitungen stand. Gab es da etwas?“
„Hm, ja … da war tatsächlich noch was … Einen Moment eben.“ Er trocknete sich die Hände ab, nahm die Bestellung der neuen Gäste auf, kam zurück. Er suchte nach den richtigen Worten, beugte sich etwas über den Tresen und sagte leiser: „Das erfuhr ich aber erst viel später. Neben dem Pogo stand ja dieses heruntergekommene alte Haus. Es war nie klar, wem es eigentlich gehörte; da hat sich ja auch nie jemand drum gekümmert. Jedenfalls erzählte man sich, dass an dem besagten Abend … Leute … drin waren.“
Ich schaute ihn fragend an. „Was kann ich mir darunter vorstellen?“
„Na ja“, er druckste herum. „Pärchen eben … Keine Liebespärchen, sondern … eher geschäftlicher Natur, wenn du verstehst, was ich meine.“
„Aha, okay. So etwas ist in unserer Gesellschaft nicht direkt verboten.“
„Auch nicht, wenn es dabei um Minderjährige geht, und um angesehene Persönlichkeiten unserer ehrenwerten Stadt?“ Sein vertrauliches Flüstern war noch mal um die Hälfte leiser geworden.
Ich antwortete nicht, blickte ihn sparsam an. Er kam noch etwas näher, ich wich ein Stückweit zurück.
„Vielleicht kam der Täter ja aus dem alten Haus.“ Er zog mit dem Zeigefinger eine Spur auf die Tresenplatte. „Das wurde nie richtig überprüft!“