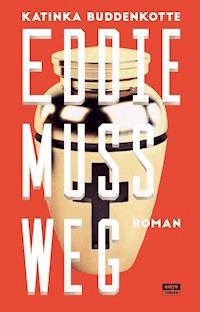8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Muskelkater vom Dauergrinsen garantiert!“ Jürgen von der Lippe über Katinka Buddenkotte
Die Comedienne Katinka Buddenkotte ist ein Film- und Fernsehprofi. Von der Couch aus. Seit frühester Kindheit fernsehbegeistert hat sie allen Unkenrufen zum Trotz dabei viel fürs Leben gelernt. Zum Beispiel, dass Schauspieler mit Ketchup gefüllt sind und man Erwachsenen eher die peinliche Knutscherei verzeiht, wenn dabei gute Hintergrundmusik läuft. Vom Bildschirm und der Leinwand nimmt sie stets wertvolle Erkenntnisse mit in die dreidimensionale Welt, die man Leben nennt. Witzig, pointiert, frech und doch wunderbar tiefsinnig – in diesen Geschichten zeigt sich Buddenkotte at her best!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
KATINKA BUDDENKOTTE, Jahrgang 1976, landete gleich mit ihrem ersten Buch »Ich hatte sie alle« einen Bestseller. Weitere Kurzgeschichten sowie zwei Romane folgten und machten ihren Namen zu einem Synonym für humorvolle Unterhaltung für junge Frauen. Katinka Buddenkotte lebt als Comedienne, freie Autorin und Vorleserin in Köln.
Katinka Buddenkotte in der Presse:
»Lange nicht mehr so gelacht.«
FIZZ
»Im typischen Buddenkotte-Stil wird es durchaus nachdenklich, oft aber auch lustig und niemals zu sentimental.«
Libelle über Fortpflanzung nach Tagesform
»Eine angenehme Abwechslung in der deutschen Comedybuchszene.«
Kulturnews über Betreutes Trinken
Außerdem von Katinka Buddenkotte lieferbar:
Fortpflanzung nach Tagesform. Roman
Betreutes Trinken. Roman
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
Katinka Buddenkotte
Früher war wenigstens Sendeschluss
Film und Fernsehen für Fortgeschrittene
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichenvon Penguin Books Limited und werdenhier unter Lizenz benutzt.Copyright © 2017 beim Penguin Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 MünchenUmschlag: Cornelia NiereUmschlagmotiv: Roland Werner (Illustration); Shutterstock/IkoSatz: Fotosatz Amann, MemmingenISBN 978-3-641-09541-3V001www.penguin-verlag.de
Für alle, die auch keine viereckigen Augen bekommen haben.
Zumindest bisher.
Inhalt
Alles nur Show
Spiel’s nicht noch einmal, Sam!
Auf sie mit Betäubungspfeilen
Killed by Translation – Tödliche Übersetzung
Vampire im Wandel der Zeit
Eine Dicke hätte dem Spiel gutgetan
Zum Selberdrehen: Anregungen für den kreativen Cineasten – Tierfilm noir mit Pfiff
Drehbuch zum Nachspielen – Im Banne des Hygrometers
Küchenpsychologie
Ponysuppe
Wir dazwischen
Ich habe die Seeräuber-Jenny vorbereitet
Unfreiwillige Selbstkontrolle
Mehltau oder Früher war wenigstens Sendeschluss
Hosenrolle
Käse streicheln
The Good, the Bad and the Ugly
Das tut nix für sie
Gefahrensucher unterwegs
Reden wir nicht mehr darüber
Der Tod trägt Locken
Mein Vermächtnis oder Tote schlafen fast
Alles nur Show
Zunächst möchte ich meiner Schwester danken, für ihre großartige Performance als Erstgeborene. Sie überzeugte meine Eltern durch grundsätzliche Niedlichkeit, einfache Handhabung und ein erfreulich hohes Schlafbedürfnis. Hätte ich ihren Part übernommen, wäre ich wohl Einzelkind geblieben. Denn auch die risikofreudigsten Produzenten würden niemals ein Sequel von einem Film herausbringen, der bei den Zuschauern floppte. Bei mir waren von vornherein Drehbuchschwächen zu erkennen: Die Geburt dramatisch, aber zu langwierig, das Ergebnis erstaunlich verschrumpelt und ein wenig gruselig. Das breite Publikum konnte sich kaum mit dem ewig schreienden, aber niemals blinzelnden Kind identifizieren, selbst die nähere Verwandtschaft fand keinen rechten Zugang zu mir.
Außerdem entwickelte sich mein Charakter nicht logisch. Bevor ich laufen konnte, sprach ich in ganzen Sätzen, mein Favorit war: »Trag mich nach Hause.« Zu Hause fand ich toll, Ausflüge wusste ich nicht wirklich zu würdigen. Gingen wir in den Zoo und wurden später gefragt, welche Tiere wir gesehen hätten, berichtete meine Schwester artig von Affen, Elefanten und Geparden und imitierte die entsprechenden Geräusche. Ich gab zu Protokoll: »Spatzen. Die machen flap-flap-flap.« Euphemistisch konnte man behaupten, dass ich konzentriert, detailversessen und kleintierlieb war. Meine Mutter machte sich das zunutze, indem sie mich beim Wäscheaufhängen an der Mülltonne parkte, wo ich meine Zeit mit den dort ansässigen Ohrenkneifern verbrachte. Über Monate liebte ich es offenbar, einfach nur still dazuliegen und die Insekten über mich krabbeln zu lassen. Aber eines Tages schrie ein Nachbarskind: »Igitt, das sieht aus, als wärst du tot!« Da schrie und heulte ich bitterlich, da ich nicht »Igitt« sein wollte.
Vom Tod hatte ich noch kein richtiges Konzept, aber da unser Hund mittlerweile recht klapprig wurde, sahen meine Eltern dieses Ereignis als willkommenen Anlass, um uns behutsam an das Thema heranzuführen. »Also, die Oma ist ja auch schon alt …« Eine klassische, aber eben auch fehleranfällige Eröffnung. »Wie alt ist Oma denn?«, fragte meine Schwester. »Oh, äh, über siebzig«, schätzte meine Mutter. »Und wie alt ist der Hund?« »Elfeinhalb«, wusste mein Vater aus dem Kopf. Meine Schwester und ich atmeten erleichtert auf. Unser Hund hatte also noch gute sechzig Jahre vor sich, er würde leben, bis wir selbst Eltern wären. Schon fingen wir an, darüber zu streiten, bei wem von uns er dann wohnen würde: in meinem Baumhaus oder auf der Pferderanch meiner Schwester. Ob meine Eltern sich an das Stichwort »Pferd« klammerten oder ob sie einfach wie immer den Fernseher anschalteten, wenn es unübersichtlich wurde, bleibt für ewig ungeklärt. Auf jeden Fall lief dort gerade Western von gestern. Das ideale Format, wenn man seiner Brut veranschaulichen will, wie die Welt funktioniert: Der Held hat immer einen schlauen Spruch auf den Lippen, die Farmerstochter ist auch in Schwarz-Weiß wunderschön, und wer beim Kartenspielen schummelt, wird direkt erschossen. Leider wollten unsere Eltern trotzdem an dem Thema »Tod von Tieren« festhalten und starteten einen zweiten Versuch: »Guckt mal, die Pferde, die rennen ja sehr schnell. Deswegen sterben die auch schneller und …« Meine Schwester fing wie auf Knopfdruck an zu heulen, und ich sagte: »So schnell rennen die in echt gar nicht. Das ist nur Film. Die spulen das einfach schneller ab.« Aus irgendeinem Grund wichen meine Eltern in diesem Moment von ihrem pädagogischen Tagesziel ab. Das hätte ich wahrscheinlich auch getan, wenn ich festgestellt hätte, dass meine sechsjährige Tochter nicht verstehen konnte, dass man ruhig ab und an Gemüse essen konnte, aber das komplexe System »Fernsehen« offenbar in all seinen Einzelheiten durchschaut hatte. Fasziniert folgten sie meinen Ausführungen: »Der Cowboy von eben ist auch nicht wirklich kaputt. Der bleibt da nur liegen, weil er ein guter Schauspieler ist. Er wäre ein schlechter Schauspieler, wenn er nicht still liegen würde. Wenn die das fertig gefilmt haben, steht der auf und geht nach Hause. Nee, vorher zieht der sich um. Der ist ja nur im Film Cowboy.«
Meine Schwester heulte immer noch oder schon wieder, weil auf dem Bildschirm gerade ein Pferd hingefallen war. »Das ist ein Schauspieler-Pferd«, versuchte ich erneut zu erklären, »das steht gleich auf und geht dann auch nach Hause.« Meine Schwester beruhigte sich einigermaßen, meine Eltern strahlten. Oft waren sie dafür kritisiert worden, dass bei uns zu Hause angeblich zu oft die Flimmerkiste angeschaltet war. Unsere Nachbarin zur Linken behauptete sogar, dass ihre Töchter überhaupt nie fernsehen würden, weil sie es auch gar nicht wollten. Aber die durften ja auch keinen Zucker essen, weil sie den angeblich nicht mochten. Beim letzten Geburtstag meiner Schwester hatte man die Ältere der beiden aber nach stundenlanger Suche in einem Busch versteckt gefunden, wo sie munter die Reste des ebenfalls verschollenen Kuchens verdrückte. Genauer gesagt war es meine Mutter gewesen, die einfach der Krümelspur gefolgt war und das schokoverschmierte Kind triumphierend lächelnd zu ihren Eltern zurückgebracht hatte. Seitdem mischte sich kein Außenstehender mehr in unsere Erziehung ein. Und unsere Eltern hatten die Zügel noch lockerer gelassen, sprich sich von »Zähneputzen-Sesamstraße-Abmarsch-ins-Bett« zu »Nur-am-Wochenende-vormittags-und-vor-der-Tagesschau-ist-wirklich-Schluss« weiterentwickelt. An diesem Nachmittag kriegten sie die fällige Bestätigung: Sie hatten instinktiv alles richtig gemacht, zumindest bis jetzt, und in Bezug auf mich. Bei meiner Schwester gab es selbstverständlich noch Nachholbedarf: »Wie wird ein Pferd ein Schauspielpferd?«, fragte sie. Bevor sich jemand anders auf diesem Spezialgebiet verlaufen konnte, hatte ich natürlich schon eine Antwort parat: »Wahrscheinlich hat es das im Theater gelernt. Da lernen Hunde Klavier spielen und Bären, wie man Hüte trägt. Und manchmal kommt Elton John und singt mit Krokodilen.« Die Begeisterung meiner Eltern wich zunächst einer gewissen Ratlosigkeit, aber als Fan der ersten Stunde konnte mein Vater schließlich meinen Gedankensprüngen folgen: »Katinka, redest du über die Muppetshow?« Selbst als Erstklässlerin wusste ich schon, was eine rhetorische Frage war: »Wovon denn sonst? Da will ich auch hin, wenn ich groß bin.«
Da bemerkte ich zum ersten Mal diesen besonderen Ausdruck im Gesicht meiner Mutter. Sie präsentiert ihn nur bei besonderen Gelegenheiten. In späteren Jahren etwa, als sie mein erstes WG-Zimmer betrat, meinen zweiten Freund kennenlernte und als ich zum dritten Mal wieder in mein Elternhaus zog. Er besteht zu je 30 Prozent aus Zweifeln an mir, ihrer selbst und der gesamten Menschheit. Der Rest ist eine dumpfe Ahnung, dass ich ihr einen extrem geschmacklosen Witz aufgetischt habe. Und immer wenn sie dieses Gesicht zieht, entsteht eine neue Falte auf ihrer Stirn, die auf ewig dort zurückbleibt. Und da sie in diesen Momenten zu sehr damit beschäftigt ist, sich daran zu erinnern, dass sie Nichtraucherin ist, überließ sie es auch an diesem Tag meinem Vater, das Verhör zu beginnen: »Du weißt schon, dass die Muppets keine echten Tiere sind, oder?«
Ich nickte eifrig: »Klar, sie sind Muppets. Im echten Leben verlieben sich Schweine ja gar nicht in Frösche.«
»Richtig«, griff mein Vater den Faden dankbar auf, und ich spann ihn sogleich weiter: »Aber das ist ja sowieso nur gespielt. Wegen der Show. Die wissen ja, wenn die Kameras laufen. Und wenn der Vorhang fällt, gehen Kermit und Miss Piggy nach Hause. Jeder in seins.«
Ich glaube, mein Vater mochte den Gedanken irgendwie, und meine Mutter versuchte erneut, die Dinge zu ordnen: »Also, das Schwein geht in den Stall und der Frosch in den Tümpel?«
Erstaunlicherweise klinkte sich meine Schwester an dieser Stelle wieder ins Gespräch ein: »Nee, die sind doch keine echten Tiere. Die leben in schicken Wohnungen, in New York.«
»Genau«, bestätigte ich.
Wahrscheinlich ist jede glückliche Familie auf ihre eigene Weise bekloppt. Denn ich glaube nicht, dass je andere Eltern bei dem Versuch, die Vergänglichkeit alles Irdischen zu erläutern, eine halbe Stunde später die Frage stellten: »Glaubt ihr tatsächlich, dass irgendein Schwein so viel Geld beim Theater verdient, dass es sich die Mieten in New York leisten kann?«
So lernten meine Schwester und ich früh: Wenn die Erwachsenen durchdrehten, mussten wir uns eben wie halbwegs normale Kinder verhalten: »Keine Ahnung, das kam in der Schule noch nicht dran«, maulte ich, meine Schwester entspannte die Lage durch den Einwurf: »Können wir jetzt ein Eis haben?«
Wir konnten nicht, aber es war einen Versuch wert gewesen. Dafür konnten unsere Eltern uns nicht die ganze Wahrheit erzählen, obwohl sie es bestimmt versucht haben. Aber sie brachten es einfach nicht übers Herz, uns grauenvolle Dinge über Menschen zu erzählen, die mit ihren Händen leblose Puppenhüllen bewegten, die danach in irgendwelchen Lagerhallen aufbewahrt wurden. Keiner von uns erwähnte je wieder die Theorie, dass Schauspieler in den Muppets stecken könnten. Die Muppets waren Schauspieler. Sehr gute sogar. Sie waren nicht reich, aber sie schmissen den Laden. Menschen waren als Gäste zugelassen, und deren Auftritte bewerteten wir weiterhin kritisch: »Ist der Mann böse?«, wollte ich einmal von meiner Mutter wissen, und sie sagte: »Nein, das ist Johnny Cash. Der ist nicht böse, der guckt nur immer so.«
»Ich finde, der könnte ruhig mal lächeln. Fozzy hat schon seine besten Witze erzählt.«
»Ja, da hast du recht. So ein armer Bär hat ja auch Gefühle.«
»Wenn ich mal zu den Muppets eingeladen werde, bin ich zu allen nett. Auch zu denen, vor denen ich Angst habe.«
»Guter Plan, Katinka.«
Bei uns zu Hause war die Realität immer relativ. Vielleicht weil wir alle ein wenig fernsehsüchtig waren, vielleicht weil wir wussten: Die meisten Träume platzen schon von alleine, wenn es an der Zeit ist. So hielt unser Hund noch stolze sechs Jahre durch, bevor er zu seinem letzten Gassi-Gang aufbrach. Zwar trauerten wir um ihn, waren aber inzwischen durch E.T. darauf vorbereitet worden, dass man sich irgendwann von jedem geliebten Wesen verabschieden musste. Erst recht wenn es nur noch vor sich hin röchelte.
Andere Träume werden wahr, wenn man am wenigsten damit rechnet. So erfolgte einer meiner ersten Auftritte direkt vor ganz großem Publikum, und ich war so aufgeregt, dass ich im Foyer des Theaters schnappatmete. Meine Mutter versuchte, mich mit den üblichen Sprüchen zu beruhigen: »Du kriegst das hin. Das klappt schon. Jetzt gilt es. Sei kein Frosch, sondern …«
»Ein Schwein?«, schlug ich vor.
Meine Mutter machte einen Gegenvorschlag: »Eine Rampensau! Also, raus mit dir und: Applaus, Applaus, Applaus!«
Sie klatschte in die Hände wie eine übergeschnappte Puppe, die in einem Menschenkostüm steckte. Das ist nicht so ihre Art, sondern eher meine. Und während ich noch dachte, sie würde einen ziemlich schlechten Scherz machen, erkannte ich: Meine Mutter veranstaltete dieses Tänzchen nur, um meine Nervosität auf sich zu nehmen.
Erstaunlicherweise funktionierte das. Dafür entdeckte ich am Ende des Abends eine ihrer Sorgenfalten auf meiner Stirn. Offenbar ist meine Familie noch merkwürdiger als gedacht. Selbst die Sache mit der Genetik ist das reine Chaos bei uns. Gut, dass die Mieten in New York so unerschwinglich sind. Sonst wären wir zusammen verrückt genug, um dort ein Theater zu eröffnen.
Spiel’s nicht noch einmal, Sam!
Es ist vollkommen lächerlich, Menschen danach beurteilen zu wollen, welche Bücher sie im Regal stehen haben. Denn auch die besten Werke könnten nur dazu dienen, Stockflecken auf der Tapete zu verstecken. Oder den Schund, der in zweiter Reihe steht. Und so tief will und darf man ja gar nicht graben, wenn man erstmalig bei einem neuen Bekannten zu Besuch ist. Die Spielregeln unserer Gesellschaft sind eben merkwürdig: Es ist vollkommen akzeptabel, einen Fremden nach einer durchzechten Nacht noch auf einen Kaffee nach oben zu bitten, und niemand erwartet, dass er das versprochene Heißgetränk tatsächlich serviert bekommt, zumindest nicht zeitnah. Stattdessen besteht ein stilles Einverständnis darüber, dass man sich ohne Umschweife zu einem weniger stillen Zweiverständnis in den Laken suhlt. Durchwühlt man hingegen direkt nach Eintritt in die Wohnung das Bücherregal der neuen Bekanntschaft, gilt man als auffällig. Da kann man noch so süßlich säuseln: »Ich wollte halt deine Seele entdecken, bevor ich mich über deinen Körper hermache.«
Nicht nur deswegen gibt es Filme. Wenn man herausfindet, welcher der Lieblingsfilm einer Person ist, weiß man, ob es sich überhaupt lohnt, mit dieser Person zu irgendeiner Tageszeit tatsächlich mal einen Kaffee zu trinken. Natürlich sollte man dabei bedenken, dass direkte Fragen oft ehrliche Antworten provozieren. Wenn eine Frau also einem Mann die Pistole auf die Brust setzt, indem sie fragt: »Bester Film aller Zeiten, deiner Meinung nach?«, dann darf sie sich nicht über das Gegenfeuer wundern: »Rambo, die ersten drei Teile, der vierte war mir zu verkopft.« Daher empfehle ich, gerade beim ersten Kennenlernen, unauffällig ein Filmzitat in die Unterhaltung zu streuen und die Reaktion darauf genau zu beobachten. Hier gilt: nicht zu abgeschmackt, selbst wenn der eigene Lieblingsfilm Casablanca sein sollte. Viele Männer fühlen sich verunsichert, wenn man ihnen »Ich schau dir in die Augen, Kleines« zuraunt. Da hilft es auch nicht, wenn man sich als Kennerin des Originaldrehbuchs hervortun will und den Gesprächspartner wissen lässt: »Here’s looking at you, kid.« Viel wirkungsvoller ist es, Zeilen aus dem Drehbuch spontan in die äußeren Geschehnisse einzuarbeiten. Lässt der Barkeeper zum Beispiel verlauten: »So, ich mache den Laden jetzt dicht, alle raus!«, und der mögliche Kandidat beantwortet diese Nachricht mit einem melancholischem Seufzen, so tröstet man idealerweise mit: »Uns bleibt immer noch Paris.« Dann wird es spannend. Wenn das Objekt der Begierde daraufhin irritiert wirkt, sich die Augen reibt und fragt: »Hä? Wann waren wir zwei denn in Paris? Du verwechselst mich, Mädchen. Oder ich dich«, dann sollte man besser nicht mit diesem Typen nach Hause fahren. Denn er lebt entweder noch bei seiner Mutter oder zusammen mit seinen Betreuern. Wenn der Mann hingegen lächelt und »Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft« murmelt, kann man davon ausgehen, dass er zu seinem Wort steht. Allerdings wird sich auch die weitere Abendgestaltung eher unaufgeregt entwickeln. Immerhin hat man auf diese Weise jemanden gefunden, der immer Kaffee dahat, egal wann man bei ihm auftaucht. Ein Kerl, der dem Barkeeper hingegen einen Zwanziger zusteckt und von diesem fordert: »Spiel’s noch einmal Sam!«, hat Stil. Um nicht zu sagen: eine gewisse Routine, was das Abschleppen von Frauen angeht, die übersichtliche Bedürfnisse haben. Wer aber mehr vom Leben will und nicht auf elende Machos steht, sollte den eigenen Filmgeschmack infrage stellen: Casablanca ist ein Klassiker, klar. Aber der einzige Hoffnungsschimmer, der im gesamten Film erstrahlt, ist der Moment, in dem sämtliche Gäste der Bar in die Marseillaise einstimmen. Der Rest ist Wehmut und Wermut. Am Ende opfert Rick seine Liebe für die gute Sache, und obwohl Victor László ein noch besserer Mann ist, hasst man ihn. Das ist kein Material, um die zarten Knospen einer frischen Romanze sprießen zu lassen.
Natürlich sollte auch niemand so verzweifelt wirken, wie er wirklich ist. Weder Männlein noch Weiblein mögen sich dazu hinreißen lassen, mit einer Perserkatze im Arm eine schummrige Gaststätte aufzusuchen und eine wildfremde Person mit den Worten zu begrüßen: »Ich will Ihnen ein Angebot machen, das Sie nicht ablehnen können.« Und wer doch wider besseres Wissen oder mangels anderer Angebote darauf einsteigen sollte, darf sich nicht wundern, wenn er am nächsten Morgen mit einem Pferdeschädel aufwacht. Wer nur ein Abenteuer sucht, sollte dieses leichtfüßig angehen. Wenn man sich schon in einer Hafenkneipe herumtreibt und jemanden erspäht, der auch nur ein kleines bisschen wie Captain Jack Sparrow aussieht, kann man auch direkt zackig vorstellig werden: »Sie sind der schlechteste Pirat, von dem ich je gehört habe!« Und sollte der Angesprochene nicht antworten: »Aber Sie haben von mir gehört!«, dann ist er zwar äußerlich Johnny, aber innerlich ein Depp. Ob man mit dem noch das Schiff zum Schaukeln bringen will oder lieber direkt die Segel streicht, bleibt Geschmackssache.
Männern, die versuchen, auf cineastische Art das Herz einer Dame zu erobern, möchte ich Folgendes raten: Lasst es. Denn sobald ihr euren Auftritt daheim vor dem Spiegel probt, setzt da ein verhängnisvoller Reflex ein. Ihr könnt gar nicht anders, als euer gespiegeltes Ich zu fragen: »Laberst du mich an? Redest du mit mir?« Dabei ist es völlig egal, ob Taxi Driver zu euren Lieblingsfilmen zählt oder nicht. Sobald ein Mann ohne Not zur Rasur vor dem Spiegel steht, hält er sich für Robert de Niro. Das ist weder zu ändern noch besonders schlimm. In einer gereiften Beziehung kann dieses Verhalten sogar ganz niedlich auf die Partnerin wirken, aber direkt vor einer Verabredung noch den Psychopathen einzuüben ist kontraproduktiv. Generell sollte ein Mann sich sämtliche Mafiafilme aus dem Hirn sieben, bevor er unter Leute geht. Wer sich einer Frau mit den Worten »Sag Hallo zu meinem kleinen Freund« nähert, macht sich ohne Handfeuerwaffe im Anschlag lächerlich, mit strafbar. Vielleicht verdeutlicht dieses Beispiel, dass Gentlemenqualitäten wieder hoch im Kurs stehen. Lassen Sie der Dame den Vortritt bei der Eroberung auf cineastische Art und konzentrieren Sie sich auf Ihr Stichwort. Falls der Flirt in eine Ehe münden sollte, kann dieses Prinzip nicht nur nützlich, sondern überlebenswichtig sein.
Denn grundsätzlich gilt: Wenn eine Frau nach echter, tiefer Liebe sucht, gar im Getümmel nach ihrem Seelenpartner fahndet, dann wird sie nicht zuvor ihr Hirn nach ihrem Lieblingsfilm durchforsten. Nein, der Film wird sie finden. Und wenn der große Regisseur da oben das Set richtig eingerichtet hat, steht sie auch noch gar nicht stocktrunken und bedürftig am Tresen, sondern saugt noch neugierig das bunte Treiben um sich herum auf. Vielleicht klopft sie sich gerade selbst innerlich auf die Schulter, dass sie sich aus dem Internet in die echte Welt hinausgetraut hat. Und da es das richtige Leben ist, können Sie, als Mann, der Dame auch eine ganz normale Frage stellen, nämlich: »Was treibst du denn hier?« Sollte sich die Frau nun irgendwie ertappt fühlen, kann es passieren, dass sie folgende Information von sich gibt: »Ich habe eine Wassermelone getragen.«
Männer, die Frau ist weder Obsthändlerin noch verrückt. Es ist ein Test. Und Sie können ihn bestehen.
Denn jeder Mann, der diesen Satz versteht, ist ein guter: Er hat Dirty Dancing gesehen und überlebt. Es ist diese Art von körperlicher und mentaler Überwindungskraft, die Frauen zu schätzen wissen. Mit einem Kerl, der neunzig Minuten Höllenqualen im Kinosessel ausgehalten hat, mit dem will die richtige Frau noch ganz andere Sachen anstellen. Jedem Mann, der es bis an diesen Punkt geschafft hat, möchte ich nur noch eins ans Herz legen: Jetzt nicht durchdrehen, es sei denn, Sie kommen vom Ballett! Tanzen Sie jetzt nur, wenn Sie es zuvor schon einmal geübt haben. Keine Hebefiguren beim ersten Date! Und vielleicht warten Sie länger als neunzig Minuten, bevor Sie die ganze Welt wissen lassen: »Mein Baby gehört zu mir.«
Auf sie mit Betäubungspfeilen
Ich bin nicht stolz drauf, aber mittlerweile verstehe ich bei fast allen Fernsehsendungen, was sie mir eigentlich sagen wollen. Bei Reality-Dokus, in denen Laiendarsteller ihre Problemzonen (erstaunliche Tätowierungen an noch erstaunlicheren Stellen, noch ungemachte Brüste und so weiter) ins Rampenlicht rücken, lautet die Botschaft ans Publikum stets: »Lernt was Vernünftiges, sonst landet auch ihr hier. Obacht, unsere Häscher lauern überall!« Mit Wetten dass? wollte man uns zumindest in der Endphase verdeutlichen, dass jemand zwar auf den ersten Blick komplett verrückt wirken mag, aber schnell wurde klar, dass sich jeder vernünftige Mensch lieber von einer Dampframme die Achseln rasieren lässt und dabei La Paloma pfeift, als sich noch eine Minute länger mit dem Moderator zu unterhalten. Herrje, ich verstehe sogar, warum jemand seine Frau tauschen will und enttäuscht ist, wenn die alte dann doch wieder zurückkommt. Ich weiß, dass nicht alle gestrandeten Schauspieler/Dekoweibchen bei »Let’s Dance« mithampeln können und deswegen »Die fünfzig buckeligsten Feldwege NRWs« kommentieren müssen, wir sind halt immer noch in der Wirtschaftskrise. Da müssen wir zusammenrücken und auf der Galeere dauerschunkeln mit Florian Silberhochzeit und immer auf der Eins und der Dreiklatschen. Ist halt nicht mehr alles Traumschiff heute.
Aber es gibt eine Art von Sendung, die überhaupt nicht in dieses Durchhalte-Konzept passt. Im Gegenteil, hier wird der Retro-Trend so stringent abgefeiert, dass ich mich bei jeder Sichtung wieder frage: »Meinen die das ernst?« Falls nicht, dann aber die Zuschauer, denn seit mehr als zehn Jahren wird auf jedem dritten Programm des deutschen Fernsehens werktäglich mindestens eine Dokumentation über Zootiere ausgestrahlt. Und geschaut.
Die Freude daran, eingepferchte Tiere zu sehen, scheint ungebrochen, Knut hin oder Knut … dahingeschieden. Dabei bekommt man die Viecher oft gar nicht besser oder gar häufiger zu sehen, als wenn man tatsächlich in den Zoo gehen würde. Im Gegenteil. Dank raffinierter Ausleuchtung scheint das Dromedar noch dösiger zu dösen, die Wisente wirken noch steifbeiniger, die Leoparden gähnen gelangweilter, untermalt von einer Panflötenmusik, bei der selbst Lamas flüchten. Manchmal sieht man auch nur eine Kiste, vor der ein grün beschürzter Pfleger steht und dem geneigten Fernsehpublikum mitteilt: »Da muss der Rudi jetzt rein. Aber da warten wir noch, ob der von alleine geht.« Und während man noch hofft zu sehen, was Rudi denn wohl für ein Tier ist, ob er von alleine reingeht und was nach dem Warten geschehen mag, gibt es einen Schnitt. Und es ertönt: die Stimme. Der Mann, der seit Jahren für alle Zoo-Dokus herhalten muss und deshalb entweder schon sehr, sehr zungenlahm ist oder, was ich befürchte, irgendwann in grauer Vorzeit alle erdenklichen Tiere und deren mögliche Aktivitäten auf Vorrat eingesprochen hat. Und aus diesem Grund klingt der Off-Kommentar seit Jahren verhackt und zusammengeschnitten: »Und … was macht … der Kakadu? Er hüpft und ahnt … nichts Böses.« Ja, ein Riesencliffhanger, der unvoreingenommene Neuzuschauer fürchtet dräuendes Unheil, und tatsächlich: »Pflegerin Birgit … naht … mit frischen Zweigen. Ob er die … mal anknabbert, der Ka…kadu?«
Leute, das kann es doch nicht sein. Da ist es ja kein Wunder, wenn das Dschungelcamp den Grimme-Preis abräumt, wenn das die öffentlich-rechtliche Konkurrenz ist. Wo, um Gottes willen, liegt der Reiz darin, sich dieses Elend anzuschauen? Ist es Pflegerin Birgit? Igitt, nein. Sie kann ihr strubbeliges Äußeres kaum mit Charme wettmachen, außerdem wirkt sie leicht beeinflussbar, wenn man sie so reden hört: »Ja, ich gebe jetzt dem Shamou, unserem Kakadu, frische Zweige. Gucken wir mal, ob er die anknabbert.« Und ob der knabbert, der Shamou. Das findet auch Pflegerin Birgit: »Ja, die knabbert er an. Das ist ein ganz natürliches Verhalten und auch wichtig, damit der Schnabel abgewetzt wird.« Shamou macht eine Kniebeuge und kackt. Birgit wird daraufhin emotional, ihr nächster Satz erscheint fast spontan dem Drehbuch hinzugefügt: »Eieiei, Digger, was haste denn da gemacht?« Shamou hält ein Schild hoch, auf dem steht: »Erschießt mich, bitte!« Nein, leider nicht, stattdessen gibt es einen erneuten Schnitt, zurück zu Rudis Kiste. »Rudi lässt sich Zeit«, sagt der Sprecher, wobei er sich Zeit lässt.
Aber jetzt, jetzt kommt Leben in die Bude. Der Tierarzt wird geholt, ein Männlein mit schlauer Brille, flankiert von groben Burschen, die den Pflegern aus Einer flog übers Kuckucksnest nicht unähnlich sehen, was ja mal die einzig wahre Zoosendung war. Medizinmann Schlaue Brille spricht in die Kamera: »So, wir werden den Rudi jetzt betäuben. Da muss man vorsichtig sein, damit man richtig trifft.« Wütendes Gestampfe aus dem Off ertönt, ein Fauchen. Ist Rudi ein Drache? Die Spannung steigt ins Unermessliche, die Pfleger schwitzen, der Tierarzt mahnt an: »Schön wäre es, wenn der Rudi direkt auf seine Decke fällt, dann können wir ihn in die Kiste hineinziehen.« Ob Rudi schön aufs Deckchen fällt?
Wir werden es erfahren, gleich nachdem wir einen kurzen Abstecher zu den Makaken gemacht haben. Da gibt es ein Junges, wie süüüß. Aber die Mutter versteckt es in der Höhle, wie – schaaaade. Pfleger Michi tröstet: »Is halt normal, ne.« Schnitt auf Affendame Luzie. Dumpf scheint sie darüber nachzubrüten, ob sie nicht irgendwo im Käfig eine Babyklappe gesehen hat, aber dann überrascht der Pfleger Micha mit einem Gleichnis: »Das ist ja menschlich, dass man sein Kind in der Höhle versteckt.« Gerade will ich den Sender anrufen, um mal einen heißen Tipp abzugeben, anonym, dass man vielleicht mal eine Mini-Volkszählung bei Pfleger Micha daheim durchführen könnte, aber da geht es wieder zu Rudi, dem, wie sich jetzt rausstellt, temperamentvollen südamerikanischen Ameisenbären. Also, relativ temperamentvoll. Close-up auf ein Blasrohr, es macht einmal »Pffkk«, Pfeil landet in Rudis Hintern. Rudi guckt, was war, und sinkt noch im selben Moment danieder – neben sein Deckchen. »Scheißdreck, verdammter«, flucht der Doktor. Hätte man ihm gar nicht zugetraut. Er relativiert sofort: »Ja, jetzt müssen wir ihn erst auf die Decke wuchten, und so ein ausgewachsenes Tier, das wiegt gut und gern seine 240 Kilo, das ist jetzt auch ein Männchen, und die haben schon ihren ganz eigenen Geruch …«
Und als ich diese Männer so schwitzen und fluchen sehe, wie sie versuchen, einen bockigen Ameisenbärenhengst auf eine filzige Decke zu ziehen, und die harzigen, stinkigen Borsten des Tieres ihre Hände mit einem nicht abwaschbaren Film benetzen, man die Flöhe von Vierbeiner zu Zweibeiner springen sieht, da ahne ich plötzlich, was den Erfolg dieser Sendungen ausmachen könnte. Es sind nicht die doofen Tiere, sondern die doofen Menschen, die im Dreck wühlen müssen, der von einem Tier produziert wurde, welches sie weder töten noch essen dürfen, weil es selten ist und sie im Fernsehen sind. Ärzte, die minutenlang hochgestochen vor sich hin schwafeln, dann aber die Maske blitzschnell fallen lassen, wenn der Tiger plötzlich blinzelt oder der Seehund sie mal richtig abklatscht. Man darf diese Sendungen einfach nicht als Nachmittags-Berieselung sehen oder auch nur als in sich abgeschlossene Folge. Man muss an Panther, Nashorn, Giraffe & Co herangehen wie an eine mit Millionen-Budget produzierte Science-Fiction-Mystic-Zombie-HBO-Serie, die einen Emmy nach dem anderen einheimst, aufgrund des ungewohnten Settings und der offensichtlichen Gesellschaftskritik. Da denke ich ja bei jeder ersten Folge auch zunächst: