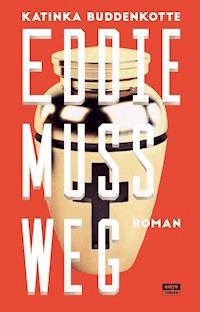Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Satyr Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Katinka Buddenkotte ist eine der besten komischen Erzählerinnen des Landes. In ihrer neuen, fünften Geschichtensammlung geht sie sämtlichen Gefühlen der Verwirrtheit nach, die das moderne Leben für uns bereithält. Wo alle Welt ständig die »neue Normalität« ausruft, stellt sie sich die Frage: Fällt die eigentlich leichter, wenn man an der alten Normalität gar nicht erst teilgenommen hat? Schließlich ist Katinka Buddenkotte seit jeher bevorzugt im Surrealen zu Hause. So erzählt sie von Fallstricken bei der Vogelbeobachtung, wie man im Supermarkt günstig an eine neue Identität gelangt und warum man am besten mit englischen Dorfpolizisten schläft – und das stets liebevoll abgedreht, mit einer großen Dosis Selbstironie und immer nah an ihren Mitmenschen. Aber noch näher am Fischotter. »Katinka Buddenkotte schreibt so lustig, dass es mich fast schon wieder demotiviert.« Torsten Sträter »Katinka Buddenkotte schafft es, mit Tiefgang und Klugheit zu schreiben und dabei durchgehend schreiend komisch zu bleiben.« Mithu Sanyal in »WDR 5 Bücher« über »Eddie muss weg« »Muskelkater vom Dauergrinsen garantiert!« Jürgen von der Lippe in »Was liest du?« über »Ich hatte sie alle« »Wie oft muss es noch gesagt werden, dass Katinka Buddenkotte einfach nur großartig ist? Ausnahmslos jedes ihrer Bücher ist ein Schlag ins Gesicht der Humorlosen, Engstirnigen und Kleinherzigen.« Jess Jochimsen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Katinka Buddenkotte
IHR WISST DOCH GAR NICHT, WAS IHR DENKT!
Katinka Buddenkotte
wurde in Münster geboren, lebt und schreibt aber in und um Köln. Beides meist komisch. Dafür liest sie überall dort vor, wo sie gebraucht wird. In regelmäßigen Abständen geschieht das bei »Rock ’n’ Read«, der Lesebühne im Kölner Klüngelpütz-Theater. Ihr Kurzgeschichtendebüt »Ich hatte sie alle« (2018 wiederveröffentlicht bei Satyr) hat sich bis heute weit über 40.000 Mal verkauft.
Wenn sie gerade keine Romane verfasst (wie zuletzt »Eddie muss weg«, Satyr) oder mit ihrem Soloprogramm durch die Lande tourt, schreibt sie Satiren, u. a. für »Die Wahrheit« der taz und das Titanic-Magazin, ganze Theaterstücke oder halbe TV-Sendungen, z. B. für die ARD.
»Katinka Buddenkotte schafft es, mit Tiefgang und Klugheit zu schreiben und dabei durchgehend schreiend komisch zu bleiben.« – Mithu Sanyal in »WDR 5 Bücher« über »Eddie muss weg«
»Muskelkater vom Dauergrinsen garantiert!« – Jürgen von der Lippe in »Was liest du?« über »Ich hatte sie alle«
»Wie oft muss es noch gesagt werden, dass Katinka Buddenkotte einfach nur großartig ist? Ausnahmslos jedes ihrer Bücher ist ein Schlag ins Gesicht der Humorlosen, Engstirnigen und Kleinherzigen.« – Jess Jochimsen
»Katinka Buddenkotte schreibt so lustig, dass es mich fast schon wieder demotiviert.« – Torsten Sträter
E-Book-Ausgabe Oktober 2023
© Satyr Verlag Volker Surmann, Berlin 2023
www.satyr-verlag.de
Cover: Jussi Jääskeläinen, www.kobaia-design.com
Korrektorat: Matthias Höhne
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über: http://dnb.d-nb.de
Abdruck von »Der Tod trägt Locken« mit freundlicher Genehmigung aus Katinka Buddenkotte: »Früher war wenigstens Sendeschluss. Film und Fernsehen für Fortgeschrittene« © 2017 Penguin Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH.
Die Marke »Satyr Verlag« ist eingetragen auf den Verlagsgründer Peter Maassen.
E-Book-ISBN: 978-3-910775-03-9
Inhalt
Ihr wisst doch gar nicht, was ihr denkt! – Ein Vorwort
Zu Hause ist da, wo man nichts versteht
Die Mauer in unseren Müttern
Schwanz ohne Hund
Rock am Ringen
Ein Wort zum Sport
Glendern
Der Tierzoo an der Autostraße
War zu viel?
Am Fenster
Hauptsache, gesund
Ich packe meinen Rucksack
Alle Vögel sind schon weggeguckt
Die perfekte Einschlafhilfe
Die Diekenkämper-Protokolle
Mein Kammerjäger und die Brauen des Grauens
Freuckma
Vorher spricht noch kurz die Gleichstellungsbeauftragte
Es ist ein Nehmen und Holen
The Otter Slide
Cantuccio
Der Tod trägt Locken
Alle Künstler glauben, sie seien Hochstapler.Nur die besten wissen, dass sie welche sind.(Wahrscheinlich von mir)
Ihr wisst doch gar nicht, was ihr denkt! – Ein Vorwort
Im Sommer hege ich des Öfteren den Verdacht, dass ich ein Schafskäse bin. Zumindest vom Aszendenten her. Entweder man legt mich für drei Monate in Salzlake ein, bevorzugt in die Ägäis, und nur drei Monate später werde ich von der Öffentlichkeit als genießbar, bisweilen sogar als köstlich empfunden, oder ich hocke im eigenen Saft in der stickigen Bude herum und strahle Entsorgungsbedarf aus. Aber Bücher müssen dort geschrieben werden, wo das Elektrogerät nicht ins Wasser fallen kann. Am Abend des Tages, als ich dieses Buch fertig geschrieben hatte, fühlte ich mich nach ausgelassenem Feiern in vertrauter Gesellschaft. Also lud ich meinen Freund zum Essen ein, mediterran, damit wir beide noch einmal den Unterschied zwischen mir und echtem Schafskäse festhalten konnten. Eselsbrücke: Ich komme auch ganz gern im Fleischmantel daher, passe aber nicht auf handelsübliche Teller.
Wir saßen im Außenbereich des Restaurants, am Nebentisch überhörte ich das Gespräch, was sich zwischen einer dreiköpfigen Speisegruppe entspann. Anlass zur Erregung gab offenbar die »Dalmati-Platte«. Genauer gesagt, die Ungenauigkeit, in der die vegetarische Wenigkeit dieses üppigen Ensembles auf der Karte beschrieben wurde. So schrillte die jüngere der beiden Damen im warnenden Quietschton: »Da ist ein Beilagensalat dabei! Aber was denn für einer, warum steht das nicht da? Iiih, hoffentlich sind da keine Tomaten drin. Wenn ja, müssen die da raus! Ich hasse Tomaten. Tomaten finde ich ekelig!« Ihre Sitznachbarin sagte nur: »Mit geht’s ja so mit Pilzen.« Beider Begleiter gestand spontan: »Mir mit Katzen.«
Es hätte eine angenehme oder vielleicht auch lehrreiche Stille entstehen können, aber natürlich beschwerte sich jemand: »Wäre es vielleicht möglich, solche Gespräche nicht zu führen, nachdem ich mein Buch zu Ende geschrieben habe?! Jetzt muss ich da noch mal ran, danke auch.«
Mein Freund gab mir unser Geheimzeichen, um mich darauf aufmerksam zu machen, dass ich das laut gesagt hatte: Er stand auf und ging sich die Beine vertreten, wobei er grob in Richtung Venezuela abzudriften schien.
Ich wollte ihn schon aufhalten, aufgrund der Jahreszeit, aber die Anti-Tomaten-Pilze-Katzen-Front nahm mich ins Kreuzfeuer: »Schreiben Sie uns etwa jetzt in Ihr Buch rein?« »Geht das überhaupt noch? Dürfen Sie das?« »Und was schreiben Sie denn da über uns?« »Darf ich mich noch mal umziehen, bevor Sie mich da reinschreiben? Nur so obenrum, ein Jäckchen drüber, man will ja nicht unbedingt mit nackigen Armen in so ein Buch!« »Was für ein Buch soll das denn überhaupt werden?«
Das waren verdammt viele Fragen und keine davon war unberechtigt. Die meisten davon hätte ich mir wahrscheinlich stellen sollen vor Manuskriptabgabe. Aber dann erinnerte ich mich daran, dass das Schreiben von Büchern etwas Magisches ist. Genauer gesagt, ist mein Verleger und Lektor ein geduldiger Hexenmeister, der noch jede Buchstabensuppe, die ich bei ihm abgeliefert habe, in einen festen Einband gezaubert hat. Dafür wollte ich ihm ja auch noch gedankt haben, und zwar …
»Im Vorwort! Sie kommen jetzt mit Ihrer Tomaten-Pilz-Katzen-Geschichte ins Vorwort rein. Das geht nämlich schwuppsdiwupps, wenn man das draufhat mit dem Schreibprogramm! Und das hat er, der Herr Surmann! Das ist ein Teufelskerl an der Computertastatur, und überhaupt. Grammatik, Rechtschreibung, Satzbau, you name it! Der könnte Ihnen, jetzt in diesem Moment, schon ein Jäckchen über die Arme korrigieren und es genauso schnell wieder löschen. Was er tun würde! Denn erstens ist es viel zu heiß dafür, zweitens möchte ich nicht, dass sich irgendwer seiner Oberarme schämt! Schon gar nicht in meinem Buch!«
»Also sind wir jetzt drin, in dem Buch? Direkt vorne? Geil! Moment, kann ich noch jemanden grüßen?«, fragte der Mann, der sich eben noch gegen Katzen im Salat aussprach. Oder war es generell im Essen? Man muss exakt arbeiten als Schriftstellerin. Auch juristisch.
»Ja, grüßen Sie, aber bitte nicht über drei Zeilen hinweg, jeden, den Sie kennen, okay?«
»Okay. Also, hallo Ingrid, hallo Willi! Ich bin’s, der Sven! Ihr werdet es nicht glauben, aber ich sitze hier gerade mit Jutta und Anja vor dem Restaurant, wo wir damals mit den Bergers deren Silberhochzeit gefeiert haben! Ja, genau, da am Kreisel, wo es links auf die B8 geht, und jetzt sind wir alle in einem Buch drin! Aber was sag ich euch, ihr lest das ja gerade. So, dann noch schönen Urlaub, ne! Und keine Sorge, euren Balkonpflanzen geht es gut, die Jutta hat die täglich gegossen. Morgens und abends. Da hat der Herr Surmann sich drum gekümmert, dass die das richtig gemacht hat. Richtig gemacht haben wird.«
»Stopp!«, brülle ich. »So geht das nicht. Das muss alles wieder raus!«
»Aber warum?«, fragt Jutta. »Die Ingrid freut sich bestimmt darüber, wenn ihre Pflanzen doch nicht eingegangen sind. Und ich muss keine neuen kaufen. Gekauft haben. Hätte gekauft haben müssen. Sagen Sie mal, ist das immer so kompliziert mit dieser Zeitverschiebung in Ihren Büchern?«
»Ach, das bügelt der Surmann schon wieder gerade, der Typ ist top«, lässt Sven uns wissen. Obwohl er recht hat, scheint er zu verdrängen, welchen Anteil ich an diesem Buch habe. Zum Beispiel habe ich aus Datenschutzgründen seinen Namen geändert, damit er mich nicht verklagt. Außerdem: »Also entweder ›bügelt‹ der Surmann das ›aus‹ oder er ›biegt es gerade‹! Schiefe Metaphern und falsche Bilder mag der nämlich gar nicht, da passt der auf wie ein Fuchs …«
»Danke, Anja, was ganz Ähnliches wollte ich auch gerade sagen. Ich meine: schreiben. Leute, ihr bringt mich noch ganz durcheinander hier. Also: Ihr seid jetzt alle im Vorwort drin, Ingrid und Willi auch. Sogar die Bergers. Was die Balkonpflanzen angeht, Jutta, würde ich an deiner Stelle der Ingrid gegenüber ehrlich sein. Sag ihr, dass es dir leidtut, aber die konnte ja auch wirklich nicht erwarten, dass du bei der Affenhitze da jeden Tag in die Dachwohnung hochklabasterst, um ihre Geranien zu tränken! Bei dreißig Grad im Schatten ist auch mal Schluss mit Nachbarschaftshilfe!«
»Nanana, Frau Autorin, Sie können aber auch nicht alles auf das Wetter schieben. Da fällt mir auf: Duzen wir uns jetzt eigentlich oder siezen wir uns?«, fragt Sven. Für jemanden, für den ich mir noch nicht einmal einen Nachnamen ausgedacht habe, verhält er sich recht forsch. Wahrscheinlich ist es an der Zeit, mich von der gesamten Bagage zu verabschieden, bevor die noch in die restlichen Texte überschwappt. Jutta hat jedoch andere Pläne: »Also, wenn wir uns jetzt wieder siezen, dann bin ich die Frau Rüschmann …!«
»Auf gar keinen Fall! So heißt meine Nachbarin von gegenüber, das ist Datenklau! Sie sind nicht Frau Rüschmann!«
»Ich denke schon«, behauptet Jutta, die gleich ganz aus dem Buch fliegt. Dann muss halt jemand anderes grundlos Tomaten verachten, da finde ich schon wen.
»Also ich denke, Sie sind viel zu bekloppt, um ein Buch zu schreiben. Jedenfalls nicht so, dass normale Leute das auch verstehen«, quengelt Anja. Noch ein Wort von ihr und ich dichte ihr einen Daunenmantel an, bis zu den Fesseln, und zwar in … Neonocker!
»Ach komm, Anja, wer ist denn bitte normal? Also die Ingrid bestimmt nicht, aber die freut sich trotzdem über die Grüße in dem Buch, denke ich. Wie lautet denn eigentlich der Titel?«
»IHR WISST DOCH GAR NICHT, WAS IHR DENKT!«, brülle ich.
Und das hilft. Endlich sind alle still. Jutta, Sven, Anja, mein Freund, die nette Kellnerin und der nicht ganz so nette Kellner schauen mich von oben herab an. Was daran liegen mag, dass ich auf dem Boden liege. Mein Gesicht fühlt sich nass an. Und schmeckt salzig: »Bin ich ein Schafskäse geworden?«
»Nein, nur ohnmächtig. Komm, ich helf dir hoch«, sagt mein Freund. Er reicht mir die Hand, als ich wieder auf den Füßen stehe, prasseln ein paar Cevapcici von mir herab. Ich werde den nicht so netten Kellner zeitnah umschreiben müssen. Er wird ein geistesgegenwärtiger, aufopfernder Restaurantteilhaber sein, wie er im Buche steht, der eine zum Glück nur lauwarme Dalmati-Platte geopfert hat, um eine dehydrierte Schriftstellerin vor einem Schädelbruch zu bewahren.
»Die bezahlen Sie aber auch«, bestimmt mein Held von eben. So schnell verliert man sein Trinkgeld, für die gesamte vergangene Woche, nachträglich. Mein Freund sagt: »Ich habe dich aufgefangen, dann erst hat er die Platte fallen lassen. Und dann haben wir dir alle zusammen den Beilagensalat ins Gesicht gekippt, weil du so dehydriert warst. Und es hat ja auch geholfen.«
»Ich hätte den eh nicht gegessen, da waren Tomaten drin«, sagt Anja.
»Und Pilze«, wirft Jutta ein.
Ich sage: »Sag jetzt nichts, Sven. Bitte. Wenn wir jetzt Schluss machen, können wir den Text retten. Und: Danke für den Titel, Leute. Der hat mir noch gefehlt.«
Wir mussten die Dalmati-Platte dann doch nicht bezahlen. Aber nur, weil ich versprochen habe, den Namen des Restaurants nicht zu nennen. Und niemals wieder dorthin zu kommen. Obwohl alle Speisen dort köstlich sind. Sie veranstalten auch Feiern aller Art. Alle Gerichte auf Wunsch ohne Schafskäse. Und garantiert katzenfrei.
Dieses Angebot gilt nur bis zum Ende des Vorworts, welches Sie hiermit erreicht haben. Gleichzeitig erlischt für Sie als Leser*in die Möglichkeit, sich mit Ihren Anmerkungen, Dialogen, Namen und Titelvorschlägen einzubringen. Es besteht allerdings die Möglichkeit und dringende Empfehlung, für den Rest der Lektüre Ihr persönliches Kopfkino eingeschaltet zu lassen. Danke. Und Grüße auch von mir.
Zu Hause ist da, wo man nichts versteht
Ich war – und bin noch immer – ein wenig neidisch auf Menschen, die bilingual aufwachsen. Immer, wenn ich an einem Spielplatz vorbeigehe, auf dem ein Dreijähriger seiner Mutter brüllend mitteilt: »I don’t wanna go nach Hause, I wanna spiel on die Holzthing alone, denn it’s meins! All meins!«, dann weiß ich, dass dieses Toddlerkleinkind schon seinen Weg machen wird. Egal ob als Haustyrann oder auf internationalem Parkett, die Welt steht ihm offen. Die zwei sich einander ja gar nicht so fremden Zungen kriegt er beizeiten auch noch auseinandergepflückt und falls nicht, wird er halt Werbetexter für Eurowings.
All diese Chancen boten sich meinen Geschwistern und mir nie. Denn wir wuchsen mindestens dreisprachig auf. Irrwitzigerweise behaupten unsere Eltern bis heute, dass es sich bei mindestens einer von diesen um Hochdeutsch gehandelt habe. Denn, so lautet ihre Argumentation, »wie hättet ihr denn sonst alle das Abi schaffen können, hä?«
Tja, man weiß es nicht, aber mittlerweile, mehr als ein Vierteljahrhundert nachdem ich zum allerletzten Mal bei meinen Eltern ausgezogen bin, habe ich diverse Theorien aufgestellt, wie wir die Hürden zur Hochschulreife genommen haben könnten. Allen ist gemein: Elegant geht anders. Aber das ist quasi unser Familienmotto.
Denn bei uns zu Hause galt vielleicht nicht das Gesetz des Dschungels, aber doch das Gesetz des »Dschungelbuchs«. Klingt harmlos, aber wenn man den Niedlichkeitsfaktor der Disney-Version herausrechnet und nach Westfalen verlegt, bleibt in der Essenz ein gemischtes Rudel teils sehr dickfelliger Säugetiere. Deren Kommunikationsversuche untereinander durch Lautstärke und Showeinlagen nicht weniger verwirrend auf ein Menschenjunges wirkten.
Wir wussten zwar, dass unsere Eltern uns liebten, ahnten aber auch früh, dass die vielfältigen Verständigungsschwierigkeiten nicht nur akustischer Natur, sondern auch erblich waren. Als wir herausfanden, dass unsere Oma die Mutter meines Vaters war, wurde uns einiges klar, vieles aber noch undurchsichtiger: Denn meine Oma war eine gebildete, pragmatische, dabei herzensgute, aber vor allem: eine große Frau. Nicht nur für ihre Generation. Sie maß einen Meter zweiundachtzig, hielt sich stets gerade und ihr schlohweißes Haar zu einem Dutt gebunden. Außerdem trug sie zu jeder Jahreszeit Kleider aus einem Stoff, der mindestens Brokat gewesen sein muss, gerne in morbiden Erdtönen. Sie hatte etwas Imposantes an sich. Wie eine vertikal aufgestellte Couch, aus deren oberem Ende die Füllung, aber auch unendliches Wissen quoll. Letzteres blieb mir leider meist verborgen, denn meine Oma sprach bevorzugt auf Masematte.
Masematte ist, so steht es im Lexikon, ein regionaler Soziolekt, der aus den Arbeitervierteln von Münster stammt und zu den Dialekten des Rotwelschen gehört. Das Schöne an Masematte ist, dass nur etwa fünftausend Wörter in dieser Sprache existieren. Aus denen sich fast ausschließlich Sätze bilden lassen, mit denen man sich über begangene oder geplante Straftaten austauschen kann. Bestenfalls eignet sich Masematte noch dazu, dem Bodyshaming eine inklusive Note zu verleihen, weil man geschlechtsneutral gleichberechtigt beleidigen kann. Eine »Schlör« ist zum Beispiel eine unangepasste Dame mit erkennbaren Lücken im Tagesablauf, aber Kerle können ebenfalls »schlören«, also rumschlampen. Wenn ein Mann das nicht tut, also einer bezahlten Tätigkeit nachgeht, ist er automatisch »Freier«. Je nach Berufszweig mit erklärender Vorsilbe. Ein »Schockfreier« ist zum Beispiel jemand, der andere in deren Freizeit »schockt«, also unterhält, sprich: ein Kirmesangestellter. Allein wenn es um die wirtschaftlich wirklich wichtigen Positionen geht, weist Masematte wenig subtil darauf hin, dass diese maskulin besetzt sind. Ein »Schallermann« ist demnach ein Musiker, mit der Auszeichnung »Schautermann« wird ein Trinker bezeichnet. Nicht zu verwechseln mit »Schauer«, was auch wieder »Mann« bedeutet, wohingegen das Wort »Schauermann« aber keinen besonders männlichen Mann bezeichnet, sondern einen überdurchschnittlich dämlichen.
Natürlich könnte ich mir im Nachhinein einreden, dass meine Oma eben eine gegen den Gendergap gangsterrappende Grandmother Flash war, ihrer Zeit weit voraus.
Aber die Wahrheit ist, dass ich zu beschäftigt damit war, ihr zuzusehen, statt ihr zuzuhören. Wenn sie in Rage geriet, brachen die Sätze in schauerlichen Schocks aus ihr heraus. Und man gerät leicht in Rage, wenn man sich mit einem leger sitzenden Gebiss in einer Sprache ausdrücken muss, in der kaum ein Wort ohne »sch« auszukommen scheint. Mir fällt da, außer dem schon erwähnten »Freier«, spontan nur noch »Keilof« ein, was »Hund« bedeutet.
Die unter diesen Aspekten strategisch sinnvolle Familienplanung meiner Eltern bestand darin, dass nicht ihr letztes, sondern ihr erstes Kind Fell haben sollte. Meine Geschwister und ich wurden demnach nicht direkt von Wölfen großgezogen, aber über weite Strecken von einem Keilof.
Wotan, unser äußerst loyaler und vor allem: saugfähiger Spitzmix stellte sich stets schützend zwischen Oma und uns. Sie ereiferte sich dann über: »Schofle waschnurken schiek pannebusch blisch schaffutkern«, was entweder bedeuten konnte, dass sie einen bis dato unentdeckten Übersetzungsfehler in der Luther-Bibel aufgespürt hatte, oder auch, dass unsere Großtante beim Scrabbeln beschiss. Man weiß es nicht.
Ich glaube, selbst meine Eltern ahnten nur manchmal, was Phase war, vielleicht rieten sie auch, aber meist blufften sie nur. Die beiden hatten immer schon verdammt gute Pokersätze drauf, wie zum Beispiel: »Sollen wir dann später trotzdem die leeren Wasserkästen mitnehmen, Mami?« oder auch: »Du guckst den Leuten nur vorn Kopp.« In dieser Zeit entwickelte mein Vater auch seinen Signature-Spruch, mit dem er sich bis heute in jede noch so abseitige Unterhaltung zurückmeldet, nämlich: »Besser als umgekehrt.«
Unsere Besuche bei Oma jedenfalls endeten, wenn es dem Hund zu feucht wurde. Dann fing er an zu bellen. Daraufhin schrien wir. Unsere Eltern schrien lauter. Meine Oma schrie am lautesten. Wiederum auf Masematte. Ja, es waren feuchtfröhliche Nachmittage damals und um das klarzustellen: Meine Oma war toll. Sie hat mir das Schreiben beigebracht. Dank ihr kann ich die Uhr lesen, muss es aber nicht. Denn man weiß ja: Es ist Zeit, nach Hause zu gehen, wenn der Hund tropft.
Und zu Hause ist da, wo ein singender Bär es mit Gemütlichkeit versucht und seine Frau durch die Wohnung pantert, weil sie es nicht fassen kann, dass alle ihre Menschenjungen zur Logopädin müssen. Aufgrund von drei unterschiedlichen Artikulationsproblemen. Mein Bruder hölzelte, ich lispelte, meine Schwester bellte, nachdem der Hund von uns gegangen war. Sie war dann auch die Einzige, die als heilbar eingestuft wurde. Und aus diesem Grunde Englisch als erste Fremdsprache lernen durfte. Sie übertrieb es ein wenig.
An ihrem sechzehnten Geburtstag bestellte sie aufmüpfig einen Cocktail und ließ den Kellner nach einem Blick auf die Karte wissen: »Dann nehme ich einen Kör Royäl.«
Ich glaube, an jenem Tag hat meine ältere Schwester es endgültig aufgegeben, ein Vorbild für ihre Geschwister sein zu wollen. Verständlich, wenn diese wie die Schakale lachen, minutenlang, in aller Öffentlichkeit, geifernd und sabbernd. Seither habe ich nie wieder miterlebt, dass meine Schwester sich ein alkoholisches Getränk bestellte. Somit ist das Rätsel gelöst, wie sie das Abitur erlangte: Sie ist einfach immer nüchtern zur Schule gegangen. Ist aber erlaubt. Alles ist erlaubt, man darf sich nur nicht erwischen lassen. Das ist eine der vier Grundweisheiten, die mein Vater gerne von sich gibt. Die anderen drei lauten: »Etwas Warmes braucht der Mensch«, »Jetzt ein Eis!« und »Wäre aber auch gegangen«. Letzteres mag eine Variante von »Besser als umgekehrt« darstellen, ich würde aber dringend davon abraten, mit meinem Vater darüber zu diskutieren. Wobei man grundsätzlich jederzeit alles mit ihm diskutieren kann, man kann nur nicht gewinnen. Außer vielleicht an Gewicht.
Nachdem seine masemattierende Mutter von uns gegangen war, verarbeitete unser Vater seine Trauer in der Küche – vor allem zu deftigen Fleischgerichten. Aber auch die Klassiker der italienischen Küche kamen bei uns auf den Tisch, zumindest drei- bis viermal pro Tag. In der Küche sang mein Vater laut zum noch lauteren Radio mit. Wenn er dann das Essen servierte, geschah dies nie ohne den Warnhinweis: »Vorsicht, heiß! Und ich habe jetzt nicht so viel gemacht, wir wollten ja abnehmen …« Damit erreichte er, dass wir Kinder die Köpfe in die Näpfe dippten und schlangen, als gäbe es kein Morgen. Oder nicht eine halbe Stunde später schon wieder eine komplette Mahlzeit. Dieses gierige Schlingen geschah nicht mal aus reinem Futterneid, sondern weil wir alle Angst vorm Zahnarzt hatten. Der uns aller Wahrscheinlichkeit nach schlecht sitzende Prothesen verpassen würde und uns Monate in der Logopädie zurückwerfen würde. Daher schonten wir unsere Backenzähne, indem wir das Kauen so weit wie möglich einstellten. Der Vorteil dieser Ernährungstechnik besteht darin, dass man lernt, auch blitzschnell zu genießen. Ein zusätzlicher Anreiz bei unseren täglichen Wettessen bestand aus dem Preis: Wer als Erstes fertig war, hatte das Wort. Es war immer mein Vater.
Was ihn dazu motivierte, das Weltgeschehen, wie er es durch die Verfolgung des Radioprogramms wahrgenommen hatte, mit uns zu teilen. Leider hörte er seit dreißig Jahren zunehmend schlechter. Seine kommentierte Kurzfassung der Ereignisse Ende April 1986 lautete zum Beispiel: »Jetzt sollen wir wegen Tschernobyl keine Pilze mehr essen! Ich glaub’s ja nicht! Was soll ich denn dann zum Rehrücken machen, zu Weihnachten? Ha, das haben die wieder nicht gesagt, klar! Die stellen einen einfach vor verendete Tatsachen.«
Zu diesem Zeitpunkt war meine Mutter längst dazu übergegangen, in weniger dringenden Fällen ihre Stimme zunächst zu schonen und ihre Mimik spielen zu lassen. Meine Mutter spricht fließend Augenbrauen. Links und rechts, beidseitig, hoch und runter. Sie hat über fünfzig verschiedene Hebe- und Senkkombinationen drauf, die allesamt »ungläubige Bestürzung« ausdrücken können, bevor sie verbal nachlegt. Und etwas sagt wie: »Ich meine doch, es heißt ›vollendete Tatsachen‹, oder?«
Mein Vater war derweil längst bei der Zusammenfassung der Kulturberichterstattung angekommen und schon auf halber Strecke zurück: »Felicità … dada…da…da… Was hast du gesagt? Vollendet? Ja sicher, was sonst. Was habe ich denn gesagt?«
»Verendet!«
»Wer ist verendet, der Ackermann? Ging’s jetzt doch so schnell? Na ja, er hat ja noch den Bruder, den schlörigen Schautermann …«
»Der Ackermann doch nicht. Die Tatsachen!«
»Welche? ›Felicità‹? Von wem ist das Lied noch mal im Original?«
»Das ist das Original!«
»Sicher? Ich dachte wohl, die hätten das halt verändert … Felicità – tatataaa – tatatata …!«
»Du hast ›verendete Tatsachen‹ gesagt, nicht ›veränderte‹!«
»Wäre aber auch gegangen. Finde ich sogar schöner als das Original … Felicità!«
Dann schlugen wir alle die Köpfe auf den Tisch. Veränderte Tatsachen, nicht zu verwechseln mit den erst viel später erfundenen Fake News. Und das war nur die Spitze des Eisbärs. Ich habe dieses Beispiel gerade in einer sehr zurückgenommenen Lautstärke aufgeschrieben. Denn natürlich lief das Radio weiter, bis Fernsehen anfing. In anderen Familien mag eine beklemmende Stille am Mittagstisch bedeuten, dass während der gesamten Mahlzeit nur jenes leise Kratzen zu hören ist, welches ein stumpfes Messerchen verursacht, wenn es Kartoffelbreireste schüchtern vom Grund des Tellers schabt, während im Hintergrund der Kühlschrank dräuend schnurrt. Wenn bei uns am Mittagstisch mal jemand länger als zwei Minuten am Stück nichts von sich gegeben hat, schrien die anderen vier bange: »Ist jemand gestorben?« Dann musste man schnell und laut zugeben: »Nein, ich habe nur gerade gekaut. Entschuldigung!« Die Restfamilie verzieh so ein Verhalten dumpf grunzend.
Tischmanieren waren wichtig, fielen vom künstlerischen Wert in dieselbe Kategorie wie Weihnachtsgedichte. Es reichte, wenn man sie auswendig gelernt hatte, dennoch bestand keinerlei Not, sie außerhalb der Saison im privaten Rahmen vorzutragen. Im rauen Alltag ging es um Geschwindigkeit, nicht nur bei der Nahrungsaufnahme, sondern auch in den Nebenfächern.
Rückblickend glaube ich, dass mein jüngerer Bruder die Lage wesentlich besser eingeschätzt hat als wir. Von seinem Hochstühlchen aus hat er relativ still beobachtet und dabei seine Chancen ausgelotet. Dann hat er die eingesparte Energie gebündelt, um an uns vorbeizupreschen. Von einem Moment auf den anderen wurde aus dem behäbigen Wonneproppen, der sich, wenn überhaupt, robbend durch die Wohnung bewegte, ein aufrecht gehender, meist sogar rennender junger Mann, der laufend redet, und zwar beides wesentlich schneller als ich. Inhalte sind ihm dabei willkommen, Themengebiete interessieren ihn zwar, begrenzt sind diese jedoch nie. Mein Bruder kann in zwanzig Minuten den kompletten Inhalt von Netflix nacherzählen und nebenbei drei Dutzend Kör Royäl mixen. Sein Wechsel vom Hochstuhl auf die Hochschule geschah so rasant, dass ich vermuten muss: Mein Bruder hat mich auch beim Abitur einfach überholt. Dafür spricht, dass ich ihn während meiner Oberstufenzeit nicht in der Schule gesehen habe. Aber vielleicht waren meine Augen einfach zu träge.
Ich habe in der Schule auch viel verpennt. Diese Ruhe, gerade bei Klausuren. – Herrlich! Und da ich im Schlaf gerne mal spreche, habe ich in den sogenannten »Laberfächern« wohl trotzdem punkten können. Den Mathematik-Grundkurs bestand ich durch eher praxisbetonte Mitarbeit, mein Verständnis für Zahlen blieb so begrenzt, wie ich es beim Lesen der Uhr gelernt hatte.
Irgendwann jedoch erhärtete sich der Verdacht, dass nicht jeder, der ab und zu die Tafel putzte, dafür mit fünf Punkten in Stochastik belohnt wurde. Viel wahrscheinlicher erschien es mir, dass das gesamte Kollegium kein gesteigertes Interesse daran hatte, mich noch ein weiteres Jahr durch ihr Institut zu schleusen. Am Tag meiner mündlichen Abiturprüfung in Biologie erreichte dieser Verdacht Diamantstatus. Die Jury bestand aus all meinen vier ehemaligen Naturwissenschaftslehrer*innen, die mir allesamt etwas zu ermutigend zuzwinkerten, als ich den Raum betrat. Ich zwinkerte entmutigend zurück. So einfach wollte ich es ihnen nicht machen. Nur weil sie mir mehrfach die Lücken gezeigt hatten, auf die es sich zu lernen gelohnt hätte, war ich weder bestechlich noch bestechend. Zu unserem Abschied wollte ich sie ein wenig zappeln lassen:
Es fing an wie zuvor besprochen: »Katinka, was können Sie uns denn über Sichelzellen-Anämie erzählen?«