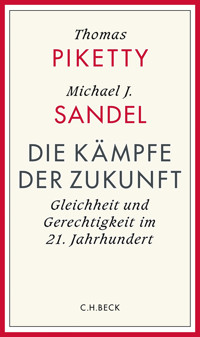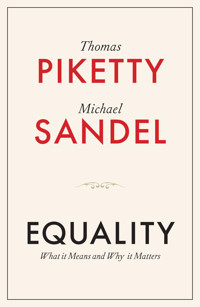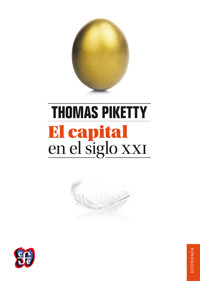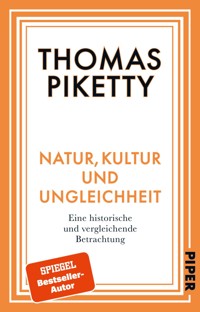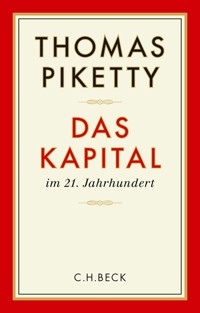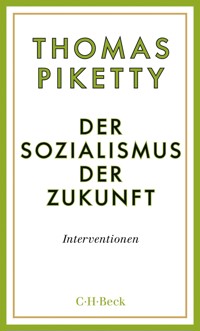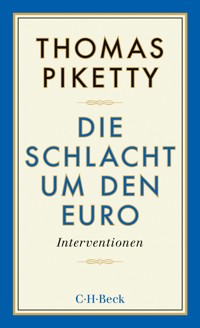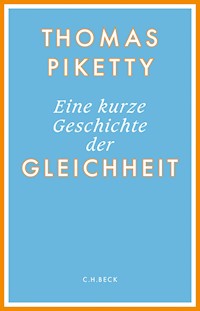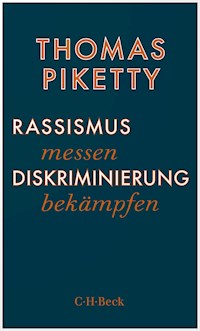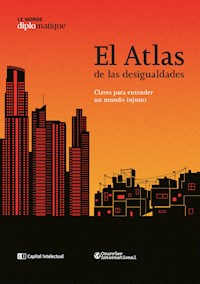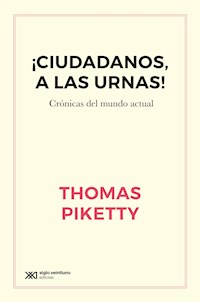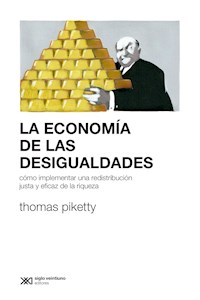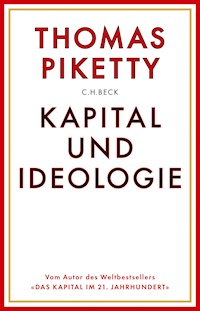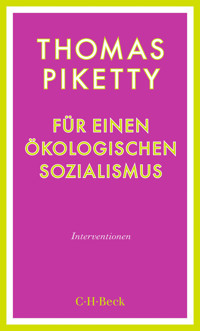
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was tun, wenn die Welt brennt – und die Reichsten noch Öl ins Feuer gießen? Die Herausforderungen unserer Zeit erfordern globale Lösungen, während paradoxerweise der Nationalismus ein Comeback feiert. Für Thomas Piketty gibt die weltpolitische Lage nicht nur Anlass zur Sorge, sondern auch zu einer erneuten Intervention im Namen echter Veränderung. In dieser Auswahl seiner Kolumnen aus den Jahren 2020 bis 2025 widmet er sich der ökonomischen Ungleichheit in Zeiten der ökologischen Krise – und der Frage, wie wir beides endlich überwinden können.
Soziale Ungleichheit und der Klimawandel gehören ohne Frage zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Thomas Piketty zeigt, dass sich diese globalen Problemlagen gegenseitig bedingen – und nur zusammen gelöst werden können. Die grundlegenden Verflechtungen von Ökonomie und Umwelt betrachtet er im Prisma brisanter Themen und Debatten, von den geopolitischen Verschiebungen und der Renaissance des wirtschaftlichen Protektionismus über den Krieg Russlands gegen die Ukraine bis hin zur Zukunft Israels und Palästinas. Inmitten der aktuellen welt- und wirtschaftspolitischen Tendenzen zur Abschottung hält Piketty ein visionäres Plädoyer: für ein föderales und starkes Europa, eine international vernetzte Linke und eine Globalisierung, die verträglich für Mensch und Umwelt ist. Für einen ökologischen, demokratischen und partizipativen Sozialismus. Für notwendige Utopien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
THOMAS PIKETTY
FÜR EINENÖKOLOGISCHEN SOZIALISMUS
Interventionen
C.H.BECK
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
1. Für einen ökologischen Sozialismus
Oktober 2024
Kein bewohnbarer Planet ohne egalitäre Entmarktung
Die Entmarktung hat schon begonnen: Der Weg zu mehr Gleichheit im 20. Jahrhundert
Die egalitäre Entmarktung im 21. Jahrhundert fortsetzen
Die Vergesellschaftung von Reichtümern wieder ins Spiel bringen
Rückbesinnung auf die revolutionäre Sozialdemokratie des 20. Jahrhunderts
Den revolutionären Elan der Sozialdemokratie zum Leben erwecken
Warum eine Umweltpolitik ohne Sozialismus scheitern muss
Von der Sozialdemokratie zum demokratischen und ökologischen Sozialismus
Von Syriza über Sanders zur Neuen Volksfront: Hoffnungen und neue linke Konfigurationen
Und wenn die politische Erneuerung aus Indien oder Brasilien käme?
Sozialismus, Liberalismus, Nationalismus und die drei Grundpfeiler der Demokratie
2. Kann sich die Linke über Europa einig werden?
15. September 2020
3. Globale Ungleichheiten: Wo stehen wir?
17. November 2020
4. Wie lassen sich Religionen finanzieren?
15. Dezember 2020
5. Diskriminierung bekämpfen, Rassismus messen
16. März 2021
6. Rechte für arme Länder
13. April 2021
7. Vom Grundeinkommen zur Erbschaft für alle
18. Mai 2021
8. Die G7 legalisiert Betrug
15. Juni 2021
9. Der chinesischen Herausforderung durch demokratischen Sozialismus begegnen
13. Juli 2021
10. Über den 11. September hinwegkommen
14. September 2021
11. «Pandora Papers»: Wäre es nicht Zeit, zu handeln?
12. Oktober 2021
12. Die neuen globalen Ungleichheiten
14. Dezember 2021
13. Sanktioniert die Oligarchen, nicht das Volk!
15. Februar 2022
14. Dem Krieg entgegentreten, Sanktionen überdenken
15. März 2022
15. Die Rückkehr der Volksfront
10. Mai 2022
16. Für ein autonomes Europa und eine andere Globalisierung
12. Juli 2022
17. Eine Königin ohne Lords?
13. September 2022
18. Den Föderalismus überdenken
11. Oktober 2022
19. Wohlstand umverteilen, um den Planeten zu retten
8. November 2022
20. Den Protektionismus neu denken
13. Dezember 2022
21. Präsident der Reichen, Staffel 2
10. Januar 2023
22. Kann man den Verfassungsrichtern trauen?
11. April 2023
23. Was, wenn die Ökonomen sich ändern würden?
9. Mai 2023
24. Für eine Parlamentarische Europäische Union
13. Juni 2023
25. Israel-Palästina: Wege aus der Sackgasse
17. Oktober 2023
26. Die BRICS-Staaten ernst nehmen
14. November 2023
27. Schluss mit dem Armenhass: Schützt die öffentlichen Leistungen
12. Dezember 2023
28. Nach Delors: Europa neu denken
15. Januar 2024
29. Bauern: der Beruf mit der größten Ungleichheit
13. Februar 2024
30. Wie die deutsche Linke die Prinzen enteignen wollte
19. März 2024
31. Soll die Ukraine der EU beitreten?
16. April 2024
32. Für einen binationalen Staat Israel-Palästina
14. Mai 2024
33. Für ein geopolitisches Europa – weder naiv noch militaristisch
11. Juni 2024
34. Draghi hat recht: Europa muss investieren
17. September 2024
35. Wie besteuert man Milliardäre?
15. Oktober 2024
36. Um Europa zu retten, müssen Frankreich und Deutschland zusammenrücken
12. November 2024
37. Für eine neue Links-rechts-Kluft
17. Dezember 2024
38. Demokratie gegen Oligarchie, der Kampf des Jahrhunderts
21. Januar 2025
39. Trumps Nationalkapitalismus wird scheitern
18. Februar 2025
40. Vertrauen in Europa wiederherstellen
18. März 2025
41. Die Welt ohne die Vereinigten Staaten denken
15. April 2025
Zum Buch
Vita
Impressum
1. Für einen ökologischen Sozialismus
Oktober 2024
Das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert der Sozialdemokratie. Das 21. wird das Jahrhundert des ökologischen, demokratischen und partizipativen Sozialismus sein. Die Behauptung mag überraschen, leben wir doch in Zeiten, in denen allenthalben eine beunruhigende Mischung aus identitärer Abschottung und mutlosem Neoliberalismus die Oberhand gewinnt. Dennoch bleibe ich optimistisch, nach wie vor. Gleichheit ist, wie ich in Eine kurze Geschichte der Gleichheit[1] zu zeigen versucht habe, ein Kampf. Dieser Kampf konnte schon in der Vergangenheit und er kann auch in Zukunft gewonnen werden, immer vorausgesetzt, dass wir die nötigen institutionellen Veränderungen und die politischen Strategien, die zu ihnen führen, sorgfältig abwägen und vor allem sozioökonomische Fragen und das Nachdenken über ein alternatives Sozial- und Wirtschaftssystem nicht anderen überlassen. Es geht um höchst politische Fragen, die nach der Stellungnahme und dem Engagement jedes einzelnen Bürgers rufen. Nur wenn wir das Wissens- und Machtgefälle abbauen und an die kollektiven sozialen Mobilisierungen der Vergangenheit anschließen, werden wir auf dem Weg zu mehr Gleichheit und Würde wieder vorankommen und das nationalliberale Intermezzo beenden können.
Kein bewohnbarer Planet ohne egalitäre Entmarktung
Fangen wir mit dem Wichtigsten an. Keine der sozialen, ökologischen und planetarischen Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, wird sich ohne einen drastischen Abbau der Ungleichheiten im globalen Maßstab und eine radikale Infragestellung der herrschenden Kapital- und Marktlogik bewältigen lassen. Anders gesagt: Der demokratische und ökologische Sozialismus wird sich am Ende durchsetzen, weil die anderen Denksysteme, allen voran Liberalismus und Nationalismus, es alleine niemals schaffen werden, die Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Die Wahldemokratie braucht einen starken sozialistischen und egalitären Grundpfeiler. Dieser Grundpfeiler fehlt seit den 1980er und 1990er Jahren, und daraus erklärt sich zu einem Großteil die Unfähigkeit der heutigen Politik, die planetarischen Herausforderungen zu bewältigen.
Um die Klimakatastrophe zu verhindern, werden sich die Konsumgewohnheiten und Produktionsweisen aller sozialen Gruppen in sämtlichen Weltregionen tiefgreifend verändern müssen. Aber die Unter- und Mittelschichten im globalen Norden wie Süden werden die notwendigen Veränderungen niemals akzeptieren, solange wir nicht damit anfangen, auch den reichsten Gesellschaftsklassen sehr viel größere Anstrengungen abzuverlangen – insbesondere Milliardären und anderen Multimillionären, die andere so gern belehren, während ihre CO2-Emissionen und ihr Beitrag zur Zerstörung der Lebensgrundlagen auf diesem Planeten deutlich gravierender sind als die der übrigen Bevölkerung. Je mehr die Umweltkatastrophen überhandnehmen, desto deutlicher wird diese Tatsache zutage treten, um die Einstellungen gegenüber dem gegenwärtigen kapitalistischen System und den abgrundtiefen Ungleichheiten, die es hervorbringt, radikal zu verändern.
Denn wie man die Dinge auch dreht und wendet, an den Tatsachen ist nicht zu rütteln: Ganz gleich, welche Messmethode man zugrunde legt, die weltweit reichsten 10 % sind für einen unverhältnismäßig großen Anteil der CO2-Emissionen dieser Erde verantwortlich, der weit über dem der ärmsten 50 % oder der folgenden 40 % liegt, wie die Arbeiten des World Inequality Lab gezeigt haben. Betrachtet man die Emissionen im Verhältnis zu den Investitionen und zum Kapitaleigentum, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass es vor allem die Besitzer von Finanz- und Immobilienkapital sind, die für die Entscheidungen über Produktion und Technologien verantwortlich zeichnen, so stehen die reichsten 10 % für etwa 70 %, die ärmsten 50 % dagegen für kaum 5 % der Emissionen. Sieht man sich umgekehrt die Emissionen im Verhältnis zum Konsum der unterschiedlichen sozialen Gruppen an – eine Herangehensweise, die sich rechtfertigen lässt, aber tendenziell die Fähigkeit der Bürger und Verbraucher überschätzt, Einfluss auf die ökologische Qualität der ihnen angebotenen Güter und Dienstleistungen zu nehmen –, dann erzeugen die reichsten 10 % etwa 40 %, die ärmsten 50 % dagegen unter 20 % der Emissionen. Und nimmt man schließlich einen Standpunkt zwischen diesen beiden Perspektiven ein, um Konsum und Investitionen nach Maßgabe ihres Anteils am Nationaleinkommen und an den Emissionen zu betrachten, dann schlagen die reichsten 10 % mit fast 50 %, die ärmsten 50 % dagegen mit unter 15 % zu Buche.[2]
Ganz gleich also, welche Perspektive man zugrunde legt, Tatsache ist, dass die Emissionskonzentration extrem stark ist. Dasselbe gilt für die Gesamtheit der verursachten Umweltschäden. Die Reichsten, insbesondere im Westen, in China, in Russland, in Indien, im Nahen und Mittleren Osten etc., tragen eine unverhältnismäßig große Verantwortung für den Klimawandel. Darum müssen alle Lösungen von einer Verringerung der globalen Ungleichheit zwischen gesellschaftlichen Klassen ausgehen, nicht von simplifizierenden Gegensätzen zwischen Nationalstaaten (die im Innern keineswegs homogen sind). Die massive Reduktion der von den Reichsten verursachten CO2-Emissionen und anderen Umweltbelastungen ist eine Conditio sine qua non, wenn wir die Klimaerwärmung begrenzen und die Bewohnbarkeit des Planeten bewahren wollen. Und das nicht nur aufgrund des erheblichen Anteils der Wohlhabendsten an den Gesamtemissionen und -belastungen, sondern auch, weil es unmöglich ist, die anderen gesellschaftlichen Gruppen dafür zu gewinnen, ihre Lebens- und Produktionsweisen zu ändern, solange diese Mindestanforderung an Gerechtigkeit und Kohärenz nicht erfüllt ist.
Der Abbau von Ungleichheiten ist freilich eine zwar notwendige, aber keineswegs hinreichende Bedingung für den Erhalt der Bewohnbarkeit des Planeten. Ein drastischer Abbau von Wohlstandsunterschieden – zum Beispiel auf ein Verhältnis von höchstens 1 zu 5 bei Einkommen und 1 zu 10 bei Vermögen – wäre zweifellos auch ganz unabhängig von der Umweltfrage ein großer Fortschritt. Die von der World Inequality Database[3] zusammengetragenen Daten weisen sämtlich darauf hin, dass ein solcher Abbau möglich und kollektiv erstrebenswert ist. Aber anzunehmen, der Abbau von Ungleichheit könne als solcher eine nachhaltige Entwicklung und einen auch im Jahr 2100 noch bewohnbaren Planeten garantieren, wäre ein Irrtum. Eine Welt, in der vollendete Gleichheit herrschen würde, aber jeder von Kohlenwasserstoffen, Plastik und Beton so abhängig wäre wie heute, ist nicht sonderlich erstrebenswert. Was wir heute brauchen, ist vor allem ein Prozess der egalitären Entmarktung, das heißt eines drastischen Abbaus von Ungleichheiten, der zugleich in immer mehr Sektoren und schließlich der gesamten Wirtschaft einen allmählichen und beharrlichen Ausstieg aus der kapitalistischen Marktlogik ermöglicht. Das heißt konkret, dass ganze Sektoren, angefangen mit dem Energie-, Verkehrs- und Bausektor, von einer rein gewinnorientierten Logik abgekoppelt werden müssen. Dies kann mithilfe einer Vielzahl von Akteuren und Eigentumsregimen sowie durch eine demokratische und partizipative Regierungsform geschehen, aber es erfordert in jedem Fall die Einhaltung strikter öffentlicher Gemeinschaftsnormen (Verbot von Verbrennungsmotoren und Plastik für nahezu alle Zwecke, Bau- und Dämmvorschriften etc.) mit abschreckenden Sanktionen für alle, die sich nicht daran halten.
Die Entmarktung hat schon begonnen: Der Weg zu mehr Gleichheit im 20. Jahrhundert
Die gute Nachricht ist, dass dieser Prozess der egalitären Entmarktung im 20. Jahrhundert nicht bloß bereits begonnen hat, sondern auch ein großer Erfolg war. Der Aufbau des Sozialstaats und der Triumph der Sozialdemokratie im 20. Jahrhundert können als besonders geglückter Prozess der Entmarktung gelten. Um die auf dem Spiel stehenden institutionellen Errungenschaften zu ermessen, sei zunächst daran erinnert, dass die Gesamtheit der Pflichtabgaben (alle Abgaben einschließlich direkter und indirekter Steuern, Sozialabgaben etc.) am Vorabend des Ersten Weltkriegs in Europa bei weniger als 10 % des Nationaleinkommens lag, um seit den 1980er Jahren auf 40–50 % des Nationaleinkommens zu steigen. Im 19. Jahrhundert und noch bis 1914 hatte der Staat sich im Wesentlichen darauf beschränkt, seine traditionellen hoheitlichen Aufgaben (Ordnung und Sicherheit) zu erfüllen. Sozialausgaben, insbesondere für Bildung und Gesundheit, fehlten fast völlig. Im Laufe des 20. Jahrhunderts sollte die öffentliche Hand, zunächst zwischen den Kriegen und dann vor allem in den Nachkriegsjahrzehnten, nach und nach ein vielfältiges und immer umfassenderes Gefüge von Aufgaben im Bereich der öffentlichen Dienstleistungen und der sozialen Sicherung wahrnehmen: Schulen, Krankenhäuser, Wohnungsbau, Verkehr, Renten etc. (siehe Grafik 1).[4]
2020 machten die Steuereinnahmen in Westeuropa durchschnittlich 47 % des durchschnittlichen Nationaleinkommens aus und wurden wie folgt ausgegeben: 10 % des Nationaleinkommens für hoheitliche Ausgaben (Armee, Polizei, Justiz, allgemeine Verwaltung, Basisinfrastruktur: Straßen etc.); 6 % für Bildung; 11 % für Renten; 9 % für Gesundheit; 5 % für Sozialleistungen (außer Renten); 6 % für sonstige Sozialausgaben (Wohnen usw.). Vor 1914 wurde für die hoheitlichen Ausgaben nahezu das gesamte Steueraufkommen aufgewendet. Anmerkung: Dargestellt sind die Durchschnittswerte für Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Schweden. Quellen und Datenreihen: siehe piketty.pse.ens.fr/egalite
Diese beispiellose Umwälzung, die man als «sozialdemokratische Revolution» bezeichnen kann, ist ein historisches Ereignis von erheblicher Tragweite. Hätte man Liberalen und Konservativen 1910 angekündigt, dass im Laufe des anbrechenden Jahrhunderts die Hälfte des Nationaleinkommens vergesellschaftet würde, sie hätten zweifellos die Rote Gefahr, die kollektivistische Hydra, den wirtschaftlichen Bankrott heraufziehen sehen. Aber es ist nicht nur zu diesem Zusammenbruch nicht gekommen, sondern das 20. Jahrhundert war im Gegenteil von einer beispiellosen wirtschaftlichen Prosperität gekennzeichnet, die von einer nie dagewesenen Arbeitsproduktivität (der pro Arbeitsstunde erwirtschaftete Reichtum) angetrieben wurde, verbunden mit einem starken Abbau von Einkommens- und – in einem geringeren Maße – Vermögensungleichheiten.[5] Aus einem einfachen Grund: Der Schlüssel zur wirtschaftlichen Prosperität ist vor allem der möglichst umfassende und inklusive Zugang zu Humankapital (insbesondere zu Bildung und Gesundheit) und kollektiven Infrastrukturen, nicht die Hyperkonzentration von Eigentum und Klassenprivilegien, wie sie für die europäischen Gesellschaften vor 1914 charakteristisch waren.
Dieser Aufbau des Sozialstaats im 20. Jahrhundert ist aber, und darauf kommt es mir hier entscheidend an, untrennbar vom Prozess der Entmarktung großer Teile der Wirtschaft. Das heißt konkret, dass sich ganze Sektoren wie Bildung, Gesundheit, Forschung, Sozialversicherungen – in geringerem Ausmaß auch Energie und Wohnungsbau – abseits der klassischen kapitalistischen Gewinnlogik entwickelt haben, insbesondere in West- und Nordeuropa. Güter und Dienstleistungen von zentraler Bedeutung wurden von einer Vielzahl nichtkapitalistischer Akteure produziert (öffentliche Verwaltungen, Gebietskörperschaften, Verbände, Stadtverwaltungen, Sozialversicherungen, Schulen und Universitäten, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, Berufsverbände etc.), mit exzellenten Ergebnissen, was sich in der kollektiven Effizienz ebenso niederschlug wie in den Gesundheitsindikatoren. In den Vereinigten Staaten, die keine so starke Expansion des Sozialstaats wie Europa erlebt haben (auch aufgrund der rassifizierten Konflikte) und deren Gesundheitssystem sehr stark auf dem gewinnorientierten Privatsektor beruht, machen die Gesamtkosten des Systems einen deutlich höheren Anteil des Nationaleinkommens aus als in Europa (fast 20 % des Nationaleinkommens, gegenüber 10–15 % in Europa), obwohl die Resultate den verfügbaren Indikatoren nach sehr viel schlechter ausfallen und überdies mit abgrundtiefen Ungleichheiten einhergehen.
Der Prozess der Entmarktung (oder «Dekommodifizierung», um den Begriff von Karl Polanyi aufzugreifen) im 20. Jahrhundert blieb jedoch höchst unvollendet, auch in Europa.[6] Gewiss wurde ungefähr ein Viertel der Wirtschaft vom Markt abgekoppelt, aber die drei anderen Viertel gehorchten weiterhin einer marktwirtschaftlichen, kapitalistischen und extraktivistischen Logik.[7] In allen westlichen Ländern – wie übrigens auch in der Sowjetunion, in Japan oder China – beruhte die wirtschaftliche Prosperität im 20. Jahrhundert und bis ins angehende 21. Jahrhundert auf einer entfesselten globalen Ausbeutung natürlicher Ressourcen, insbesondere aber auf der Strategie einer hemmungslosen Verbrennung der seit Jahrmillionen auf der Erde akkumulierten Kohlenwasserstoffe, mit den bekannten Folgen für Klimaerwärmung und Umweltzerstörung. Fast überall hat die Logik der kurzfristigen Gewinnorientierung die Oberhand über die Berücksichtigung langfristiger kollektiver Interessen gewonnen. Das Klimabewusstsein hat sich in Europa über die letzten Jahrzehnte hinweg etwas stärker entwickelt als in anderen Weltregionen, aber gemessen an der historischen Verantwortung bleibt die Senkung der Emissionen gleichwohl begrenzt (vor allem unter Berücksichtigung importierter Emissionen), und Initiativen zur Umverteilung von Wohlstand im globalen Maßstab stecken noch in den Kinderschuhen. Historisch betrachtet haben die europäischen Sozialdemokraten gelegentlich den Akzent auf Arbeitszeitverkürzung gelegt (auf Kosten der Mehrproduktion, was zu begrüßen ist), aber den Konsumismus und Extraktivismus nicht entschlossen genug in Frage gestellt.
Die egalitäre Entmarktung im 21. Jahrhundert fortsetzen
Die sozialdemokratische Revolution im 20. Jahrhundert hat, um das zusammenzufassen, den Beweis angetreten, dass sich Kapitalismus und Markt- oder Profitlogiken in einer ganzen Reihe von Tätigkeitsfeldern überwinden lassen. Unglücklicherweise ist sie auf halbem Wege stehen geblieben. Es ist diese grundlegende historische Erfahrung mit ihren Erfolgen wie ihren Grenzen, über die wir heute nachdenken und auf die wir uns stützen müssen, um im 21. Jahrhundert den Weg zu einer ehrgeizigeren und umfassenderen Entmarktung einzuschlagen.
Drei entscheidende Lehren sind es, die sich aus der historischen Analyse ergeben. Die erste betrifft die Sektoren, in denen es die Entmarktung im 21. Jahrhundert vor allem voranzutreiben gilt, und die Formen der demokratischen Steuerung, die dort entwickelt werden müssen. Die zweite betrifft die Schlüsselrolle der Steuerprogression für die Einleitung eines neuen Zyklus der wachsenden Vergesellschaftung von Reichtum. Die dritte betrifft die politische Strategie und die gesellschaftlichen Bündnisse, die es für eine Fortsetzung der sozialdemokratischen Revolution im 21. Jahrhundert braucht.
Beginnen wir mit dem ersten Punkt: mit den Sektoren, in denen die Entmarktung vorangetrieben werden muss, und ihrer demokratischen Steuerung. Die größte Herausforderung der kommenden Jahrzehnte liegt darin, die nicht marktbestimmten Sektoren des 20. Jahrhunderts auszubauen (insbesondere Bildung und Gesundheit, die im 21. Jahrhundert ohnehin immer größere Bedeutung gewinnen werden, ob man sie nun mit den nötigen öffentlichen Mitteln ausstattet oder der privatwirtschaftlichen, gewinnorientierten Logik das Feld überlässt). Sie liegt aber zugleich auch darin, sich die Mittel an die Hand zu geben, neue Sektoren dieser Art aufzubauen (Energie, Verkehr, Bauen und Sanieren, biologische Landwirtschaft, Schutz der Umwelt in all ihren Formen). Diese Herausforderung wird sich nur bewältigen lassen, wenn man entschlossen auf eine wachsende Vergesellschaftung von Reichtümern setzt und zugleich neuartige Modi der partizipativen, dezentralen, demokratischen Steuerung in diesen ganz unterschiedlichen Sektoren entwickelt. Nichts kann hier als gegeben vorausgesetzt werden. Die Mobilisierung neuer Steuermittel ist stets ein heikler politischer Prozess, dem die Bürger und Steuerzahler jederzeit ihre Unterstützung entziehen können, und der Aufbau neuer Organisationsformen erfordert Demut und Beharrlichkeit. Ihre praktische Umsetzung ist stets komplexer, als wir es theoretisch vorhersehen können, zumal die Strukturen mit dem Auftauchen neuer Bedürfnisse und Forderungen nach Teilhabe fortlaufend überdacht und weiterentwickelt werden müssen.
Im Bildungsbereich zum Beispiel hat sich der Anteil der aufgewendeten öffentlichen Mittel am Nationaleinkommen verzehnfacht (in Europa vor 1914 unter 0,5 % des Nationaleinkommens gegenüber 5–6 % seit den 1980er Jahren). Das hat den Übergang von einem ultraelitären Bildungssystem (in dem die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung nur eine rudimentäre Grundschulbildung genoss) hin zu einer beispiellosen Demokratisierung der Schulbildung möglich gemacht, in der die sekundäre Schulbildung fast der gesamten Bevölkerung und die Hochschulbildung künftig mehr als der Hälfte einer Altersklasse offensteht. Dieser eindrucksvolle Fortschritt wurde durch die institutionelle und organisatorische Zusammenarbeit einer ganzen Reihe von Akteuren möglich: öffentliche Zentralverwaltungen, Gebietskörperschaften, Grundschulen, Sekundarschulen, Gymnasien und Universitäten, Lehrer- und Elternvertretungen etc. Gleichwohl können diese Erfolge nie als gesichert gelten. Sie müssen im Zuge der Demokratisierung der Bildung ständig überdacht und in Frage gestellt werden. So kann zum Beispiel die Vielfalt der Bedürfnisse und Studiengänge in der Hochschulbildung eine stärkere Dezentralisierung und größere Autonomie der Einrichtungen (etwa in Gestalt von Vereinen und Stiftungen) erforderlich machen, als wir sie in der primären und sekundären Schulbildung haben, sie kann aber auch zu einem Abbau der sozialen und regionalen Ungleichheiten beim Hochschulzugang führen.
Vor ganz ähnlichen Problemen steht das Gesundheitssystem. Hier sind die öffentlichen Mittel noch stärker gestiegen (unter 0,5 % des Nationaleinkommens vor 1914, 10–12 % heute) und haben für eine spektakuläre Verbesserung der Gesundheitsindikatoren gesorgt. Auch daran waren zahllose Akteure beteiligt: Zentralverwaltungen, Gebietskörperschaften, Sozialversicherungskassen, Krankenhäuser und Fachkliniken, freiberufliche Vertragsärzte etc. Die Überlegungen zur idealen Verwaltung und Organisation des Sektors sind freilich alles andere als abgeschlossen: Dabei geht es etwa um eine mögliche Neugestaltung des Tarifsystems für Krankenhäuser und der Vergütung von Ärzten, die wachsende Rolle der Gesundheitshäuser, eine bessere Einbindung von Patienten und Pflegekräften etc.
Die gleichen Fragen wirft heute schon die Organisation neuer marktferner Sektoren auf, und sie werden immer dringlicher. Es steht viel auf dem Spiel: Organisation des öffentlichen Nahverkehrs, Erzeugung und Transport erneuerbarer Energien (Wind, Sonne, Wasserkraft, Biomasse) auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene, Verwaltung von Wasser, Wäldern und natürlichen Ressourcen, Gebäudebau und -sanierung, Förderung der landwirtschaftlichen Produktion und «soziale Ernährungssicherung»,[8] Schutz der Biodiversität und so weiter. In all diesen Sektoren müssen neue Formen der Zusammenarbeit zwischen den Akteuren, zwischen öffentlichen Körperschaften, Gemeindeverbänden, Stadtwerken, Vereinen, Genossenschaften etc. gefunden werden. Die Lösungen müssen erst noch erdacht werden, bietet doch die traditionelle gewinnorientierte und kapitalistische Logik keine Antwort auf die neuartigen Herausforderungen und Bedürfnisse. Es werden also andere organisatorische Ansätze entwickelt werden müssen – geduldig, aber entschlossen.
Der Prozess der Entmarktung und Überwindung der kapitalistischen Logik muss sich auch auf traditionell gewinnorientierte Marktsektoren erstrecken. Im Laufe des 20. Jahrhunderts haben Sozial-, Gewerkschafts- und Arbeitsrecht zu einem gewissen Gleichgewicht der Kräfte zwischen Kapital und Arbeit geführt. Der Eigentümer eines Unternehmens hat heute nicht mehr die gleiche Macht wie 1910: Er kann Arbeitnehmer nicht mehr kurzerhand entlassen oder einseitig den Lohn mindern, ganz wie der Eigentümer einer Wohnung einem Mieter nicht mehr einfach kündigen oder nach Belieben seine Miete erhöhen kann – und das ist gut so. In bestimmten Ländern wie Deutschland oder Schweden verfügen seit den 1950er Jahren gewählte Arbeitnehmervertreter über einen erheblichen Anteil (zwischen einem Drittel und der Hälfte) der Sitze in den Leitungsgremien großer Unternehmen (Verwaltungs- oder Aufsichtsräte). Das heißt konkret, dass die Arbeitnehmer – sofern sie darüber hinaus 20 oder 30 % der Unternehmensanteile besitzen oder eine Gebietskörperschaft einen solchen Anteil hält – die Kontrolle über das Unternehmen übernehmen und Aktionäre auch dann überstimmen, wenn Letztere über 70 oder 80 % der Aktien halten. Es handelt sich also um einen deutlichen Bruch mit der klassischen kapitalistischen Logik, der den Aktionären erst durch intensive soziale und politische Kämpfe abgerungen werden konnte. Am Ende weist alles darauf hin, dass dieses Gesetz eine bessere Einbindung der Arbeitnehmer in langfristige Investitionsstrategien ermöglicht und der wirtschaftlichen Prosperität des fraglichen Landes keineswegs geschadet hat, ganz im Gegenteil.
Prinzipiell spricht nichts dagegen, sich die Ausweitung eines solchen Systems vorzustellen, indem man es zunächst überall einführt (und nicht nur in Deutschland und Nordeuropa) und es dann auf kleine und mittlere Unternehmen ausdehnt (mit einer proportional zur Größe des Unternehmens steigenden Anzahl an Sitzen für Arbeitnehmer). Und schließlich müsste eine Obergrenze für die Stimmrechte festgesetzt werden, über die ein Einzelaktionär in einem großen Unternehmen verfügen darf (zum Beispiel nicht mehr als 10 % der Stimmen in einem Unternehmen mit 100 Beschäftigten [siehe Grafik 2]. Auch die Diskussion der von Rudolf Meidner und seinen Kollegen vom schwedischen Gewerkschaftsbund LO in den 1970er und 1980er Jahren vorgeschlagenen «Lohnfonds» hat jüngst wieder Fahrt aufgenommen. Dieses System würde hauptsächlich die größten Unternehmen betreffen und sieht vor, dass Arbeitgeber Jahr für Jahr einen Teil der Gewinne in einen Lohnfonds einzahlen, sodass die Arbeitnehmer innerhalb eines Zeitraums von zwanzig Jahren allmählich die Kontrolle über zuletzt 52 % des Kapitals übernehmen.[9] Gedacht als Ergänzung zu den Mitbestimmungsrechten, die Arbeitnehmern unabhängig von jeder Kapitalbeteiligung einen Teil der Stimmen garantiert, stieß dieser Vorschlag bei den schwedischen Kapitalisten auf so erbitterten Widerstand, dass er sich nicht umsetzen ließ. Erst neuerdings ist er von einem Teil der US-amerikanischen Demokraten (namentlich Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez) und im offiziellen Parteiprogramm der britischen Labour Party wieder auf die Tagesordnung gesetzt worden.[10] Innovative Vorschläge sind jüngst auch zur Schaffung öffentlicher Investitionsfonds auf lokaler und kommunaler Ebene gemacht worden.[11] Meine Absicht ist nicht, die Diskussion abzuschließen, sondern ihre Tragweite herauszustellen: Die konkreten Formen der Macht, der Selbstverwaltung und der Wirtschaftsdemokratie wollen stets wieder neu erfunden werden.
Innerhalb des hier erwogenen Systems eines partizipativen Sozialismus hält ein Einzelaktionär (der 100 % der Aktien des Unternehmens besitzt) 73 % der Stimmrechte, wenn das Unternehmen zwei Beschäftigte hat (darunter er selbst), 51 % der Stimmrechte, wenn es 10 Beschäftigte hat (darunter er selbst), und verliert die Mehrheit bei über 10 Beschäftigten. Ein nicht beschäftigter Einzelaktionär hält 45 % der Stimmrechte, wenn das Unternehmen weniger als 10 Beschäftigte hat, danach fällt dieser Anteil stetig und erreicht 5 % bei 100 Beschäftigten. Anmerkung: Die hier zugrunde gelegten Parameter sind: (i) Die Beschäftigten (ob Aktionäre oder nicht) teilen sich 50 % der Stimmrechte; (ii) innerhalb der 50 % Stimmrechte, die auf die Aktionäre entfallen, darf ein Einzelaktionär in einem Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten nicht mehr als 90 % halten (das heißt 45 % der Stimmen); dieser Anteil sinkt stetig auf 10 % (das heißt 5 % der Stimmen) in Unternehmen mit mehr als 90 Beschäftigten (nicht zugewiesene Stimmrechte von Aktionären werden den Beschäftigten zugeschlagen). Quellen und Datenreihen: siehe piketty.pse.ens.fr/egalite
Die Vergesellschaftung von Reichtümern wieder ins Spiel bringen
Fassen wir zusammen: Die erste Lehre aus der sozialdemokratischen Revolution des 20. Jahrhunderts lautet, dass sich nicht im Voraus festlegen lässt, auf welche Sektoren die Entmarktung sich erstrecken soll – so wenig wie die vielfältigen Formen der Steuerung, die erprobt werden wollen, um in immer mehr Berufsfeldern aus der marktwirtschaftlichen und kapitalistischen Logik auszusteigen. Fest steht, dass eine Ausweitung nicht marktbestimmter Sektoren einen neuen Anlauf zur Vergesellschaftung von Reichtümern erfordert: eine Perspektive, zu der man sich in aller Deutlichkeit bekennen muss. Sollten langfristig die Pflichtabgaben auf 60–70 oder 80–90 % des Nationaleinkommens steigen? Und in welchem Tempo wird sich diese fortschreitende Vergesellschaftung von Reichtum umsetzen lassen? Es ist unmöglich, auf diese Art von Fragen im Voraus eine exakte Antwort zu geben. 1910 hätte sich niemand träumen lassen, dass die Pflichtabgaben im Laufe des Jahrhunderts von 10 auf 50 % des Nationaleinkommens steigen würden. Nicht anders als im 20. Jahrhundert wird auch im 21. alles von der Fähigkeit des öffentlichen Sektors (im weiteren Sinne) und der nicht marktwirtschaftlichen Logiken abhängen, die konkreten Bedürfnisse der Bürger (Bildung, Gesundheit, Verkehr, Energie, Wohnen, Ernährung etc.) besser abzudecken als ein der Profitlogik gehorchender privater Sektor. Betont werden muss auch, dass es eine ganze Reihe öffentlicher Maßnahmen gibt (das System der Geldschöpfung, Regeln der Unternehmensführung, Mindest- und Höchstlöhne, das Verbot von Verbrennungsmotoren oder von Plastik, Bau- und Sanierungsnormen etc.), die mindestens so wirksam sein können wie Steuern und Transfers, ohne an den Anteil der Pflichtabgaben am Nationaleinkommen zu rühren. Der strukturelle Wandel des sozioökonomischen Systems ist ein mehrdimensionaler Prozess, der sich nicht auf einen einzigen Indikator reduzieren lässt. Am Ende können dieselben Ziele durch unterschiedliche institutionelle Kombinationen erreicht werden. Nur historische Erfolge werden über den richtigen Weg entscheiden und Fortschritte möglich machen. Besser ist es, von konkreten Bedürfnissen, Erfordernissen, Organisations- und Finanzfragen auszugehen, Sektor für Sektor, ohne die Vielfalt langfristiger Entwicklungen aus dem Auge zu verlieren, zu denen dieser Prozess der Überwindung des Kapitalismus führen kann.