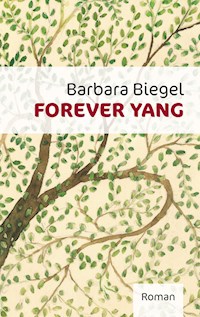Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gabes Grenzen Eine Frau mit Prinzipien und dem Vornamen Gabe läuft widerwillig einen Fernwanderweg an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Sie folgt den Spuren Karls, eines Unbekannten, dessen Tagebuch die Route vorgibt. Sie trifft auf abgeschnittene Verbindungen, alte Verletzungen und auf neue Mauern in den Köpfen. Zum Glück hat sie zwei Freunde an ihrer Seite. Die video-affine Rosi und Jim, ein Hobbyastronom, stehen mit ihr über Handy in Verbindung. Gabe muss erkennen, dass sie ihre Prinzipien loslassen und sich der eigenen Vergangenheit stellen muss.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Ida
Inhalt
Ordnung und Klarheit
Unabhängigkeit
Gesundes Misstrauen
Gegenwart
Ortstreue
Konsequenz
Verantwortung
Sparsamkeit
Keine Gefühlsausbrüche
Tag 1 Das Übersinnliche
Tag 2 Grünschnitt
Tag 3 Der bellende Hund im Wald
Tag 4 Sehnsucht
Tag 5 OstWest
Tag 6 Gefühlsausbrüche
Tag 7 Rollen und Spiele
Tag 8 Die Vergangenheit abschütteln
Tag 9 Anders sein
Tag 10 Das Wagnis
Die Bäckerei
Ankunft und die Sache mit dem Heupferd
1. Ordnung und Klarheit
Einmal in der Woche für eine Stunde mit Wörtern zu tun zu haben war für mich die ideale Dosis. Noch dazu mit zwei Aufpassern, wie ich Rosi und Jim insgeheim nannte. Ihre Anwesenheit reichte aus, um mich nicht in alte Muster verfallen zu lassen. Ich wollte mich nicht mehr über das aufregen, was andere zu Papier gebracht hatten und was sie für der Weisheit letzten Schluss hielten. Gegen das, was Rosi und Jim aufschrieben und vorlasen, hatte ich nie etwas einzuwenden.
Sie konnten nicht wissen, wie viel mir unsere Treffen mit den kleinen Schreibaufgaben bedeuteten. „Mit leerem Gerede ist keinem geholfen. Deshalb finde ich es gut, dass wir nur kurze Texte schreiben und keine Romane“, hatte ich zu den beiden gesagt, „von Worten gehen jede Menge Missverständnisse aus.“ „Findest du? Aber du willst uns bestimmt nicht sagen, wie du zu dieser Überzeugung gekommen bist“, mit einem unschuldigen Blick rührte Rosi in ihrer Kaffeetasse. Sie wusste genau, dass die Vereinbarung, nicht über unsere Vergangenheit zu sprechen, einer Antwort im Wege stand. Jim verzog keine Miene. „Rosi“, sagte ich, „ich spreche von zu viel Gerede. Du kennst meine Meinung über moderne Kommunikationsmittel, die in Sekundenschnelle inhaltsloses Geschwätz verbreiten. Deswegen …“ „… hast du dir nie ein Handy angeschafft!“, vollendete sie meinen Satz. „Genau“, sagte ich, „jedes Exemplar spielt dem Ende der Zivilisation in die Hände.“
Rosi fand das nicht. Sie hatte sehr wohl ein Handy und Jim nutzte die neuesten wissenschaftlichen Kenntnisse, die die Computer der Bibliothek bereithielten, obwohl das ein Unort war, wie ich ihm gegenüber nicht müde wurde zu betonen. „Jim“, sagte ich ein ums andere Mal, „pass dort bloß auf dich auf, du gehst voller Ideale rein und sie sind nur darauf aus, dir irgendetwas anzuhängen.“ Doch er schaute mich stets nur ernst an und blieb wortkarg. Abgesehen von solchen kleinen Irritationen waren wir drei uns einig, die Beschäftigung mit Wörtern war Gehirnjogging und weil wir für Kreuzworträtsel zu jung waren - uns fehlten im Schnitt noch fünfzehn Jahre bis zur Rente - lösten wir leidenschaftlich gern Schreibaufgaben.
An jedem Mittwochnachmittag trafen wir uns im Café Ella und schrieben zehn Minuten über ein Wort - und zwar noch bevor wir den Kuchen bestellten. Wir waren der Reihe nach mit Vorschlägen dran und man konnte ein Veto einlegen, wenn einem das Wort gegen den Strich ging. Davon machte aber nie jemand Gebrauch, ich schon gar nicht, kein Wort konnte so toxisch sein, dass ich nicht darüber schreiben wollte. Jedenfalls hatte ich das gedacht, bis zu einem Mittwoch, an dem Rosi am Zug war.
Sie hatte in die Runde geblickt, als habe sie etwas ganz Besonderes im Angebot. Als sie sich unserer ungeteilten Aufmerksamkeit sicher war, rückte sie endlich mit ihrem Wort heraus: „Ost!“ Ich öffnete den Mund und sagte zu meinem Erstaunen: „Nicht mit mir. Ich lege mein Veto ein.“ Rosi riss die Augen auf. „Weshalb?“ „Deshalb! Denk dir bitte etwas anderes aus.“ „Aber was ist so schlimm an einer Himmelsrichtung?“ fing sie an, doch Jim unterbrach sie, indem er die Hand hob. „Du könntest ‚Rost‘ vorschlagen“, sagte er zu ihr. „Warum nicht? Das ist gut“, stimmte ich sofort zu. Rosis Blick wanderte von mir zu Jim, während sie auf dem Sofa ein Stückchen nach hinten rutschte. „Also gut, dann ‚Rost‘. Meinetwegen“, meinte sie, „ich kenne die Regeln.“ Mit gerunzelter Stirn nahm sie mit der einen Hand ihren rosafarbenen Füller und drehte mit der anderen die originelle Sanduhr um, Jim zückte seinen Kugelschreiber und ich zog die Kapsel von meinem blauen Fineliner.
Die winzigen grünen Kunststoffkugeln brauchten ganze zehn Minuten, um durch die gläserne Engstelle von unten nach oben zu schweben. Hatten sie es geschafft, gaben wir uns noch etwas Zeit für das Polieren, wie wir es nannten.
Wenn Rosi das Wort vorgeschlagen hatte, war ich immer als Erste mit Vorlesen dran.
„Rost“. Nach der Überschrift räusperte ich mich kurz, dann las ich weiter.
„Rost konnte ich noch nie leiden. Es ist nicht sehr viel besser als Ost. Schon wenn ich das Wort ausspreche, werde ich heiser und meine Stimme bekommt einen kratzigen, unversöhnlichen Tonfall. Rost geht mir auf die Nerven. Es sind Männer, die die rostigen Eisen-Herzen oder Spiralen herstellen, die überall in den Gärten herumstehen, denn Männer stehen auf Rost, es gibt nur wenige Ausnahmen von dieser Regel. Ihr Verhältnis zu Metall hat sie geprägt, seit sie nach Erzen gegraben haben und seit es Eisen gibt. Über Jahrhunderte hat der Umgang mit rostigen Nägeln tiefe Spuren in ihrer DNA hinterlassen. Ständiges Geschraube vertiefte ihren Kontakt mit Rost und wurde zu ihrer Spezialstrecke. Sie befassen sich gern mit ihm, während weibliche Wesen ihrer Ansicht nach mit ihrem Gerede alles blank schleifen wollen und versuchen, hinter dem roten Schmutzfilm irgendwelche Wahrheiten aufzudecken. Männer wollen das nicht, die wollen die Dinge entweder zugespachtelt und glanzlackiert oder eben rostig, mit Schlieren, die von Schrammen und Beulen ablenken und sie verstecken. Unschöne Formen und störende Kanten lassen sich hinter blühendem Eisen perfekt zum Verschwinden bringen, man braucht es nur der Feuchtigkeit auszusetzen und schon lenkt die Veränderung der Oberfläche vom Eigentlichen ab. Sogenannte Schock-Rostlöser, die nach dem Einwirken eingerostete Schrauben und Muttern rücksichtslos freisprengen, dienen Männern als Ersatz für längst überfällige Beziehungsarbeit. Rost ist mehr als sinnlos, er widerspricht dem Prinzip von Ordnung und Klarheit. Eine gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Phänomen Rost ist in meinen Augen überfällig.“
Scheinbar hatte Rosis erster Vorschlag mich innerlich aufgeladen, nur so war die scharfe Note zu erklären, die meine Texte sonst eher selten würzte. Jim saß kerzengerade und mit geschlossenen Augen da und Rosi hatte mit gesenktem Kopf über der Tischdecke meditiert, ein sicher seltsamer Anblick für die übrigen Gäste. Nach ihrer Andacht reagierte sie überschwänglich: „Wirklich gut, du hast dich übertroffen. Da haben wir es wieder: Du hast die Gabe, so ein unerotisches Wort wie ‚Rost‘ in ein gesellschaftspolitisches Statement zu verwandeln. Ja, du machst deinem Namen alle Ehre.“ Das war kein Lob, sie trug mir mein Veto nach und nahm meinen Groll auf meinen Vornamen zum Anlass, mich zu ärgern.
Ich hätte Gabi heißen sollen. Offenbar hatte mein Vater nicht gelesen, was der Standesbeamte ihn hatte unterschreiben lassen. Von da an war ich Gabe. Manche Dinge waren nicht mehr gutzumachen, weder die Schreibweise noch meine Vorwürfe den Eltern gegenüber. Davon konnte Rosi nichts wissen, ihr genügte der ironische Unterton, mit dem ich meinen Vornamen aussprach, wenn ich danach gefragt wurde.
„Vielen herzlichen Dank, Rosi“, betonte ich, verschränkte die Arme und wandte mich Jim zu. Er strich sich über die kurzen grauen Haare, als würde ihm das helfen, einen Kommentar aus seinem Kopf hervorzulocken, und gab dann bedächtig eines seiner knappen Urteile ab: „Interessante Analyse, Gabe. Auch ich besitze einen Schock-Rostlöser.“ Er sagte es, ohne zu lächeln. Mehr kommentierte er selten und ich war dankbar über seine Rückendeckung und wollte nicht weiter nachfragen. Doch Rosi hatte sich mit meinem Veto noch nicht abgefunden. „Ich weiß nicht, was du gegen das Wort ‚Ost‘ hast“, hakte sie nach, „es gibt doch tolle Leute im Osten, mich zum Beispiel. Und Jim. Du musst erst mal jemanden finden, der unseren Erfindungsreichtum hat, nicht wahr, Jim?“ „Darum geht’s nicht, Rosi“, ich winkte ab und wollte das Thema beenden, doch sie gab keine Ruhe. „Doch, doch, das soll uns mal einer nachmachen! Und ich kenne eine Menge Leute, die hervorragend zwischen den Zeilen lesen können und sich nicht gleich wie Lämmer zur Schlachtbank führen lassen, nur weil irgendjemand etwas beschlossen und in Regeln gegossen hat.“ Sie kicherte: „Außerdem verstehen wir zu feiern, aus dem Nichts heraus. Wenn ich nur daran denke, wie wir früher über die Dörfer gezogen sind. Jemand hat irgendein Lied angestimmt und alle haben mitgesungen. Es hat nie lang gedauert, dann hat man uns was zu trinken oder zu essen gebracht, wenn’s auch nur Wasser war oder eine Scheibe Brot. Die Leute haben zusammengehalten.“ Mir reichte es. „Rosi, dafür, dass du mit ‚Ost‘ eine Himmelsrichtung gemeint hast, bist du ganz schön in die Vergangenheit abgeschweift“, sagte ich streng. „Oh, stimmt. Sorry“, sie tauschte mit Jim einen Verschwörer-Blick und zuckte scheinbar leidenschaftslos mit den Schultern.
Er wartete schweigend einige Minuten, meist begann er erst mit dem Vorlesen, wenn Rosi kurz vor dem Platzen war. Ungeduldig stöhnte sie vor sich hin. Sein Text handelte von einem Astronomen mit dem Nachnamen Rost, der als Verfasser galanter Romane und vor allem wegen seiner Forschungen an einer Sternwarte berühmt geworden war. „Ach was!“, rief Rosi dazwischen, die die Tatsache, dass es nicht der erste Beitrag zu Jims Lieblingsthema war, auf gar keinen Fall unkommentiert lassen wollte. Erneut sah ich sie streng an, die Anderen zu unterbrechen, war nicht erlaubt, doch Jim ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und fuhr unbeirrt fort:
„Johann Leonhard Rost sammelte seine Erkenntnisse in zahlreichen Schriften. Besonders mit der Beobachtung der Sonnenflecken machte er auf sich aufmerksam. Veröffentlichungen zu Sonnen- und Mondfinsternissen, Nordlichtern und schweren Unwettern folgten. 1718 erschien sein Hauptwerk. Es trug den Titel ‚Astronomisches Handbuch‘ und verschaffte ihm Zugang zur Preußischen Akademie der Wissenschaften. Seine Eltern betrieben eine Gaststätte, die heute noch existiert, doch er erkrankte und starb, noch keine vierzig Jahre alt. Nach ihm ist der Mondkrater ‚Rost‘ benannt.“
Jim besaß das Gedächtnis eines Elefanten, war sparsam mit Worten und las stets langsam. Konsonanten und Vokale erhielten genau den Raum, den sie brauchten, um es sich in ihrem Wort gemütlich zu machen. „Beeindruckend, Jim“, sagte ich, als er schwieg, „wie immer mit Fakten und Zahlen. Und knapp. Kurz kam mir der Gedanke, was du wohl geschrieben hättest, wenn das Wort ‚Trost‘ geheißen hätte.“ Er zog nur unmerklich die Augenbrauen hoch. „Rosi“, wollte ich ein versöhnliches Signal aussenden, „du hast sicher bemerkt, dass ‚Rost‘ ganz nah am ‚Trost‘ vorbeischrammt?“ Sie nickte kühl: „Du hast recht, aber es war ‚Rost‘, nicht ‚Trost‘, und auch nicht ‚Ost‘.“ Sie hatte mir mein Veto immer noch nicht verziehen und wendete sich Jim zu: „Dich zu kennen, erweitert meinen Horizont, was das Thema Astronomie betrifft. Aber das ist nichts Neues. Wirklich überrascht bin ich wegen des Details mit der Gaststätte, Jim. Man ist versucht, nachzuprüfen, ob das stimmt. Wird wohl so sein, wenn man dich kennt.“ Jim neigte den Kopf und lächelte fein, er war sich also sicher, und Rosi klopfte unwillkürlich mit ihrem Füller auf die Tischkante und gab sich geschlagen. Ich sagte nichts und hoffte, ihr Ärger würde nach dem Lesen ihres eigenen Textes verflogen sein. Sie griff nach ihrem Block, streckte den Kopf etwas vor und sah durch den Nahbereich ihrer Gleitsichtbrille.
„Rost stellt für jeden von uns eine unterschätzte Gefahr dar. Jeder, der mit Eisen in Berührung kommt, kann sich heimlich, still und leise einen Rostfleck einfangen, und entgegen der landläufigen Annahme, diese Flecken wären leicht loszuwerden, behaupten sie in unserer scheinbar perfekt durchorganisierten Welt zäh und ausdauernd ihren Platz. Nur ein wahrer Feldzug gegen Rost, an dem sich alle mit vereinten Kräften beteiligen müssten, würde helfen, ihn zurückzudrängen. Unsere Kleidungsstücke sind ständig in Gefahr, dass sich Rost von alten Schrauben, von vielbenutzten Werkzeugen oder rostigen Küchengeräten ablöst, um nur einige Beispiele zu nennen, und sich auf den unterschiedlichsten Stoffen festsetzt. Selbst Essbesteck aus rostfreiem Stahl scheint fortwährend darauf aus zu sein, Flugrost, der sich in allerfeinsten Partikeln in der Luft befindet, magnetisch anzuziehen und sich bereitwillig die eigene Schutzschicht von ihm durchdringen zu lassen. Alle alten Autokarosserien tragen das ihre dazu bei, dass der rostige Feinstaub nie geringer wird – sie werden Regen, Schnee und Nebelschwaden ausgesetzt, obwohl allgemein bekannt ist, dass es zu Rostflecken kommt, sobald Feuchtigkeit mit angegriffenen Oberflächen in Kontakt tritt. Obwohl uns die Werbung weismacht, man müsse nur zu dem passenden Fleckentferner greifen und uns mit der Bezeichnung ‚Fleckenteufel‘ suggeriert, wir würden mit dem Stellvertreter einer dunklen Macht in unseren Händen gegen Rost erfolgreich vorgehen können, haben viele von uns zu ihrem Leidwesen schon die Erfahrung gemacht, dass keines der auf dem Markt befindlichen Mittel gegen die hässlichen, braunroten Stellen hilft. Auch eine doppelt oder dreifach so lange Einwirkzeit kann man sich schenken. Solange die breite Masse diese Gefahr nicht ernst genug nimmt, bleibt uns wenig anderes übrig, als mit dem Rost in friedlicher, doch wachsamer Koexistenz zu leben.“
Jim sah starr geradeaus, ich musste kichern, aber Rosi funkelte mich an, also riss ich mich zusammen und sagte: „Wirklich gut, Rosi. Ich bin beeindruckt. Unglaublich detailreich. Mit all dem Staub und den Partikeln kam es mir vor wie ein weiterer interstellarer Text. Da hast du Jim direkt Konkurrenz gemacht. Und ich wusste gar nicht, dass du an dunkle Mächte glaubst.“ Sie beugte sich vor und tat so, als wolle sie mich mit ihrem Stift erstechen: „Nicht nur das, sie sind auf meiner Seite. Nimm dich bloß in Acht. Bisher schreibe ich gegen Widerstände nur an.“ Nach diesem letzten Seitenhieb lachte sie plötzlich und war wieder die Alte. Beleidigt zu sein, hielt sie nie lange durch.
Wir sprachen nicht viel über unsere Texte, es war nur ein amüsanter Zeitvertreib und keiner wollte sich zum Schiedsrichter aufspielen, doch Rosi ließ es sich nie nehmen, hinterher ein paar feierliche Worte zu verlieren. „Jim, Gabe“, sie sah uns von ihrer etwas tieferen Position des Sofas aus an und sagte in die entstandene Pause hinein: „Egal welches Wort - mit euch zu schreiben war wieder einmal herrlich.“ Noch während sie sprach, winkte ich Gunda, um endlich zu bestellen. „Wir wollen uns schließlich nicht nur Worte auf der Zunge zergehen lassen, Gunda“, kommentierte Rosi wie üblich ihren immer gleichen Wunsch, ein Stück Schwarzwälder-Kirschtorte.
Eine halbe Stunde später hielt sich Jim an dem Rest seiner Saftschorle fest und unsere Teller und Tassen waren fast leer. Es wurde langsam Zeit, ihnen die Neuigkeit mitzuteilen. Draußen vor dem Fenster ließ eine Horde Spatzen die Ligusterhecke am Rand der Terrasse vibrieren. Ich holte Luft, sagte, was ich zu sagen hatte, und schloss mit den Worten: „Ich weiß es seit gestern.“ Rosi sah mich mit großen Augen an, soweit das bei ihrem rundlichen Gesicht möglich war. „Wieso hast du nicht ‚Nein‘ gesagt?“ Das Licht der Lampe über dem Tisch ließ die kleinen Schweißperlen auf ihrer Stirn schimmern. Ich zuckte mit den Schultern. Sie warf Jim einen Seitenblick zu und rutschte unbehaglich auf dem Sofa hin und her. „Oh. Und deine …“, sie überlegte, „… Prinzipien? Es muss doch einen Grund geben, weshalb du zugestimmt hast. Du bist doch sonst so …“
Konsequent, direkt, geradlinig, etwas in dieser Richtung, sie suchte nach dem passenden Begriff. Um die ganze Sache abzukürzen, tat ich so, als wäre es das Natürlichste der Welt, das Gegenteil von dem zu tun, was man seit Jahren predigte. „Konsequent, wolltest du sagen? Ja, du hast recht, ich hätte ‚Nein‘ sagen sollen.“ Dabei musterte ich scheinbar interessiert den Bezugsstoff des Sofas, auf dem sie saß. Sein orientalisch überbordendes Muster bildete einen seltsamen Kontrast zu Jims karierter Hose, der auf dem Stuhl daneben seine langen Beine übereinandergeschlagen hatte. „Und weshalb hast du es nicht?“ Mehrere kurze Sätze in Folge waren eigentlich untypisch für Rosi. Sie zu irritieren, war nicht schwer, sie war nie gefasst auf die Winkelzüge der Welt. Ihre Kuchengabel blieb mit leichtem Zittern in der Luft stehen wie eine Drohne. „Du wolltest doch nie mehr …?“ Ich rührte den Rest Kaffee in meiner Tasse um, als hätte ich vor, einen Wirbelsturm zu erzeugen. „Jemand hat mal gesagt, das Wort ‚Ja‘ wäre das schönste Wort der deutschen Sprache, dem kann ich nicht zustimmen. Ein ‚Ja‘ wird leicht erpresst“, sagte ich. „Ich jedenfalls bin buchstäblich dazu gezwungen worden. Das Ganze ist ein Lehrstück dafür, dass Zustimmung viel zu oft nichts als eine Lüge ist.“
Rosi wandte sich mit großer Geste an Jim, der dasaß wie immer, unerschütterlich auf seinen knochigen Sitzhöckern festgetackert wie der Orion am Himmel. „Du sagst ja gar nichts, Jim. Hast du nicht gehört, was Gabe eben gesagt hat?“, drängte sie. Er wiegte den Kopf und fragte in seiner langsamen Sprechweise, die mich manchmal ebenso ermüdete wie Rosis Wortschwall: „Was ist daran so schlimm?“ „Jim, ich bitte dich, du und dein Gleichmut, der ist hier fehl am Platz! Gabes Leute haben ihr Versprechen gebrochen. Sie putzt seit Jahren in ihrem Haus und von Anfang an unter der Bedingung, dass sie nicht ausgeliehen wird, das weißt du doch. Wo Gabe doch so schlechte Erfahrungen mit öffentlichen Gebäuden gemacht hat!“ Rosis Gabel landete mit einem Klirren auf ihrem Teller neben der Maraschino-Kirsche, die sie verabscheute, was in ihren Augen den Genuss der Torte aber nicht schmälerte. Seit Gunda gesagt hatte, die Kirschen würden in Salzlake wochenlang gebleicht und anschließend neu eingefärbt, erinnerte mich die rote Farbe an Schnippgummis.
Rosis Empörung tat mir gut. Was auf mich zu kam, hatte bereits leichten Druck auf meinen Magen erzeugt. Nicht wegen der Arbeit, für viele war Putzen ein notwendiges, aber lästiges Übel - nicht für mich. Egal ob Fensterputzen, Staubsaugen oder das Bad schrubben, Saubermachen hatte mit Ordnung zu tun und Ordnung war wichtig. Wie es in einem selbst aussah, spiegelte sich im Außen. In meiner Wohnung stand jedes Ding an seinem Platz, nur meine Clivia hatte durch ihr unkontrollierbares Wachstum das Potential, Unruhe in die Ordnung zu bringen, was man einer Pflanze aber nicht übelnehmen konnte.
Selbstmitleid lag mir nicht, ich war jemand, der die Dinge anpackte, die anzupacken waren, doch Rosi hatte recht, sie hatten mich überrumpelt und meine Abhängigkeit ausgenutzt. „Sie arbeiten schon so lange für uns, Gabe. Sie wissen doch, dass wir uns nicht an Sie wenden würden, wenn es sich nicht um eine außergewöhnliche Notsituation handeln würde.“ Frau Westend, die ich insgeheim so nannte, weil das Haus im Villenviertel lag, hatte mich nervös angesehen und ihr linker Mundwinkel hatte gezuckt, wie an den Tagen, an denen das Klobecken eine Zumutung war oder wenn ihr Mann vor meinem Kommen nicht die Kellertreppe freigeräumt hatte.
„Das kommt nicht in Frage“, hatte ich ihre Bitte ausgeschlagen. Da war mir noch nicht klar gewesen, dass ich gar keine Wahl hatte, weil mein Job auf dem Spiel stand. „Sie wissen, dass ich auf keinen Fall in öffentlichen Räumen putzen will, ich arbeite ausschließlich privat, das habe ich von Anfang an zur Bedingung gemacht.“ Sie nickte eifrig und ihre Hand rutschte am Tisch ein Stückchen vor, als wolle sie meinen Arm berühren. Das fehlte mir noch. Wurde man mit ihnen zu privat, erzählten sie einem alle ihre Probleme und das Arbeitgeber-Angestellten-Verhältnis geriet in eine Schieflage. Auf diese klare Trennung hatte ich immer geachtet. Mit einem einnehmenden Lächeln sah sie mich an: „Es ist nur so lange, bis wir jemand anderen finden. Versprochen!“ Manche Versprechen konnte man sich schenken, sie würden so schnell niemanden finden, der so weit draußen eine Putzstelle annehmen würde, mit Arbeitszeiten, zu denen kaum ein Bus fuhr. „Wie soll ich da hinkommen? Ich habe kein Auto“, versuchte ich, ihr einen Strich durch die Rechnung zu machen. Ihr Gesicht wurde lebhaft: „Das ist organisiert, Gabe. Sie nehmen den Zug in den Nachbarort, von dort fährt ein Bus in engerem Takt. Wir übernehmen selbstverständlich die Kosten.“ Sie sah, dass ich zögerte und beeilte sich, nachzuschieben: „Und Sie können auch am Montag ins Haus, wir vertrauen Ihnen den Schlüssel an. Das haben wir gegenüber dem Vorstand durchgesetzt. Wir kommen Ihnen entgegen, weil heutzutage verlässliches Personal, wie Sie es sind, selten ist. Bitte lassen Sie uns und vor allem meinen Mann nicht im Stich. Das Museum bedeutet ihm alles. Ihre Absage würde uns sehr enttäuschen. Wir würden ungern auf Sie verzichten.“ Der letzte Satz war doppeldeutig, eine ähnlich komfortable Putzstelle würde ich so schnell nicht wieder finden. Ich schwieg eine Weile und gab mich dann geschlagen. In der Hoffnung, dass, anders als in Bibliotheken, nur wenige Besucher dieses neue abgelegene Kunstmuseum aufsuchen würden und dass kein Vorgesetzter mir in meine Arbeit hineinreden wollte, lenkte ich ein: „Also, gut, ich stimme zu. Aber nur, wenn Sie erstens alles tun, um so bald wie möglich einen Ersatz zu finden, zweitens, wenn es nicht länger als ein halbes Jahr dauert und drittens, wenn ich im Anschluss zwei Wochen frei bekomme, bezahlt, versteht sich. Denn danach brauche ich sicher eine Pause.“ „Gabe!“ Der Strahlkranz aus Wimpern um ihre blauen Augen war fast so rund wie ihr offenstehender Mund. Ich machte ein unbeteiligtes Gesicht und wischte einige unsichtbare Brösel vom Tisch, sie wusste schließlich, was sie an mir hatte. Sie antwortete: „Ich werde darüber mit meinem Mann reden!“, und wies mich als nächstes an, mit dem Deckenbesen durch das ganze Haus zu gehen, um die Spinnweben zu entfernen. Das hatte ich zwar erst die Woche zuvor erledigt, aber sie wollte wohl zeigen, wer das Sagen hatte. Ich war wieder einmal froh, dass ich stets abgelehnt hatte, sie mit ihrem Vornamen anzureden.
Rosi riss mich aus meinen Gedanken und hakte nach: „Und dein Putzjob bei ihnen, soll der auch weitergehen?“ „Der soll pausieren“, antwortete ich. „‚Gabe‘, hat sie gesagt, ‚es fällt uns schwer, aber wir werden wohl, solange Sie im Museum arbeiten, ohne Sie zurechtkommen müssen.‘“ Nachdenklich wiegte Rosi den Kopf, während Jim sein Glas leerte und es mit einem Klacken auf die Marmorplatte stellte, als wolle er einen Schlusspunkt setzen. „Rosi, lass uns über etwas anderes reden“, sagte ich, „mir reicht’s für heute. Erst hat sich die Chefin über ihre Frühjahrsmüdigkeit und dann über das Buch beschwert, das sie gerade liest.“ Ich imitierte die hohe Stimmlage: „‚In das Buch bin ich nicht gleich reingekommen, aber dann ging’s.‘“ Ich schüttelte den Kopf: „Dabei hat niemand behauptet, dass alles immer angenehm oder leicht ist. Was klappt schon von Anfang an wie am Schnürchen, aber vom Frühling oder von einem Buch erwarten sie es. Wie sagt man heute? Das Leben ist kein ‚Wünsch dir was‘, oder so ähnlich.“ Ich sah in zwei aufmerksame Gesichter, was ich unter Freundschaft verbuchte, und zuckte mit den Schultern. „Das mit dem Job ist vielleicht gar nicht so schlimm. Er ist begrenzt und etwas Abwechslung wird mir gut tun.“ Ich fragte mich, weshalb ich so viel darüber redete und stellte fest, dass mich die Zukunft nervöser machte als gedacht.
Wir zahlten und Rosi konnte es nicht lassen, meine Neuigkeit noch einmal zu kommentieren: „Hoffentlich bleibt es bei unseren Treffen. Das mit dem Museum ist wirklich der Hammer.“ „Hammer, was für ein interessantes Wort“, warf Jim zum Glück ein. „Das stimmt“, gab ich ihm recht, „klingt irgendwie niederschmetternd“, und er lächelte. Für jemanden, der sich mit den Weiten des Universums beschäftigte, waren solche schicksalhaften Wendungen nicht von Bedeutung. Er sah über irdischen Morast hinweg und meinte, man müsse Hindernisse mit den Augen eines Pferdes angehen, das wären Tiere, deren Gesichtsfeld fast 180 Grad umfassen würde. Darüber hinaus gäbe es noch ganz andere Dinge zu entdecken. „Gabe wird diese Hürde nehmen“, bemerkte er plötzlich zu meiner Überraschung und warf einen Seitenblick auf mich, in dem ich zu lesen glaubte, dass er sich dessen gar nicht so sicher war. Unwillkürlich straffte ich mich und sagte energisch: „Ich sehe es als Herausforderung, das muss reichen.“
Eine kurze Zeit in der Hölle konnte man überbrücken. Schließlich war ich schon einmal dort gewesen und wieder entkommen, wenn auch mit Blessuren. Ich hatte es nicht mehr nötig, mich herumkommandieren zu lassen. Mit den Prinzipien an meiner Seite hatte ich mein Leben gut gemeistert. Sie würden mir beistehen.
2. Unabhängigkeit
Rosi hatte ich an einer Fußgängerampel kennengelernt. Sie hatte ganz vorn am Bordstein gestanden und ungeduldig auf Grün gewartet. Damals trug sie noch Kostüm, was ihr meiner Meinung nach besser stand als die weiten Schlabberhosen, für die sie später eine Vorliebe entwickelte. Kleine rötliche Löckchen klebten auf ihrer Stirn, sie schwitzte schnell, daran hatte sich wenig geändert. Der Ampeltaster war aktiviert und der Schriftzug „Signal kommt“ blinkte beharrlich. Rosi wendete sich mit einer Falte zwischen den Brauen um und überprüfte, ob das Symbol leuchtete. „Manchmal dauert es ewig“, stellte ich ungefragt fest. Ihre hellgrün umrandeten Augen hinter der Brille musterten mich. „Und ich dachte schon, ich hätte nicht gedrückt!“ „Haben Sie, zweifelsohne. Sie haben alles richtig gemacht!“ Sie lachte und im selben Moment wechselte die Ampelphase und das grüne Fußgängersymbol erschien. Wir setzten uns in Bewegung und sie meinte über die Schulter: „Ich hatte schon an mir gezweifelt.“ „Das soll man nie!“, kommentierte ich trocken, wandte mich nach links und überquerte die Seitenstraße, als in meinem Rücken ein helles „Danke!“ ertönte, gefolgt von der Frage: „Wollen wir einen Kaffee zusammen trinken?“ Ich drehte mich um und sah in ihr offenes Gesicht. Spontan stimmte ich zu. Es konnte auch von Vorteil sein, keine Arbeit und viel Zeit zu haben. Wenig später saßen wir das erste Mal im Café Ella am Rand des Parks und waren bald beim Du. „Gabe? Hm, noch nie gehört, den Vornamen, aber interessant“, bemerkte sie. Zum Glück verzichtete sie auf jede Anspielung. Als nächstes erfuhr ich eine Menge über ihre Tante Mina. Nach einem Felssturz waren zwei riesige Steinblöcke von einer Bergflanke zu Tal gerollt und rechts und links neben Minas Haus zum Liegen gekommen. Rosi entfaltete ein Zeitungsfoto mit dem wie durch ein Wunder unbeschadet gebliebenen Gebäude. „Meine Tante Mina war ein Glückskind. Sie trat aus der Haustür und sagte: ‚Na sowas‘.“ Rosi kicherte. „Ein bisschen was hab ich von ihr, das Naturell und mein Hobby, das Schreiben. Das Haus wurde einige Jahre später doch noch durch einen Felssturz zerstört, aber da war sie schon ausgezogen.“ „Und wo lebt sie jetzt?“, fragte ich. „Sie ist tot“, sagte Rosi leichthin. „Sie war erst neunundsiebzig, als sie starb.“ Als nächstes fragte sie mich unvermittelt: „Schreibst du auch?“ „Nein“, wehrte ich ab, „ich kann Bücher nicht leiden.“ „Oh“, sie legte den Kopf schräg und meinte entgegenkommend, lange Texte wären auch nicht ihr Ding, aber kleine Schreibaufgaben, nach denen wäre sie süchtig. Sie war mir sympathisch und ich fragte sie ein wenig darüber aus. Lebhaft nannte sie mir Beispiele aus dem kreativen Schreiben, einem Ableger der Literatur, der mir völlig fremd war. „Ich bin schon mal gedruckt worden. Im Kirchenblättchen“, sie gluckste, „ich hatte Engelpostkarten gekauft und beschrieben, wie sich die Engel aus ihren alten Gemälden davongemacht und andere Leute auf verrückte Gedanken gebracht haben.“
Rosi hatte anscheinend Hoffnung geschöpft, mich mit ihrer Begeisterung anstecken zu können und schlug wiederholt vor, wir sollten uns erneut treffen, wieder im Café, aber mit Schreibzeug. Ich zweifelte daran, dass sie es schaffen würde, mich vom Unterhaltungswert gemeinsamen Schreibens zu überzeugen, aber ihre Munterkeit verlockte mich zu einer Zusage. Meinem Prinzip Unabhängigkeit würde etwas Austausch nichts anhaben können. Wir verabredeten uns für den darauffolgenden Mittwoch.
Mit Papier und Stift in der Tasche ging ich durch den großen Raum des Cafés bis nach hinten. Rosi sah mir von dem Sofa mit dem orientalisch gemusterten Bezug schon entgegen und winkte mich mit dem Stift in der Hand an ihren Tisch. Das Blatt des Schreibblocks vor ihr war mit einer Schrift voll ausufernder Schwünge bedeckt. „Was schreibst du denn?“, fragte ich, während ich auf dem Stuhl neben ihr Platz nahm. Gut gelaunt zeigte sie mit ihrem rosa Füller auf mich, als wolle sie mich aufspießen. „Über alles, was so vor sich geht, zum Beispiel: Gabe kam herein und fragte: ‚Was schreibst du denn?‘“ Sie lachte: „Setz dich. Wollen wir zuerst bestellen?“ Ich entschied mich für Apfelkuchen, Rosi nahm Schwarzwälder-Kirschtorte.
Sie merkte bald, dass ich auf Fragen nach meinem Leben lieber Gegenfragen stellte oder ausweichend antwortete und es nahm mich sehr für sie ein, dass sie nicht weiterfragte und stattdessen auf das Schreiben zu sprechen kam. „Man muss Wörter einfach mal von einer anderen Ebene aus ansehen“, sagte sie, „man muss akzeptieren, dass sie ein Eigenleben haben.“ Auf meinen skeptischen Blick hin erklärte sie mir, was sie meinte: „Nimm zum Beispiel das Wort ‚Nisse‘. Ich frage mich, was mir dazu einfällt. Ich überlege, ob es nicht genug davon hat, immer nur auf Läuseeier reduziert zu werden. Oder ob es ihm etwas ausmacht, meistens nur Teil eines Wortes zu sein, eine Nachsilbe wie bei Hindernisse, Vorkommnisse, Gefängnisse. Dann fällt mir auf, dass es so ähnlich wie ‚Pisse‘ klingt. Ich frage mich, ob es sich mit dem Wort ‚Erlebnisse‘ darüber wegtrösten kann oder ob es sich freut über ‚Geheimnisse‘, ‚Wagnisse‘ und ‚Wildnisse‘. Ob es lieber ein ‚t‘ gegen ein ‚s‘ tauschen würde, um sich in ‚nisten‘ zu verwandeln.“ Mittlerweile saß ich mit offenem Mund da und sie war bester Laune. „Lass es uns einfach mal ausprobieren. Sag irgendein Wort, das dir einfällt.“ Ich sah, wie die Bedienung, von Rosi „Gunda“ gerufen, im Laufschritt zur Kasse lief, während ein anderer Gast schon mit dem Portemonnaie wedelte, und sagte: „Also gut. Effektiv.“ „Sehr schön“, freute sich Rosi, „und was fällt dir dazu ein?“ Ich überlegte laut: „Es ist ein unmögliches Wort. Die Konsonanten prasseln auf einen herunter wie Hagelkörner. Es besteht nur aus Forderungen, hat nichts Schwebendes und macht nur Stress. Es klingt wie affektiert, vielleicht sind beide verwandt, weil Leute damit angeben, wie schnell und fit sie sind. Es gibt zu viele Leute und Bücher, die dieses Wort vor sich hertragen.“ Aufmerksam sah sie mich an. Vermutlich hatte sie gemerkt, dass ich gerade etwas über meine Vergangenheit preisgegeben hatte.
In meinem früheren Leben in der Bibliothek war Effektivität in jedem zweiten Satz der Leiterin vorgekommen. Für die Arbeit brauchte man damals keine Ausbildung, es gab jede Menge Seiteneinsteiger und sie war der Ansicht, man müsse ungelernte Kräfte wie mich antreiben. Meine Erwartung, die Arbeit in einer Bibliothek mache es mir leicht, meinen Wissensdurst zu befriedigen, wurde enttäuscht. Die Bücher befanden sich zwar in Reichweite, bereit, ergriffen und gelesen zu werden, aber ich war immer auf Trab und hatte höchstens Zeit, den Deckel aufzuschlagen, das Datum zu stempeln und das Exemplar richtig einzuordnen. Ich holte und brachte Bücher von A nach B, ich sollte freundlich zu oft unfreundlichen Kunden sein, die sich manchmal verhielten, als machten sie mich persönlich dafür verantwortlich, dass ein bestimmtes Buch ausgeliehen war oder dass sie sich die Bücher nicht leisten konnten. Bei der Arbeit an der Theke entgingen mir weder die Unsicherheit, der Zorn und die Unruhe der Leute, noch, dass sie irgendetwas zu verbergen hatten, wobei Eselsohren das Wenigste waren. Ich machte meine Arbeit gründlich und verhielt mich konsequent, selbst in der undankbaren Rolle, Mahngebühren durchzusetzen, obwohl ich das dringende Bedürfnis verstand, ein Buch zu behalten, solange es nötig war. In meiner Freizeit war ich erschöpft und kaum mehr in der Lage, selber zu lesen. Mit den Jahren nahm meine Enttäuschung über die Bibliothek zu und ging auf die Bücher über. Sie blieb an ihnen haften wie der Leim an meinen Fingern nach Reparaturen.
„Das war ein gutes Beispiel“, riss mich Rosi aus meinen Gedanken, „lass uns darüber schreiben, nur ein paar Minuten, ohne Druck.“ Zu meiner Überraschung verfasste ich eine ganze Seite über einen Esel, der möglichst ineffektiv über eine Brücke gehen wollte und Rosi revanchierte sich begeistert mit einer Geschichte über den Geburtsort unseres Wortes mit dem Namen Effeff.
3. Gesundes Misstrauen
Von da an traf ich mich jeden Mittwoch mit Rosi im Café. Ich war ein eher sparsamer Typ, doch sie vertrat die Meinung, man müsse sich ab und zu etwas gönnen, auch wenn man wenig Geld hatte. Der einzig genießbare Kuchen dort war Donauwelle, fand ich. Rosi bekam mit, wie ich meine Prinzipien um mich versammelte und mich auf den Putzjob im Westend bewarb. Den Vorsatz, nie mehr in einem öffentlichen Gebäude zu arbeiten, trug ich damals schon vor mir her, denn das Leben hatte mich gelehrt, dass ein gesundes Misstrauen gegenüber Menschen und Orten, an denen sie häufiger auftraten, viele Unannehmlichkeiten auf Abstand hielt. Auf Rosis Vermutung, sie wäre meine einzige Bezugsperson, gab ich zur Antwort, auch ohne Bezugspersonen falle man nicht ins Bodenlose, ein gesundes Nähe-Distanz-Verhalten sei das A und O. „Aha“, bemerkte sie und machte es sich auf dem Sofa bequem.
Als Jim später zu uns stieß, konnte sie sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen und meinte, dass ich trotz meines gesunden Nähe-Distanz-Verhaltens noch gut für Überraschungen sei. Er war mir in der Stadt aufgefallen, weil er ebenso oft wie ich zu Fuß ging. Wir hatten ein paar Worte gewechselt, über einen Betrunkenen, der mit mehr Glück als Verstand die Straße überquert hatte, und uns dann noch über anderes unterhalten, wenn man Jims karge Beiträge als Unterhaltung bezeichnen wollte. Schließlich hatte er mir mitgeteilt, dass er Posaune im Stadtorchester spielte, deshalb laute sein Spitzname ‚Herr Pos‘. Ich weigerte mich, Spitznamen zu benutzen, so etwas fand ich albern. „Aber ein geliebtes Kind hat viele Namen“, rief Rosi jedes Mal, wenn ich das sagte, aber ich war der Überzeugung, Spitznamen trügen zum allgemeinen Chaos bei, die Leute wussten am Ende gar nicht mehr, wer sie eigentlich waren. „Ich nenne ihn Jim“, beharrte ich, „auch wenn das ein komischer Vorname ist.“ „Ach, davon scheint es mehr zu geben.“ Rosi konnte unausstehlich sein.
Jim war selbst daran schuld gewesen, dass man ihn ‚Herr Pos‘ genannt hatte, das hatte er zugegeben. Er habe ständig Witze mit dem Wort ‚Posaune‘ gemacht. Er suche seine Aune, hatte er den Leuten gesagt, und dieses Rätsel erst spät aufgeklärt. Er war ein schrulliger Junggeselle und der langsamste Mensch, den ich je getroffen hatte. Wie er es vermochte, schnellere Stücke zu spielen und wie es wirklich in ihm aussah, war schwer zu erraten. Er nahm sich Zeit zum Überlegen und was er von sich gab, hatte er bestimmt einige Male im Kopf vor- und zurückgewendet. „Von der Milchstraße aus gesehen ist vieles bedeutungslos“ war sein Lieblings-Mantra. In anstrengenden Zeiten würde er früh zu Bett gehen, behauptete er, manches Problem erledige sich über Nacht von selbst. Ob das stimmte, konnte ich schlecht einschätzen, aber eines war sicher, er liebte Sterne und die Musik.
Schon bei unserem ersten Gespräch in der Stadt wurde mir Jim zum Vorbild, er hatte so viel mehr verstanden als ich. Auf meine Klage über die breite Masse hatte er nur gesagt, die kümmere ihn nicht. „Denken Sie nicht, dass manche Leute ihr Verhalten ändern sollten?“, hatte ich gefragt. „Nein, das bringt nichts.“ Ich sah ihn von der Seite her an, er strahlte tatsächlich Gelassenheit aus, etwas, was mir damals fehlte. „Und über Sie selber, machen Sie sich da Gedanken?“ „Nein, weniger. Sonst bringt man Dinge durcheinander.“ Ich überlegte, wie ich diese Radikalität fand. „Haben Sie Familie?“ Er schüttelte den Kopf, als würde er sich über die Frage wundern: „Nein.“ Während ich mich von den Leuten in der Bibliothek nachhaltig hatte kränken lassen, saß hier jemand und behauptete, völlig von der Bewertung anderer unabhängig zu sein. Ich gab noch nicht auf: „Hier laufen eine Menge Leute vorbei. Denken Sie sich nicht manchmal, wo gehen die hin, wo kommen die her?“ „Nein, das führt zu nichts.“ „Fehlt Ihnen denn nichts im Leben?“ Da sah er mir prüfend ins Gesicht. „Man darf nicht an der Vergangenheit hängen. Es gibt solche und solche Zeiten. Ich habe meine Musik. Ein Blick auf die Sterne reicht und ich nehme mich weniger wichtig.“ Das klang stimmig und faszinierte mich. Die Begegnung mit Jim half mir, mich zu sortieren und mir ein Gerüst zu basteln, das mich stützen sollte, ein Gerüst aus neun Prinzipien. Ordnung, Unabhängigkeit, gesundes Misstrauen, Gegenwart, Ortstreue, Konsequenz, Verantwortung, Sparsamkeit und nicht zuletzt: Keine Gefühlsausbrüche.
Auf dem Weg zu einem Treffen mit Rosi war ich Jim einige Wochen später wieder begegnet. Er trat etwas steif, wie es seine Art war, aus einem Hauseingang. Wir stutzten beide. „Da sind Sie ja wieder“, platzte ich heraus, „wie geht es Ihnen?“. Er lächelte sein feines Lächeln. „Es geht mir gut. Und Ihnen auch, wie ich sehe.“ Ohne darüber nachzudenken, woran er das festmachte, lud ich ihn spontan ein, mitzukommen. „Heute nicht“, schüttelte er den Kopf, doch er hörte aufmerksam zu, was ich ihm von den Mittwochstreffen im Café Ella erzählte und erklärte sich bereit, sich uns das nächste Mal anzuschließen. „Unsere einzige Bedingung für diese Treffen“, informierte ich ihn, „ist, ganz in der Gegenwart zu sein und nicht über die Vergangenheit zu sprechen. Dabei bedeutet Vergangenheit nicht ‚letzte Woche‘, sondern alles, was davor liegt, versteht sich.“ Das nahm er zustimmend zur Kenntnis.
Rosi hatte nichts dagegen, neugierig, wie sie war. Jim kam, sie beäugte ihn und nickte dann huldvoll. Er schlug seine langen Beine übereinander, legte seine Schreibsachen auf den Tisch, bot uns das Du an und fügte sich ein, als sei er von Anfang an dabei gewesen.
„Heute haben wir einen Gast, da will ich einmal anders vorgehen“, verkündete Rosi. „Zur Abwechslung habe ich kein Wort mitgebracht, ich werde mir eines suchen.“ Sie erhob sich vom Sofa, ging zur Garderobe und kam mit der Tageszeitung des Cafés zurück. „Ich deute einfach irgendwohin und über dieses Wort werden wir schreiben. Seid ihr soweit?“ Wir nickten. Das Papier raschelte beim Umblättern, Rosi schloss die Augen und ihr Finger pickte ein Wort heraus. „Heimweh“, las sie laut, und sah einen Moment ratlos in die Runde. Ein so gefühlsbetontes Wort hatte keiner von uns erwartet. „Und wie soll das gehen, ohne über Vergangenheit zu schreiben?“, fragte ich. Sie zuckte mit den Schultern. „Das geht!“, entschied sie, und drehte die Sanduhr um.
Mein Stift schrieb wie von selbst los, als habe er lange darauf gewartet, diese Zeilen endlich zu Papier zu bringen.
„Das Heimweh will dein Bestes, es will, dass du dich wieder erinnerst, an die große Wolldecke mit den roten Rauten auf blauem Grund. Es möchte, dass du dich in Gedanken darin einwickelst und dich in der Geborgenheit wiederfindest, die es für dich, Kind, reichhaltig gab. Es will, dass du dieses Gefühl ganz tief in dir aufnimmst und dass es dich durch die nächste Zeit hindurch trägt. Das Heimweh will, dass du dir am Markt eine bestimmte Sorte Äpfel kaufst und dir einen Apfelkuchen bäckst. Der Zimtgeruch soll sich in der ganzen Wohnung ausbreiten, dich jeden Tag von Neuem schnuppernd nach ihm suchen lassen und sich in deiner Kleidung auf dem Weg zum Friedhof nicht verlieren. Das Heimweh will, dass du den Globus ein Stück weiter drehst, genau so weit, dass das Land, in das ihr beide so gern gereist seid und das sonst sorgfältig mit dem Gesicht zur Wand gerichtet ist, nach vorne wandert wie die vielen Sanddünen, die sich in ihm fortbewegen auf eine ebenso geheimnisvolle Art und Weise. Es will, dass sich dein Herz mit der Hitze der Wüste sättigt und dich, wenn du deinen Lieblingsmenschen vermisst, warm durchströmt. Sei offen für das Heimweh.“
Ich las den Text vor und sagte entschuldigend in das entstandene Schweigen, ich wüsste nicht, aus welchen Tiefen er aufgestiegen war, der Inhalt habe nichts mit mir zu tun, ich wäre nie in der Wüste gewesen. „Du kannst dich doch nie an deine Träume erinnern“, meinte Rosi und zupfte sich am Ohrläppchen. „Vielleicht war das eine Art Ersatz.“ Es sah aus, als überlege sie noch eine Weile, dann forderte sie Jim auf, vorzulesen. Wir beide waren sehr gespannt. Langsam hob er das Blatt vor die Augen und begann.
„Alle ehemaligen Astronauten haben Heimweh. Ihnen fehlt die Schwerelosigkeit. In ihr ist alles leicht. Wenn man sich einmal an das Leben in Schwerelosigkeit gewöhnt hat, will man immer dahin zurück. Dort gibt es weder festen Boden unter den Füßen noch Oben und Unten. Menschen bestehen zum großen Teil aus Wasser, sie sind wie Wassertropfen. Ein Tropfen formt sich im Fall zu einer vollendet runden Kugel. Nichts zieht an ihm, er schwebt. So empfindet auch ein Mensch im All. Gegenstände sind anders, sie müssen befestigt werden, sonst fliegen sie unkontrolliert herum. Beim Essen, Trinken oder Waschen müssen alle Flüssigkeiten abgesaugt werden, sonst verteilen sie sich in der Raumstation. Selbst beim Schlafen muss für eine ausreichende Befestigung gesorgt werden. Nur in Träumen kann man ähnlich schweben. Und beim Hören von Musik.“
Jims Blick war noch in seinem Blatt gefangen, da klatschte Rosi bereits in die Hände: „Wie schön. Wir haben einen Dichter unter uns.“ Er zuckte zusammen und nahm dann ihre Begeisterung bescheiden zur Kenntnis. Ich sagte, es sei sonderbar, selbst bei mir habe das Wort ‚Heimweh‘ für einen gefühlvolleren Text als üblich gesorgt. „Und damit meine ich nicht, dass er irgendwie verweichlicht ist, es hat eher mit Kontrollverlust zu tun.“ „Ach was“, rief Rosi, „du siehst das viel zu negativ. Das ist doch gerade das Schöne, dass Wörter uns mitnehmen können, auf andere Ebenen, oder in andere Welten.“ „Wir schreiben doch keine Romane“, wendete ich brummig ein. „Na und? Das gilt für alle Texte, stimmt’s, Jim?“ Mir blieb die Luft weg, verhielt sie sich anders, nur weil ein Mann im Raum war? Doch Jim antwortete sehr diplomatisch, dass seine unmaßgebliche Meinung nicht ins Gewicht falle. Rosi überlegte kurz, winkte Gunda herbei und fragte, ob sie lese, um in andere Welten einzutauchen. Die verschränkte die tätowierten Unterarme und fragte zurück: „Sollte das nicht jedem selbst überlassen sein?“ Rosi verdrehte die Augen: „Na gut, ich gebe mich geschlagen. Jeder liest das rein oder raus aus allen Texten, was er will und braucht. Sind wir uns da einig?“ „Ja“, kam es wie aus einem Mund, von Gunda, Jim und mir.
4. Gegenwart
Ich war lange nicht mehr mit dem Zug unterwegs gewesen, das wurde mir auf dem Weg zu meiner neuen Arbeitsstätte bewusst. Bahnfahren lief unter ‚Nutzung öffentlicher Räume‘ und ich versuchte, es zu vermeiden. Ein Auto konnte ich mir von dem Putzgeld nicht leisten. Zum Glück war ich sportlich und kam zu Fuß und notfalls mit dem Bus überall hin. Ich mochte meine Beine und war sicher, sie würden mich noch lange nicht im Stich lassen. Nebenbei hielt ich mein Geld zusammen und entging als Zugabe den Unzuverlässigkeiten, die öffentlicher Nahverkehr mit sich brachte. Außerdem war ich nicht ängstlich. Man hatte seinen Alltag zu bewältigen, seinen Job so gut zu machen wie möglich und Punkt. Alles andere war Zeitverschwendung.
Zu meiner Überraschung hatte man mittlerweile in den Abteilen Regale eingebaut, für Bücher, die keiner mehr haben wollte. Anscheinend gab es Leute, die auf ausgesetzte Bücher scharf waren. Ich hatte lange genug in der Bibliothek gearbeitet, um Büchern gegenüber kritisch zu sein, aber im Allgemeinen vermied ich, meine Abneigung laut zu äußern, um nicht in die Ecke der Ungebildeten und Unbelehrbaren gestellt zu werden. Dabei hatte ich jede Menge Bücher gelesen, denn anfangs hatte ich noch an sie geglaubt. In der Regel hatte das wenig gebracht. Man musste sich nur ansehen, welche Summen die Leute für Ratgeber-Literatur ausgaben, ohne irgendeinen Fortschritt zu erzielen, anstatt durch simples Nachdenken von selbst auf die eine oder andere Wahrheit zu kommen. Am Ende waren Bücher nichts als Staubfänger. Entweder sie befassten sich mit der Vergangenheit, was zu ungesundem Grübeln führte, oder sie gaukelten Freiheit vor, als ob Freiheit des Denkens oder persönliche Freiheit jemals realisiert werden könnten. Wir alle waren ferngesteuert, was Herkunft, Werte und Ziele anging.
Das Regal im Zug enthielt einige Exemplare zerlesener Romane und einen veralteten Reiseführer durch Marokko. Im untersten Fach befand sich ein Buch mit einem türkisfarbenen, gemusterten Stoffeinband, der mich an den Bezug des Sofas im Café Ella erinnerte. Aus einer Laune heraus nahm ich es beim Aussteigen mit, bemerkte flüchtig den dunkelroten Lederrücken und die im gleichen Leder eingefassten Buchecken. Beim Weitergehen blätterte ich es auf und stieß auf linierte, mit winziger Handschrift dicht beschriebene Seiten, es schien sich um ein Tagebuch zu handeln. Ich fand es unmöglich, solche privaten Aufzeichnungen an die Öffentlichkeit zu zerren. Tagebuchschreiber waren Leute, die sich vor Verantwortung scheuten und in Selbstmitleid schwammen. Unangenehm berührt schlug ich das Buch wieder zu. Nur wegen des Stoffmusters nahm ich es mit, das wollte ich unbedingt Rosi zeigen, es war fast dasselbe, auf dem sich mittwochs ihr Hinterteil breitmachte.
Am Bahnhofsvorplatz bestieg ich den Bus und war erleichtert, dass die meisten Sitzplätze frei waren. Dicke Menschen waren oft so raumgreifend, weshalb ich meist gleich nach dem Öffnen der Läden zum Einkaufen ging, da waren die Dicken noch nicht da. Rosi war auch nicht gerade dünn, doch sie war eine Ausnahme, merkwürdigerweise vergaß ich immer, dass sie zu viel auf den Rippen hatte. Wenn ich sie sah, erwachte ein ganz anderes Bild in mir, das Bild einer Frau in einem dicken Mantel, in den sie sich wickelte, um sich zu schützen. Auch ihr Gesicht war merkwürdig wandelbar. Mal wirkte es viel jünger, dann strahlte es etwas frisches und energiegeladenes aus, an anderen Tagen hatte es einen verhärmten Ausdruck und erinnerte mich an das einer alten Hexe voller Verbitterung über eine Welt, die fehlerbehaftet und ungerecht war.
Was ich insgeheim von ihr dachte, war mir einmal herausgerutscht, als wir uns schon eine Weile kannten: „Du bist die geborene Mitläuferin, Rosi!“ Prompt konterte sie: „Und du bist eingebildet!“ Ab und zu schien sie an mir üben zu wollen, mutig zu sein. Ruckartig richtete sie sich auf und kam dabei ins Schwanken. „Fall bloß nicht vom Sofa“, sagte ich lässig, erhob mich und ging zu den Toiletten. „Und du pass mit deinen Vorurteilen auf, je öfter man Leute mit Etiketten versieht, desto mehr färben sie auf einen selber ab“, rief sie mir nach. Wo hatte sie das nur gelesen? Ich sah beim Händewaschen in den Spiegel. Ich hatte ein halbes Jahrhundert Lebenserfahrung, aber eingebildet war ich ganz und gar nicht. Ich war ungeschminkt und stand zu meinen grauen Haaren, ich war ein unkomplizierter, sportlicher Typ und bemühte mich, korrekt zu sein. Umso mehr hatte mich verletzt, dass man in der Bibliothek ständig an mir herumkritisiert hatte. Anstatt sich für das, was ich dachte, zu interessieren, war man sich schnell einig gewesen, dass ich unbequem war und bald hatten mir alle zu verstehen gegeben, dass ich nicht ins Team passte.
Das Kunstmuseum hatte man weit draußen am Rand der Stadt an eine ehemaligen Fabrikantenvilla angebaut, in der übertriebenen Hoffnung, die Leute würden von weit her anreisen und sich für Ausstellungen interessieren, die so oder so ähnlich in allen Städten der Republik zu finden waren. Kurz bevor ich es das erste Mal betrat, rief ich mir noch einmal ins Gedächtnis, dass es nichts zu befürchten gab. Wenn ich konsequent meine Prinzipien verfolgte, würden die paar Wochen mich nicht aus der Bahn werfen. Im Übrigen würde alles so weitergehen wie bisher. Unsere Mittwochstreffen würden stattfinden, ab und zu ein Stück Kuchen war okay, ich war fit und mir passten Hosen, die ich mir vor fünfundzwanzig Jahren gekauft hatte.
Öffentliche Orte hatten manchmal mehr Gemeinsamkeiten als erwartet. Wie die Bibliothek verfügte das Museum über einen Altbau, der seine Vergangenheit selbstgefällig zur Schau trug. Obwohl an einer Fassade nichts verdienstvoll war, hing man der Überzeugung an, dass Villen oder alte Fabrikgebäude grundsätzlich erhaltenswert waren. Man ignorierte den Fortschritt, man klebte an Vergangenem wie Fliegen am Leim und erhob die gute alte Zeit, die es nie gegeben hatte, zum Ideal. In jenen Tagen hätte ich nicht putzen wollen, überall Ruß und Dreck und nie genug heißes Wasser, um in der Küche das Fett zu beseitigen. Das Hauptgebäude des Museums war auch so ein Fall, es tat mit seinem Inhalt so, als sei es modern, doch die knarzenden Böden mit den breiten Rissen, die von den gekrümmten Wänden abstehenden Fußleisten und die hohen, schwer zu erreichenden Decken, an denen sich Spinnen und Fliegen versammelten, sprachen eine andere Sprache. Man hatte lediglich neue Toiletten in die denkmalgeschützten Räume eingebaut.
Ich sah immer zu, dass ich mit meiner Arbeit im Altbau schnell durchkam und verbrachte meine Pause im Innenhof. Vier Holzbänke mit je einem Magnolienstrauch ragten wie Inseln aus dem grauen, feinkörnigen Kies. Jemand hatte an einem Zweig einen fast unsichtbaren Stern aus Glas aufgehängt. Ich ließ ihn hängen, denn manchmal fing er von irgendwo Helligkeit ein und blinkte. Nach der Pause putzte ich im großen modernen Nebengebäude weiter, dessen Fenster meist mit hellen Stoffen verhängt waren, damit die Sonne nicht die Farben der Kunst ausbleichen konnte.
Beim Antritt meiner Arbeitsstelle gab es im Hauptgebäude Radierungen zu sehen, nichts daran sah radiert aus, bei der Technik wurden Motive in Platten geritzt und abgedruckt. Mit den Arbeiten konnte ich wenig anfangen. Der Künstler hatte im Ersten Weltkrieg den Ablauf der Offensive dokumentiert und eine Flut detailgenauer Zeichnungen von Unterständen, Dörfern und Vieh, von toten Pferden, zerschossenem Wald und verbrannten Häusern erzeugt. Mir reichten derartige Themen in den Abendnachrichten. Unter einem großen, sehr düsteren Bild stand zur Erklärung, der Künstler sei in eine Krise geraten und habe in der gezeigten Arbeit alle von ihm gesehenen Verheerungen über Mensch und Natur dargestellt. Kein Wunder, dass man in eine Krise geriet, wenn man solche Geschehen so nah hatte herankommen lassen.