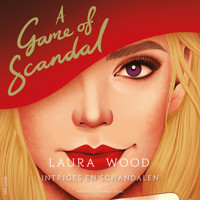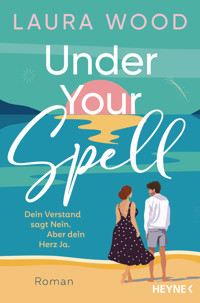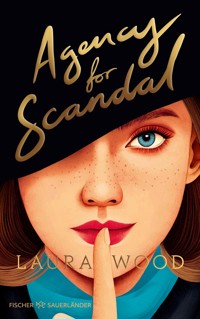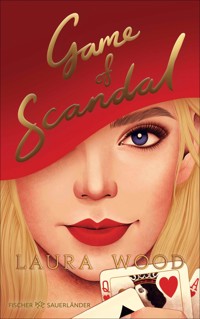
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Agency for Scandal-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein Skandal jagt den nächsten: Band 3 der Cosy Historical Romance ab 14 – ein Must-Read für alle, die Romantik, Spannung und ein bisschen Crime lieben Felicity Vane denkt nicht im Traum daran zu heiraten. Sie will Mathematik studieren! Um den gesellschaftlichen Erwartungen zu entfliehen, beschließt sie, ihre Universitätsgebühren beim illegalen Kartenspiel zu gewinnen. Es ist der perfekte Plan – wäre da nicht Ash: Der verboten gut aussehende Besitzer des Casinos beschuldigt Felicity prompt des Betrugs. Zudem weckt ihr Geschick im Spiel die Aufmerksamkeit eines überaus gefährlichen Mannes, den auch die Ladys vom Finkennest bereits im Visier haben. Während sie zusammen mit Ash in eine kriminelle Verschwörung hineingezogen wird, spielt Felicity bald nicht mehr nur um Geld und ihre Zukunft – sondern auch um ihr Herz. Es geht weiter mit der Detektei rund um die starken jungen Frauen der Agency for Scandal! So spannend und zutiefst romantisch war es im viktorianischen London noch nie – Jane Austen wäre entzückt! - Perfekte Cosy Historical Romance für alle ab 14 - Mutige junge Detektivinnen der Agency for Scandal sorgen für Gerechtigkeit in der skandalumwitterten Welt der Oberschicht - Voller romantischer Verwicklungen und für alle, die »Enola Holmes« und »Bridgerton« lieben!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Laura Wood
Game of Scandal
Band 3
Über dieses Buch
Ein Skandal jagt den nächsten: Band 3 der Cosy Historical Romance ab 14 – ein Must-Read für alle, die Romantik, Spannung und ein bisschen Crime lieben
Felicity Vane denkt nicht im Traum daran zu heiraten. Sie will Mathematik studieren! Um den gesellschaftlichen Erwartungen zu entfliehen, beschließt sie, ihre Universitätsgebühren beim illegalen Kartenspiel zu gewinnen. Es ist der perfekte Plan – wäre da nicht Ash: Der verboten gut aussehende Besitzer des Casinos beschuldigt Felicity prompt des Betrugs. Zudem weckt ihr Geschick im Spiel die Aufmerksamkeit eines überaus gefährlichen Mannes, den auch die Ladys vom Finkennest bereits im Visier haben. Während sie zusammen mit Ash in eine kriminelle Verschwörung hineingezogen wird, spielt Felicity bald nicht mehr nur um Geld und ihre Zukunft – sondern auch um ihr Herz.
Es geht weiter mit der Detektei rund um die starken jungen Frauen der Agency for Scandal! So spannend und zutiefst romantisch war es im viktorianischen London noch nie – Jane Austen wäre entzückt!
»Clever, romantisch und vollkommen süchtig machend.« Julia Quinn, Autorin der Bridgerton-Reihe
Alle Bücher der Agency for Scandal-Reihe:
Band 1: Agency for Scandal
Band 2: Season for Scandal
Band 3: Game of Scandal
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischer-sauerlaender.de
Biografie
Laura Wood wurde in den englischen Midlands geboren und ist preisgekrönte Schriftstellerin. Sie promovierte über die Literatur des neunzehnten Jahrhunderts und schreibt Bücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Laura Wood lebt mit ihrem Mann und ihrem Hund in Warwickshire und hat eine Schwäche für Liebesromane, Tee, schönes Briefpapier, salziges Karamell und Feminismus.
Petra Koob-Pawis studierte in Würzburg und Manchester Anglistik und Germanistik und ist seit vielen Jahren als Übersetzerin tätig. Sie lebt in der Nähe von München.
Impressum
Dieses Buch kann sensible Themen Elemente enthalten. Weitere Informationen dazu findest du am Ende des Buches. (Achtung, diese Hinweise enthalten Spoiler!)
Zu diesem Buch ist beim Argon Verlag ein Hörbuch erschienen, das als Download und bei Hörbuch-Streamingdiensten erhältlich ist.
Erschienen bei Fischer Sauerländer E-Book
Die englischsprachige Originalausgabe erschien 2025
unter dem Titel A Game of Scandalbei Scholastic Children’s Books, London.
Text © Laura Wood, 2025
Illustration © Mercedes deBellard, 2025
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2025, Fischer Sauerländer GmbH,
Hedderichstraße 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Dahlhaus & Blommel Media Design, Vreden, nach einer Idee von Mercedes deBellard / Folio Illustration Agency
Coverabbildung: Mercedes deBellard, 2024
ISBN 978-3-7336-0949-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Teil Eins
Kapitel 1
Kapitel 2
Teil Zwei
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Teil Drei
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Teil Vier
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Teil Fünf
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Epilog
Danksagung
Für meine Nummer eins und besten Freund, Archie
Teil Eins
Februar 1900
Kapitel 1
Meiner Ansicht nach wurden Hochzeiten völlig überbewertet.
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen – die Braut war wunderschön, der Bräutigam hinreißend, und die Blicke, die sie sich zuwarfen, hätten selbst ein Herz aus Stein zum Schmelzen gebracht. Gegen Hochzeiten an sich hatte ich auch gar nichts einzuwenden. Die Zeremonie war jedoch sterbenslangweilig. Seit Stunden saßen wir nun schon in dieser Kirche, der Pfarrer schwadronierte munter vor sich hin, und das Ganze schien einfach kein Ende nehmen zu wollen.
Ich blickte auf meine Handschuhe, die ich in meinem Schoß zwischen den Fingern hielt. Eigentlich hatte ich gedacht, ich hätte sämtliche Tintenspritzer entfernt, aber an der Seite meiner rechten Hand entdeckte ich einen saphirblauen Fleck. Während der Pfarrer seine endlose Predigt zum Thema Ehe fortsetzte, versuchte ich, die Farbe wegzurubbeln.
War das nicht alles ein bisschen übertrieben? Ein kurzes »Willst du? Ja, ich will« täte es doch auch, oder nicht? Musste wirklich die ganze Gemeinde hören, wie fruchtbar diese Ehe nach Meinung des Pfarrers sein sollte? Ich jedenfalls fand es unhöflich von ihm, das Paar auf das Thema Fortpflanzung anzusprechen (vor Publikum!), wo die beiden sich doch erst vor wenigen Augenblicken ihr Eheversprechen gegeben hatten. Abgesehen davon war Iris Scott-Holland gerade mal ein Jahr älter als ich. Allein der Gedanke ließ mich erschaudern.
»Hör auf zu zappeln«, murmelte mein Bruder Max mit zusammengepressten Zähnen.
»Ich zapple nicht«, flüsterte ich zurück und knuffte ihn in die Seite. »Ich schaudere.«
Mein Bruder blickte mit unbewegter Miene geradeaus, aber auf meiner anderen Seite spürte ich die bebenden Schultern seiner Frau Izzy.
»Felicity, bitte bring mich nicht dazu, in der Kirche loszulachen«, sagte sie leise.
»Der Pfarrer scheint sich sehr für fleischliche Dinge zu interessieren, findet ihr nicht auch?«, überlegte ich, ebenfalls mit gedämpfter Stimme. »In der Öffentlichkeit ist es eher nicht üblich, über diese Dinge zu reden. Seltsam, dass es ausgerechnet in der Kirche akzeptabel ist.«
Izzys Schultern bebten stärker.
Neben Izzy fragte ihre beste Freundin, Teresa St.Clair, ein bisschen zu laut: »Was ist so lustig?«
Max gab einen Laut von sich, der wie das Fauchen eines zornigen Katers klang.
Ich schnaubte und beschloss, meine Aufmerksamkeit von dieser langweiligen Trauung abzuwenden und mich stattdessen der Frage zu widmen, wie das Prinzip der harmonischen Progression mit dem besonders kniffligen mathematischen Problem zusammenhing, zu dem Dr. Volterra von der Universität in Rom und ich kürzlich korrespondiert hatten. Diese Strategie funktionierte wunderbar, und als Nicholas Wynter laut »Endlich!« rief (womit er die Gedanken der gesamten Kirchengemeinde laut aussprach) und seine Braut mit einer Begeisterung küsste, die ein schockiertes Glucksen durch die Reihen gehen ließ, konnte ich bereits erfreuliche Fortschritte verzeichnen. Sobald wir wieder zu Hause waren, würde ich mir einige Notizen dazu machen.
Geschwätziges Raunen setzte ein, und nachdem das Brautpaar wieder den Mittelgang entlanggeschritten war, verließen nacheinander alle die Bankreihen im Kirchenschiff.
»Ach«, seufzte Teresa. Sie tupfte sich mit ihrem Taschentuch die Augen und stand auf. »Das war sehr ergreifend, nicht wahr? Ich liebe Hochzeiten. Da hat man immer eine schöne Ausrede, um mal richtig zu weinen.«
»Als bräuchtest du eine Ausrede dafür«, neckte Izzy sie. »Ich kenne niemanden, der so nah am Wasser gebaut ist. Erst heute Morgen hat dich der Roman, den du gerade liest, zu Tränen gerührt.«
»Ich bin eben sehr gefühlvoll«, erwiderte Teresa schniefend. »Was ist daran falsch?«
»Überhaupt nichts«, versicherte ihr Ehemann und legte seinen Arm um ihre Taille. Er neigte den Kopf und flüsterte ihr etwas ins Ohr, woraufhin ihre Wangen dasselbe leuchtende Rosa annahmen wie ihr Kleid.
»James! Wir sind in der Kirche!«, zischte sie und schlug nach seinem Arm, aber ihr verschmitztes Schmunzeln sprach Bände.
Ich verdrehte die Augen. Das Problem mit den St. Clairs war, dass sie ständig herumturtelten. Max und Izzy waren kaum besser. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal erleben würde, wie mein stets vernünftiger großer Bruder sich in einen weichherzigen Trottel verwandelte – aber genau dazu wurde er, wenn es um seine Frau ging.
In den letzten Jahren hatte ich mir angewöhnt, meine Anwesenheit möglichst geräuschvoll anzukündigen, bevor ich zu Hause einen Raum betrat, da ich immer damit rechnen musste, die beiden in einer innigen Umarmung vorzufinden. Und als Max’ Schwester fand ich diesen Anblick einigermaßen gruselig. Er schämte sich nicht einmal. Das war mehr als genug, um einen vernünftigen Menschen von jeglicher Romantik abzuschrecken.
Wir traten in die Februarsonne hinaus, die die wunderschöne, mit Frost überzogene Landschaft in ein blasses Licht tauchte, und schlossen uns der Schar gut gekleideter Gäste an, die den Pfad von der Kirche zum großen Haus entlanggingen. Die Wynters hatten beschlossen, auf dem Anwesen von Iris’ Familie in Kent zu heiraten, wo, wie es hieß, im Laufe der Jahre schon viele rauschende Feste stattgefunden hatten.
Ich war nicht die Einzige, die sich über diese Entscheidung wunderte. Nicholas Wynter war einer der elegantesten Männer des Landes, und seine Frau wäre sicherlich die Unvergleichliche der kommenden Saison geworden, wäre Lord Wynter nicht allen anderen heiratsfähigen Junggesellen zuvorgekommen (sehr zu deren Leidwesen), indem er sie praktisch vom Fleck weg zum Altar führte. Normalerweise würde man da eine prachtvolle Zeremonie in der Stadt erwarten, mit viel Pomp und Prunk, im Beisein von allerlei Würdenträgern und dem einen oder anderen Mitglied des Königshauses. Aber die geladene Hochzeitsgesellschaft war viel kleiner und intimer.
Vielleicht lag es an der mysteriösen Geschichte der Braut. Niemand wusste genau, wo Iris Scott-Holland in den letzten Jahren gewesen war, auch wenn viele Gerüchte kursierten. Am weitesten verbreitet war die Geschichte, dass sie irgendwo in Europa zur Schule gegangen war. Aber ich wusste es besser und lächelte in mich hinein. Ich fragte mich, wie empört viele der Gäste wohl wären, wenn sie wüssten, dass Iris Scott-Holland als Mädchen weggelaufen war, sich in London durchgeschlagen und als Näherin gearbeitet hatte, nur um sieben Jahre später nach Hause zurückzukehren und das Familienanwesen zu beanspruchen, das rechtmäßig ihr gehörte? Und in genau jenem Haus fand die heutige Feier statt.
Das nenne ich mal eine gute Geschichte.
»Felicity!«, hörte ich jemanden rufen. Ich drehte mich um und sah die Person, die mir die ganze Geschichte überhaupt erst erzählt hatte: meine Freundin und Iris’ Stiefschwester Cassandra Weston.
»Dem Himmel sei Dank, dass du hier bist«, sagte Cassie. Sie hakte sich bei mir unter und zog mich von meiner Familie weg. Ich warf Max einen Blick zu und sah, wie er die Worte Benimm dich! mit den Lippen formte. Ich lächelte ihn engelsgleich an, woraufhin seine Augen schmal wurden. Er kannte mich zu gut.
Max war zwar mein Bruder, aber er hatte mich praktisch großgezogen. Unser Vater war gestorben, als ich vier und Max zwölf Jahre alt war, und meine Mutter, das musste ich mir bei aller Liebe eingestehen, hatte nie großes Interesse an mir gezeigt, inbesondere weil ich – zumindest nach den gängigen gesellschaftlichen Maßstäben – so eigenartig war. Max war mit achtzehn Jahren mein gesetzlicher Vormund geworden, wobei er mich in seiner ritterlichen Art schon all die Jahre zuvor behütet und umsorgt hatte. Was konnte ich denn dafür, dass ich dazu neigte, in Schwierigkeiten zu geraten …? Ich war eben von Natur aus neugierig und steckte als Kind ständig meine Nase in Dinge, die mich nichts angingen. Ich wollte schon immer wissen, wie die Welt funktionierte – woran sich bis ins Erwachsenenalter nichts geändert hatte.
Meiner Ansicht nach gab es einen direkten Zusammenhang zwischen Vorfällen, bei denen ich mich auf der Suche nach einer Dachsfamilie im Wald verirrte oder beinahe das Haus in Brand setzte. Oder wenn ich eine Gaslampe in ihre Einzelteile zerlegte oder mich meinem intellektuellen Interesse an der Lösung mathematischer Probleme widmete. Dabei ging es mir immer darum, immer noch mehr zu wissen – ich wollte wissen, warum die Dinge so waren, wie sie waren. Für jedes Problem gab es eine logische Erklärung. Zu meinem Leidwesen gab es jedoch einen Bereich, in dem ich nur sehr wenig Logik erkennen konnte, und das war das gesellschaftliche Leben mit seinen unzähligen verwirrenden und widersprüchlichen Regeln.
Es ist nicht so, als hätte ich nicht versucht, mich so zu verhalten, wie es meine Familie von mir erwartete, aber ich habe es nie richtig hinbekommen. Ich schien Ärger anzuziehen wie ein Magnet, und dann musste stets Max eingreifen, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen.
Dies hatte zu der beklagenswerten Situation geführt, in der ich mich jetzt befand: Ich war achtzehn Jahre alt, und wann immer mein Bruder mich anblickte, sah er vermutlich das vorlaute kleine Mädchen mit Zöpfen und Kniestrümpfen vor sich.
»Ich dachte schon, der Gottesdienst nimmt nie ein Ende.« Cassie stöhnte, als wir uns ein paar Schritte hinter die anderen zurückfallen ließen, um den wachsamen Blicken meines Bruders zu entgehen.
»Ja, schier endlos«, stimmte ich zu.
Cassies Blick bohrte sich in Max’ Rücken. Mein Bruder war bereits auf den Weg ins Haus, während wir immer langsamer wurden und höflich lächelnd die Leute vorbeiließen. »Und?« Ihre Augenbrauen schnellten in die Höhe. »Was hat er gesagt?«
Mein Gesichtsausdruck musste meine Frustration widergespiegelt haben, denn Cassie stieß enttäuscht die Luft aus. »Er hat wieder Nein gesagt?«
»Nicht direkt Nein«, murmelte ich. »Sondern noch nicht, wogegen sich viel schwerer etwas einwenden lässt.« Ich seufzte. »Er sagt, dass wir das mit der Universität noch einmal überdenken können, wenn ich meine erste Saison hinter mich gebracht habe. Er sagt, dass Mutter sich schon darauf freut, nach London zu kommen, um mich überall als Debütantin vorzuzeigen und an Festen teilzunehmen. Dass es sie glücklich machen würde und es mir vielleicht sogar gefallen könnte. Er stellt es so hin, als wäre das eine Frage der Vernunft, als würden mir damit mehr Optionen offenstehen, aber er ist so leicht zu durchschauen. Er glaubt ernsthaft, dass ich, sobald ich einen Ballsaal betrete, den erstbesten adeligen Langweiler anschmachte, denn dann könnte er mich in den sicheren Hafen der Ehe lotsen, und ich würde mir das Studium der Mathematik aus dem Kopf schlagen. Er tut so, als wäre das Ganze nichts als die … Träumerei eines kleinen Mädchens.«
Cassie grummelte entrüstet, was mir ein Lächeln entlockte. Es war ein Geschenk, eine Freundin zu haben, die so unerschütterlich an meiner Seite stand. Wie ich hatte auch sie keine große Lust auf einen Ehemann. In ihrem Fall lag dieser Entscheidung ein mangelndes Interesse an Romantik zugrunde. Bei mir … nun, ich hatte bereits einen Mann in meinem Leben, der mich bevormundete. Ich sah absolut keine Notwendigkeit, einen weiteren hinzuzufügen.
»Ich hätte mehr von ihm erwartet«, erklärte sie mit missbilligendem Unterton. »Ich dachte, er wäre in den letzten Jahren so viel fortschrittlicher geworden. Seine Rede im Parlament letzte Woche war geradezu ein Weckruf.«
»Das stimmt auch«, sagte ich hastig, denn trotz allem verspürte ich das Bedürfnis, Max zu verteidigen. »Er würde dir versichern, dass er die Bildung von Frauen befürwortet, und das meint er auch so. Aber hier geht es um mich. Und bei seiner kleinen Schwester war er schon immer überfürsorglich. Außerdem wird Mutter außer sich sein, wenn sie von meinen Plänen erfährt. Max versucht lediglich, den Familienfrieden so lange wie möglich zu bewahren.«
Cassie nickte. »Trotzdem …« Sie verstummte.
»Trotzdem ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.« Ich erwiderte ihren Blick, und ein breites Lächeln breitete sich in meinem Gesicht aus. »Er glaubt, dass ich meinen Plan aufgebe, aber er wird schon noch merken, dass er sich täuscht.«
»Was hast du vor?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Mir wird irgendetwas einfallen. Vielleicht sollte ich mich noch mal mit Izzy unterhalten. Ich weiß, dass sie sich nicht in mein Verhältnis zu Max einmischen will, aber wenn jemand ihn zur Vernunft bringen kann, dann sie.« Ich zog mit der Fußspitze eine Linie in den Boden und handelte mir damit einen Fleck auf meinen albernen rosa Schleifchenschuhen ein.»Alles wäre so viel einfacher, wenn ich selbst auf mein Treuhandvermögen zugreifen könnte. Was für einen Sinn hat es, dieses Vermögen zu besitzen, wenn ich erst Max um Erlaubnis bitten muss, bevor ich etwas davon ausgeben darf? Ich kann nicht über mein eigenes Geld verfügen, aber ich kann auch keine Arbeit annehmen, weil eine Lady nicht arbeitet. Wenn es nach Max ginge«, redete ich mich in Rage, »würde ich heiraten und alle Geldangelegenheiten meinem Ehemann überlassen. Das macht mich so wütend. Ich habe genauso viel Recht auf mein Erbe wie er. Himmel noch mal, ich würde es besser verwenden als die meisten Männer in meinem Bekanntenkreis. Ist eine gute Ausbildung denn wirklich etwas so Unerhörtes?«
Cassie nickte entschieden. »Wie recht du hast!«, sagte sie. »Wenn Iris nicht wäre, würde ich immer noch zu Hause festsitzen und darauf warten, etwas aus meinem Leben zu machen.« Sie griff nach meiner Hand und umfasste sie. »Niemand hat mehr Tatendrang als du«, sagte sie. »Max hat das noch nicht erkannt, aber er wird es schon noch begreifen. Es wäre sträflich, einen Geist wie deinen in einen Käfig zu sperren. Er liebt dich. Irgendwann wird er das einsehen. Du weißt doch, Männer können manchmal schrecklich begriffsstutzig sein.«
Ihre Worte waren wie ein warmes Getränk an einem kalten Tag – ein wohliges Gefühl breitete sich in mir aus. Cassie glaubte unerschütterlich an mich, und das schon seit wir uns vor vier Jahren bei einer der wenigen gesellschaftlichen Anlässe kennengelernt hatten, an denen Mädchen aus gutem Hause teilnehmen durften: einer langweiligen Teeparty in einem Londoner Privathaus. Ich hatte mitbekommen, wie Cass sich mit ein paar stibitzten Sandwiches nach draußen schlich, um sie an den dicken Mops der Gastgeberin zu verfüttern, und von diesem Moment an waren wir Freundinnen.
Cassie hatte einen scharfen Verstand und verachtete alles Konventionelle. Bis vor Kurzem war es ihr – genau wie mir – verwehrt gewesen, diesen Verstand sinnvoll einzusetzen. Aber dann waren ihre Mutter und ihre Schwester nach Europa aufgebrochen, hatten Cassie bei Iris zurückgelassen und ihr Zugang zu dem Vermögen gewährt, das ihr von ihrem Stiefvater vermacht worden war. Kaum waren die beiden weg, hatte Cassie sich am University College in London für ein Medizinstudium eingeschrieben. Das hatte zu gleichen Teilen Stolz als auch Neid in mir ausgelöst, und ganz eindeutig hatte ihre Entscheidung erst jene Entschlossenheit in mir entfacht, mit der ich Max von meinen Plänen zu überzeugen versuchte. Ich hatte einen Verstand – einen brillanten noch dazu –, und ich war entschlossen, ihn zu nutzen.
Bereits mit acht Jahren hatte ich mich weitaus mehr für Zahlen begeistert als die Gouvernante, die mich unterrichtete, und Max hatte – wohl mehr oder weniger zum Spaß – einen jungen Lehrer aus Oxford engagiert, der mir Mathematik beibringen sollte. Mit zehn war ich dem Mann haushoch überlegen. In der Zwischenzeit hatte ich gelernt, in Büchern und Zeitschriften zu stöbern und einen Briefwechsel mit einigen der bedeutenden Mathematikern unserer Zeit begonnen (immer unter dem Namen F. Vane, da ich ahnte, dass die betreffenden Herren mir nicht so entgegenkommend antworten würden, wenn sie wüssten, dass ich ein Mädchen war).
Aber wonach ich mich sehnte und was ich jetzt brauchte, war eine Ausbildung: eine richtige Ausbildung unter professioneller Anleitung. Ich hatte jede Menge Detailwissen und eine natürliche Begabung, aber ich war zu mehr fähig, das wusste ich. Ich müsste nicht einmal die Stadt verlassen, denn ich musste ja nicht unbedingt gleich im glorreichen Cambridge studieren. Das University College in London akzeptierte Frauen, und selbst die Mathematical Society hatte weibliche Mitglieder in ihre Reihen aufgenommen, die wichtige Arbeit leisteten und ihre Ergebnisse sogar veröffentlichten. Ich wünschte mir so sehr, Teil von alldem zu sein, dass mich allein bei dem Gedanken daran die Sehnsucht zu verzehren drohte. Wir standen am Beginn eines neuen Jahrhunderts, und plötzlich schien alles möglich.
»Lass uns jetzt nicht darüber nachdenken«, sagte ich und schüttelte den Kopf, wie um die frustrierenden Gedanken zu verscheuchen, die dort in einer Endlosschleife kreisten. »Das macht mich nur wütend, und dann wird Max mir wieder vorwerfen, dass ich alle Leute finster anstarre. Und das auch noch bei einer Hochzeit.«
»Ich fürchte, wir müssen uns unter die Gäste mischen«, sagte meine Freundin missmutig. »Plaudern und plappern. Der reinste Albtraum.«
»Wie wär’s, wenn wir uns heimlich davonschleichen?«, schlug ich vor. »Wir könnten die Fahrräder nehmen.« Ich blickte zum wolkenlosen blauen Himmel auf. Es war kalt, aber die Sonne schien; ich konnte fast schon die Brise spüren, die mir mit eisigen Fingern übers Gesicht streifen würde, wenn wir einen der vielen Hügel auf dem weitläufigen Gelände rund um Scott-Holland Hall hinunterradelten. Ich verschwendete allenfalls den Bruchteil eines Augenblicks an das wunderschöne blaue Seidenkleid, in das mir Nancy, meine Zofe, heute Morgen hineingeholfen hatte. Zweifellos war dies genau die Art von Eskapade, die mir bei Max Ärger einhandeln würde. Ich schob die Bedenken kurzerhand beiseite. Was konnte schon Schlimmes passieren?
Cassies Gesichtsausdruck hellte sich auf. »Wir könnten uns aus dem …«
»Denk nicht einmal daran«, hörte ich eine Stimme hinter mir. Ich drehte mich um und sah, wie die Braut höchstpersönlich Cassie mit einem durchdringenden Blick fixierte. »Ich weiß genau, was du vorhast, Cassandra Weston, aber du bist die Schwester der Braut. Hör auf, hier draußen in der Kälte herumzutrödeln. Komm rein und begrüße mit mir die Gäste.«
Cassie schmollte kurz, gab aber nach, als Iris sie liebevoll anlächelte.
»Sie sehen bezaubernd aus, Lady Wynter«, sagte ich. Und das tat sie auch. Sie sah aus wie der Rauschgoldengel auf der Spitze des Weihnachtsbaums – glänzendes goldenes Haar, tiefblaue Augen, feine Gesichtszüge. Ihr Hochzeitskleid war aus italienischer weißer Spitze und so atemberaubend schön, dass nur sie selbst es entworfen haben konnte. Sie war zierlich, elegant, und bei meinen Worten errötete sie zart. Wenn man sie nicht kannte, hielt man sie für ein Lämmchen und nicht für das, was sie wirklich war – eine Füchsin im Schafspelz. Iris Wynter war alles andere als zahm: Sie hatte einen eisernen Willen und eine Stärke, die man nicht unterschätzen durfte. Ich fand sie faszinierend.
»Lady Wynter«, sagte sie kopfschüttelnd. »Daran werde ich mich wohl erst gewöhnen müssen. Wie auch immer …« Iris’ Miene wurde ernst. »Ich sehe euch beiden an, dass ihr Flausen im Kopf habt, aber ich habe Cassie bereits gesagt, dass sie den Gästen keinen Stoff für Skandale liefern soll, zumindest nicht, bevor sich alle satt gegessen haben.«
Cassie seufzte und warf mir einen Blick zu. »Sie ist jetzt eine tugendhafte verheiratete Frau. Sehr respektabel.«
»Oh, ich hoffe, das werde ich nie sein«, erwiderte Iris. »Allein schon, weil mein Mann dann furchtbar enttäuscht von mir wäre.«
»Genau wie ich«, sagte Cassie.
»Und ich auch«, fügte ich hinzu. »Wenn ich mit abstimmen darf.«
»Gut, dann ist der Antrag einstimmig angenommen.« Iris hakte sich auf der einen Seite bei Cassie und auf der anderen bei mir unter und bugsierte uns zur Eingangstür. »Hiermit schwören wir feierlich, niemals tugendhaft und respektabel zu werden.«
Kapitel 2
Cassie mochte in gesellschaftlichen Verpflichtungen gefangen sein, aber ich war eine freie Frau – zumindest noch. Darauf bedacht, Max und Izzy aus dem Weg zu gehen, verzog ich mich an den Rand des Ballsaals, während Leute mit Getränken in der Hand durch den Raum schlenderten und darauf warteten, dass das Hochzeitsfrühstück im Speisesaal eröffnet wurde.
Ich hatte nur ein kleines Zeitfenster, um meine Flucht zu planen, ansonsten drohten langatmige Reden und opulente Büfetts. Ich würde unweigerlich neben einen »heiratswürdigen Junggesellen« gesetzt werden, der nicht einmal wusste, wie man Pythagoras buchstabierte. Doch in all dem Gedränge würde mich kaum jemand vermissen – außer natürlich meine Familie, aber die würde sich nicht wundern, dass ich wieder einmal die Flucht ergriffen hatte.
Der Ballsaal bot einen ziemlich spektakulären Anblick, ein bisschen wie eine überdimensionierte Hochzeitstorte, voller Gold und Marmor, mit blassblauen Wänden und einer hohen Decke, an der sich rosige Engel zwischen Wolken tummelten. Der Raum war wunderschön mit Girlanden aus Stechpalmenzweigen und roten Rosen dekoriert, die einen berauschenden Duft verströmten. Kerzenlicht verlieh der Szenerie einen festlichen Glanz.
Ich begriff sofort, dass dies eine jener Situationen war, die oberflächliche Konversation erforderten – eine Situation also, die es zu vermeiden galt wie die Pest. Ungefähr seit einem Jahr hatte sich etwas an der Art und Weise verändert, wie die Leute mich ansahen. Über meinem Kopf schien jetzt ein Schild zu schweben, auf dem stand: Im Angebot! Ledige Erbin und Schwester eines Dukes. Ich wurde als Heiratsmaterial betrachtet, und da es in den Augen der besseren Gesellschaft nichts Wichtigeres gab als Geld und Herkunft, befand ich mich in der misslichen Lage, als »gute Partie« zu gelten.
Es spielte keine Rolle, was mich als Mensch ausmachte. Es spielte keine Rolle, dass ich die Zahl Pi bis auf mehr als achthundert Stellen aufsagen konnte, dass ich Apfelkuchen und Fahrradfahren liebte, dass ich Pflaumen hasste oder dass meine Finger immer mit Tinte gesprenkelt waren. All das spielte keine Rolle. Ich war ein hübsches Schmuckstück in einer Vitrine, das den Herren zur Begutachtung präsentiert wurde und auf das alle ihr Angebot abgeben konnten.
In gesellschaftlichen Situationen musste ich mich tadellos benehmen, denn nichts anderes wurde von mir erwartet. Und weil ich meine Familie liebte und es mir wichtig war, was sie von mir hielt und was andere Leute von ihr hielten, gab ich wirklich mein Bestes. Aber es war anstrengend und ich wurde den Ansprüchen nie gerecht. Wie ein Puzzleteil, das in der falschen Schachtel gelandet ist, passte ich einfach nicht dazu.
Zum einen mochte ich keine Menschenansammlungen. Das war hinderlich, wenn man bei gesellschaftlichen Ereignissen ein schillernder Schmetterling sein sollte. Es war nicht nur das müßige Geplauder, das mir schwerfiel. Die Anwesenheit so vieler Leute fühlte sich erdrückend an. Das Stimmengewirr, die Art und Weise, wie all die Geräusche in meinem Gehirn nach Aufmerksamkeit schrien. Der Lärm und die Energie im Raum waren überwältigend, und das verstärkte mein Unbehagen noch.
»Lady Felicity«, rief eine Stimme. Nur mit Mühe gelang es mir, keine Grimasse zu schneiden, als Nicholas Wynters Großmutter – die verwitwete Countess – vor mich trat und mir den Fluchtweg versperrte. Eigentlich mochte ich den alten Drachen, aber dem wachsamen Auge dieser Frau entging nicht die kleinste Kleinigkeit. Sofort beschlich mich das Gefühl, dass sie jeden frevelhaften Gedanken kannte, der mir je in den Sinn gekommen war. Sie hatte zweifellos bemerkt, dass ich gerade versuchte, mich unauffällig aus dem Raum zu schleichen.
»Lady Wynter.« Ich lächelte höflich. »Wie schön, Ihnen hier zu begegnen.«
Die Frau gab ein dumpfes Mmmpf von sich, was ich so interpretierte, dass sie genau wusste, wie sehr ich mir in diesem Augenblick wünschte, überall, nur nicht hier zu sein.
»Die Zeremonie war sehr schön«, versuchte ich es mit höflichem Geplauder, verspürte aber sofort dieses unangenehm taube Gefühl, das ich dabei stets empfand.
»Die Zeremonie war viel zu lang.« Die Countess verzog verächtlich die Lippen. »Aber was kann man in einer so provinziellen Kirchengemeinde anderes erwarten? Der Pfarrer ist nicht gerade ein begabter Redner. Wenn ich daran denke, dass wir die Hochzeit mit allem Pomp und Prunk in St. George hätten abhalten können, in Anwesenheit von Bertie … nun ja.« Sie beendete den Satz mit einem Schnauben, und ihre Augen blitzten. »Meine neue angeheiratete Enkelin weiß offensichtlich ganz genau, was sie will.« Trotz ihrer Bemühung, höchst unzufrieden zu klingen, schwang in ihren Worten auch eine widerwillige Anerkennung mit.
»Ich finde, dass die beiden sehr glücklich aussehen«, wandte ich beherzt ein. »Sie sind ein schönes Paar.«
»Ja, das sind sie«, stimmte die Countess zu. Sie musterte mich von Kopf bis Fuß. »Und du, Felicity Vane, hast das Aussehen deiner Mutter. Du hast dich zu einer attraktiven jungen Dame gemausert, aber das brauche ich dir sicher nicht zu sagen.«
»Nein«, sagte ich lapidar, »aber trotzdem danke.« Auch wenn ich mich nicht mit Iris Wynter vergleichen konnte, war mir klar, dass mein Aussehen nach den konventionellen Maßstäben der Gesellschaft mehr als akzeptabel war. Ich hatte die schlanke Figur meiner Mutter und ihr glattes silberblondes Haar geerbt. Mein Gesicht war symmetrisch, was, wie ich wusste, von Vorteil war; meine Augen waren dunkelblau und tendierten bei gewissen Lichtverhältnissen ins Violette. (Das wusste ich dank der blumigen Beschreibung eines Freundes von Max, der auf einem Fest, zu dem ich vor zwei Wochen geschleppt worden war, einen kurzen Flirtversuch unternommen hatte. Nun ja, es ist beim Versuch geblieben.)
Lady Wynter lachte kurz auf. »Das gefällt mir, Mädchen. Ich kann diese Etepetete-Dämchen nicht ausstehen, die so tun, als hätten sie sich noch nie im Spiegel gesehen. Mit deinem Kleid hast du eine hervorragende Wahl getroffen. Die Farbe bringt deinen Teint zur Geltung.«
»Das habe ich alles meiner Schwägerin zu verdanken«, sagte ich.
Die Augen der Countess verengten sich. »Ich nehme an, sie und dein Bruder haben bereits begonnen, den Heiratsmarkt für dich zu sondieren?«
Mein Lächeln gefror. »Ich würde sagen … wir sind diesbezüglich noch in Verhandlung.«
»Hmmm.«
Ich wusste nicht, was genau dieser Laut bedeutete.
»Nun« – wieder wurde ich mit einem durchdringenden Blick bedacht – »eins steht jedenfalls fest: Ich werde deine kommende Saison mit Interesse verfolgen.«
Ich wusste nicht, ob das eine Drohung oder ein Versprechen war, aber ich hatte nicht vor, hierzubleiben und es herauszufinden.
»Ich freue mich darauf«, antwortete ich lahm. »Oh, ich glaube, ich habe da drüben eine alte Freundin entdeckt – bitte entschuldigen Sie mich.« Und damit drehte ich mich um und machte mich so vornehm wie möglich aus dem Staub. Das Glucksen, das ich hinter mir hörte, verriet mir jedoch, dass ich nicht so subtil gewesen war, wie ich gehofft hatte.
Den Blick fest zu Boden gerichtet, schaffte ich es, den Ballsaal zu verlassen, ohne von jemand anderem abgefangen zu werden. Ich ging den verwinkelten Korridor entlang und öffnete dabei Türen, bis ich fand, wonach ich suchte.
Mit einem Seufzer der Erleichterung sah ich mich in der Bibliothek um. Sie war gigantisch, erstreckte sich über zwei Stockwerke, und die Regale ächzten förmlich unter der Last der Bücher. Der Raum war spärlich möbliert, aber ich entdeckte einen Lehnstuhl vor dem eindrucksvollen Steinkamin. Ich schleppte ihn zu einem der Erkerfenster, wo gerade genug Platz war, sodass ich mich hinsetzen und die Vorhänge hinter mir zuziehen konnte. Es war kein absolut sicheres Versteck, falls Max nach mir suchte, aber zumindest ein Rückzugsort.
Zügig ging ich die Regale ab, bis ich ein geeignetes Buch fand. Die Fachliteratur zur Mathematik war leider sehr veraltet, aber ich entdeckte ein vielversprechend aussehendes, stark abgegriffenes Buch mit dem Titel Geschichte der Piraterie, das von den Abenteuern von Mary Read und Anne Bonny handelte. Ich hatte eine besondere Vorliebe für Piratengeschichten, und wenn jemand einen vernünftigen Ratschlag geben konnte, wie man mit einem überfürsorglichen älteren Bruder umging, dann doch wohl zwei furchtlose, von der Gesellschaft geächtete Frauen. Vergnügt machte ich es mir auf dem Stuhl bequem. Die zugezogenen Vorhänge bildeten eine Art Kokon, während das kalte Licht von draußen über meine Schulter fiel. Ich seufzte zufrieden. Versteckt, allein und mit einem Buch: So konnte man sogar eine Feier genießen.
Ich war bereits einige Minuten in den Heldinnengeschichten versunken, als mich das Geräusch einer aufgestoßenen Tür hochschrecken ließ.
Ich zuckte zusammen, doch dann richtete ich mich auf und sagte mir im Stillen, dass mich hinter dem Vorhang niemand sehen konnte. Insgeheim hoffte ich, dass die Person, die gerade hereingekommen war, sich umdrehen und schnurstracks wieder gehen würde. Stattdessen hörte ich eine aufgeregte Stimme und Schritte.
»Heißt das, du willst die Verantwortung nicht übernehmen?« Die Stimme bebte vor Empörung. »Du bist nur eine Haaresbreite davon entfernt, der nächste Anwärter auf den Titel zu sein!«
Da vernahm ich eine zweite Stimme, und irgendetwas an ihr ließ meinen Puls in die Höhe schnellen. Sie war sanft, amüsiert, mit einem Hauch von Schärfe. »Das weiß ich selbst, vielen Dank auch. Über diese Entwicklung sind wir beide nicht gerade glücklich, aber sofern du keine weiteren Söhne gezeugt hast, von denen ich nichts weiß, dann ist an dieser Lage wohl nichts zu ändern. Mir bleibt nichts anderes übrig, als auf Perrys baldige Genesung zu hoffen. Wie du weißt, habe ich kein Interesse an deinem Titel.«
»Sprich nicht so respektlos! Dein Bruder könnte sterben!«
Die andere Stimme, die gerade noch in schleppendem Tonfall gesprochen hatte, wurde härter. »Ich werde nicht so tun, als würde ich ihn mögen. Ich bin kein Heuchler. Aber natürlich will ich nicht, dass Perry stirbt. Ich hoffe, dass er überlebt – sowohl in meinem Interesse als auch in seinem. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass er ein kaltherziger, grausamer Schurke ist und immer war.«
Darauf reagierte sein Gesprächspartner mit einem erstickten Schnauben. Offensichtlich fehlten ihm vor lauter Wut die Worte.
»Erleide jetzt bloß keinen Schlaganfall«, sagte die andere Stimme gelangweilt. »Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass ihr beide tot umfallt. Nicht auszudenken, wie lästig das wäre.«
»Du! Du … undankbarer Köter! Dein Bruder ist hundert Mal mehr wert als du.«
Diese Worte schienen die Belustigung des anderen nur zu verstärken. »Nein, ist er nicht. Genau das ist ja das Problem, nicht wahr?«
»Wie selbstgefällig du bist.« Die zornige Stimme klang jetzt höhnisch. »Du betreibst eine schäbige Spielhölle. Eine Schande für den Familiennamen! Ich schäme mich für dich.«
»Nun, ich schäme mich für dich, also sind wir quitt, Vater. Und das Lucky Penny ist keine Hölle. Es ist ein Geschäft. Man würde doch meinen, dass ich damit die bessere Wahl getroffen habe als Perry, der mit seinen Schulden die ganze Familie in den Ruin treibt und sich bei seinen halbseidenen Machenschaften zu allem Überfluss auch noch anschießen lässt.«
»Dein Bruder wurde auf der Straße von einem Verrückten angegriffen!«, brüllte der ältere Mann. »Und du wagst es, seine Ehre infrage zu stellen?«
»Das machen die Klatschmäuler schon zur Genüge. Oder sind die Gerüchte über seine zwielichtigen Verbindungen etwa aus der Luft gegriffen? Soweit ich weiß, hat er mit seinem Reichtum geprahlt, bevor es zu dem Vorfall kam, oder? Wie interessant. Ich frage mich, wo all das Geld wohl geblieben ist.«
Die Antwort war ein weiteres empörtes Schnauben. »So ein Unsinn! Ich habe diesem albernen Gerede ein Ende bereitet. Denn ich werde nicht zulassen, dass auch nur der Schatten eines Skandals auf unsere Familie fällt. Außerdem war das alles ein Missverständnis. Dein Bruder ist ein Gentleman. Nicht, dass ich erwarten würde, dass du das verstehst. Ich weiß alles über das Loch, das du in Whitechapel betreibst. Whitechapel! Ein Sohn von mir! Der Betreiber einer Lasterhöhle!«
»Lasterhöhle.« Die andere Stimme klang seidenweich. Ich stellte mir ein kleines Lächeln vor. »Das gefällt mir.«
»Das überrascht mich nicht.« Es folgte ein gurgelndes Geräusch, ähnlich den kehligen Lauten eines Truthahns, und ich musste die Lippen zusammenpressen, um nicht laut loszulachen. »Mir ist zu Ohren gekommen, dass du dort sogar Frauen an die Spieltische lässt. Frauen! Das ist widernatürlich.«
Bei diesen Worten wurde ich hellhörig. Eine Spielhölle, in der Frauen erlaubt waren? Ich hatte noch nie von einem solchen Ort gehört … andererseits gehörten Nachtclubs in Whitechapel nicht zu dem gesellschaftlichen Umfeld, in dem ich mich normalerweise bewegte. Leider.
»Das schien dich nicht zu stören, als du mich um Geld anpumpen wolltest«, sagte die jüngere Stimme gelassen und lenkte meine Aufmerksamkeit wieder auf das Gespräch.
»Ich habe dich nur gebeten, einige der Ausgaben deines Bruders zu begleichen. Jetzt sehe ich, dass ich mir die Mühe hätte sparen können. Familienzusammenhalt und brüderliche Verbundenheit sind Fremdwörter für dich!«
»Wie schön, dass wir uns in diesem Punkt einig sind.«
»Mach mir nichts vor, du hast keinen müden Penny in der Tasche. Du bist nichts als ein … ein … leichtfertiger Taugenichts. Du verbringst deine Zeit mit Glücksspiel und Trinken und wer weiß was sonst noch alles!«
»Mmm. Also für mich klingt das nach äußerst sinnvoll genutzter Lebenszeit.«
»Mein einziger Trost ist, dass kaum jemand von der Verbindung zwischen uns weiß«, fuhr der ältere Mann fort, als hätte sein Sohn nichts gesagt. »Du hattest zumindest einen Rest von gesundem Menschenverstand, nicht den Familiennamen zu verwenden. Aber wenn dein Bruder stirbt … wenn du erbst …« Der ältere Mann senkte die Stimme und schien jetzt mehr zu sich selbst zu sprechen. »Wer den Titel trägt, muss über jeden Zweifel erhaben sein. Die Nachfolge zu sichern, hat Vorrang vor allem anderen. Aber ständig werden mir Steine in den Weg gelegt. Allmählich kommt es mir vor, als läge ein Fluch auf dieser Familie, und wenn dann auch noch du das zukünftige Oberhaupt werden solltest … nun, dein Verhalten kann nicht weiter toleriert werden.«
»Und mit diesem Verhalten meinst du mein Leben?«, fragte die samtige Stimme.
»Jetzt reicht es mir aber mit deinen frechen Antworten! Diese Hochzeit ist ein wichtiges Ereignis mit wichtigen Leuten. Du wirst dich entsprechend benehmen.«
»Nichts anderes hätte dich von Perrys Seite weglocken können, da bin ich mir sicher.« Der ironisch amüsierte Ton war wieder da, und mir wurde klar, dass der Vater umso wütender wurde, je gelassener der Sohn sich gab. Eine bewundernswerte Taktik. »Die Zeiten, in denen du mir mein Verhalten vorschreiben konntest, sind längst vorbei, Vater. Aber du hast nichts zu befürchten. Ich habe nicht die Absicht, mich schlecht zu benehmen. Ich habe hier mehr Freunde als du. Und sehr viele von ihnen besuchen meine … Lasterhöhle. Darunter auch der Bräutigam. Ebenso die Braut. Glücksspiel gilt in ihren Kreisen als der letzte Schrei. Du wirst feststellen, dass ich bei diesen wichtigen Leuten sehr beliebt bin, und das ganz ohne familiäre Beziehungen.«
Die Antwort des älteren Mannes bestand aus einem frustrierten Stöhnen, ehe er wütend davonstapfte. Ich hörte, wie die Tür aufgerissen wurde. »Ich habe dir nichts mehr zu sagen.« Dann knallte die Tür zu.
Eine schwere Stille legte sich über den Raum. Ich verharrte, unbeweglich wie eine Statue, und wagte kaum zu atmen. Auf der anderen Seite des Vorhangs stand, wie ich annahm, nur noch der jüngere Mann. Ich hoffte, dass er, nun da der Familienstreit beendet war, ebenfalls den Raum verlassen würde.
Stattdessen kräuselte sich der Vorhang vor meinem Gesicht, als hätte jemand mit den Fingern darübergestrichen, und allein die Vorstellung ließ einen Schauder über meinen Rücken laufen.
»Wenn du schon private Gespräche belauschst«, murmelte die Stimme, die so seltsame Dinge mit meinem Inneren anstellte, »dann solltest du das nächste Mal darauf achten, dass man deine hübschen Seidenschuhe nicht sieht.«
Mir stockte der Atem, und ich blickte erschrocken auf meine Füße. Ich hatte nicht bemerkt, dass der Vorhangsaum nicht ganz bis zum Boden reichte. Ich unterdrückte einen Fluch.
»Danke«, brachte ich nach einem Moment heraus und stellte erleichtert fest, dass meine Stimme nicht bebte. »Ich werde es mir merken. Fürs nächste Mal.«
Ein Lachen war die Antwort. Der Stoff kräuselte sich erneut, und für einen Augenblick dachte ich, der Fremde würde den Vorhang zurückziehen. Ich machte mich auf eine Konfrontation gefasst. Dann hörte ich, wie er ohne jede Eile zur Tür ging. Als das Schloss mit einem leisen Klicken einschnappte, wusste ich, dass ich wieder allein war.
Ich atmete tief durch und sank auf den Stuhl. In Gedanken ließ ich die Ereignisse der letzten Minuten Revue passieren. Der Streit. Die Angst, entdeckt zu werden. Es lag zweifellos ein gewisser Nervenkitzel darin, andere Leute zu belauschen. Dass einer der beiden meine Anwesenheit bemerkt hatte, tat dem keinen Abbruch. Es war, als hätte mich der Fremde in eine seltsame Intimität hineingezogen, indem er mich wahrgenommen und mit mir gesprochen hatte, dabei aber bewusst darauf verzichtet hatte, mein Gesicht zu sehen oder mir seines zu zeigen. Da war nur diese Stimme, die sich um mich kräuselte wie Rauch.
Ich schüttelte mich, um die eigenartigen Gefühle abzustreifen, die diese Stimme in mir ausgelöst hatte, und wandte meine Gedanken stattdessen einer wichtigeren und überaus verlockenden Idee zu.
Eine Spielhölle, in der Ladys willkommen waren.
Was war Glücksspiel denn anderes als pure Mathematik? Zufall, Wahrscheinlichkeiten, Risiko und Belohnung. Bestimmt könnte eine findige Mathematikerin die Gewinnchancen berechnen und Wege finden, ihre mageren Pennys in eine viel größere Summe zu verwandeln. Männer schienen beim Kartenspielen ständig ein Vermögen zu gewinnen, und nur wenige von ihnen hatten ein Fachwissen wie meines in der Hinterhand.
Ich lehnte mich auf meinem Stuhl zurück und schnurrte regelrecht vor Zufriedenheit angesichts der Möglichkeit, die sich mir mit einem Mal auftat.
Geld bedeutete Freiheit. Mit meinem eigenen Geld würde ich meine Einschreibegebühren bezahlen und Max vor vollendete Tatsachen stellen können, was meine Universitätskarriere anging. Dann würde er einsehen, wie ernst es mir war. Es würde mir die Kontrolle über mein eigenes Schicksal geben. Könnte Max mich daran hindern? Ich überlegte. Vermutlich könnte er es, zumindest rechtlich gesehen. Aber das würde er nicht tun. Ich kannte meinen Bruder. Er würde es nie so weit kommen lassen. Ich musste ihn einfach aus seiner beschränkten Weltsicht herausreißen, aus seinen falschen Vorstellungen von dem, was ich wollte und brauchte. Ich musste ihm zeigen, dass ich meinen Weg mit oder ohne seine Hilfe gehen würde, dass ich es ausnahmsweise besser wusste als er.
Mit einem Grinsen schob ich den Vorhang beiseite und ging entschlossen zu den Bücherregalen. Ich musste lernen, wie man Karten spielt. Ich musste lernen, wie man perfekt Karten spielt.
Und dann würde ich dem Lucky Penny einen Besuch abstatten.
Teil Zwei
Drei Monate später
Kapitel 3
Ich hielt mich im Schatten der Hauswände, rückte meine goldene Spitzenmaske zurecht und beobachtete, wie verwegen aussehende Besucher in kleinen Grüppchen das Lucky Penny betraten. Jedes Mal, wenn die Tür aufging, drang Lärm nach draußen, und für einen kurzen Moment erhaschte ich einen Blick auf roten Samt und flackerndes Kerzenlicht, nahm den Geruch von Parfüm und Zigarrenrauch wahr. Es war wie ein Blick in eine andere Welt, und ich trat näher, angezogen von den Verlockungen, die mich hinter dieser Tür erwarteten.
Dies war das dritte Mal, dass ich vor der Spielhalle stand. Es war geradezu lächerlich einfach gewesen, aus dem Haus zu schleichen und eine Droschke nach Whitechapel herbeizurufen. Was unter anderem daran lag, dass Max und Izzy selbst oft abends das Haus verließen und in geheimer Mission für die verschiedenen Organisationen unterwegs waren, in deren Diensten sie standen – die, von denen sie dachten, dass ich nichts davon wüsste.
Tatsächlich wusste ich schon seit Jahren von Max’ Arbeit für die Regierung. Es war nicht schwer gewesen, sein Geheimnis zu lüften – ich hatte nur darauf geachtet, wann er das Haus verließ, sein Kommen und Gehen mit bestimmten Nachrichten in Zusammenhang gebracht, genau beobachtet, in welcher Gesellschaft er sich bewegte, und gelegentlich an der ein oder anderen verschlossenen Tür gelauscht.
Zugegeben, Izzy wusste ihre Geheimnisse besser zu hüten als Max, aber wir wohnten zusammen in einem Haus. Ich bekam so viel mit, dass ich neugierig wurde. Anfangs dachte ich, sie würde für dieselbe Agentur arbeiten wie mein Bruder, aber diese Theorie verwarf ich schnell wieder. Dass Max weibliche Agenten aus dem Adel rekrutierte, war schlichtweg undenkbar; das war eindeutig nicht sein Stil. Dennoch schien er zu wissen, was sie tat, und gelegentlich gingen sie zusammen auf nächtliche Ausflüge und schlichen sich praktisch Hand in Hand in die Dunkelheit hinaus. Nach einigen Monaten kam ich zu der aufregenden Erkenntnis, dass die Leute, mit denen Izzy zusammenarbeitete, ausschließlich Frauen waren. Es spielte keine Rolle, ob sie sie durch den Dienstboteneingang einschleuste oder mit ihnen in Geheimcodes kommunizierte: Ich war geschickt darin, wiederkehrende Muster zu erkennen.
Manchmal war ich kurz davor, den beiden zu sagen, dass sie sich nicht die Mühe machen mussten, derart geheimnistuerisch zu sein, dass sie einfach kommen und gehen konnten, wie es ihnen gefiel. Andererseits bereitete es mir ein gewisses Vergnügen, dabei zuzuschauen, wie sie sich aus ihrem eigenen Haus hinaus- und dann wieder hineinschlichen, weil sie mich wie immer dramatisch unterschätzten.
Die ersten beiden Male, als ich das Lucky Penny aufsuchte, ging es mir vor allem darum, Informationen zu sammeln. Da ich noch nie zuvor in einer Spielhölle gewesen war, interessierte ich mich zunächst für die Gepflogenheiten, die dort herrschten. Das war eine kluge Entscheidung gewesen, denn ich fand heraus, dass Frauen zwar in dem Club ein- und ausgingen, dabei jedoch stets maskiert waren. Außerdem fiel mir auf, dass keine Frau je allein den Club betrat. Das hatte mich kurzzeitig beunruhigt, bis mir klargeworden war, dass ich lediglich den richtigen Zeitpunkt abpassen musste, um mich unauffällig einer der großen, ausgelassenen Gästescharen anzuschließen, die immer wieder durch die breiten Mahagonitüren hineinströmten.
Trotz aller Bemühungen hatte ich durch beiläufige Fragen in meinem Umfeld nur sehr wenig über diesen Ort und seinen Besitzer herausgefunden. Keine junge Frau in meinem Alter wusste etwas darüber, da wir vor skandalösen Abenteuern dieser Art abgeschirmt wurden. (Leider.) Und ich konnte es kaum riskieren, Izzy und Max zu fragen, denn die beiden würden sofort Verdacht schöpfen. Alles, was ich in Erfahrung gebracht hatte, stammte aus meinen eigenen nächtlichen Beobachtungen, und damit würde ich mich wohl oder übel begnügen müssen.
Der Club befand sich in der Goulston Street, in einem eher heruntergekommenen Teil von Whitechapel, wobei das Gebäude besser aussah als die meisten anderen. Auf dem Schild über der Tür stand nichts geschrieben, lediglich eine Goldmünze war darauf abgebildet, die im schwachen Licht der Straßenlaterne schimmerte. Überraschenderweise kam die Kundschaft hauptsächlich aus der vornehmen High Society. Ein Besuch in diesem Lokal gehörte offenbar zu dem Nervenkitzel, den die Mitglieder der Oberschicht suchten, wenn sie einen Ausflug in diesen Teil der Stadt unternahmen. Es war das Spiel mit der Gefahr, das sie reizte, zumal ihnen gleichzeitig ein Gefühl der Sicherheit vermittelt wurde in Gestalt zweier muskulöser Türsteher, deren Hände sich beim ersten Anzeichen von Ärger zu Fäusten ballten.
Nicht in das Visier dieser Aufpasser zu geraten, war bisher meine größte Herausforderung gewesen, aber das sollte sich bald ändern. Ich hatte keine Zeit mehr zu verlieren. Es waren nur noch wenige Wochen, bis es ernst wurde und die Saison richtig losging. Dann würde Mutter unseren Landsitz, wo sie normalerweise lebte, verlassen und in die Stadt kommen, und mein Leben würde sich in einen endlosen Kreislauf aus Teegesellschaften, Dinnerpartys und Bällen verwandeln. Mit anderen Worten: ein Albtraum, aus dem es kein Erwachen gab.
Mehr als drei Monate lang hatte ich mich dem Studium des Kartenspiels gewidmet. Tatsächlich hatte sich die zugrunde liegende Mathematik als äußerst faszinierend erwiesen. Bereits in den 1650er-Jahren hatten Pascal und Huygens spannende Theorien über die Struktur von Glücksspielen aufgestellt. Es war ein Bereich, der zu weiteren Forschungen geradezu einlud, und dieses neue Nebenprojekt hatte sich als eine lohnende intellektuelle Beschäftigung erwiesen. Was den heutigen Abend umso gewinnbringender machen würde. Ich war zuversichtlich, dass ich die Handvoll Münzen in meinem Retikül in eine beträchtliche Summe verwandeln könnte, wenn nicht sogar in ein Vermögen.
Als eine feierwütige Schar die Straße entlangkam, holte ich einmal tief Luft, dann huschte ich ihnen im dämmrigen Licht hinterher. Jetzt oder nie.
Sechs oder sieben Herren in Begleitung von drei Frauen – und sie alle waren eindeutig in Whitechapel unterwegs, um eine Nacht voller Abenteuer zu erleben.
»Ich hoffe, Joe hat genug Nachschub von diesem Brandy bestellt«, lallte einer der Herren. »Er hat eine feine Nase für Alkohol.«
»Ash hat ein Händchen für Schmuggelwaren, meinst du wohl«, kicherte eine der Frauen, woraufhin einige Männer laut johlten. Ich versuchte mitzulachen, aber selbst in meinen Ohren klang mein Lachen hölzern. Jetzt, da der Moment gekommen war, wurde mir erst so richtig bewusst, was heute Abend alles schiefgehen konnte.
Niemand schien zu bemerken, dass ich mich der Gruppe angeschlossen hatte, und ich sandte ein stilles Stoßgebet zum Himmel, dass das auch so bleiben würde. Wir erreichten die beiden Muskelprotze an der Tür, und ich wagte es, zu einem von ihnen aufzublicken. Er war ein wahrer Hüne mit einem Kopf, der aussah, als wäre er aus einem Felsbrocken gehauen worden. Ein Felsbrocken, der die vage Ähnlichkeit mit einem Gesicht hatte.
Ich lächelte ihn schüchtern an. Er überraschte mich, indem er das Lächeln erwiderte, wobei gelbliche Zähne aufblitzten, was ihn eigentlich ziemlich nett aussehen ließ. Von seiner Freundlichkeit ermutigt, segelte ich auf einer Welle des Selbstvertrauens an ihm vorbei durch die Tür und betrat zum ersten Mal das Lucky Penny.
Die Geräuschkulisse traf mich so unvorbereitet, dass ich das Gefühl hatte, in eine Explosion hineingeraten zu sein.
Das Lokal war voller Menschen, Gäste scharten sich in aufgeheizter Stimmung um die Spieler, die gerade mitten in einer Partie waren. Ein langer Tisch mit einem Roulette-Rad zog besonders viele Zuschauer an. Ich nahm mir einen Moment Zeit, um mich zu orientieren. Der Raum war groß, und immer traten Besucher hinter den schweren waldgrünen Vorhängen hervor, die den Raum abteilten – was darauf hindeutete, dass es dahinter noch kleinere Nebenräume gab. Dies stimmte mit meinen Beobachtungen überein, die ich gemacht hatte, als ich um das Gebäude herumgegangen war und die Fenster gezählt hatte. In dem Hauptraum gab es überhaupt keine Fenster, er war wie ein dekadenter Kokon aus tiefgrünem Samt, also war es nur logisch, dass es dahinter noch weitere Separees gab. Die Tische waren aus poliertem Mahagoni, die Sitze mit einem satten Pflaumenrot bezogen, hier und da stand eine Palme mit ausladenden Blättern neben schweren goldenen Kandelabern (wobei mein scharfes Auge mir verriet, dass es sich wohl kaum um echtes Gold handelte).
Die Stimmung ließ die Luft vibrieren, und die ganze Szenerie wurde vom Schein zahlreicher Kerzen erhellt. Im Licht der tiefroten Lampenschirme schien der Raum noch wärmer, als er es ohnehin schon war. Kellner in grauen Uniformen schlängelten sich lautlos wie Schatten zwischen den Menschen umher, die keinerlei Notiz von ihnen nahmen, und servierten Getränke und kleine Speisen.
Ich wartete auf das Unbehagen, das mich in solchen Situationen normalerweise unweigerlich befiel, aber im Moment war ich so von den Eindrücken gefesselt und der Nervenkitzel so groß, dass für Angst kein Platz war. Außerdem fühlte ich mich, maskiert inmitten all dieser Menschen, herrlich anonym. Kein Mensch rechnete damit, hier auf Lady Felicity Vane zu treffen, und es gab keine neugierigen oder berechnenden Blicke. Soweit ich erkennen konnte, verschwendete niemand in diesem Raum einen Gedanken darauf, wie ich mich verhielt oder wen ich heiraten würde oder nicht. Niemand maß mich an unerfüllbaren gesellschaftlichen Standards. Niemand schenkte mir auch nur die geringste Aufmerksamkeit. All das machte mein Abenteuer noch so viel spannender!
Ich gab meinen Umhang einem Angestellten und strich meinen Rock glatt. Dann nahm ich mir ein paar Minuten Zeit, um durch den Raum zu schlendern und mir die verschiedenen Spiele anzusehen, deren Verlauf ich mit wachsendem Interesse verfolgte. Ich nahm ein Glas Brandy von einem der Bediensteten in Livree entgegen und legte eine Münze auf das Tablett. Ich nippte an dem Glas und spürte, wie der goldene Branntwein meine Kehle hinunterlief. Er schmeckte überraschend gut – vermutlich gehörte er zu der Schmuggelware, von der die Gruppe gesprochen hatte –, aber an den Alkohol, den ich gelegentlich aus Max’ Arbeitszimmer stibitzte, kam er nicht heran.
Schließlich ließ ich mich an einem der Tische nieder, an dem ein Mann in dunkler Uniform Vingt-et-un spielte. Darauf hatte ich mich vorbereitet, und es war an der Zeit, meine Theorien in die Praxis umzusetzen. Ich schaute eine Weile zu, wohl wissend, dass meine Erfolgschancen umso größer wurden, je länger das Spiel voranschritt, ohne dass der Bankhalter die Karten neu mischte.
Im Grunde genommen ging es nur darum, die Zahlenverhältnisse im Blick zu haben und die Wahrscheinlichkeiten dafür, dass hohe oder niedrige Karten gezogen wurden, zu berechnen. Der Schlüssel lag darin, die Zahlen so lange wie möglich im Kopf zu behalten – und dank der Art und Weise, wie mein Gehirn funktionierte, sowie der vielen Stunden, die ich geübt hatte, war ich darin ziemlich gut.
Schließlich schob ich eine einzelne Münze über den Tisch und platzierte meinen ersten Einsatz. Es fühlte sich bedeutsam an. Mein Herz pochte, und meine Hände waren feucht, aber nachdem mehrere Karten aufgedeckt worden waren, bestätigte sich meine Vermutung.
»Vingt-et-un«, sagte der Bankhalter lächelnd. »Die Lady gewinnt.«
Das Gefühl, das mich bei diesen Worten durchströmte, war berauschender als der Brandy. Aus meiner einzelnen Münze wurden fünf, und ich spürte, wie sich ein Lächeln auf meinen Lippen ausbreitete.
Eine Stunde später war das Lächeln des Kartengebers etwas hölzern geworden. »Die Lady gewinnt erneut«, sagte er, woraufhin das Publikum, das sich mittlerweile um mich versammelt hatte, in Jubel ausbrach.
Ich hatte inzwischen etliche Spiele hintereinander gewonnen. Meine verschiedenen Hypothesen hatten sich allesamt als richtig erwiesen, und das war der größte Nervenkitzel überhaupt. Nach dem ersten Sieg war die anfängliche Aufregung fast sofort verflogen – was blieb, war eine schwindelerregende Freude daran, die gezogenen Karten vorherzusagen. Die Zahlen hallten wie kristallklare Glocken in meinem Kopf, die alles andere übertönten. Für mich existierte in diesen Momenten einzig und allein die Frage, wie ich die Wahrscheinlichkeit berechnen konnte, dass die nächste gezogene Karte eine Sechs oder niedriger sein würde.
»Sie spielen gut«, schreckte mich eine Stimme neben mir auf.
Ich drehte mich und sah einen Mann. Er lächelte mich mit einem breiten Lächeln an, das seine ebenmäßigen weißen Zähne zeigte. Er war ungefähr so alt wie Max, hatte sandfarbenes Haar und ein offenes, freundliches Gesicht.
»Danke«, sagte ich und wandte meinen Blick wieder den Karten zu.
»Es ist spannend, einer schönen jungen Frau zuzusehen, die gerade eine Glückssträhne hat«, fuhr der Mann fort.
»Das ist kein Glück«, sagte ich gedankenverloren.
»Nein?« Jetzt klang er noch interessierter. »Hexerei also?«
Das brachte mich zum Lachen, und als ich mich ihm erneut zuwandte, grinste er. Sein schelmischer Gesichtsausdruck war charmant, und er wackelte mit den Augenbrauen, was mich erneut zum Lachen brachte.
»Vielleicht ist es tatsächlich Hexerei«, sagte ich leichthin und legte meinen Einsatz. Als die Kreuz Vier aufgedeckt wurde, konnte ich ein triumphales Jauchzen nicht unterdrücken.
Plötzlich legte sich anstelle der schmalen Finger des Kartengebers eine kräftige Hand, groß wie ein Essteller, auf den Tisch vor mir und riss mich endgültig aus der Konzentration. Ich zuckte zusammen, behielt aber die Zahlenreihen im Kopf, die sich in ein ungeordnetes Durcheinander aufzulösen drohten.
»Entschuldigen Sie mal«, schnaubte ich, die Augen auf die Karten geheftet. »Sie stören.«
»Der Boss will Sie sehen«, dröhnte eine raue Stimme irgendwo über mir. Als ich widerwillig den Kopf drehte, um über die Schulter zu schauen, sah ich den stämmigen Türsteher hinter mir. Nur dass jetzt jeder Anflug von Freundlichkeit aus seinem Gesicht verschwunden war. Der Ausdruck in seinen Augen ließ fast mein Blut gefrieren.
Für einen Moment schoss mir die Stimme aus der Bibliothek durch den Kopf. Es war durchaus möglich, dass es sich bei diesem »Boss« um den Mann von der Hochzeit handelte. Falls er es war und er sich wie ich in der High Society bewegte, wollte ich trotz Maske nicht riskieren, als Lady Felicity Vane erkannt zu werden.
»Ich habe keine Lust, Ihren Boss zu sehen«, sagte ich mit aller Ruhe, die ich aufbringen konnte. »Bitte danken Sie ihm für die Einladung, aber ich muss leider ablehnen.«
»Das war keine Einladung«, grunzte der Mann und zerrte an der Stuhllehne, sodass ich mit einem Laut der Überraschung vom Tisch wegrutschte. Die Menschentraube um uns herum, einschließlich des lächelnden Gentlemans, löste sich auf. Aus den Augenwinkeln nahm ich neugierige Blicke und Tuscheln wahr.
Ich musterte den Hünen voller Abneigung. Er erwiderte meinen Blick. Ich wog meine Optionen kurz ab und kam zu dem Schluss, dass es das Beste wäre, die Situation zu entschärfen, indem ich besagten Boss traf und mich dann aus dem Staub machte. Ich konnte nur hoffen, dass meine Maske ihren Zweck erfüllte und ich unerkannt blieb. Das Ärgerlichste an der ganzen Sache war, dass ich wegen dieser Unterbrechung mit weit weniger Gewinn nach Hause gehen würde als geplant.
Ich straffte die Schultern, warf dem Grobian einen frostigen Blick zu und erhob mich.
»Mein Geld bitte«, sagte ich und wandte mich mit ausgestreckter Hand an den Bankhalter.
Er öffnete den Mund, aber der Hüne kam ihm zuvor. »Oh, keine Sorge, Spence wird gut darauf aufpassen – nicht wahr, Spence?«
»Natürlich«, sagte der Kartengeber, und sein Blick wanderte von dem Hünen zu mir.
»Sorgen Sie dafür, dass es noch da ist, wenn ich zurückkomme«, verlangte ich, und er nickte. »Nun gut.« Ich wandte mich dem Türsteher neben mir zu. »Gehen Sie voran.«
Kapitel 4
Noch nie war ich so dankbar gewesen, mit einem Silberlöffel im Mund geboren worden zu sein. Es fiel mir nicht schwer, meine privilegierte Herkunft vor mir herzutragen. Genau genommen nahm ich mir die einschüchternde Countess Wynter zum Vorbild, während ich mit geradem Rücken durch den Spielsaal schritt wie eine Aristokratin, die es gewohnt war, ihren Willen durchzusetzen. Ich bemerkte, dass der hünenhafte Kerl dieser arroganten Selbstsicherheit nicht gewachsen war und sein Gesichtsausdruck mit jedem Schritt weniger grimmig wurde. Stattdessen wirkte er zunehmend verunsichert.