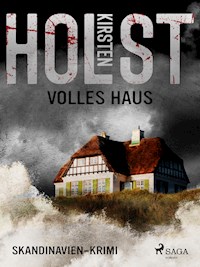Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ein wichtiges Jugendbuch, das als das dänische Coming Out-Buch der 80er und 90er gefeiert wurde: Claus befindet sich in einer prägenden Zeit seines Lebens, in der alles im Fluss ist. Er ist verliebt in Agathe, die jedoch unnahbar ist, und sein bester Freund Thomas zieht sich immer mehr von ihm zurück. Und auf einmal heißt es, Claus sei homosexuell. Ein Buch über Liebe und erste Erfahrungen mit Sexualität. -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kirsten Holst
Ganz nah und doch so fern – Jugendbuch
Übersetzt Gabriele Haefs
Saga
Ganz nah und doch so fern – Jugendbuch ÜbersetztGabriele Haefs OriginalMin ven ThomasCoverbild/Illustration: Shutterstock Copyright © 1987, 2020 Kirsten Holst und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726569483
1. Ebook-Auflage, 2020
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
1
Wenn ich mir das jetzt so überlege, dann habe ich manchmal das Gefühl, daß alles – alles, was dann später geschehen ist – in Wirklichkeit mit dem Info-Wochenende bei Hannah angefangen hat, kurz nachdem wir in die 2 g gekommen waren. Das ist jetzt schon fast zwei Jahre her. Ein Jahr und zehn Monate, um es ganz genau zu sagen.
Es war das Wochenende, an dem Thomas mit Anne im Bett war, obwohl er keine Lust dazu hatte, und an dem ich nicht mit Agathe im Bett war, obwohl ich große Lust dazu gehabt hätte.
Es war auch das Wochenende, wo Samstagnacht oder eher Sonntagmorgen das Fest und seine Teilnehmer so ziemlich in Auflösung übergingen – wo Lisbeth eine Flasche Rotwein ins Schwimmbecken fallen ließ und Fotto ins Rhododendronbeet kotzte. Aber wie Mini richtig bemerkte, wäre es umgekehrt schlimmer gewesen; schließlich hat ein Bad im Rotwein noch niemandem geschadet. Mini faßte seine Bemerkung übrigens in bedeutend mehr und bedeutend schlimmere Worte, er kann den Mund einfach nicht aufreißen, ohne daß sich ein ganzer Abfallhaufen herauswälzt. Ich glaube, das hängt damit zusammen, daß er nur 1 Meter 70 groß ist, wenn ihr versteht, was ich meine.
Es stimmt natürlich nicht, daß alles an diesem Wochenende angefangen hat, das weiß ich genau. Irgend etwas wäre sicher auf jeden Fall passiert. Auch wenn wir damals keine Ahnung davon hatten – der Countdown hatte doch schon längst begonnen. Trotzdem habe ich immer noch das Gefühl, daß einiges anders gekommen wäre, wenn wir nicht genau an diesem Wochenende in genau diesem Haus zusammengewesen wären.
Was ich jetzt am allerunglaublichsten finde, ist eigentlich, daß dieses Wochenende für einige von denen, die dabei waren, so gut wie gar nichts bedeutete. Für sie war es vielleicht nicht anders als viele andere Wochenenden. Vielleicht war ich der einzige, unter dem die Erde zu beben anfing. Aber das habe ich selbst erst später richtig wahrgenommen, nachdem meine ganze Welt in Zeitlupe einen Purzelbaum geschlagen hatte.
Genau so, in Zeitlupe, sehe ich es jetzt, während ich versuche, Zusammenhang und Überblick zu erhalten. Mich daran zu erinnern versuche, was in den letzten beiden Jahren gesagt und getan worden ist. Es ist so viel passiert, daß ich Zusammenhang und Überblick noch immer nicht gefunden habe, auch wenn ich jetzt ein bißchen mehr begreife. Wenn man etwas aus der Entfernung betrachtet, kann man plötzlich ein Muster sehen, das nicht zu erkennen war, als man noch mittendrin steckte, und manches versteht man dann ganz von selbst. Das Problem ist bloß, daß man sich an alles mögliche durcheinander erinnert und daß es schwer ist, die unwichtigen Details von den wirklichen Ereignissen zu unterscheiden. Die Details erschienen damals so wichtig. Sie hatten Ähnlichkeit mit Ereignissen, und die eigentlichen Ereignisse wirkten dagegen bloß wie unwesentliche Details.
Es gibt bestimmt Leute, die mich für bescheuert halten werden, weil ich damals nicht sofort kapiert habe, was Sache war, und weil ich nichts unternommen habe, um den Lauf der Geschichte zu ändern, zumindest den Lauf dieser Geschichte. Ab und zu kommt mir das auch selbst so vor, aber es ist so verflixt leicht, hinterher klüger zu sein, und damals wußte ich einfach nicht genug.
Irgendein Schlaumeier sagt bestimmt auch: »Na und? So einen Knuff versetzt uns das Leben eben manchmal, und alle jungen Leute müssen da durch, um erwachsen zu werden.«
Das kann nur einer sagen, der das nicht mitgemacht hat. Ich finde, es ist genug passiert, mehr als genug.
Übrigens hielten wir uns selbst für erwachsen. Wir hatten die Lage voll im Griff und durchschauten alles. Wir waren genauso unbesiegbar wie die spanische Armada. Und die ist bekanntlich 1588 von den Engländern vernichtend geschlagen worden. Wir waren achtzehn Jahre alt oder zumindest fast achtzehn. Wir hatten das Wahlrecht und den Führerschein (oder würden beides bald haben), wir hatten ein Recht auf unsere eigenen Meinungen, wenn wir damit niemandem schadeten, aber wir konnten mit all dem überhaupt nichts anfangen. Wir waren Schulkinder, du meine Güte, die reinsten Babys waren wir! Ich zumindest war eins. Das größte Baby von uns allen, ein richtiges Riesenbaby!
Tatsache ist jedenfalls, daß ich in vieler Hinsicht ungeheuer unerwachsen war. Ich habe nämlich erst vor kurzem in einer Zeitung gelesen, daß zweiunddreißig Prozent aller dänischen Jungen von fünfzehn Jahren ihr erstes sexuelles Erlebnis schon hinter sich haben. Ich aber war fast achtzehn und hatte noch nie mit einem Mädchen geschlafen.
Und zwar, weil ich in Agathe verliebt war. In die Frau, nicht in ihren Namen. Ich hatte Agathe immer für einen scheußlichen Namen gehalten, bis ich sie sah. Und dann war ich hin und weg von ihr und dem Namen. Ich weiß nicht, wo sie sich vorher versteckt hatte, ich entdeckte sie nämlich erst, als ich schon seit zwei Monaten aufs Gymnasium ging. Sie ging nicht in meine Klasse, aber eines Tages sah ich sie plötzlich in der Mensa. Dort saßen Hunderte von Schülern, aber ich sah nur sie. Die anderen verschwanden einfach, so wie sich die Wasser teilten, als die Israeliten durch das Rote Meer gingen.
Sie war die schönste Frau mit dem tollsten Gang und den scheußlichsten alten, geflickten Hosen, die ich je gesehen hatte. Ich wußte sofort, daß sie Agathe heißen mußte, es konnte gar nicht anders sein. Ich war vom Fleck weg so ungeheuer verknallt, daß ich bloß noch dumm grinsen und schwachsinnige Sprüche loslassen konnte, während ich in Wirklichkeit am liebsten meine Jacke vor ihr auf den Boden geworfen hätte, damit sie unbeschmutzt übers Parkett hätte wandeln können. Ich hätte mir auch die Hose vom Leibe gerissen, wenn das irgendwas gebracht hätte, aber sie würdigte mich keines Blickes, sondern schritt mit geradem Rücken und hochgereckter Nase an mir vorbei. Und so ging es weiter. Ich liebte sie, aber sie haßte mich – und ich konnte mir nicht einmal vorstellen, warum. Ich hatte ihr nie etwas getan, hatte sie nie belästigt, hatte keine zwei Worte mit ihr gewechselt, und trotzdem haßte sie mich.
Wenn ich abstoßend häßlich gewesen wäre, hätte ich das ja noch einsehen können, aber das war ich nicht. Meine Mutter behauptete immer, ich sei der flotteste Typ am ganzen Gymnasium. Das denken sicher alle Mütter von ihren Söhnen, und natürlich war es eine wüste Übertreibung. Der flotteste Typ war eindeutig Thomas, das fanden er und ich jedenfalls. Aber Nummer zwei zu sein war ja schließlich auch nicht schlecht. Leider ließ Agathe sich davon überhaupt nicht beeindrucken, eher im Gegenteil. Und deshalb litt ich in meiner unerwiderten Liebe und meiner Jungfräulichkeit still vor mich hin, denn wenn ich nicht mit Agathe ins Bett konnte, dann wollte ich mit überhaupt keiner ins Bett. Es wäre mir fast wie Untreue vorgekommen. Thomas verstand das, aber Mini wäre vor Lachen fast vom Stengel gefallen, als mir das ihm gegenüber einmal herausrutschte. Er zappelte auf seinem Stuhl herum und gakkerte dermaßen, daß er das Gleichgewicht verlor, nach hinten umkippte und krachend mit dem Hinterkopf auf den Boden aufschlug. Leider bekam er davon nicht einmal eine Gehirnerschütterung.
Aber zurück zum Wesentlichen. Alles fing wie gesagt in Hannahs Haus an, und auf irgendeine Weise hatte das Haus etwas damit zu tun. Es war so anders als alles, woran wir gewöhnt waren, daß wir selbst auch ein bißchen anders wurden. Nicht viel, aber genug. So wie eine kleine Abweichung am Anfang ausreicht, um eine Bowlingkugel an allen Kegeln vorbeisausen zu lassen.
Entscheidend waren das Haus, die Umgebung und die ganze Atmosphäre dort draußen, nicht Hannah selbst. Vor dem Wochenende hatte ich sie kaum gekannt, und hinterher kannte ich sie auch nicht besser, obwohl ich jetzt sehr viel mehr über sie wußte.
Sie war am Ende des ersten Gymnasiumsjahres plötzlich neu in unsere Schule gekommen, aber wir landeten erst später in derselben Klasse. Sie ware eine von dieser zurückhaltenden, unauffälligen Sorte, die man nicht sieht, solange man nicht gerade über sie stolpert. So erschien sie mir jedenfalls damals, aber auch das war ein Punkt, an dem ich nicht besonders klar sah.
Vom Aussehen her erinnerte sie mich an Marleen Merlin, diesen Stummfilmstar, mit ihren langen, dunklen Haaren, dem spitzen Gesichtchen und der Brille. Sie wäre eigentlich sehr niedlich gewesen, wenn sie nicht so eine scheußliche Haltung gehabt hätte. Das hört sich vielleicht schwachsinnig und rückständig an, aber so war es eben. Sie reckte den Kopf vor und den Hintern zurück, und ihre Schultern zog sie über die Ohren. Normale Menschen hätten am ganzen Körper einen Krampf, wenn sie auch nur eine halbe Stunde so herumlaufen müßten, aber Hannah schien das nichts auszumachen. In alten Zeiten sagten die Väter immer zu ihren Kindern: »Halt dich gerade!«, und Hannahs Vater hätte ihr einen großen Dienst erwiesen, wenn er das gesagt hätte. Womöglich hat er es ja auch getan, aber dann hat es nichts geholfen, und inzwischen war er tot, das wußte ich immerhin. Ich wußte auch, daß sie und ihre Eltern in Indien gelebt hatten und daß ihre Mutter gestorben war, als Hannah elf war. Sechs Jahre später war sie nach Dänemark übergesiedelt, weil sie dort Abitur machen wollte. Kurz darauf kam ihr Vater bei einem Flugzeugabsturz ums Leben, und Hannah zog in unsere Gegend.
Sie wohnte draußen auf dem Land, und ich nahm an, daß sie zu Verwandten gezogen war. Aus irgendeinem Grund, vielleicht weil sie ein bißchen altmodisch wirkte, hatte ich die Vorstellung, daß sie bei alten Menschen lebte, bei ihren Großeltern oder Großtanten oder so, und daß sie in einem kleinen weißen Steinhaus wohnten. Das Haus war wirklich weiß, aber ansonsten stimmte keine von meinen Vermutungen.
Ursprünglich hatten wir für unser Info-Wochenende ein Ferienhaus mieten wollen, aber offenbar waren wir zu spät dran, denn wir konnten einfach keins auftreiben. Heutzutage veranstaltet ja jeder Heini sein Info-Wochenende, schon die neunten Klassen fangen damit an.
Die Mädchen hatten die Organisation übernommen. Sie fanden heraus, daß erst im Dezember wieder Ferienhäuser frei wären, und das kam für uns nicht in Frage. Wir hatten schon alle Hoffnung aufgegeben, noch etwas zu finden, als Hannah plötzlich mit leichtem Zögern sagte: »Wir könnten es natürlich draußen bei mir machen.«
2
Bei Hannah? Ich dachte zuerst, das sollte ein Witz sein. Wir waren zwar eine kleine Klasse mit nur sechzehn Schülern, aber ich konnte mir trotzdem nicht vorstellen, wie diese ganze Bande samt zwei, drei Lehrern sich in ein kleines weißes Steinhaus quetschen sollte, in dem schon Großväter, Großmütter und alte Tanten saßen. Aber die Mädchen waren wild begeistert. Später ging mir auf, daß sie natürlich etwas gewußt hatten, was ich nicht wußte.
»Für das ganze Wochenende?« fragte Mini skeptisch.
Er dachte offenbar das gleiche wie ich.
»Ja, natürlich!« krähten die Mädchen im Chor. »Das wird spitze!« »Aber, ich meine, hast du denn genug Schlafplätze für uns alle? Für alle zusammen?« fragte Mini vorsichtig. Er hatte ganz offenbar Angst, Hannah zu verletzen, aber er hörte sich trotzdem sehr skeptisch an.
»Ja«, antwortete Hannah. »Das wird schon gehen. Wir haben ja auch noch den Hühnerstall.«
Den Hühnerstall! Es wurde wirklich immer besser!
»Da stecken wir die Lehrer rein«, sagte Fotto mit einem Grinsen. »Ja, das hab’ ich mir auch überlegt. Das ist sicher die praktischste Lösung«, meinte Hannah, ohne eine Miene zu verziehen.
Ich freute mich auf die Gesichter, die die Lehrer machen würden, wenn sie hörten, daß sie in einem Hühnerstall schlafen sollten. Womöglich legten sie dann Eier!
»Aber ein paar von euch müssen einen Schlafsack mitbringen«, fügte sie fast wie um Entschuldigung bittend hinzu.
Ich glotzte sie überrascht an. Was hatte sie sich denn vorgestellt? Daß wir den Greisen die Bettdecken klauen würden?
Die Mädchen waren Feuer und Flamme. Sie quasselten alle wild durcheinander, hundert Wörter pro Sekunde, und wir anderen konnten nicht den kleinsten Mucks dazwischenwerfen. Sie planten schon alles in sämtlichen Einzelheiten. Mädchen planen gern – besonders die Details. Sie sind die geborenen Sekretärinnen. Wenn wir dabeigeblieben wären und wenn ich zugehört hätte, wäre ich von Hannahs Haus nicht so überrascht gewesen, aber wir verdrückten uns, als uns aufging, daß wir überflüssig waren. So lief es immer, wenn etwas organisiert werden mußte. Die Mädchen regelten alles, denn sie konnten das viel besser als wir – dachten sie. Im letzten Moment warfen sie uns dann allergnädigst noch ein paar Aufträge an den Kopf, so wie man einer Hundemeute Knochen hinwirft. Zum Beispiel: »Ach, Mini, du sorgst doch für Tischplatten und Böcke?« Oder: »Claus, sei ein Schatz und bring doch bitte zwölf Stühle mit.« Und dann konnte man nur noch dankbar sein, zwölf Stühle an Land ziehen, selbst wenn man sie stehlen mußte, und sie auf den Gepäckträger laden.
Aber diesmal gab es keine Aufträge. Niemand sollte sich um Tische und Stühle kümmern, niemand sollte die Getränke besorgen, niemand sollte überhaupt irgendwas tun. Alles wurde ohne unsere Einmischung geregelt. Von den Mädchen, nahm ich an, oder von unsichtbaren Händen. In Wirklichkeit erledigten Hannah und ihre Ayah alles.
Wir waren siebzehn, als wir freitags am frühen Abend mit einem gemieteten Bus losfuhren. Vierzehn Schüler und drei Lehrer: Palle, Niels Ole und unsere absolut ungenießbare Mathelehrerin Hetty Ibsen. Es waren nur vierzehn Schüler, weil Hannah ja schon draußen war und weil der Stumme Truls sich an nichts beteiligte. Niemand wußte, warum, und niemand interessierte sich dafür. Er war eine Größe für sich, ein Einzelgänger. Lisbeth hatte einmal behauptet, er gehöre irgendeiner Sekte an, aber wir hatten uns geeinigt, daß er einfach bloß verrückt war.
Das Haus war die erste Überraschung, Hannahs Ayah die zweite. Ich fahre viel Rad, und ich war hier oft vorbeigekommen, aber das Haus hatte ich noch nie gesehen. Es lag verborgen hinter Bäumen und einer mehrere Meter hohen Hecke. Von außen konnte man höchstens ein Stück vom Dach und im Winter etwas Weißes erkennen, das war alles.
Und jetzt lag das Haus plötzlich in all seiner Pracht da, mitten in einem schönen, gepflegten Garten voller Blumen, eine Art angloindischer Bungalow, wie man sie aus Filmen kennt, fast ganz von einer Terrasse umgeben. Es gab ein riesiges Eßzimmer und einen fast genauso großen Wintergarten, der nach Süden schaute, außerdem eine Bibliothek und eine große Diele. Im anderen Flügel lagen vier Schlafzimmer, alle mit Bad, und hinter der Küche hatte die Ayah ihre winzige Wohnung.
Es war das »Sommerhaus« von Hannahs Eltern gewesen. Jetzt wohnte sie das ganze Jahr über hier, und sie mußte sicher ein Vermögen allein für die Heizung blechen.
Hannahs Ayah war eine alte Inderin im Sari, die barfuß im Haus herumlief. In der Stadt hätte sie in dieser Kleidung Aufsehen erregt, aber hier paßte sie gut zu dem indischen Kram und dem vielen Messingzeug, das hier herumstand.
Im Eßzimmer war der Tisch gedeckt, als wir kamen. Was mich am meisten beeindruckte, war, daß es zwölf völlig gleiche Stühle gab. Ich kannte niemanden, der zwölf identische Stühle hatte, nicht einmal Thomas, und dabei war sein Vater Möbelfabrikant.
Die Mädchen hatten, sicher auf ausdrückliche Aufforderung der Lehrer hin, beschlossen, daß wir freitags eine leichte Mahlzeit und nur ein Glas Wein oder Bier bekommen würden, denn schließlich sollten wir an diesem Abend und am Samstagvormittag das kommende Schuljahr planen – in allen Einzelheiten!
Aber schon am Samstagnachmittag nahmen wir Rache dafür, und Samstagabend servierte die Ayah ein Festmahl mit Strömen von Wein, weshalb einige von uns schon vor Mitternacht blau waren. Aber wenn jemand erwartet, daß deshalb etwas Dramatisches passierte, dann wartet dieser Jemand vergeblich. Obwohl das Ganze an diesem Wochenende anfing, geschah nichts, was uns aufgefallen wäre, jedenfalls damals nicht.
Das Wetter war schon seit Tagen ganz phantastisch, wie es im August eben sein kann. Die Dunkelheit umschloß uns warm und samtweich, und darum fand das Fest hauptsächlich im Garten statt. Vielleicht lief deshalb alles ziemlich friedlich ab, aber ich glaube, wie gesagt, auch, daß es etwas mit Hannahs Haus zu tun hatte.
Abgesehen davon, daß alle pausenlos mit und ohne Bekleidung ins Schwimmbecken sprangen, daß Fotto sich übergab und daß die Hollywoodschaukel zusammenbrach und zwei Blumentöpfe umriß, passierte kein Unfall, niemand lief Amok und bearbeitete die kostbaren Teppiche mit dem Rasenmäher oder warf mit den Möbeln um sich.
Ich war nicht blau, ich betrinke mich nie. Deshalb half ich Fotto aufs Klo, als ihm schlecht wurde. Es war harte Arbeit, denn er ist zwar kleiner als ich, aber anderthalbmal so schwer. Er ist um die 1 Meter 80 groß und wiegt hundert Kilo. Er frißt und säuft wie ein Schwein, und zu irgendeinem Zeitpunkt wird ihm immer schlecht. Trotzdem machen wir uns nie über ihn lustig, anscheinend haben wir uns also an ihn gewöhnt. Die einzige Anspielung auf seine Fülle ist sein Name. Fotto bedeutet ursprünglich »fetter Otto«, aber ich glaube, auch daran erinnert sich kaum noch jemand.
Als er seine angeregte Unterhaltung mit der Kloschüssel beendet hatte, schleppte ich ihn in den Wintergarten und ließ ihn auf das helle Ledersofa fallen. Ich zog ihm die Schuhe aus, tippte ihn mit einem Finger an, worauf er umkippte, und deckte ihn zu. Ich hoffte, daß er sich jetzt leergekotzt hatte, denn dem hellen Sofa und den echten Teppichen würden solche Attacken sicher nicht gut bekommen.
Dann suchte ich mir meinen Schlafsack, brachte ihn in den Wintergarten, rollte ihn aus und stellte eine Tischlampe auf den Boden, weil ich noch lesen wollte. Mit einem Buch, das ich in einem Regal in der Bibliothek gefunden hatte, machte ich es mir unter dem Flügel gemütlich.
Die anderen kamen jetzt nach und nach ins Haus und beschlagnahmten die Schlafzimmer – paarweise oder in Gruppen. Irgendwer lärmte immer noch am Schwimmbecken herum, aber ich mochte nicht nach draußen gehen. Ich kann gut darauf verzichten, mit Leuten zusammenzusein, die sternhagelvoll sind.
Ich las, Fotto schnarchte, und nach und nach wurde es fast im ganzen Haus still.
3
Durch Fottos Schnarchen hindurch konnte ich die Uhr auf dem Kaminsims die Sekunden verticken hören. Es hörte sich an wie eine alte Jungfer, die eifrig, aber völlig sinnlos die Nacht in kleine Scheibchen schnitt. Schnipp-schnapp, schnipp-schnapp.
Jetzt räusperte die Uhr sich leise, zögerte kurz und schlug dann. Ich zählte die Schläge. Sechs. Unwillkürlich schaute ich auf meine Uhr, eine Rolex, die mein Vater mir zur Konfirmation geschenkt hatte. Wahrscheinlich hatte er sie in irgendeiner obskuren Kneipe billig erstanden, aber die Uhr war in Ordnung, sie ging auf die Sekunde genau, wie auch die Uhr auf dem Kaminsims. Natürlich. Es war unvorstellbar, daß in Hannahs Haus irgend etwas nicht ordnungsgemäß funktionierte.
Ich drehte mich mühselig um. Ich lag nun schon seit vier Stunden hier unter dem Flügel und fühlte mich am ganzen Körper wie gerädert. Außer Lisbeth hatte mich niemand gestört. Sie hatte mehrfach hereingeschaut, um zu fragen, ob ich ihre Zigaretten gesehen hätte. Jedesmal hatte ich schon lange vorher ihre Klagerufe gehört: »Wer zum Henker hat meine Kippen geklaut? Wer zum Henker hat meine Kippen geklaut?«
Ich hatte nur noch zehn Seiten zu lesen. Ich hatte gelesen und gelesen und gelesen und gelesen. Vier Stunden lang. Die Flucht des Hirsches von Christian Winther. Ein richtig berühmtes klassisches Werk, an die hundertfünfzig Jahre alt, glaub’ ich. Natürlich hatte ich schon oft von diesem Buch gehört, aber ich hatte es nie näher angeschaut, deshalb hatte ich keine Ahnung, worum es da ging, als ich mich hinlegte und das Buch aufmachte. Ich wäre fast wieder aufgestanden und hätte mir in der Bibliothek ein anderes Buch geholt, als ich entdeckte, daß das ja Reime waren, richtige altmodische Herz-und-Schmerz-Reime. Ich lese eigentlich ganz gern Gedichte, doch diese hier wirkten einen Tick zu verstaubt.
Aber ich hatte einfach keinen Nerv mehr, wieder aufzustehen, und außerdem dachte ich, ich würde bestimmt ganz toll davon einschlafen können. Also überflog ich ohne große Begeisterung die ersten Seiten. Und dann war ich von der Geschichte plötzlich gefangen. Es war ja ein Roman in Reimen, wer hätte das ahnen können? Und der Dichter verstand sein Handwerk wirklich. Ich hatte richtig fühlen können, wie sich die kleinen Haare in meinem Nacken sträubten, als ich die Strophe zu Anfang des Buches gelesen hatte:
Die Zeit der Ritter und die Zeit der Gilden
hat mir die Sinne, hat mein Herz entfacht.
Des Haders viel – es blitzte von den Schilden,
es stieg der Hengst und wetterte zur Schlacht;
doch auch mit weichen, zartgestimmten Tönen
aus jener Zeit kann ich das Herz versöhnen.
Es gab Handlung und Spannung, viel Liebe, glückliche wie unglückliche, es gab Treue und Verrat und eimerweise Tränen, es gab sogar Sex, und das verblüffte mich sehr. Aus irgendeinem Grund ist es nur schwer vorstellbar, daß es Sex schon in alten Zeiten gegeben hat; das kommt einem genauso merkwürdig vor wie der Gedanke, daß die eigenen Eltern ein Sexualleben haben. Einige von ihnen jedenfalls.
Es war ein seltsamer Zufall, daß mir das Buch ausgerechnet in dieser Nacht in die Hände gefallen war, denn es war vielleicht die einzige Nacht in meinem Leben, in der ich es lesen konnte. Wegen der Stimmung, der Stimmung der Nacht und meiner eigenen, und weil ich Agathe hatte – oder besser gesagt, weil ich sie nicht hatte. Sie haßte mich nämlich offenbar immer noch.
Draußen wurde es langsam hell. Ich knipste die Lampe aus und sah in den Garten hinaus, wo Bäume und Büsche morgengrau und unbeweglich standen, als ob sie noch nicht ganz wach wären, oder wie Tänzer, die in starrer Haltung darauf warten, daß das Rampenlicht eingeschaltet wird.
Kein Wind rührte sich, und am blassen Himmel war keine einzige Wolke, es würde also ein ebenso prachtvoller Tag werden wie gestern.
Wenn ich das Buch ausgelesen hätte, wollte ich ausgiebig laufen und ans Meer zum Schwimmen gehen, um meine Knochen wieder an ihren richtigen Platz zu schütteln, sie schienen unter meiner Haut wild durcheinandergeraten zu sein.
Ich knipste die Lampe wieder an, legte mich besser zurecht und versuchte, eine halbwegs bequeme Position zum Liegen zu finden. Ich hatte gerade wieder angefangen zu lesen, als eine durchdringende, klagende Stimme mich geradezu aus dem Buch herausheulte. »Wer zum Henker hat meine Kippen geklaut?«
Wieder Lisbeth. Mußte dieses wahnsinnige Weibsbild denn nie schlafen? Rasch löschte ich das Licht, schloß die Augen und stellte mich schlafend. Vielleicht war das eine überflüssige Sicherheitsmaßnahme, vielleicht würde sie dieses Zimmer erst gar nicht betreten. Sie konnte sich doch verflixt noch mal selber sagen, daß ich ihre Zigaretten weder vor drei noch vor zwei noch vor einer Stunde und folglich auch jetzt noch nicht gesehen hatte.
Das konnte sie nicht.
Im nächsten Moment wurde die Tür aufgerissen, und Lisbeth kam wie ein gereizter Zyklop ins Zimmer getrampelt.
»Wer zum Henker hat meine Kippen geklaut?«
Die Schritte näherten sich dem Flügel und hielten neben mir inne. »Claus!« Sie trat mich mit fünf langen, harten Zehen in meine wunden Rippen. »Knackst du?«
Ja, ich schlief. Das konnte sie doch wohl sehen, die blöde Kuh.
Sie trat ein bißchen fester, bohrte ihre Zehen zwischen meine Rippen, und ich hätte fast laut aufgestöhnt.
»Knackst du?« wiederholte sie ungeduldig.
Dann schwieg sie erwartungsvoll, und ich kniff meine Augen fest zusammen.
»Claus, zum Teufel, du elender Blödi, ich weiß genau, daß du nicht knackst. Du tust bloß so! Wenn du wirklich schlafen würdest, dann wärst du jetzt aufgewacht.«
Ich unterdrückte ein Grinsen. Das war typische Lisbethlogik.
Sie trat mich immer noch in die Seite, es schien fast automatisch abzulaufen. Ich konnte genausogut aufgeben.
»Okay, dann schlaf’ ich eben nicht«, sagte ich und schlug die Augen auf.
»Ich hab’s ja gewußt. Du siehst übrigens ganz schön niedlich aus, wenn du knackst – auch wenn du gar nicht wirklich knackst. Was machst du hier?«
»Ich lese.«
»Du kannst doch wohl nicht die ganze Nacht lesen – und bei dem Licht! Hier unter dem Flügel ist es doch stockfinster!«
»Ich hab’ das Licht ausgemacht, als du gekommen bist.«
»Warum denn? Wolltest du nicht mit mir reden?«
Sie klang nicht einmal verärgert, nur neugierig.
»Nein. Jetzt kommst du schon zum viertenmal hier reingeplatzt. Warum mußt du dich ausgerechnet an mir austoben? Warum weckst du nicht lieber Fotto?«
»Fotto! Das geht doch gar nicht. Der ist voll wie eine Strandhaubitze, schläft wie ein Ochse und schnarcht wie ein Schwein. Außer dir ist in dieser Bude einfach kein Mensch wach und nüchtern.« »Aber du bist doch auch wach – und wie!«
»Aber nüchtern bin ich nicht.«
»Warum suchst du dir keinen Schlafplatz? Für ein paar Stunden solltest du dich schon aufs Ohr hauen. Warum wuselst du bloß so rum? Du spukst schon die halbe Nacht wie die Weiße Frau durch die Gegend. Wo steckt denn Søren?«
»Der pennt.« Sie setzte sich auf den Boden, beugte sich vor und stützte sich auf die Ellbogen, um mich unter dem Flügel hindurch anblicken zu können.
»Und du hast meine Kippen wirklich nicht gesehen?«
»Nein, hab’ ich nicht. Das hab’ ich dir schon vor drei Stunden und vor zwei Stunden und vor einer Stunde erzählt. Wo zum Henker sind meine Kippen? Das hat sich wie eine endlose Litanei durch die frühen Morgenstunden gewunden.«
»Wie poetisch! Was zum Kranich ist eine Litanei?«
»Ein Klagegesang«, antwortete ich. »Manchmal beeindruckst du mich wirklich, Lisbeth.«
»Echt?« rief sie erfreut. »Meine Güte, ich hätte so gern eine Kippe! Warum beeindrucke ich dich?«
»Weil deine Unbildung monumental ist.«
»Ba!« Sie schnitt mir eine Grimasse. »Bloß weil ich nicht weiß, was eine Litanei ist. Das weiß ja wohl kein normaler Mensch.«
»Ich schon.«
»Ja.« Sie grinste, und ich hielt klüglich den Mund. Eine Diskussion mit Lisbeth ist wie ein Gefecht mit einem Spiegelkabinett. Ehe man sich versieht, ist alles verwandelt, verzerrt und total absurd, und am Ende weiß man nicht mehr, ob man selbst oder sie hier völlig verrückt geworden ist.
Sie kam mit ihrem Gesicht ganz nah an meins heran und hauchte mir ihren Fuselatem voll in die Nase, während sie eindringlich fragte: »Hast du meine Kippen wirklich nicht gesehen?« Ich holte tief Luft und wollte gerade mit gewaltigem Nachdruck losreden, als sie mir zuvorkam: »Gut! Gut! Reg dich ab! Du hast sie also nicht gesehen, und das hast du mir schon viermal oder vierhundertmal oder viertausendmal erzählt, aber irgendwer hat sie geklaut. Ich finde es ganz schön übel, andrerleuts Kippen zu mopsen, wo wir hier draußen mitten im ödesten Niemandsland sitzen und nicht einmal die kleinste Fluppe aufzutreiben ist.«
»Aber deshalb brauchst du dich doch nicht so anzustellen! Als ich ins Haus gegangen bin, hattest du eine Zigarette in der Hand, du hast also vor vier Stunden erst geraucht.«
»Vor vier Stunden erst! Ein halbes Fest ohne Kippen! Das ist einfach zu arg. Aber du kannst das natürlich nicht raffen, du bist ja so verdammt heilig und rauchst selber nicht. Ich möchte wetten, das war Mini, dieser elende kleine Mistkerl! Das würde ihm ähnlich sehen. Der hatte schon vor Mitternacht alles weggepafft, und trotzdem hatte er immer eine Kippe in der Hand, wenn ich ihn gesehen habe. Aber meinst du, er hätte mich auch nur einmal ziehen lassen? Er ist ein richtiger kleiner Stinker, und ein Miststück von einem Dieb.«
»Geh jetzt schlafen, Lisbeth«, sagte ich müde.
»Willst du denn nicht reden?«
»Nicht über deine Zigaretten.«
»Na gut, worüber reden wir dann?«
»Über nichts. Ich will das Buch hier auslesen.«
»Hast du heute nacht ein ganzes Buch gelesen?« rief sie ungläubig. »Ich sag’ ja immer, du bist einfach knatschverrückt.«
»Außerdem können meine zarten Nerven zu dieser Tageszeit deine Sprache nicht verkraften. Du hörst dich ja fast genauso übel an wie Mini!«
»Zarte Nerven! Du hast überhaupt keine Nerven. Du hast nicht einmal Gefühle. Dir ist es scheißegal, daß irgendwer meine Kippen geklaut hat.«
»Na und?«
»Du bist vielleicht öde«, sagte sie und stand auf. »Ich muß wohl Søren wecken gehen und in seinen Armen Vergessen suchen.« »Hau schon ab!« antwortete ich müde.
Sie lachte und rappelte sich hoch.
Ich sah ihr nach, als sie zur Tür ging. Ich wäre so gern in Lisbeth verliebt gewesen. Das hätte alles viel einfacher gemacht. Jetzt hatte sie zwar Søren, aber früher hatte sie sich für mich interessiert. Das war in der neunten Klasse, doch damals kümmerte mich das alles noch nicht. Ich bin eben immer schon ein bißchen langsam gewesen.
Mit Lisbeth wäre alles so leicht. Sie sagt, was sie denkt und fühlt und meint; sie schreit es fast von den Dächern. Und für sie ist Sex so natürlich und notwendig wie das Atmen. Ich wäre bestimmt schon längst nicht mehr Jungfrau, wenn ich mich in sie verliebt hätte. Sie war nur einfach nicht mein Typ. Vielleicht kannte ich sie zu gut. Sie war lieb, sie war verrückt, sie war nicht so dumm, wie sie vorgab, und ich mochte sie wirklich von allen Mädchen am besten leiden, aber ich hätte mich niemals in sie verlieben können.
Ich fand sie auch zu groß und grob – in jeder Hinsicht. Sie war zu sehr wie ein Junge. Obwohl sie lange blonde Haare hatte, hatte sie nichts vom »blonden Dummchen«; mit ihren hellen Nasenhaaren, der Flachsmähne und den fast weißen Wimpern und Augenbrauen über meeresblauen Augen sah sie eher aus wie ein junger Wikinger. Ihre Figur war schon feminin, mit großen Brüsten, breiten Hüften und kräftigen Oberschenkeln. Sie war ziemlich attraktiv, wenn man diesen Typ mochte. Søren ging das so. Er war nicht bloß scharf auf sie, sondern total schwachsinnig lallend verschossen, so sehr, daß es manchmal fast komisch wirkte.
Ich fragte mich, ob ich mit meiner lächerlichen Verliebtheit in Agathe wohl auch so komisch wirkte. Und das tat ich bestimmt.
Ich seufzte, legte mich zurecht und machte mich an die letzten Seiten.
4
Die Sonne war schon ein ganzes Stück über den Horizont gestiegen, als ich nach dem Laufen am Strand ankam. Sie verteilte großzügig Goldflecken auf dem Wasser, es funkelte und glitzerte, und ich mußte die Augen zusammenkneifen. Ich setzte mich auf einen großen Stein, um zu verschnaufen und mich etwas abzukühlen, ehe ich in die Wellen sprang. Als ich in der fünften Klasse war, hatte ich einen Schulkameraden, der nach einer langen, heißen Radtour sofort ins Wasser gewetzt war und nie mehr herauskam. Seither war ich vorsichtig. Hoch oben über mir schrien sich die Möwen die neusten Fischkurse zu, aber abgesehen von ihren langen, scharfen Schreien war alles so still, daß ich hören konnte, wie die Wellen über den Strand züngelten.
Es war ein schöner Morgen, und ich saß eine Weile da und genoß ihn einfach, aber dann begann ich zu frösteln, denn die Luft war noch ziemlich kalt, obwohl es später sicher heiß werden würde. Rasch zog ich mich aus, rannte in großen Sprüngen durch das seichte Wasser, warf mich auf den Bauch und kraulte los. Nach der kalten Luft kam mir das Wasser fast warm vor. Warm und doch sauber. Aber natürlich konnte es trotzdem verschmutzt sein. Ein Stück weiter die Küste hinunter war Badeverbot erlassen worden. Ich stand wieder am Strand und zog mich gerade an, als Thomas und Mini den Strandweg hinunterkamen. Thomas’ 191 Zentimeter ragten über Minis 170 auf. Sie sahen aus wie Pat und Patachon.
»Warst du schon schwimmen?« rief Mini von weitem.
»Ja.«
»Und wie war’s?«
»Spitze!«
»Du hast deine Uhr ja anbehalten«, sagte Mini, als sie bei mir angekommen waren.
»Die ist wasserdicht und so stabil, daß ich sogar zwischen Korallen tauchen kann, ohne daß etwas kaputtgeht.«
»Na, das muß ja rasend nützlich für dich sein«, grinste Mini. »Ist die nicht kalt?«
»Die Uhr?«
»Die See, du Idiot!«
»Die ist spitze, das hab’ ich dir doch gesagt. Fast warm. Viel wärmer als die Luft.«
»Das ist ja auch das mindeste, was wir erwarten können«, meinte Mini.
Er hatte sich noch vor Thomas ausgezogen und lief ins Wasser, aber als es ihm bis zum Nabel reichte, brüllte er los, machte mit einem Luftsprung kehrt und kam wieder herausgeplatscht. »Spitze, du Arschloch!« rief er anklagend. »Das ist doch saukalt!« »Ist es nicht, du mußt bloß richtig untertauchen.«
Ich sah ihm nach, als er wieder ins Wasser lief. Er war zwar klein, sah aber nicht mehr aus wie ein Junge. Er wirkte fast erwachsener als wir anderen, mit seiner Matte von schwarzen Haaren auf der Brust. Einer etwas fadenscheinigen Matte zwar, aber immerhin. Er sah aus wie ein erwachsener Mann, nur eben wie ein kleiner Mann.
Thomas kraulte in einer geraden Linie drauflos. Typisch Thomas! Voll ins offene Meer. Alle guten Ratschläge, immer am Ufer entlang schwimmen und so, waren ihm schnurzegal. Er nahm wohl an, daß wir ihn im Notfall retten würden. Oder besser gesagt, er kam erst gar nicht auf die Idee, daß etwas passieren könnte. Ihm doch nicht. Nicht Thomas, the golden boy. Wonderboy! Zähneklappernd kam Mini wieder aus dem Wasser. »Meine Fresse, das war ja vielleicht kalt. Das war verdammt noch mal kein Vergnügen! Ich kann Baden überhaupt nicht ausstehen, ist doch total unnatürlich. Wenn der liebe Gott gewollt hätte, daß wir im Wasser herumplatschen, dann hätte er uns Kiemen und Schwimmhäute zwischen den Zehen verpaßt.«
»Wenn du es so schrecklich findest, warum machst du’s dann?« Mini grinste. »Um nicht als Waschlappen bezeichnet zu werden. Ich mache die schwachsinnigsten Sachen, um nicht Waschlappen genannt zu werden. Das muß ich einfach, weil ich so klein bin. Sag mal, wo zum Teufel will der denn noch hin?«
Er zeigte auf den kleinen Punkt weit draußen, der Thomas’ Kopf war.
»Jetzt macht er kehrt«, sagte ich.
»Leih mir mal dein Handtuch«, sagte Mini und sah sich danach um. Seine Lippen waren blau vor Kälte.
»Ich hab’ kein Handtuch dabei.«
»Kein Handtuch!« rief er vorwurfsvoll. »Du bist mir vielleicht ein Heini! Erst lockst du mich mit haufenweise falscher Reklame ins Wasser, und dann hast du nicht mal ein Handtuch. Ich bring’ dich vor Gericht, wenn ich an Lungenentzündung eingehe!«
»Alles klar. Lauf eine Runde, dann wird dir schon warm.«
Er wetzte zweimal hin und her, dann kam er keuchend und nach Luft schnappend wieder zurück zu dem Stein, auf dem ich hockte, wühlte in seinen Hemdtaschen und zog ein zerknülltes Päckchen Zigaretten hervor.
»Miese Kondition«, stellte ich fest. »Sind das Lisbeths Kippen?« »Ja, es ist ungesund, daß sie so viel raucht«, antwortete er ohne Hemmungen. »Außerdem waren nur noch vier übrig. Aber Hannah hat versprochen, zum Frühstück neue zu besorgen.«
»Für dich ist es genauso ungesund.«
»Weiß ich doch. Wenn ich rauche, wachse ich nicht mehr. Das haben sie mir schon erzählt, als ich gerade mal elf war, und gestimmt hat’s auch.«
Er warf die leere Packung weg.
»Schwein«, sagte ich automatisch.
»Sonst ist es hier gut, was?« fragte er.
»Zu viele Steine«, sagte Thomas, der jetzt auch aus dem Wasser gekommen war und sich neben uns trockenschüttelte.
»Ich meine nicht den Strand. Den könnt ihr von mir aus an die Russen verscheuern. Aber das andere, Haus und Garten und alles. Sie ist einfach steinreich. Geld wie Heu. Dallas kann da nicht mithalten.«
»Du übertreibst wie immer, Mini«, sagte Thomas.
»Kohle hat sie jedenfalls, und nicht zu knapp. Stell dir vor, achtzehn Jahre und den Hintern voll Geld. Sie kann tun und lassen, was ihr gerade paßt. Ach, wenn ich das doch wäre.« »Vielleicht hätte sie lieber ihre Eltern behalten«, meinte Thomas trocken.
»Aber wieso denn?« fragte Mini, und es hörte sich wirklich an, als ob er das ernst gemeint hätte.