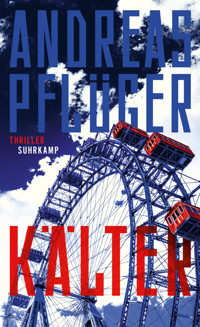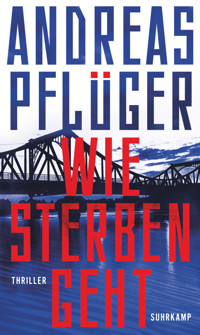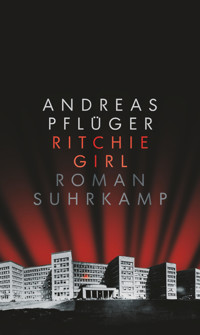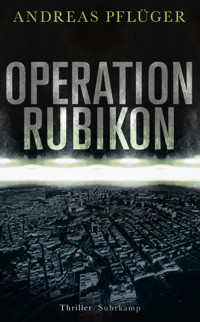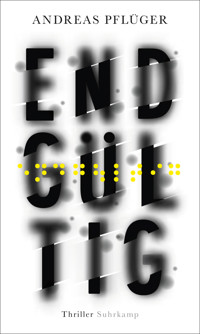11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Jenny Aaron
- Sprache: Deutsch
Es ist niemals leicht lautet der Kodex der Abteilung, einer hochgeheimen Polizeieinheit. Das gilt mehr als je zuvor. Denn es ist nur noch ein Hauch bis zu ihrer Auslöschung. Ihre letzte Hoffnung könnte Jenny Aaron sein. Die blinde Elitepolizistin weiß, was sie ihren Kameraden verdankt. Aber ist die Abteilung wirklich das, wofür Aaron sie immer hielt?
Die Abteilung liquidiert Warlords, bekämpft Terroristen, dringt in Drogenkartelle ein. Weil ihr dabei fast jedes Mittel recht ist, hat sie viele Feinde, auch in der Politik. Doch jetzt steht sie einem Gegner gegenüber, wie es noch keinen gab.
Für die Elitepolizistin Jenny Aaron war die Abteilung alles – auch und gerade, nachdem sie bei einem Einsatz erblindete. Dort wurde sie zu der Kämpferin, die sie heute ist, dort fand sie die Menschen, die ihr am meisten bedeuten. Jetzt könnte Aaron die letzte Hoffnung der Abteilung sein. Doch damit würde sie vielleicht ihre einzige Chance verspielen, jemals wieder sehen zu können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 709
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Titel
Andreas Pflüger
Geblendet
Roman
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2019
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 5124. Korrigierte Fassung, 2022.
© Suhrkamp Verlag Berlin 2019Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Umschlagfoto: FinePic®, München
eISBN 978-3-518-76299-8
www.suhrkamp.de
Widmung
Für Aaron
Motto
Wie willst du je erfahren was hinter dem Spiegel ist wenn du ihn nicht zerbrichst?
Geblendet
Übersicht
Cover
Anfang des Buches
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Motto
Die Seelen der Toten
1
.
Heute
2
3
4
5
6
7
The other Mouth of Hell
8
Einatmen und Ausatmen
9
10
11
12
13
Eine Billion Sandkörner
14
15
16
17
18
19
20
Gatha des Shenxiu
.
vor fünfzehn Jahren
21
22
Die große Fresserin
23
24
25
26
27
28
Der Thron des Drachen
29
30
31
32
33
Zehn Dinge
Nachwort
Textnachweis
Informationen zum Buch
Die Seelen der Toten
In der jähen Stille steht das Mädchen vor Notre-Dame de Paris. Die Kathedrale ruht in der späten Sonne, ein ungeheures Tier mit zwei Köpfen, das allen Lärm der Stadt tief eingeatmet hat. Lichttupfer huschen wie Geckos über die Arabesken, erkunden die Falten von Königsgewändern, flitzen frech in die Mäuler der unheimlichen Chimären. Bald funkeln zu viele, um sie noch zählen zu können. Sie vereinigen sich zu einer Flut, deren Gleißen die alles beherrschende Bleikristallrosette in ein glühendes Zyklopenauge verwandelt.
Es ist die Woche nach dem Osterfest, der »Weiße Sonntag«. Sie ist zwölf und zum ersten Mal in Paris. Im Geschwätz fremder Menschen, ihrem Schubsen, Rufen, Lachen folgt sie dem Vater zum Mitteltor.
Dort bleibt er stehen. »Das ist das Portal des Jüngsten Gerichts«, sagt er und lenkt ihren Blick nach oben. »Siehst du den Erzengel Michael mit den Waagschalen?«
Sie legt den Kopfin den Nacken.
»Ja.«
»Er wiegt die Seelen der Toten.«
Dafür kommen ihr die Schalen sehr groß vor.
»Schließ die Augen und öffne sie erst, wenn ich es dir sage.«
Sie hält ihrem Vater die Hand hin, damit er sie führt. Dann spürt sie unversehens eine Kühle, die sie in dem dünnen Kleid zittern lässt, hört ein Rauschen wie von Blut, das Flüstern von Vielen und wird eine Weite gewahr, so schrecklich und gewaltig wie in einem der Träume, in denen sie fällt und fällt.
»Jetzt«, sagt ihr Vater.
Als sie die Augen öffnet, erblickt sie ein Gewölbe wie keins zuvor; ein steinernes Gemälde, aber auch eine Kaskade aus Licht. Nichts ist schwer, alles schwebt, selbst die riesigen Fenster, die wie Schmetterlingsflügel aussehen.
Benommen setzt sie einen Fuß vor den anderen. Unter dem aus Fels gewobenen Baldachin eines Seitenschiffs findet sie sich in einer auf ewig erstarrten Prozession von Frauen und Kindern und Herrschern und Bettlern wieder, sieht kniende Ritter, nach denen Flammen lecken.
An der Wand sind verwitterte Buchstaben, eine Runzel in einer fremden Sprache. »Ist das Latein?« fragt sie ihren Vater. Als er keine Antwort gibt, bemerkt sie, dass er ihre Hand längst losgelassen hat.
Erst jetzt tritt er zu ihr. »Tempus edax, homo edacio. Die Zeit ist blind, der Mensch töricht. Verstehst du, was das bedeutet?«
»Nein.«
»Dass die Zeit durch die Welt rast und uns mitreißt. Dass wir nicht bestimmen, ob es uns Verderben oder Glück bringt. Hast du das Buch gelesen, das ich dir gegeben habe?«
»Ja.«
»Dann weißt du, dass draußen vor langer Zeit etwas in die Mauer geritzt war. Was stand dort?«
»Unausweichliches Schicksal.«
»Es meint dasselbe. Und ist genauso falsch.«
Als sie sich auf eine Bank setzen, ist sie froh, dass ihr Vater den Arm um sie legt, denn ihr ist kalt. Lange schweigen sie mit Kardinälen und Heiligen und Fabelwesen.
»Kann man die Seele wiegen?« fragt sie.
»Ein kluger Mann hat einst gesagt, dass sie aus einer Art Atem gemacht ist. Wie schwer wird Atem wohl sein?«
»Also gibt es kein Jüngstes Gericht?«
»Die Kirche behauptet, dass die Guten ins Paradies kommen und die Bösen ins Höllenfeuer. Dass wir von dem Tag unserer Geburt an schuldig sind.«
»Und du glaubst das nicht?«
»Das Gemäuer ist fast ein Jahrtausend alt«, erwidert ihr Vater. »Aber die meisten Statuen sind Kopien, weil man in der Französischen Revolution alles zerstört hat. Notre-Dame wurde von den Jakobinern zum Tempel des höchsten Wesens erklärt: der Vernunft. Doch auch die ist nichts als ein Götze, ein Goldenes Kalb, um das die Unwissenden tanzen. Das höchste Wesen kann nur einer sein. Weißt du, wen ich meine?«
Sie denkt nach. »Wir selbst«, sagt sie.
»Ja. Darum gibt es kein Gut und Böse. In uns ist beides eins.«
Ihr ist, als ob Zeit vergeht. Aber es muss eine Täuschung sein, denn an diesem Ort gibt es keine Zeit.
»Erzähl mir von dem Buch«, fordert ihr Vater sie auf. »Wovon handelt es?«
Nach den ersten Seiten war sie enttäuscht gewesen; es war altmodisch geschrieben, und die Menschen redeten über unverständliche Dinge. Doch bald konnte sie es nicht mehr aus der Hand legen, verschlang es am Ende regelrecht.
»Es geht um das wunderschöne Mädchen Esmeralda, dessen Herz dem Hauptmann Phoebus gehört. Obwohl er sie abweist, glaubt sie an die ewige Liebe und ist bereit, dafür zu sterben. Als sie schon unterm Galgen steht, wird sie von Quasimodo gerettet, einem buckligen, einäugigen Wesen, das so hässlich ist, dass kaum einer wagt, es anzuschauen. Er ist der Glöckner von Notre-Dame, und seine einzigen Freunde sind die Ungeheuer, die er beneidet, weil sie aus Stein sind. Die Glocken haben ihn taub gemacht, aber er ist glücklich, wenn er an den Seilen hängt und vom Kopf bis zu den Füßen zittert. Nachts wirft er verzauberte Dinge durch die Schornsteine der Stadt. Er tanzt auf den Dachrinnen und lebt in einer Welt, in der Blinde sehen und Tiere reden können. Niemand weiß, dass die Zigeuner, die Esmeralda ihrer Mutter geraubt hatten, Quasimodo als Baby auf die Stufen von Notre-Dame gelegt haben. Er ist mit Esmeralda durch das Schicksal verbunden.«
»Wie sah Esmeralda aus?« fragt ihr Vater.
Sie grübelt. »Ich weiß nicht. Das muss ich überlesen haben.«
»Sie hatte schwarzes Haar und flammende Augen, so wie du. Was ist aus ihr geworden?«
»Esmeralda will nicht wahrhaben, dass sie Phoebus egal ist. Sie wird der Hexerei beschuldigt, und Quasimodo versteckt sie hier in der Kirche. Aber man findet sie und henkt sie auf dem Place de Grève. Quasimodo legt sich zu ihr ins Grab. Er liebt sie über den Tod hinaus.«
»Hast du nicht jemand Wichtigen ausgelassen?«
Fragend schaut sie ihren Vater an.
»Frollo«, sagt er.
»Ach, der. Das ist ein Mann, der sich an schwarzer Magie versucht. Er glaubt, dass Licht nichts anderes als Gold ist. Er will einen Sonnenstrahl vergraben und das Geheimversteck erst in achttausend Jahren öffnen lassen.«
Sie schaut zu der gigantischen gläsernen Rosette hoch, sieht sie im frühen Abendrot pulsieren. Wenn Licht wirklich Gold ist, denkt sie, muss man es zu dieser Stunde einfangen, weil es dann am allerschönsten ist.
»Hat Frollo Esmeralda nicht auch geliebt?« fragt ihr Vater.
»Schon.«
»So sehr, dass er sie dem Galgen ausgeliefert hat, damit kein anderer sie besitzen durfte«, fährt er fort.
Diesen Teil der Geschichte mag sie nicht.
»Hältst du Frollo für einen schlechten Menschen?« fragt er.
»Ja, sicher.«
»Weil er nur an sich gedacht hat?«
»Ja.«
»Dennoch war er der Einzige, der wusste, wie lächerlich der Glaube an Schicksal ist. Er war kein Sklave der eigenen Angst.«
Daraufbleibt sie stumm.
Ihr Vater steht auf, sie folgt ihm zu einem Tisch mit Kerzen. »Zünd eine an und wünsch dir etwas«, sagt er.
Sie hält ein Streichholz an den Docht, schließt die Augen und wünscht sich nichts. Ganz fest glaubt sie, dass es das Schicksal gibt und eine Kerze es nicht ändern wird.
Draußen schlendern sie an den weit gespannten Strebebögen der Kathedrale entlang, die kolossal und zartgliedrig in einem sind, den Beinen einer riesenhaften schlafenden Spinne gleich. Vater und Tochter schweigen zusammen, wie sie es oft tun. Sie weiß, dass manche Angst vor ihm haben. Die schlossen nie ihre Augen in dem Wissen, dass er über ihren Schlaf wacht. Sie sucht nach dem Ausdruck für seine Schritte. Bemessen vielleicht. Als ob keiner überflüssig wäre. In der Parkanlage sieht sie einen anderen Vater mit einem Mädchen und einem etwas älteren Jungen. Sie ist froh, keine Geschwister zu haben, schon gar keinen Bruder. Will den Vater mit niemandem teilen müssen. Das andere Mädchen ist in ihrem Alter. Aber noch ein Kind. Der andere Vater hat breite Schultern, dicke Halsmuskeln. Ihr Vater ist schlanker, kleiner. Und doch könnte er den Mann mit seinem Daumen töten, ohne aus dem Tritt zu geraten.
Oft denkt sie darüber nach, wie es wohl ist, die Seele eines Menschen in Händen zu halten. Immer wieder war sie versucht, ihren Vater zu fragen.
Tat es nicht.
Sie will es wissen und will es nicht wissen.
Musik reißt sie aus ihren Gedanken, Straßenkünstler auf der Pont Saint-Louis. Einer trägt Frack und Zylinder, sein Gesicht ist eine weiße Maske mit einer schwarzen Träne. Unbewegt steht er auf einer Kiste, den Rumpf eingeknickt, eine Hand hinterm Rücken, die andere weist mit großer Geste zum Publikum, eingefroren in einer Verbeugung. Menschen bewundern und fotografieren ihn, werfen Geldstücke in seine Dose.
Sie schenkt ihm kaum einen Blick. Stunden kann sie so stehen wie er, bewies es, als ihr Vater ihr die Aufgabe gestellt hatte, sich in das Schaufenster des Kaufhauses zu schleichen und mit den Puppen zu wetteifern. Keiner von denen, die draußen die Auslage betrachteten, ahnte, was sie ist. Nicht ein einziges Mal hat sie geblinzelt.
Ein dickes Schiff tuckert unter der Brücke durch, mit lärmenden Menschen, die unwissend sind wie die vor dem Schaufenster, dumm wie jene, die um das Goldene Kalb tanzen.
Ihr Vater hat sie einen anderen Tanz gelehrt.
Sie dreht sich um. Die Sonne steht so tiefhinter der Kathedrale, dass sie gerade noch die Zinnen der Türme erreicht. Tiefrot glimmen sie auf, als seien es die Köpfe zweier mächtiger Streichhölzer, die der Himmel angezündet hat. Sie stellt sich vor, dass Quasimodo auf dem linken Turm steht und Esmeralda auf dem rechten, beide verzweifelt, denn unter ihr im Treppenschacht sind schon die grausamen Fackel-Männer, die sie zum Place de Grève schleifen wollen.
Aber sie träumt sich ein Seil, straff zwischen den Türmen gespannt, und sieht, wie Quasimodo hinübertanzt und Esmeralda auf die andere Seite trägt.
Als ob ihr Vater in ihrem Kopf wäre, fragt er: »Was glaubst du, was uns zum Menschen macht und was zum Ungeheuer?«
Sie findet die Antwort nicht.
»Es ist die Liebe«, sagt er. »Sie macht uns zu beidem.«
Auf der Rive Droite winkt er einem Taxi und weist den Fahrer an, sie ins Faubourg-du-Roule zu bringen. Sie passieren das Zuckerbäckerrathaus und biegen in die Rue de Rivoli ein, durch deren Kolonnaden sich Touristen wälzen. Das Radio spielt leise einen französischen Schlager, irgendetwas über den Schmerz, der das Herz durchbohrt. Ohne dass ihr Vater es aussprach, weiß sie, dass sie sich alle Straßen bis zum Ziel einprägen soll. Es kostet sie keine Anstrengung, während sie sich fragt, wohin die Fahrt geht. Sie werden etwas zum Anziehen für sie kaufen, denn heute ist ein besonderer Abend. Inständig hofft sie, dass es kein Geschäft für Kinder ist, sondern eine richtige Boutique, vielleicht in der Passage mit der Glaskuppel, auf der die vielen Spatzen hüpften. An diesem Abend möchte sie so erwachsen aussehen, wie sie sich fühlt, möchte schön für ihren Vater sein, damit er stolz auf sie ist.
Links ist der Louvre. Morgens waren sie dort. Doch die meisten Gemälde waren dunkel, wie mit Tee übergossen, und als sie schließlich vor der »Mona Lisa« standen, entpuppte sie sich als schielende Frau ohne Augenbrauen. Das weltberühmte Lächeln kam ihr blasiert vor; sie fragte sich, woher die Zicke ihre Hochnäsigkeit nahm.
Zuletzt ging es in die Ägyptische Sammlung. Ihr Vater zeigte ihr einen Krummdolch. Die Klinge war tiefschwarz und beidseitig geschliffen; der Griff stellte einen Skorpion dar, mit Augen aus feuerroten Edelsteinen.
Eine solche Waffe hatte sie noch nie gesehen.
»Damit wurde Pharao Echnaton erstochen«, sagte ihr Vater.
»Woraus ist der Dolch gemacht?«
»Aus Obsidian. Eine Art Glas, das entsteht, wenn Lava erkaltet. Schwerer als ein Keramikmesser, aber genauso scharf.«
Was hätte sie dafür gegeben, ihn in der Hand zu halten.
Stellte sich vor, wie er eins mit der Hand wurde.
»Findest du ihn perfekt?« fragte ihr Vater.
»Nein. Nur wunderschön.«
»Warum?«
»Zum Töten wäre eine gezackte Klinge besser, dann schließt die Wunde sich nicht.«
Ihr Vater sagte: »Das ist wahr, aber in diesem Fall nicht nötig. Der Dolch birgt ein Geheimnis. Im Inneren gibt es einen Kanal, kaum dicker als ein Haar. Man kann den Griff abziehen und Gift hineinträufeln, das in die Wunde sickert. Ob Echnatons Mörder das tat, ist nicht überliefert. Falls ja, wäre er ein kluger Mann gewesen. Dieser Dolch ist herrlich, doch die Kunst des Tötens liegt nicht in der Schönheit, nur in der Effektivität.«
Das hatte er schon einmal gesagt, mit anderen Worten.
Es muss einfach sein.
Und schnell.
Aber auch: Das Einfache ist immer das Schwerste.
Ganz für sich trieb sie so dahin und stand auf einmal vor der Statue eines Mannes, der einen goldenen Kegel auf dem Kopf trug. Sein Gesicht war stolz, und die Augen waren geschminkt. Auf einer Tafel las sie, dass es Osiris war, ein Königssohn. Er wurde von seinem Bruder Seth ermordet, der die Leichenteile über das Reich verstreute. Osiris war es jedoch bestimmt, der Herrscher der Unterwelt zu werden. In der Halle der vollständigen Wahrheit saß er dem Totengericht vor, das entschied, wer ewig leben durfte. Um darüber zu befinden, wurde das Herz des Verstorbenen in eine Waagschale gelegt. In der zweiten Schale war eine Feder. Nur wenn das Herz leichter als diese Feder war, wurde man unsterblich.
Jetzt, im Taxi, beschäftigt sie das Rätsel, weshalb sie nicht an Osiris dachte, als ihr Vater vom Wiegen der Seele sprach. Aber bereits Augenblicke später, beim Place de la Concorde mit dem Obelisken von Luxor, den sie gestern bestaunte, weiß sie es: Ein Herz ist etwas anderes als eine Seele; nur ein Muskel, ein Ding wie diese Säule aus Granit. Dass sie einen gewaltigen Schatten wirft, ändert nichts daran, dass am Ende von ihr so wenig bleiben wird wie von einem Herzen. Die Seele jedoch ist unsichtbar und schwerelos, und darum hat nichts Macht über sie, weder die Zeit noch der Tod.
Als sie über all dies nachdenkt, des Vaters Worte in ihr widerhallen, das Antlitz von Osiris ein Spiegel in der Fensterscheibe, umrunden sie schon den Élysée-Palast mit seinen rotgefederten Gardisten und gelangen in die Rue du Faubourg Saint-Honoré, eine schmale Straße mit vielen Geschäften. Ihr Vater lässt den Fahrer anhalten.
Beim Aussteigen ist es, als ob ein Zirkusmagier den Hut lüftet und einen Traum hervorzaubert.
Chanel!
Die schneeweißen Markisen winken ihr zu, und sie betreten eine Welt, die aus Glitzer gemacht ist. Eine Dame mit griechischer Nase und riesigem Mund fragt, womit sie dienen könne, und ihr Vater erklärt, dass sie abends in Longchamps sein werden und etwas Passendes für seine Tochter suchen. Sofort wird sie vermessen, gedreht, gewendet und ist, während sie noch den wunderbaren Duft von Überfluss einsaugt, in einem Wirbel von Stoffen, einer schöner als der andere. Unaufhörlich schnatternd wählt die Dame vier Kleider aus.
Ehe sie die Kabinentür schließt, sieht sie, dass ihr Vater sich in ein Fauteuil setzt und nach einer der Tageszeitungen langt, die für strapazierte Ehemänner bereitliegen.
In den ersten beiden Kleidern, einem gelben mit Puffärmeln und einem aus grünem Samt mit tiefem Rückenausschnitt, fühlt sie sich unwohl. Sie führt sie dennoch vor und ist beide Male erleichtert, dass ihr Vater, an einem beflissen gereichten Espresso nippend, tadelnd die Augenbrauen hebt. Das dritte ist zu kurz, in den Volants des vierten ertrinkt sie fast.
Als die Dame noch an ihr herumzupft und meint, dass man das raffen könne, schaut sie auf ein Poster. Cindy Crawford posiert in einem hinreißenden Etwas, das aussieht wie im Himmel geschneidert. Die Dame bemerkt ihren Blick und raunt, dass es aus der Lagerfeld-Show im Jeu de Paume stamme und sie nicht sicher sei, ob es in der passenden Größe – aber nein, da hätten sie es ja. Es ist ein Etuikleid aus pudrigem Rosa, das eine Handbreit über den Knien endet.
Sie liebt es.
Ihr Vater nickt der Dame zu: »C’est ça.«
Jetzt brauchen sie noch ein Jäckchen. Schnell ist es gefunden, eine cremefarbene Wollphantasie mit Perlmuttknöpfen. Dazu eine Tasche mit goldener Schulterkette und Ballerinas, in denen sie läuft wie barfuß.
Zuletzt der Hut, schließlich ist es Longchamps. Der erste ist so riesig, dass er ihr wie ein Sombrero vorkommt, beim zweiten, einer Schleierglocke, muss sie an Beerdigungen denken. Aber der dritte! Ein Chevalier mit rotem Ripsband, frech und elegant zugleich.
Ihr Vater hat kein einziges Mal nach einem Preis gefragt und legt an der Kasse seine Kreditkarte hin. Verstohlen schmult sie auf den Beleg und vergisst zu atmen.
Er weist mit dem Kinn aufCindy Crawford und flüstert: »Was ist die gegen dich?«
Der Taxifahrer will die Einkäufe in den Kofferraum tun, aber sie gibt sie nicht aus der Hand. Sie drückt ihre Schätze im Auto an sich, selbst die Kartons duften betörend. Während sie zum Fahrstuhl des Plaza Athénée schwebt, kann sie es kaum erwarten, alles noch einmal anzuprobieren. In der Suite steht sie vor dem Spiegel, eine zwölfjährige Königin, die wollte, sie könnte diesen Augenblick in ein Schächtelchen tun und ihn herausholen, wann immer sie möchte.
Ihr Vater kommt herein. Sie dreht eine verzückte Pirouette, kriegt vor Glück keine Luft.
Er sagt: »Du bist wunderschön. Aber zu dem Jäckchen, den Schuhen und der Tasche musst du heute Jeans anziehen. Das Kleid führen wir ein andermal aus, versprochen.«
Kein Blitz wäre so schnell verschwunden wie ihr Lachen.
»Später wirst du es verstehen«, meint er. »Wir haben noch zwei Stunden Zeit. Versuch, ein bisschen zu schlafen.«
Als er sie allein gelassen hat, steht sie verloren da, mit einer Seele so schwer wie Granit. Sie zieht das Kleid aus und rollt sich auf dem Bett zusammen und weint.
Eine Limousine holt sie ab. Bis sie bei der Pont de Grenelle vom Seineufer abbiegen, schweigen sie. Dann beugt ihr Vater sich zu ihr. »Mach es heut Abend wie am Flughafen; unser kleines Spiel, du weißt schon.«
Trotzig starrt sie aus dem Fenster, sieht Mietskasernen vorbeifliegen, die dunklen Bäume eines Parks, kaum Lichter.
»Bitte«, sagt ihr Vater, »tu mir die Freude.«
Gestern.
Ein Spiel, das sie schon oft gespielt haben.
Aber nie ging es so aus.
Während sie in Frankfurt darauf warteten, dass ihr Flug aufgerufen wurde, ließ er sie andere Passagiere analysieren. Der gegenüber war einfach. Ein Struwwelpeter-Jeanstyp mit Rucksack und Walkman, der in einem dicken französischen Roman herumkritzelte.
»Ein deutscher Student«, flüsterte sie dem Vater zu. »Seine Eltern besitzen Geld, aber keinen Geschmack. Die Rolex ist ein protziges Geschenk, das ihm peinlich ist, sonst würde er nicht sofort den Ärmel drüberschieben, sobald er draufgeschaut hat. Sie lassen ihn in Paris zur Uni gehen, und er lernt etwas, von dem man nicht leben kann.«
»Woher weißt du, dass er kein Franzose ist?« gab ihr Vater zurück. »Vielleicht war er hier zu Besuch.«
»Er setzt die Kopfhörer nur bei deutschen Durchsagen ab.«
Als Nächstes die stark geschminkte Frau im eleganten Wollmantel, die traurig ins Leere starrte.
»Sie ist Französin und in Frankfurt von ihrem Verlobten verlassen worden«, flüsterte sie.
»Warum keine Deutsche?«
»Der Mantel ist viel zu dick für die Jahreszeit, sie hat gedacht, dass es hier kälter als in Paris ist. Außerdem ist sie für eine Deutsche zu schick. Vor kurzem hat sie geweint und sich auf der Toilette nur notdürftig zurechtgemacht, weil es ihr gerade egal ist. Am Finger ist ein heller Streifen; vielleicht hat sie ihren Ring ins Klo gespült.«
»Es könnte ihr Ehemann gewesen sein, nicht der Verlobte.«
»Nein. Der Streifen ist rechts, und in Frankreich trägt man den Ehering links, das habe ich gelesen.«
So ging es minutenlang weiter. Das streitende Ehepaar mit den Zwillingen, der Althippie, dem seine Zigaretten fehlten, die beiden Nonnen mit dem beseelten Dauerlächeln und den Steinaugen. Sie alle wurden von ihr vermessen, gewogen, zerlegt und wieder zusammengesetzt. Als das Boarding begann, wollte sie aufstehen, aber ihr Vater bedeutete ihr, noch sitzen zu bleiben. Er lenkte ihren Blick auf einen Asiaten in der Ecke.
»Was ist mit dem?« fragte er.
Ungeduldig, in Gedanken schon im Flugzeug, auf dem Weg in die Sehnsuchtsstadt, musterte sie den Mann. Kein Koreaner oder Japaner. Vielleicht ein Chinese. Sein Anzug war zerknittert. Sicher teuer, aber nicht maßgeschneidert, die Ärmel eine Spur zu lang. Er trug eine Brille mit dünnem Goldrand, auf der Stirn standen Schweißperlen.
»Er hat einen langen Flug hinter sich und steigt in Frankfurt um«, sagte sie. »Ihm ist nicht gut. Er hat einen trockenen Mund und würde gerne etwas trinken. Eigentlich sieht er wie ein Geschäftsmann aus, aber er hat keine Aktentasche bei sich, keine Zeitung, das ist seltsam. Die Seidenkrawatte ist schlecht gebunden, als ob er darin nicht geübt wäre, und die Brille sitzt nicht richtig, sonst würde er sie nicht dauernd abnehmen und über die Druckstelle auf dem Nasenrücken reiben.« Sie gab auf. »Ich weiß nicht, wo ich ihn hintun soll.«
»Schau auf seine Schuhe.«
Sie waren ausgelatscht, das Leder rissig.
»Er ist eine ›Ameise‹«, sagte ihr Vater leise, »eine arme Sau, die für ein paar hundert Dollar fünfJahre Gefängnis riskiert. Ein Kartell hat ihn in Südostasien in einen vernünftigen, einigermaßen sitzenden Anzug gesteckt, ihm eine Brille mit Fensterglas auf die Nase gesetzt und ihn als Drogenkurier nach Europa geschickt. Die Schuhe sind typisch, daran wird gerne gespart. Der Flug hat elf oder zwölfStunden gedauert, aber er hat nichts gegessen und getrunken, weil er nicht auf die Toilette darf. Wenn man ihn röntgt, findet man mindestens sieben mit Heroin gefüllte Präservative in seinem Darm, und sollte eins platzen, ist er tot. Fällt dir an seinem Handgepäck etwas auf?«
Es war ein Rollkoffer mit Stoffbespannung, der aussah wie hundert andere. Sie schüttelte den Kopf.
»Ich wette, dass er ein Vermögen wert ist. Man macht reines Heroin flüssig und tränkt den Stoff damit. Wenn du die Kleidung rubbelst, die im Koffer ist, rieselt Rauschgift heraus. Vielleicht sind sogar seine Schuhe imprägniert, plus Schnürsenkel.«
Der Asiate stellte sich direkt hinter ihnen in die Schlange.
»Du könntest der Polizei einen Tipp geben«, flüsterte sie dem Vater ins Ohr.
»Dann würden wir den Flug verpassen.« Er trat einen Schritt zur Seite, lächelte die Ameise freundlich an und sagte auf Englisch: »Gehen Sie ruhig vor, wir haben es nicht eilig.«
Sie sah den Mann zittern und zitterte selbst.
An der Schnellstraße huscht ein Schild vorbei: Hippodrome de Longchamps 3. Sie fühlt den Blick ihres Vaters und konzentriert sich widerstrebend auf den Chauffeur. Routiniert steuert er die Limousine im dichten Verkehr. Er ist in den Dreißigern, specknackig, aber nicht dick. Die Haare sind strähnig, seine Fingernägel müssten geschnitten werden. Er legt keinen Wert auf solche Dinge und hat einen Chef, dem anderes wichtiger ist. Die teigige Wange zeigt, dass er wenig Sonne abkriegt; wahrscheinlich arbeitet er nachts.
Teigbacke atmet durch den Mund. Sie erinnert sich, dass er vor dem Hotel, als er sie in schlechtem Englisch begrüßte, nach einer verstopften Nase klang. Jetzt würde sie eher darauf tippen, dass sie mehr als einmal zusammengeflickt wurde. Teigbacke könnte alles Mögliche sein: Chauffeur, gutmütiges Faktotum, Knochenbrecher.
Sie sind da.
Die Rennbahn ist eine Neonpyramide mitten im Bois de Boulogne. Als sie zwischen all den Menschen hindurchgehen und sie die mondänen Frauen mit den abenteuerlichen Hutkreationen sieht, die Männer mit Frack und Zylinder, Mädchen ihres Alters, jedes davon tausendmal eleganter als sie, kommt sie sich in den Jeans hässlich vor, und der Chevalier, den sie vorhin so keck fand, erscheint ihr lächerlich.
Sie hofft, dass sie wenigstens direkt an der Bahn sitzen, nah bei den Pferden, doch zu ihrer Enttäuschung führt ein livrierter Page sie zu einem Aufzug.
Es ist eine Suite mit Glaswänden unter dem vorspringenden Dach der Tribüne. Ein Buffet ist aufgebaut. Zehn Männer trinken, lachen, keine Frauen.
Einer begrüßt ihren Vater. »Wie nett, dass Sie es einrichten konnten. Hier mache ich am liebsten Geschäfte.«
Ein Franzose, aber sein Deutsch ist sehr gut. Sie schätzt ihn auf Anfang vierzig; ein Beau mit weicher Stimme und harten Augen, der sie an Andy García erinnert.
»Hallo, Alain. Das ist meine Tochter.«
Er nimmt ihre Hand und lässt sie nicht los. »Was für eine hübsche junge Dame du bist. Deine Mutter muss eine wahre Schönheit sein.«
»Guten Abend, Monsieur.«
»Nicht so förmlich. Sag Alain.« Noch immer besitzt er ihre Hand. »Bist du das erste Mal bei einem Pferderennen?«
»Ja.«
»Heute ist eine Premiere. Sonst finden in Longchamps keine Nachtrennen statt, aber für diesen Mann dort hat man eine Ausnahme gemacht und Flutlichtmasten aufgestellt.« Endlich gibt Alain ihre Hand frei.
Sie sieht die Araber in der Nebenloge. Alle tragen Burnus und das von einem Ring zusammengehaltene Kopftuch, doch nur bei einem ist es rotweiß. Die anderen stehen um ihn herum und bewundern jede Geste von ihm, jedes Wort.
Alain wendet sich ihrem Vater zu. »Wissen Sie, wer das ist?«
»Iskandar Rashid. Er ist Rüstungshändler und Minister der saudi-arabischen Nationalgarde. Ein enger Vertrauter von Ruhi bin Sultan.«
»Zwei Tage war er in Paris«, sagt Alain, »um mit unserer Regierung einen von den Deals zu machen, von denen man nie in der Zeitung liest. Rashid ist Pferdenarr und besitzt unter anderem ein Gestüt in der Haute-Garonne. Er wollte partout, dass seine Wunderstute Amber hier läuft, allerdings hätten ihm die Geschäfte keine Zeit gelassen, dabei zu sein. Noch diese Nacht muss er zurückfliegen; sein König hat morgen Geburtstag, zu fehlen wäre unentschuldbar. Deshalb erwies man Rashid die Gefälligkeit, das Rennen auf den Abend zu legen.« Alain feixt. »Amber ist neun-zu-eins-Favorit im Hauptrennen. Ich fürchte jedoch, es wird kein erfreulicher Abend für den Prinzen.«
Als ob Rashid wüsste, dass über ihn gesprochen wird, wendet er den Kopf und sieht mit einem dünnen Lächeln zu ihnen herüber. Er wirkt nicht wie einer, der Verlieren gelernt hat.
Alain deutet eine Verbeugung an. »Heute Nacht heulst du in deiner goldenen 747 die Kissen nass, mein Freund. Und dann sind wir quitt.«
Sie fängt einen seltsamen Blick ihres Vaters auf. Mit einem Mal denkt sie, dass es bei dem Paris-Besuch von Anfang an um diesen Prinzen ging. Ihr Vater hatte nur erwähnt, dass sie zum Pferderennen gehen und einen Bekannten von ihm treffen würden. Aber nun kommt ihr in den Sinn, dass er wusste, wer in der Nebenloge sein würde.
Sie darauf vorbereiten wollte.
Notre-Dame und das Jüngste Gericht. Der Tanz ums Goldene Kalb. Das Schicksal, nur ein Aberglaube. Das Buch von Victor Hugo, Mensch und Ungeheuer. Der Dolch mit dem Skorpion. Das Kleid, das sie nicht anziehen durfte.
Das Spiel am Flughafen.
Oder irrt sie sich?
Ihr Vater schenkt dem Prinzen keine weitere Aufmerksamkeit, setzt sich mit Alain, um sich zu unterhalten, und sie tritt an das Panoramafenster. Unter ihr liegt die riesige Rennbahn, ein Vorlauf wird gestartet. Die Pferde sind so schnell, dass sie einen Schweif aus Flutlicht hinter sich herziehen. Eine Lautsprecherstimme schlägt Salti, ist aber nur Gebrüll hinter dickem Glas.
Niemand beachtet sie. Ungestört kann sie Alains Männer im Spiegel der Scheibe studieren.
Keiner ist älter als vierzig. Keiner sitzt. Keiner trinkt Alkohol. Sie sind vertraut miteinander, witzeln, lachen leise. Auch wenn sie nicht alles versteht, hört sie heraus, dass es Zoten sind, sexuelle Anspielungen auf die Araber nebenan. Die Männer sind es gewohnt, sich in einem beliebig großen Raum zu bewegen, ohne jemandem auf die Füße zu treten. Sie tragen Sneakers mit weichen Sohlen, ihre Anzüge sind bequem geschnitten und buchten sich über dem Gesäß aus.
Pistolen.
Sherpas.
Automatisch benutzt sie für die Leibwächter den Begriff, den sie vom Vater gelernt hat. Keiner hat einen Blick fürs Rennen oder scheint sich für irgendetwas zu interessieren; alle halten die Augen ruhig. Doch sie registriert die Körperspannung und weiß, dass die Lässigkeit sich im Bruchteil einer Sekunde in ein Ballett verwandeln kann.
Eine Ballerina erkennt sowas.
Sie geht zum Buffet, schenkt sich eisgekühlte Limonade aus einem Krug ein und inspiziert unauffällig den Mann, der neben der Tür lehnt und von dort alles im Blick hat.
Er ist mittelgroß, Südeuropäer, vielleicht Türke. Sein Gesicht ist ausdruckslos, der Kinnbart akkurat gestutzt. Die Nase, die hohen Wangen, die Schultern – alles ist scharfkonturiert. Als er sich bückt, um einen Schnürsenkel zu binden, fließt unter dem taillierten Hemd eine Muskelwelle durch seinen Körper.
Sie stellt sich vor, dass er nicht aus Fleisch und Blut besteht, sondern aus einer Masse, die sich jederzeit beliebig verformen kann; so wie Jim Carrey in Die Maske.
Um abzuschätzen, wie groß seine Reichweite ist, zieht sie in Gedanken einen unsichtbaren Kreis um ihn.
Dann einen zweiten, größeren.
Einen dritten.
Mit einer winzigen Augenbewegung dirigiert Jim den Sherpa, der Alain und ihrem Vater zwei Cognac gebracht und sich dann in eine Ecke zurückgezogen hat, einen Meter nach links, wo die Sichtachse besser ist.
Sie spürt, dass sie beobachtet wird, wendet sich um und wird von Alain herbeigewunken.
»Komm, setzt dich zu uns«, sagt er.
Erst denkt sie, er wolle mit ihr plaudern, doch Alain beachtet sie nicht weiter und führt sein Gespräch mit ihrem Vater fort. Es geht um die Treuhand, ein Wort, das sie schon einmal gehört hat. Um eine Werft in Rostock, ein Geschäft, viel Geld, Probleme mit dem Bundeskriminalamt. Das alles in Zimmerlautstärke; ihr Gastgeber ist so selbstsicher, dass er sich keine Mühe gibt, etwas vor seinen Männern zu verbergen.
»Selbstverständlich machen die deutschen Investoren, die Ihrem Kanzler den Hals mit sogenannten Spenden vollstopfen, sich nicht die Hände schmutzig. Sie sitzen in ihren klimatisierten Frankfurter Büros mit Aussicht auf den Wolkenkratzer der Dresdner Bank, bestechen Bundestagsabgeordnete und unterschreiben Schecks für die russische Mafia. Im BKA stört das keinen. Stattdessen verfügt Präsident Wolf, dass Leute von mir auf die Fahndungsliste von Interpol gesetzt werden.« Alain prostet ihrem Vater mit dem Cognacschwenker zu. »Sorgen Sie dafür, dass er mich endlich in Ruhe lässt. Dann haben Sie Ihre Schulden bezahlt.«
»Sie überschätzen meine Möglichkeiten.«
Alain hebt seine Stimme. »Ich habe euch unseren Gast noch gar nicht vorgestellt. Er ist in Deutschland eine große Nummer und könnte sich jederzeit vom BKA-Präsidenten ins beste Restaurant von Wiesbaden einladen lassen. Aber er meint, dass ich ihn überschätze. Wie findet ihr das?«
Die Sherpas lachen.
»Sie wollen, dass ich meinen Kopf unter ein Fallbeil lege«, sagt ihr Vater ruhig.
Alain sieht sie an. »Es scheint, dass dein Vater das alte korsische Sprichwort kennt: ›Sind die Schulden hoch genug, können sie getrost noch höher werden.‹« In seinem Mundwinkel ist getrocknete Spucke, weiß wie ein Rest Zahnpasta. »Nun ja, man kann Schulden auch abstottern, nicht alles ist eine Geldfrage.« Er legt lächelnd seine Hand aufihren Arm. »Wollen wir uns die Pferde ansehen?« Und zu ihrem Vater: »Sie haben doch nichts dagegen?«
Der sagt: »Geh nur. Es wird dir gefallen.«
Sieben Sherpas bleiben bei ihm, zwei steigen mit Alain und ihr in den Fahrstuhl. Erst ist sie überrascht und hält es für Nachlässigkeit, doch das Menschengewimmel, in dem sie bald sind, macht ihr bewusst, dass man auf einer solchen Kirmes niemanden vernünftig schützen kann, selbst mit zwanzig Mann nicht. Außerdem würde Alain damit nur Aufmerksamkeit erregen.
Gleichzeitig schießt ihr die Frage durch den Kopf, warum er überhaupt mit so vielen Sherpas gekommen ist.
Um meinen Vater zu beeindrucken, Macht zu demonstrieren.
So schlecht kennt er ihn.
Und er ahnt nicht, was mein Vater mich gelehrt hat.
Alain geht dicht neben ihr, lässig, als sei er hier zuhause. Er hat den Arm um sie gelegt, damit sie nicht getrennt werden. Ihre Schulter glüht unter seiner Hand.
Auf einem Rondell führen Jockeys die Pferde im Kreis; Rennbesucher drängeln sich hinter der Absperrung, um das Starterfeld zu begutachten. Alain lässt sich von den Sherpas den Weg freibahnen und tritt mit ihr ans Seil. Sie liebt Pferde, auch wenn sie immer ein wenig Angst vor ihnen hat, bewundert das Spiel der Muskeln; Kraft, die nicht protzt, einfach da ist.
»Gehört eins davon Ihnen?« fragt sie.
»Früher hatte ich ein Pferd, jetzt fehlt mir dazu die Zeit. Auf wen würdest du Geld setzen?«
Ihr Blick wird von den blitzenden Augen eines Hengstes angezogen, der als Einziger gescheckt ist. »Auf den vielleicht.«
Alain lacht. »Das ist ein Tobiano. Seine Beine sind zu kurz. Er soll nur das Publikum unterhalten, wie ein Clown im Zirkus.«
Eine riesige Stute wird vorbeigeführt; sie kann sich nicht vorstellen, wie der Jockey in den Sattel kommt. »Und die?«
»Keine schlechte Wahl, sie hat eine erstklassige Übersetzung und geht weich im Maul. Aber sie ist ein ›Flieger‹, etwas für den Sprint. Für die zweitausend Meter, die hier gelaufen werden, hat sie nicht genug Atem.«
»Woran erkennt man ein gutes Rennpferd?«
»Par les ganaches«, antwortet Alain. »An den, wie heißt das auf Deutsch – Backen. Sie dürfen nicht zu eng stehen, weil dort die Zügel entlangführen.« Er deutet mit dem Kinn auf eine Stute, die noch größer als die andere ist. Sie tänzelt und schnaubt, hat flockigen Schaum um die Nüstern, einen Brustkorb wie ein Fass.
»Was hältst du von der?«
»Wow«, bringt sie nur raus.
»Das ist Amber, das Pferd des Prinzen. Hübsch, nicht wahr?«
»Die wird bestimmt gewinnen.«
»Nein. Der da macht das Rennen, mit zwei Längen.«
Alain meint den braunen Wallach mit der Stirnblesse, der dahinter kommt. Er ist unscheinbar, wirkt gutmütig, fast wie ein Pferd für Kinder.
»Warum?« fragt sie.
Hinter sich hört sie die Stimme ihres Vaters.
»Weil Alain es will.«
Sie dreht sich um. Der Lärm, die vielen aufgeregten Gesichter, die Pferde – das alles verschwindet abrupt, ist wie ausgelöscht.
Es gibt nur noch die beiden Männer.
Ihr Vater und Alain sehen einander in die Augen, als seien sie die einzigen Menschen auf der Erde, eine Ewigkeit vor unserer Zeit, umgeben von glühender Lava, die in Abertausend Jahren zu Obsidian erstarren wird.
Alain streicht ihr über die Wange, als wolle er eine teure Porzellantasse auf Staub prüfen. »Ich werde fünftausend Francs für dich setzen, das wird ein schönes Taschengeld.«
Er geht mit den Sherpas. Ihr Vater sieht sie mit einem Blick an, der sie frieren lässt. »Komm.«
Ohne ein Wort kehren sie zur Tribüne zurück.
Als sie im Fahrstuhl sind, stoppt er ihn zwischen zwei Stockwerken. »Alain ist ein großes Problem für mich. Und du kannst es lösen.«
»Wie?« flüstert sie.
»Weißt du, was für ein Mensch er ist?«
Sie nickt.
»Sag es.«
»Er mag Mädchen wie mich.«
»Ja. Und einige von ihnen leben nicht mehr.«
Sie weiß nicht, ob der Fahrstuhl zittert oder sie.
»Ich will, dass du ihn heute Nacht tötest«, sagt ihr Vater.
Einmal war sie im Krankenhaus gewesen, wo man ihr den Blinddarm entfernt hatte. Das Rennen, die schweißsprühende Korona der Pferde in einem Taumel hochspringender Menschen, die Wut, mit der Rashid sein Champagnerglas gegen die Scheibe schmiss, Alains Grinsen, der stumme Abschied von ihrem Vater, all das war wie damals nach der Operation, als sie ohne klaren Gedanken gewesen war, nicht schlafend, nicht wach.
Jetzt sitzt sie mit Alain im Wagen. Teigbacke fährt auf einer Autobahn Richtung Westen. Nur Scheinwerfer und Rücklichter lassen sie wissen, dass sie in dieser Nacht nicht allein auf der Welt ist. In den anderen Autos sind Menschen. Aber unendlich weit fort, unerreichbar; von ihrem Herzrasen ahnen sie nichts. Eine halbe Stunde dauert die Fahrt nun schon. Gleich nach dem Einsteigen nahm Alain das klobige Gerät aus der Mittelkonsole und telefoniert seitdem in einer unbekannten Sprache, Korsisch vielleicht.
Sie nimmt jedes Detail überwach wahr, als wäre nichts außerhalb ihres Körpers, sondern alles in ihr. Unter ihrer Haut, in ihren Muskeln, sogar in ihrem Blut. Den ekligen Rauch seiner Zigarre. Das Grunzen, mit dem er den Krawattenknoten lockert. Sein widerliches Eau de Toilette, das ihre Nase verstopft. Seine langen, manikürten Finger, die zu nichts gut sind außer zum Schnipsen.
Alains Stimme ist leise und konzentriert, aber jeder Satz hat ein Ausrufezeichen. Ab und zu knurrt er unwillig in das Telefon, selbst das ein Befehl. Von draußen dringen keine Geräusche in den gepanzerten Wagen. Es blitzt, donnert, beginnt zu regnen. Stumpfe Schlieren bleiben auf der Windschutzscheibe zurück, weil die Wischblätter abgenutzt sind.
Einmal sieht sie Teigbackes Blick im Rückspiegel und weiß: Sie ist nicht das erste Mädchen, das in seinem Auto sitzt.
Die anderen Männer geleiten sie in drei Limousinen, die sich mit Führung und Nachhut abwechseln. Zwischen den Fahrzeugen ist nie mehr als ein Meter Luft, bei jeder Geschwindigkeit. Die Sherpas wurden erstklassig ausgebildet, kein anderer Wagen könnte sich dazwischendrängen.
Sie merkt sich die Strecke, so gut es geht. Zuerst war es eine Schnellstraße durch den Bois de Boulogne. Dann ging es über eine Insel, groß wie die von Notre-Dame, jedoch ohne Häuser. Wieder fuhren sie am Fluss entlang. Und schließlich auf diese Autobahn, die jetzt im Nirgendwo endet. Neben der Straße sind Gleise; hinter der Wand aus Regen ahnt sie Supermärkte, Tankstellen, Fabrikgebäude.
Eine neue Autobahn, abermals überqueren sie ein Gewässer, ein Kohlenschiff stampft lautlos unter ihnen.
Kann das immer noch die Seine sein?
Vielleicht.
Eine Sturmbö scheucht den Regen weg. Rechts sieht sie ein hell angestrahltes Stauwehr, einen Wirbel aus weißer Gischt.
Ein Ortsschild: Carrières-sur-Seine.
Als Teigbacke das Tempo drosselt, legt Alain das Telefon weg. »Ganz vergessen: dein Gewinn.« Er greift ins Jackett und drückt ihr ein dickes Geldbündel in die Hand. »Was wirst du dir davon kaufen?« fragt er lächelnd.
»Etwas, das für immer bleibt«, sagt sie. Sie tut die Scheine in die Chanel-Tasche zu dem gezackten Keramikmesser, das ihr Vater ihr im Lift gegeben hat.
Das Anwesen liegt am Ende einer langen Zufahrt, die durch nachtschwarze Wiesen und Weiden führt. Ein Tor öffnet sich in einer hohen Mauer. Sie halten. Die Tür der Limousine bewegt sich automatisch. Alain steigt mit ihr aus und legt seinen Arm um ihre Taille.
Auf dem Weg zum Haus hört sie Teigbackes Kaugummiblase platzen, Kies unter ihren Ballerinas knirschen, Hunde in einem Zwinger knurren. Alle Geräusche sind jetzt. Aber ihr Kopfist auf einem fernen Planeten, der eine fremde Sonne umkreist, ein Ort, wo eine irdische Sekunde Stunden währt. Eine Sonde mit der Stimme ihres Vaters fliegt aufihrer endlosen Reise durch den Weltraum an ihr vorbei.
Im Haus will er mit dir allein sein.
Die Männer bleiben draußen, sichern das Grundstück.
Nur du und er.
Und dann ist es nur noch ein Flüstern.
Alain macht Licht an. Sie fotografiert alles mit den Augen. Die kostbaren Möbel, den Kronleuchter, das Schachbrettmuster des Fußbodens, die gewundene Treppe in den ersten Stock. An der Wand ein Gemälde, Chaos aus Klecksen und Schlangenlinien; nichts hat einen Anfang oder ein Ende. So wie die Angst, die sie einatmet, ausatmet, der ranzige Geschmack im Mund, das Geräusch in ihrem Kopf, ein Hämmern wie von hundert Fäusten an einer Kirchenpforte.
Wir haben es oft genug trainiert.
Du bist so weit.
Du wirst mich nicht enttäuschen.
Alain fasst sie an der Hand und geht mit ihr nach oben. Ihr ist, als ob die Hand in Flammen steht. Er öffnet eine Tür, das Schlafzimmer. Der Sauerstoff, um den sie ringt, schafft es nicht in ihre Muskeln. Unsagbar schwer ist sie, aus Stein wie der Obelisk von Luxor. Alain nimmt ihren Hut ab, streift das Jäckchen von ihren Schultern, die Chanel-Tasche fällt zu Boden. Sein Rasierwasser schießt in ihre Nase wie Riechsalz.
Plötzlich hat sie Sätze aus dem Glöckner von Notre-Dame vor Augen. Sie hat sie nicht auswendig gelernt, sich zuvor nicht einmal an sie erinnert. Doch nun sieht sie die Worte so klar, als seien sie in die blendend weiße Bettdecke gewebt.
Halb im Schlaf, halb wachend, empfand sie nichts weiter, als dass sie in die Luft emporstieg, dass sie in ihr schwamm, in ihr flog, dass etwas sie über die Erde emporhob. Da fühlte sie jene eigentümliche Erschütterung, die plötzlich die Passagiere eines Schiffes weckt, das mitten in einer dunklen Nacht auf Grund fährt.
»Warte«, bittet sie, als Alain sie aufs Bett drücken will.
Sie hebt ihre Handtasche auf und öffnet sie.
Er ist entspannt, legt das Jackett ab.
Sie umschließt den Griff des Messers.
Nimmt es heraus.
Rammt ihm die Klinge bis zum Heft unters Kinn.
Der Schrei, den sie auf den Lippen hat, verlässt ihren Mund nicht, explodiert in ihr. Ihr ganzer Körper bebt, als wäre er ein Klöppel, der in einer stählernen Glocke schwingt.
Alain versucht, etwas zu sagen. Er hustet Blut in ihr Gesicht, tatscht nach ihr, will sich an ihr festhalten und rutscht an ihrem Arm ab.
Fällt.
Liegt auf einem roten Spiegel.
Seine Augen werden leer und grau. Sie weiß nicht, wie lange sie aufihn hinabsieht, und stellt sich vor, wie die Seele aus dem Etwas zu ihren Füßen entweicht. Aber dass sie schwerer als das Messer ist, das sie jetzt an der Bettdecke abwischt.
Sie löscht das Licht, huscht ans Fenster und öffnet den Vorhang einen Spalt weit. Der Regen ist vorbei, die Bäuche großer Wolken glimmen silbern zwischen Sternen. Unten patrouillieren Männer mit Waffen. Sie schaut auf die Uhr und weiß, dass sie mindestens eine halbe Stunde warten muss, bis sie aus dem Haus kann.
Schweiß brennt in ihren Augen.
Aber plötzlich ist ihr eiskalt.
Eine Hand greift nach ihrem Fuß.
Alain lebt noch.
Er ist zu ihr gekrochen und umklammert den Fuß mit einer Kraft, die aus dem Totenreich kommen muss. Verzweifelt versucht sie, sich zu befreien, taumelt und reißt im Sturz eine große Porzellanvase um. Sie zersplittert so laut, dass sie glaubt, man müsse es bis Paris hören. Alain wälzt sich über sie, Blut gurgelt aus der Stromschnelle seines Mundes. In seinen Augen sieht sie den unbändigen Willen, ihre Seele mitzunehmen.
Ihre Hände fliegen an seinen Hals, ertasten blind die Wunde. Sie schiebt zwei Finger hinein und reißt den glitschigen Schlitz so weit auseinander, wie es geht.
Ihre Augen in seinen.
Sein Herzschlag in ihrem.
Alains Blick geliert.
Dann ist es still.
Es ist eine Schinderei, die schwere Leiche wegzudrücken und auf die Beine zu kommen. Sie wankt zum Badezimmer, rutscht auf Alains Blutspur aus, fällt hin, zieht sich am Bett hoch, lässt Licht aufzucken.
Sie starrt in den Spiegel, in eine rote Maske aus Verwirrung und Furcht, und erkennt sich nicht.
Schrubbt das fremde Gesicht mit Seife.
Sie muss sich am Becken festhalten, weil der Raum sich in einem zweiten Raum dreht, der unsichtbar ist, aber Wände aus Eis besitzt. Ihr Gesicht teilt sich im Spiegel in drei verschiedene Gesichter. Eins gehört einem kleinen Mädchen, das noch an Wunder glaubt. Eins trägt ein Kainsmal auf der Stirn. Eins ist blind, hat tote Augen.
Sie erinnert sich an ein Märchen, in dem eine Frau gestorben war und alle Spiegel im Haus verhüllt wurden, um den Tod daran zu hindern, noch jemanden zu holen.
Unbewusst greift sie nach einem Handtuch, will es über den Spiegel hängen. Doch plötzlich vereinen sich die Bilder in einer rasenden Ziehharmonikabewegung, und sie ist zurück in dem Haus aus Angst.
Es klopft an der Schlafzimmertür.
Eine Stimme: »Monsieur? Tout va bien?«
Sofort weiß sie: Jim. Der Kommandoführer.
»Monsieur?«
Als die Tür aufgeht, er hereinkommt und das Licht anmacht, hat sie schon eine Nadel aus ihrer Lockenmähne gezogen, hat das Messer in ihrer anderen Hand und presst sich an die Wand. Sie schneidet tiefin Jims Oberschenkel, dreht die Klinge, springt weg, um aus seiner Reichweite zu gelangen, und hofft, dass sie die Arterie erwischt hat.
Hat sie nicht.
Ohne einen Laut zieht er das Messer heraus und wirft es achtlos hin. Alains Leiche lässt ihn kalt. Er war nur ein Patron, andere zahlen genauso gut. Aber sie ist interessant. Jim mustert sie wie ein seltenes Insekt.
Sie betet, dass er seine Männer nicht ruft.
Nein, das wird er nicht, dazu amüsiere ich ihn zu sehr.
Blitzartig memoriert sie die verwundbarsten Stellen.
Gesicht, Kehle, Solarplexus, Rippen, Genitalien, Nacken, Augen.
An Gesicht und Kehle komme ich nicht unmittelbar heran. Für seinen Solarplexus, die Rippen und den Nacken fehlt mir die Kraft.
Die Genitalien. Dann die Augen.
Sie fällt auf die Knie, robbt aufJim zu, bettelt: »Bitte, bitte, tun Sie mir nichts.«
Und sieht nicht zu dem Messer, das zwischen ihnen auf dem Parkett liegt.
Aber weiß genau, wo es ist.
Schenk mir noch einen halben Meter.
Jim reißt sie an den Haaren hoch. Ihre Bewegungen sind für ihn nur ein Schatten. Eine Hand greift in seinen Schritt, mit der anderen sticht sie die Nadel in beide Augen. Als Jim den Mund zum Schreien öffnet, sein Körper vor Schmerz gelähmt, stocksteif, stopft sie den Schal hinein, den sie um die Schultern trug.
Hat das Messer.
Zieht es durch seine Kehle.
Der zweite Körper ohne Seele.
Und alles noch einmal. Das Badezimmer, der Spiegel, ihr Gesicht unter kaltem Wasser. Sie setzt sich aufs Bett, schließt die Augen und wartet, dass andere Männer kommen und sie töten.
Nichts.
Niemand.
Irgendwann beginnt sie, die Sekunden zu zählen, bis eine halbe Stunde um ist. Sie steht auf, zieht die Bluse aus, streift das Chanel-Jäckchen über die nackte Haut, knöpft es zu, setzt den Hut auf. Ihre Jeans sind schwarz, die Blutflecken sind kaum zu sehen. Sie steckt das Messer in die Handtasche, nimmt das Geld heraus und wirft die Scheine auf Alains Leiche.
Als sie durch die Tür geht, schwört sie sich, alles, was hier geschehen ist, so tiefin sich zu verschließen, dass sie nie mehr daran denken wird. Es aus ihrer Erinnerung zu löschen, sodass es niemals war.
Draußen reden zwei Sherpas im Flüsterton. Einer von ihnen ist Teigbacke, der Chauffeur.
Sie sagt: »Jemand soll mich zurück ins Hotel bringen.«
Blickwechsel.
Schweigen.
»Fragt Alain.« Sie wundert sich, dass das ihre Stimme ist.
Teigbacke greift zum Sensor, die Türen der Limousine öffnen sich. Sie steigt hinten ein, die zwei Männer vorn. Als sie schon anfahren, tritt ein Dritter ins Scheinwerferlicht und bedeutet ihnen zu halten.
Teigbacke lässt die Scheibe herunter.
»Geht’s in die Stadt?«
»Ja, warum?«
»Ich komm mit.«
Teigbacke lacht. »Ah, die Rothaarige«, sagt er.
Der andere grinst. »Ich schwöre, sie ist blond.«
Er setzt sich neben sie, beachtet sie nicht, an seinem Hals ist eine dicke rote Narbe. Teigbacke macht das Radio an, Johnny Hallyday, ein Liebeslied. Sie fahren durchs Dorf und sind bald auf der Uferstraße. Teigbacke beschleunigt, links ist eine Tankstelle. Das Stauwehr kommt in Sicht. Ihr ist, als habe sie es nie zuvor erblickt, sei nie hier gewesen. In Gedanken taucht sie in die schaumige Flut und löst sich darin auf.
Das Autotelefon klingelt, der Beifahrer nimmt ab. »Ja? Was?«
Im selben Moment hat sie das Messer in der Hand und treibt es Rotnarbe neben ihr ins Ohr. Er ist nicht angeschnallt, kippt nach vorn. Sie reißt die Pistole aus dem Gesäßholster und weiß sofort, dass es eine Glock ist, die sie nicht entsichern muss. Ihr Zeigefinger verwandelt den Hinterkopf des Beifahrers in einen Nebel aus Gehirnmasse. Teigbacke will ihr die Waffe entwinden, verrenkt sich, steuert mit links. Sie beißt so fest in seine Hand, dass er loslässt. Hört seinen Schrei. Hat Kupfer im Mund, spuckt etwas aus. Sie schwenkt die Glock herum, drückt ab und öffnet Teigbackes Schädel mit fünf Gramm Blei.
Sterbend gibt er das Steuer frei. Der Wagen schlingert. Während die Zeit Ferien hat, versucht sie, ans Lenkrad zu gelangen, und sieht zu, wie ihre Fingerspitzen Millimeter um Millimeter vorankriechen.
Endlich berührt sie das Leder.
Aber sie hat noch nie ein Auto gefahren.
Die Zeit wird von null aufÜberschall katapultiert und macht graue Schemen aus der Welt. Hastig reißt sie das Steuer herum, die Limousine schießt über die Uferböschung. Ein Reifen trifft auf ein Hindernis; sie heben ab, werden zu einem tonnenschweren Geschoss. Rotnarbe fällt auf sie, seine Körpermasse eine Dampframme. Dann liegt sie plötzlich über ihm, krallt sich an ihm fest, während das Auto sich erneut dreht und mit dem Unterboden aufs Wasser kracht. Kurz sieht sie noch die Lichter des Stauwehrs, flackernd wie die Kerzen einer Totenmesse.
Dann sinken sie.
Es wird stockfinster.
Irgendwann ein Knirschen. Die Strömung schleift das Auto über Geröll, bis es still ist. Panisch tastet sie nach Rotnarbe. Er liegt im Fußraum. Sie sucht seine Jacke ab.
Bitte, lieber Gott, lass ihn ein Feuerzeug haben!
Sie findet es und macht es an.
Kein Wasser.
Sie vermutet, dass der Wagen für alle möglichen Ernstfälle ausgerüstet und selbst gegen Gasangriffe abgedichtet ist. Verzweifelt versucht sie, die Tür zu öffnen, gibt aber sofort auf. Sie erinnert sich, was ihr Vater einmal sagte: »Bei manchen Panzerlimousinen sind Türen und Fenster so schwer, dass sie sich nur elektronisch öffnen und schließen lassen.«
Ihr Daumen wird heiß, sie lässt die Flamme ausgehen. Bis zur Oberfläche sind es wenige Meter. Aber keiner wird dieses Grab je finden. Sie denkt an ihre Mutter, zum ersten Mal seit Tagen. An ihr Lächeln beim Abschied und die Traurigkeit dahinter. An all das, was sie nie mit ihr teilen konnte. Tränen steigen in ihr hoch, so viele, so viele. Die Tränen und ein billiges Einwegfeuerzeug sind alles, was sie hat.
Doch dann kommt ihr in den Sinn, dass bei einem Auto, das so ausgestattet ist, die Elektronik vielleicht noch funktioniert. Sie lässt die Flamme wieder aufflackern, zwängt sich nach vorn. Teigbacke und der andere hängen wie schlafend in den Gurten.
Unzählige Schalter. Welche sind für Fenster oder Türen? Sie drückt jeden, den sie in die Finger bekommt.
Als die Fenster sich öffnen, schießt eisiges Wasser von allen Seiten mit solchem Druck herein, dass ihr das Feuerzeug aus der Hand gerissen wird. In völliger Dunkelheit holt sie tiefLuft, einmal, zweimal, dreimal. Sie zwingt sich zu warten, bis ihr Kopf unter Wasser ist, tastet nach dem Beifahrerfenster, fühlt die Türzarge und schwingt sich hinaus.
Sie wird herumgewirbelt, weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, strampelt. Irgendwann spürt sie Grund unter den Füßen und stößt sich ab. In ihrer Lunge lodert ein Feuer.
Ihr wird schwarz vor Augen.
Dann ist sie oben.
Sie reißt den Mund auf und schlingt so gierig Sauerstoffin sich hinein, dass sie sich verschluckt, Schleim würgt. Mit letzter Kraft schwimmt sie zum Ufer. Als sie die Böschung hochkriecht, klappern ihre Zähne, aber ihre Muskeln schmelzen wie Wachs.
Die Straße ist leer.
Nein. Ein Auto nähert sich. Sie ist versucht, auf die Fahrbahn zu springen und zu winken.
Doch sie sieht, dass der Wagen langsam fährt, und duckt sich hinter einen Felsen. Am Telefon waren die Schüsse zu hören. Alains Männer suchen das Ufer ab. Sie können abschätzen, wo sie sich ungefähr befunden haben müssen.
Sie wartet, bis die Rücklichter im Dunst zerfließen, und sprintet dann in die entgegengesetzte Richtung, im Wissen, dass die Männer bald umdrehen und zurückfahren werden.
Sie rennt, rennt, rennt. Im Kopf das eine:
Auch das werde ich vergessen. Auch das werde ich vergessen.
Endlich sieht sie die Leuchtreklame der Tankstelle, an der sie vorbeigekommen sind. Völlig entkräftet langt sie dort an und ist ein einziges Zittern. Ein Transporter steht an einer Zapfsäule, der Fahrer bezahlt an der Kasse. Sie schleicht zur Hecktür, sie ist unverschlossen.
Als der Wagen losfährt, kauert sie zähneklappernd zwischen Obst- und Gemüsekisten. Der Sekundenzeiger ihrer Uhr wandert vor, aber sie glaubt ihm nicht. Es kann unmöglich erst eine Stunde her sein, dass sie mit Alain in das Haus ging.
Nach einer Zeit rappelt sie sich hoch. Durch das kleine Fenster sieht sie, dass sie auf der Autobahn sind. In welche Richtung geht es? Nach Paris?
Auch das werde ich vergessen. Auch das werde ich vergessen.
Viel später eine scharfe Kurve, gläserne Paläste, ein Hafen für Ausflugsdampfer. Sie fahren längs der Seine. Der Eiffelturm ist wie hingetupft, fast ein Pastell, und doch trotzt er dem Himmel ein Stück Ewigkeit ab. Dort oben hat sie gestanden, mit einem weiten Blick, den Wind in den Wollhaaren, zum Platzen glücklich, in ihrer Kindheit. Dahinter das pechschwarze Karree der Tuilerien, wo sie mit ihrem Vater in der Sonne saß und Spatzen mit Eiswaffelkrumen fütterte.
Der Louvre, in dem Osiris über die Toten richtet.
Das Auto biegt in eine Seitenstraße und rumpelt über Kopfsteinpflaster kreuz und quer durch ein stilles Viertel, sodass sie bald nicht mehr weiß, wo sie ist. Sie halten. Noch ehe der Fahrer ausgestiegen ist, hat sie die Tür aufgestoßen und rennt.
Der Mann brüllt: »Putain! Qu’est-ce qui se passe?«
Nichts kommt ihr bekannt vor, kein Haus, kein Platz. Dunkle, fremde Gassen gleichen einem Fadengewirr, das eine Katze zerzaust hat. Doch mit einem Mal erhascht sie zwischen trüben Reklamen eine Ecke des knallbunten Centre Pompidou. Jetzt weiß sie, in welche Richtung sie laufen muss, und ist bald wieder an der Seine.
Sie bleibt stehen.
Auf der Insel thront die Kathedrale in einem Sprühregen aus Licht. Das ungeheure Tier, das sie erst gestern bestaunte, gefangen in einer Geschichte voller Wunder. Als sie noch an Magie glaubte, an sprechende Tiere, blinde Seher. Als der Tod nur ein Märchen war.
In diesem nicht enden wollenden Augenblick beginnen die Glocken von Notre-Dame de Paris zu läuten. Sie vereinigen sich, werden zu einem wogenden, hüpfenden, schwingenden Chor, der sich als Säule über das Häusermeer schraubt und ihr Zittern zum Himmel emporträgt.
Unter erloschenen Laternen läuft sie über die verlassene Pont d’Arcole, ist am Quai de la Corse, dem Treffpunkt, den ihr Vater genannt hat. Er löst sich aus dem Schatten eines Tores, drückt sie an sich und sagt irgendwas.
Selbst diese Umarmung wird sie für immer vergessen.
1
Heute
Keine Stille ist wie die andere. Es gibt die Stille in den Sekunden, bevor ihre Augen zufallen und sie fast schon im Traum ist. Die Stille nach einem falschen Wort und die Stille in einer Kirche am Abend. So wie es die Stille gibt, deren Klang die Welt rasen lässt. Die Stille der Verwundung. Die Stille, wenn man in das andere Land sieht. Die Stille, in der sie all der Menschen gedenkt, die gegangen sind.
Dies ist die Stille eines Sommertags, den der Wind verschläft. Nichts lenkt sie vom Hören ab. Auch jetzt sind kleine Dinge da, rein und klar wie in einem Konzerthaus. Ein Grashüpfer, ganz nah. Das Flirren der Luft. Viermal die Minute ihr Atem.
Sie hat die Augen geschlossen. Obwohl sie weiß, dass es Unsinn ist, bildet sie sich ein, dann alles noch intensiver zu empfinden. In der Leere, fast schon unter der Dezibel-Skala, fispert ein Auto auf einer zwölf Meilen entfernten Straße. Für Momente glaubt sie, eine Spinne in ihrem Netz zu hören, den Flügelschlag eines Raubvogels hoch am Himmel, einen Satelliten auf seiner Umlaufbahn.
Vibrationen; etwas unter der Erde. Vielleicht ein Maulwurf. Oder eine Schlange in einem Bau.
Plötzlich wird die Stille zu laut und dröhnt in ihr. Aaron ändert die Sitzposition, zum ersten Mal seit über einer Stunde. Im Südosten der Anhöhe weiß sie ein Tal, in dem fast immer Nebel ist, roter Ahorn, von Tröpfchen lackiert. Darüber wird alles tiefblau und leicht sein, wie Dunst auf einem Spiegel.
Sie öffnet die Augen.
Zehn Dinge, die für Aaron aufregend sind:
Gewimmel am Flughafen, Durcheinander von Klecksen
fahrende Autos in der Stadt, Wischblenden
der Wald, eine schwarze Wand
die Umrisse eines großen Baumes, blass wie Perlmutt
ein hüpfender Fleck vor ihrem Fenster, vielleicht ein Spatz
das Grizzeln von Wasser im Sonnenlicht
fliegende Schatten im Dojō
die Feuerzeugflamme dicht vor ihren Augen
Farben
wenn die Morgenröte die Netzhaut anmalt
Sie tippt ihre Cartier an. Die digitale Stimme sagt: »Achter Juni. Mittwoch. Sechzehn Uhr, zwölf Minuten, zwei Sekunden.«
Aaron richtet sich auf und sieht dabei ihre Hände und Füße, weil sie es sich vorstellt. Sie hat sie so genau vor Augen, als wäre sie nicht blind. Mit dem Stock sucht sie bedacht ihren Weg zwischen Zedern. Bald ist sie auf dem Pfad aus festgestampftem Lehm, der zum Kloster hinunterführt. Sie klappt den Stock ein, schnalzt alle zwei Sekunden mit der Zunge und wird in dem grünen Gewölbe von den Echos geleitet. Ab der Biegung sind es genau siebenundneunzig Schritte, sodass sie die Klicklaute nicht mehr benötigt. Rechts weiß sie den japanischen Garten, dessen Ruhe sie in vielen Stunden genossen hat, hört das Plätschern des kleinen Wasserfalls, einen Rechen im Sand.
Der Gong ruft zur Teezeremonie. Beim fünften Schlag ist sie auf der Stufe, streift die Schuhe ab und betritt den Raum, in dem sich schon zehn andere versammelt haben. Für Aaron wird stets der gleiche Platz freigehalten, keiner muss ihr helfen. Sie nimmt die Seiza-Position ein, kniet auf den Fersen, drückt den Spann auf den Boden und hält den Rücken kerzengerade. Sie spürt die Unruhe ihres linken Nebenmanns. Kaum eine Minute nachdem er sich hingehockt hat, tun ihm bereits seine Schienbeine weh. So war es auch bei ihr, damals.
Das Gemurmel verebbt, als Meister Kishō beginnt, die Tee-Utensilien mit einem Seidentuch zu reinigen. Aaron versenkt sich ganz in die wenigen Geräusche. Sie hört, wie Kishō Wasser zum Kochen bringt, das Matcha-Pulver mit dem Bambusbesen verquirlt, den Tee aufbrüht.
Er reicht dem Ersten die Schale. Einige seufzen enttäuscht; sie wissen, dass diese Ehre nur demjenigen zuteilwird, der gut gekämpft hat. Auf ein Schlürfen folgt ein Kommentar, ehe die Schale abgewischt und weitergereicht wird. Kishō nennt die jungen Männer Kodomo, Kinder. Sie sind auf der Shu