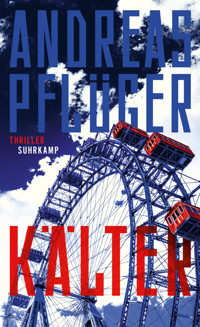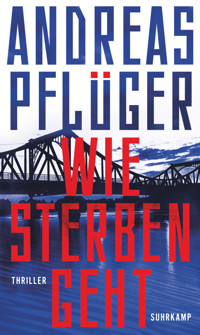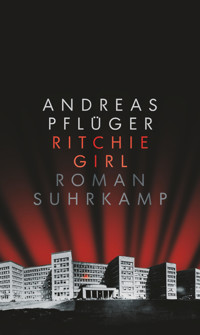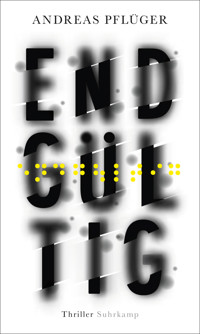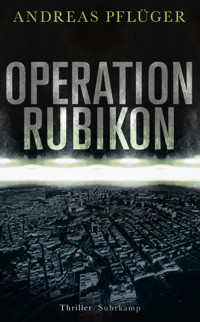
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der scheinbar aussichtslose Kampf gegen ein machtgieriges Kartell – perfekt choreographiert und packend bis zum Schluss. Ein explosiver Thriller mit elegant verwobenem Plot und voller Insiderwissen, der bleibenden Eindruck hinterlässt.
Für die junge Staatsanwältin Sophie Wolf ist es der erste richtige Fall: Sie soll einen Spezialeinsatz des Bundeskriminalamts bei einem illegalen Waffengeschäft leiten. Dass der BKA-Präsident ihr Vater ist, zu dem sie seit ihrer Kindheit keinen Kontakt hatte, macht die Sache nicht unbedingt leichter. Die Aktion endet in einem Desaster: Zwei hohe Mafiabosse werden liquidiert, ein Ermittler stirbt bei der Explosion eines Waffencontainers, ein Informant wird auf dem Flughafen erschossen. Alles verweist auf ein neues Kartell, das mit Erpressung, Korruption und Mord den internationalen Waffen- und Drogenmarkt zu erobern versucht. Der BKA-Präsident geht einen gefährlichen Weg: Er gründet die Gruppe Rubikon. Nur Sophie und vier seiner engsten Mitarbeiter wissen davon. Vielleicht einer zu viel ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1172
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Andreas Pflüger
OPERATION RUBIKON
Thriller
Herausgegeben von Jürgen Haase
Suhrkamp
Für Anne
PROLOG
Wolf erwachte von seinem eigenen Schrei. Naß von Schweiß richtete er sich im Bett auf und starrte in die Dunkelheit. Die Gardine wurde vom Wind gebauscht, der von den Hängen des Taunus kam und klamm und kalt in das Zimmer stieß. Ein leiser, singender Ton erfüllte die Luft. Wolf fröstelte und fühlte den trommelnden Herzschlag in seiner Brust. Es dauerte einen Moment, ehe seine Augen sich an das Dunkel gewöhnt hatten und er die Umzugskartons erkannte; zusammengerollte Teppiche, in Tücher eingeschlagene Bilder, Verpackungsmaterial. Der Singsang kam von dem arabischen Mobile, das vor dem Fenster hing und vom Wind gegen das Glas gedrückt wurde. Ein Beduinenfest, Tänzer, die in Stammestracht herumwirbelten. Er würde es zuletzt abhängen. Morgen. Leise stöhnend setzte er die Füße auf den Boden. Stemmte sich hoch, um ins Badezimmer zu schlurfen. Neonlicht zuckte auf. Wolf beugte den Kopf über das Becken und ließ Wasser über seinen Nacken fließen.
Als er sich wieder aufrichtete und in den Spiegel blickte, lief ein zittriges Rinnsal seinen Rücken hinab. Wolf sah einen Mann von Mitte Sechzig. Schüttere Haare umrahmten ein Gesicht, das von tiefen Kerben durchzogen war. Sie kamen von langen, einsamen Nächten, in denen er Entscheidungen treffen mußte, und von weiteren Nächten, in denen er mit seinen Dämonen allein war. Selbst jetzt, in der barfüßigen Lächerlichkeit eines alten Mannes, dem die Beine der Schlafanzughose bis hinab auf den Boden schlabberten, hielten sie seinen Schmerz am Leben.
Du hast getötet, was du liebst, damit lebt, was du haßt.
Draußen fiel der Schnee dicht und grau. Der Wind wälzte ihn über den mit Natodraht gesicherten Doppelzaun, fort aus dem Lichtkreis der Scheinwerfer, hinaus in die Finsternis, wo er sich in einem schimmernden Wirbel verlor.
Wolf konnte die unteren Stockwerke des terrassenförmig in den Berg getriebenen Gebäudekomplexes sehen, in dessen siebter Etage er seine Wohnung hatte. Das war einmal mein Reich. Ein Gefängnis, das er vorher nie als solches empfunden hatte. Eine hell erleuchtete Glasfront stach aus der Wand aus Schnee. Das kalte Licht eines Vernehmungsraumes drang durch eine Jalousie. Als Wolf die Augen zusammenkniff, konnte er schemenhaft zwei Beamte erkennen, die einen Verdächtigen bearbeiteten. Wolf wußte, daß sie ihre Jacketts abgelegt hatten. Er wußte, daß ihre Hemden von den Waffenholstern zusammengeschnürt wurden, während sie dem Mann ihre Fragen entgegenhämmerten. Fast glaubte er, ihre monotonen Stimmen zu hören: »Wann und wo? Wann und wo? Wann und wo?« In diesem Augenblick beneidete er niemanden auf der Welt so sehr wie diesen Mann, der den Kopf erschöpft auf die Tischplatte sinken ließ. Es wäre so einfach. Er müßte nur alles zugeben und das Protokoll unterschreiben. Dann würde man ihn wieder in seine Arrestzelle führen und ihn in Ruhe lassen. Er hätte seine Schuld gestanden und wäre nicht mehr mit ihr allein.
Welch eine Gnade.
Angst und Schmerz überfluteten Wolf wie eine Welle, und er spürte, wie das Zimmer sich bewegte.
Schuld.
Hatte er sich jemals zuvor gefragt, wie sie sich anfühlt? Er war sich nicht sicher. Er hatte Verantwortung für mehr als fünftausend Männer und Frauen getragen, doch dieses Gewicht hatte er nie auf seinen Schultern gespürt. Nicht wirklich. Sicher, wenn nötig, hätte er jederzeit die politische Verantwortung für sein Haus übernommen. Eine anständige Pension, vielleicht eine kleine Gastprofessur, eine gute Zigarre, abends ein Glas Rotwein, das wäre sein Leben gewesen.
Dieses Leben würde er niemals führen.
Als der Morgen anbrach, hatte es aufgehört zu schneien. Der Himmel war farblos wie gebleichtes Leinen. Krähen kreisten über dem Berg, ihre Schreie zerschellten in der eisigen Luft. Wolf hatte einen Mantel um die Schultern geschlungen und stand auf seiner Terrasse, die wenig mehr war als eine kleine, betonierte Freifläche auf dem Dach des Hauptgebäudes. Männer mit Maschinenpistolen unter den Achseln patrouillierten entlang des stählernen Zaunes, der das Gelände umschloß. Eine Böe fuhr unter die große, halbmast geflaggte Deutschlandfahne. Sie knatterte gegen den Mast und erzeugte einen peitschenähnlichen Knall, ehe sie wieder zusammensank und nur noch lautlos zappelte.
Wiesbaden lag schlafend unter ihm. Es war schon fast sieben, doch die wenigen Autos, die auf der Danziger Straße den Berg hochkrochen, hatten noch die Scheinwerfer an. Bald vierzig Jahre lebte er hier, und erst jetzt wurde ihm bewußt, daß er die Stadt immer nur von ferne gesehen hatte. Aus dem Hubschrauber. Oder aus der Panzerlimousine. Rasende Fahrt über Wilhelmstraße und Dambachtal. Fast immer war er in seine Akten vertieft gewesen. Meist war es der Fahrer, der ihn darauf hinweisen mußte, daß sie angekommen waren und bereits in der Tiefgarage standen. »Herr Präsident, wir sind da!« Das war sein Leben gewesen. Präsident. Er hatte dieses Wort so oft gehört, daß er es als Vorsilbe zu seinem Namen empfand. »Ihre Verantwortung, Präsident Wolf. Ganz allein Ihre Verantwortung!« Wie lange war das her? Tage, Monate, Jahre? Er wußte es nicht mehr.
Sein Blick suchte unwillkürlich das Waldstück zwischen dem Opelbad und der griechischen Kapelle, deren mattgoldene Kuppeln von Schnee bedeckt waren. Fünfhundert Meter, auf denen der Wald bis an die Serpentinenstraße wucherte. Ein idealer Ort für einen Anschlag. Wolf hatte immer gedacht, wenn es ihn einmal erwischte, dann hier. Er war einer der bestgeschützten Männer der Bundesrepublik gewesen, sein Schutzkommando hatte aus acht Bodyguards bestanden. Zwei Panzerlimousinen. Doch natürlich hatte er sich deshalb niemals sicher gefühlt. Man kommt an jeden Mann heran, das wußte TUAREG genausogut wie die Männer, die bereit sein mußten, ihr Leben für ihn zu geben. Aber seine Sherpas hatten ihm wenigstens die Illusion gelassen, hatten es zumindest versucht, und dafür war er ihnen immer dankbar gewesen.
»Ist das alles, was Sie dazu zu sagen haben?«
Wolf schloß die Augen. Der eisige Wind betäubte seine Haut. »Herr Vorsitzender, dürfte ich als der in diesem Prozeß Angeklagte eine Bitte äußern? Ich möchte nicht mehr als PRÄSIDENT angesprochen werden. Diesen Titel habe ich stets mit Stolz getragen. Doch das kann ich jetzt nicht mehr. Es geht nicht, verstehen Sie? Ich ertrage es nicht länger!«
»Aber Herr Präsident, das ist doch hier kein Prozeß. Und Sie sind nicht angeklagt. Also antworten Sie bitte auf meine Frage: Wer hat den Einsatzbefehl erteilt? Wer, Herr Präsident?«
Das Bewußtsein seiner Schuld überwältigte ihn, und Wolf erkannte, daß es für ihn keine Erlösung geben konnte.
Keine Erlösung. Verwundert und von einem dunklen Taumel erfaßt, sah er auf diesen Gedanken wie auf einen Zettel, der aus dem Fenster eines rasenden Zuges gerissen wird. Er hörte das Klatschen der Fahne aus großer Ferne, vom anderen Ende des Tunnels, in den der Zug eingetaucht war. Wolf sank auf die Knie. Er versuchte zu schreien; kein Laut kam heraus. In seiner Brust stampften die Kolben des rasenden Zuges. Der Schmerz war so groß, daß er den Drang hatte, sich zu übergeben. Er würgte, doch alles, was austrat, war dünner, wäßriger Schleim.
Dann war es vorbei. Der Zug stand still, und Wolf lag da, zusammengekrümmt wie ein Baby, und weinte.
Erstes Buch MAULWURF
Tausend Feinde außerhalb des Hauses
sind besser
als einer drinnen.
MAROKKANISCHES SPRICHWORT
EINS
Das Fest war vorbei. Abdullah Bucak und seine Freunde waren die letzten, die noch zwischen Luftschlangen und Resten vom Hammelbraten auf dem Boden saßen. »Kopf« hieße, in Völklingen, im Haus von Bucaks Schwester, deren vierundzwanzigsten Geburtstag sie gefeiert hatten, zu übernachten, »Zahl« dagegen, noch in der Nacht nach Saarbrücken zurückzufahren.
In Wirklichkeit hieß Kopf Leben und Zahl Tod.
Doch das ahnten sie nicht.
Bucak warf die Münze. Kopf gewann. Da er aber das enttäuschte Gesicht von Mesut sah, befand Bucak, daß das Geldstück auf den Teppichrand gerollt und damit »verbrannt« sei. Es sei also nötig, noch einmal zu werfen. Alle grinsten, denn sie wußten, daß Mesut, den sie nur »Mäuschen« nannten, in ein Mädchen aus dem Studentenwohnheim verliebt war. Mäuschen hatte Augen wie schwarze Perlmuttknöpfe und Ohren, die so weit abstanden, daß sie vorwitzig aus den Wuschelhaaren hervorspitzten. Jeden Morgen war er schon um sechs im Gemeinschaftsraum, wo er mit Herzklopfen wartete, bis das Mädchen endlich kam und er sich »zufällig« zu ihr setzen konnte, um mit ihr zu frühstücken. Das wollten sie ihm nicht verderben. So mußten sie, unter Aufbietung immer absurder werdender Regeln, bei denen sie sich gegenseitig zu übertrumpfen suchten, drei weitere Male werfen, bis endlich Zahl oben lag. Lachend nahmen sie Mesut in die Mitte und traten die Heimfahrt an. Es hätte sich sowieso kaum noch gelohnt, ins Bett zu gehen.
Krustiges Eis schmolz auf der Kühlerhaube von Bucaks altem Opel, als sie auf dem Parkplatz des Studentenwohnheims ausstiegen. Sie kamen nicht einmal bis zum Eingang. Die Männer tauchten aus dem Nichts auf. Ehe Bucak wußte, was geschah, raste der Schmerz wie eine Flutwelle durch seinen Körper. Die Muskeln wurden schlaff, und sein Darm entlud sich. Dann wurde er bewußtlos. Die Männer packten die fünf jungen Kurden, die sie mit Bullenschockern paralysiert hatten, in einen Ford Transit. Fünf Minuten später waren sie auf der Stadtautobahn, die sie in Güdingen, einem Vorort von Saarbrücken, wieder verließen.
Als Bucak die Augen öffnete, sah er, daß er auf einer dunklen Ladepritsche lag. Neben sich hörte er das leise Stöhnen seiner Freunde. Sie waren alle mit Tape gefesselt und geknebelt. Es war, als sei sein Körper eine einzige Wunde, doch Bucak zwang sich, den Kopf zu heben. Er starrte in die Gesichter von drei Männern. Sie trugen keine Masken.
Einer von ihnen sagte lächelnd: »Bozkurtlar gelior.«
Da wußte Bucak, daß sie alle sterben würden.
Der Ford Transit hielt an einer Ampel. Zwei Sekunden später stoppte ein Streifenwagen daneben. Der Beamte, der am Steuer saß, registrierte mit einem müden Blick, daß die Reifen des Fords heruntergefahren waren. Vorne hockten zwei Türken, junge Burschen, die vermutlich zur Frühschicht auf die Halberger Hütte fuhren. Einen Moment lang überlegten die beiden Polizisten, die ihren Dienst schon beendet hatten und auf dem Rückweg zum Revier in Kleinblittersdorf waren, ob sie eine Anzeige schreiben sollten. Doch die Aussicht auf zwanzig Minuten draußen in der schneidenden Kälte konnte mit dem heißen Kaffee, der auf sie wartete, nicht konkurrieren. Sie bogen nach rechts ab, und der Lieferwagen fuhr weiter in Richtung französische Grenze.
Auf einem Feld, dicht an der Saar, wurden Abdullah Bucak und die anderen aus dem Auto gezerrt. Raben kauerten auf dem braunen Gras, Nebel stieg vom Fluß hoch. Das einzige Geräusch, das Bucak hörte, war sein eigenes, herzrasendes Fiepen, das unter dem Knebel hervordrang. Die Männer zwangen die Kurden auf die Knie und verlasen – im Namen des türkischen Volkes – die Todesurteile. Dann ging es schnell. Dreien von Bucaks Freunden schossen sie in den Kopf; Mesut, der auf allen vieren zu fliehen versuchte, wurde in einem Bach ertränkt. Bucak sah es mit an. Seine Augen flehten um Gnade, doch das Messer, mit dem sie sich an ihm zu schaffen machten, löschte alles aus.
Der Polizeibeamte, der als erster am Tatort eintraf, stand kurz vor seiner Pensionierung. Er dachte, er hätte in seinen vierzig Dienstjahren alles erlebt. Doch als er sah, was man Bucak, der im Alter seines eigenen Sohnes war, angetan hatte, mußte er sich wegdrehen und schluchzte.
Dies ereignete sich am Morgen des 6. Dezember.
Abdullah Bucak hatte dreizehn Messerstiche in Brust, Hals und Bauch. Neben ihm auf dem Acker hatte das gelegen, was sie abgeschnitten hatten.
Aber er überlebte.
Nach einer Woche war er vernehmungsfähig. Bucak hatte für die Studentenzeitung der Universität Saarbrücken mehrere kritische Artikel über türkische Polizeiwillkür und über staatlich sanktionierte Folterungen an Kurden geschrieben. Die »Grauen Wölfe« hatten ihn schon seit längerem bedroht. »Bozkurtlar gelior« – die Grauen Wölfe kommen! Das war die Parole der Männer, die seine Freunde getötet hatten.
Damit gehörte der Fall in die Zuständigkeit der Bundesanwaltschaft.
Von der Nacht an, in der Bucak seine Aussage im Saarbrücker Krankenhaus Winterberg machte, sollte dieses Land nicht mehr dasselbe sein.
ZWEI
Der Tag begann mit der Farbe Grau. Mit dem Asphaltgrau der menschenleeren Brauerstraße, auf der das Regenwasser trocknete, dem verwaschenen Grau der hohen Mauer, die das Gebäude der Karlsruher Bundesanwaltschaft umgab, mit den grauen, übernächtigten Gesichtern der Wachschutzbeamten, die an der Eingangsschleuse Dienst taten. Darüber spannte sich die Wolkendecke wie graues Reispapier auf einem Paravent und verbarg die Wintersonne, die seit Wochen niemand mehr gesehen hatte.
Sophie stoppte ihren Mercedes SLK neben dem Magnetscanner der Schleuse. Sie erwiderte das stumme Nicken der mit Maschinenpistolen bewaffneten Beamten, während sie ihre Chipkarte aus der Handtasche fingerte und in den Schlitz schob. Zwei Sekunden später hob sich die Schranke, und Sophie fuhr auf das Gelände. Vor ihr öffnete sich die Mauer zu einem Innenhof. Im Zentrum befand sich eine kreisförmige Rasenfläche mit Brunnen. Die Hälfte des Areals wurde von dem sandsteinfarbenen, vierstöckigen Bau eingenommen, in dessen Vorderfront ein gläserner, nach innen gewölbter Rundbogen eingelassen war. Von der Außensicherung abgesehen, hätte es eine Bank sein können oder die Zentrale einer Versicherung. Tatsächlich war es der Sitz der obersten Strafverfolgungsbehörde der Bundesrepublik Deutschland.
Die Tiefgarage war an diesem Sonntag so gut wie leer. Als Sophie den Mercedes einparkte, sah sie die beiden Panzerlimousinen und den schwarzen Porsche, die zur Fahrzeugkolonne des Generalbundesanwaltes gehörten. Also war Steindorff im Haus. Solange Sophie hier arbeitete, bald dreieinhalb Jahre, war das für ein Wochenende mehr als ungewöhnlich. Der Generalbundesanwalt wohnte die Woche über zwar in einem kugelsicheren Penthouse auf dem Dach der Bundesanwaltschaft, verbrachte seine »freien« Tage jedoch üblicherweise in der ehelichen Villa in Bad Herrenalb, zwanzig Autominuten vom Amt entfernt, wo sein Begleitkommando schon Freitag abends einen dicken Karton mit Akten ablieferte, die er dann bis Montag durcharbeitete.
Der GBA war detailbesessen und hatte ein juristisches Gedächtnis, das bis ins Justizministerium berüchtigt war. Sophie war erst ein einziges Mal bei einer Besprechung dabeigewesen, an der er teilnahm, und sie erinnerte sich an ihre Verblüffung, als Steindorff scheinbar mühelos und aus dem Stand Leitsätze aus Urteilen zitierte, die an irgendeinem Oberlandesgericht vor Jahren ergangen waren. Natürlich war ihr klar, daß er das durchaus kalkuliert tat, um seine Umgebung zu beeindrucken.
Jetzt mußte Sophie unwillkürlich lächeln, als sie daran dachte, wie der GBA, der Leiter dieser mächtigen Behörde, am Stirnende des Konferenztisches gethront hatte, das Kreuz kerzengerade, die Hände fuchtelnd in der Luft, und sein Wissen präsentierte wie ein Einserschüler. Steindorff konnte man respektieren, bewundern konnte man ihn nicht.
Sie blieb neben dem Fahrstuhl stehen und schob erneut ihre Karte in einen Scanner. Als die Tür auffuhr, drückte sie auf »2. Stock«, lehnte den Kopf gegen die Kabinenwand und fühlte, wie müde sie war. Die halbe Nacht hatte sie zu Hause in ihrer kleinen Ettlinger Wohnung Akten gewälzt, bis sie gegen vier ins Bett gefallen war. Nach drei Stunden hatte das Telefon sie aus dem Schlaf gerissen. »Entschuldigung, falsch verbunden.« Ihr Frühstück hatte aus einer verschrumpelten Pampelmuse bestanden, dazu Kaffee aus der Espressomaschine, die sie letztes Jahr zu einem sündhaften Preis in Mailand gekauft hatte. Sie war, abgesehen von dem SLK, der luxuriöseste Gegenstand, den Sophie besaß.
Ihre Schritte hallten von den Wänden des Rundgangs wider, der um das Atrium herumführte. Die einzigen Farben waren Sandstein und Schwarz und das Blau von Sophies Wollmantel, den sie noch im Gehen auszog, weil das Gebäude hoffnungslos überheizt war.
In der Etage unter ihr befanden sich die Büros der Abteilung Spionage, über ihr saßen die Kollegen, die für Revisionsverfahren vor dem Bundesgerichtshof zuständig waren. Sophies Abteilung ermittelte Staatsschutzdelikte, präzise: Terrorismus, und war die personell stärkste im Haus. Außer ihr arbeitete hier in der Regel sonntags niemand. Sophie schaute unwillkürlich nach oben, wo der GBA im vierten Stock sein Amtszimmer hatte. Sie hörte Schritte und sah Lorenz Binkle, der aus der Bibliothek kam und gedankenverloren, den Kopf über ein Schriftstück gebeugt, sein Büro ansteuerte.
Binkle war irgendwo in den Vierzigern, ein dürres Männchen, das die wenigen Haare, die ihm geblieben waren, wagemutig von links nach rechts über den kahlen Schädel drapiert hatte. Sophie hatte vor Jahren, als sie frisch zur Bundesanwaltschaft abgeordnet worden war, ein Praktikum in seinem Referat absolviert, und er hatte sich sehr um sie gekümmert. Anders als seine Kollegen besaß er nicht den Standesdünkel der »Revisionisten«, für die ihre Profession die hohe Schule der Wissenschaft war, dieweil die »Erstinstanzler«, zu denen Sophie gehörte, rohes Metzgerhandwerk betrieben. Daraus hatte sich eine Art kollegiale Freundschaft entwickelt, die jedoch ihr jähes Ende fand, als Binkle auf einer nächtlichen Zugfahrt, die sie von einer Besprechung beim Münchener Verfassungsschutz zurück nach Karlsruhe brachte, Sophie schlafend gewähnt und eine Hand auf ihre Brust gelegt hatte.
In diesem Moment wandte Binkle den Kopf und starrte Sophie an. Ertappt, als müsse sie ein schlechtes Gewissen haben, formte sie die Lippen zu einem stummen »Guten Tag«, ehe sie in ihrem Büro verschwand, wo sie den Mantel aufhängte, sich in den Schreibtischsessel fallen ließ, nach ihren Gitanes griff und die Akte Bucak aufschlug.
Aktenzeichen URS/1204/up. Zusatz zur Aussage von Bucak, Abdullah. Quelle: Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV). VS – Verschlußsache.
Die Grauen Wölfe (Bozkurtlar): Antikommunistische und militante Gruppierung, Schößling der türkischen Mutterpartei MHP, die für ein großtürkisches Reich kämpft. Langjähriger Führer: Alparslan Türkes, 1997 verstorben. Ehrentitel: »Basbug« – Führer. Glühender Verehrer von Adolf Hitler. Sachlage: Auf das Konto der Gefolgsleute von Türkes gehen mehrere tausend Morde an Oppositionellen sowie Massaker im Kurdengebiet. Mentalität: Fanatisch. Ideologie: Rassistisch. Zielobjekte: Kurden. Linksgerichtete Türken im In- und Ausland. Einfluß auf höchste Regierungskreise. Enge Verflechtung mit dem türkischen Geheimdienst MIT.
Auch der Papstattentäter Ali Agca war einer von ihnen gewesen.
Bei der Bundesanwaltschaft waren fünf Staatsanwälte mit den aufsehenerregenden Morden befaßt, die sich im Saarland zugetragen hatten. Sophie hatte nicht gerade den Zuckerguß vom Kuchen abbekommen. In Karlsruhe führten die Bundesanwälte das Wort, und eine Oberstaatsanwältin, zumal eine, die erst so kurze Zeit fest dabei war, durfte keine allzu großen Ansprüche stellen. Da zwei der wissenschaftlichen Mitarbeiter, die ihnen normalerweise zuarbeiteten, krank waren, hatte Sophie deren Job übernehmen müssen. Fast eine Woche hatte sie damit verbracht, das Bundeszentralregister nach Prozeßakten zum Thema Graue Wölfe zu durchforsten. Danach war ihr die Ehre zugefallen, in der Bibliothek des Bundesgerichtshofs zu recherchieren. Eingemummelt in ihren Wintermantel hatte sie endlose Stunden in den unbeheizten, düsteren Katakomben gehockt, die sich unter dem erzherzöglichen Palais an der Karlsruher Herrenstraße erstreckten, und hatte den alten Kopierer gequält.
Oberstaatsanwältin mit vierunddreißig. Die meisten meiner früheren Kommilitonen würden sagen: Die hat’s geschafft. Aber was bedeutet das großartige Schild an meiner Tür? In Karlsruhe – gar nichts. Tatsache ist, ich trete auf der Stelle. Zwar hatte ihre bisherige Karriere steil nach oben geführt, doch nun bewegte Sophie sich in einer Luft, die so dünn war, daß man lernen mußte, darin zu segeln wie ein Langstreckenflugzeug, dem der Sprit ausgegangen ist; Tausende von Kilometern, wenn es sein mußte. Es konnte passieren, daß man schließlich vom Radar verschwand, abstürzte und von niemandem vermißt wurde. Man konnte aber auch Glück haben, wurde entdeckt und in der Luft aufgetankt, um das Ziel endlich zu erreichen.
Vorgestern, nach Feierabend, als sie gerade die Tür zu ihrer Wohnung aufschloß, hatte ihr Telefon geklingelt.
»Axel Gusner. Störe ich?«
Gusner. Sie hatten zu Studentenzeiten zusammen in einer Berliner WG gewohnt und sich dann, als Sophie nach Stanford ging, aus den Augen verloren. Inzwischen hatte er es zum persönlichen Referenten von Fritz Limmer, dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, gebracht.
»Ihr ermittelt doch in der Sache Bucak«, sagte Gusner. »Seid ihr da weitergekommen?«
Sophie hielt kurz den Atem an. Sie überlegte, wie sie reagieren sollte, und entschied sich dann, auf Zeit zu spielen und abzuwarten.
»Warum interessiert euch das?« fragte sie und hörte ein Rascheln am anderen Ende der Leitung, das klang, als ob Gusner eine Akte umblätterte.
Er räusperte sich. »Ich habe da vielleicht was für dich. Etwas, mit dem ich nicht zu deinem Referatsleiter gehen will.«
»Aha.«
»Sieh mal, die Sache ist ganz einfach. Hör es dir an, und mach damit, was du willst. Du kannst deinen Chef informieren, kannst es aber auch für dich behalten, okay?«
Sophie zögerte, dann sagte sie: »Ich höre.«
Fünf Minuten später tigerte sie durch ihre Wohnung, in der sie so wenig Zeit verbrachte, daß sie noch immer aussah wie kurz nach dem Einzug. Schließlich traf sie eine Entscheidung und rief Bundesanwalt Siegfried del Mestre an, der genau wie sie am Fall Bucak arbeitete.
»Schießen Sie los«, sagte del Mestre in seinem bedächtigen badischen Dialekt. »Ich bin ganz Ohr.«
Sophie erzählte ihm, ohne Gusners Namen zu nennen, was sie soeben erfahren hatte: Sedat Yilmaz, ein Türke, der in Ankara ein Import- und Exportgeschäft besaß, hatte zwei Tage zuvor mit einem Landsmann in Pirmasens telefoniert. Dabei war der Name Ufuk Catli gefallen. Möglicherweise war er der Drahtzieher der Güdinger Morde. Yilmaz jedenfalls hatte Kenntnisse, daß es sich bei ihm um einen Aktivisten der Grauen Wölfe handelte. Catli war kurz vor dem Überfall auf die kurdischen Studenten nach Deutschland eingereist. Und zwar mit einem Diplomatenpaß, den ihm der türkische Geheimdienst MIT besorgt hatte.
»Ist Ihre Quelle sicher?« fragte del Mestre.
»Absolut«, sagte Sophie und verschwieg, wie sie es Gusner versprochen hatte, daß Yilmaz als Undercoveragent auf der Lohnliste des BfV stand. Die Verfassungsschützer hatten ihn abgehört, weil er seit längerem im Verdacht stand, gleichzeitig für den MIT zu arbeiten und doppelt zu kassieren. Natürlich konnten sie diese Information nicht über offizielle Kanäle laufen lassen, denn Auslandsaufklärung war allein Sache des Bundesnachrichtendienstes, und die Tatsache, daß das BfV in der Türkei eigene Undercoveragenten führte, würde beim BND wie eine Bombe einschlagen. Präsident Julius Boehnke, der gewöhnlich keinem Streit aus dem Weg ging, würde stante pede zum Kanzleramtsminister rennen und dem Verfassungsschutz jede Menge Ärger machen.
Sophie hörte das leise Kratzen eines Stifts, als del Mestre sich Notizen machte. »Weiß Ihre Quelle, wo dieser Catli jetzt ist?« fragte er.
»In Frankfurt, sein Bruder betreibt dort ein Reisebüro. Mein Informant hat erfahren, daß er erst in einer Woche wieder zurück in die Türkei reisen wird.«
»Okay, ich werde das BKA veranlassen, den Mann zu observieren. Alles weitere dann Montag.« Er brach ab, und einen Herzschlag lang dachte Sophie schon, daß er auflegen würde. Doch dann hörte sie seine Stimme noch einmal. »Gute Arbeit. Sollte sich der Verdacht erhärten und der Mann festgenommen werden, gehe ich zu Bresser und sorge dafür, daß Sie mit der Vernehmung beauftragt werden.«
Vor Sophie lag eine schlaflose Nacht, in der sie dreimal ihren Aschenbecher leerte und Espresso trank wie Leitungswasser. Der türkische MIT kooperierte, wie sie aus einem VS-Papier wußte, eng mit dem BND, und sie beschlich die dunkle Ahnung, daß hinter den Güdinger Morden mehr steckte als ein Racheakt von Fanatikern.
Catli war mit einem falschen Diplomatenpaß eingereist.
Kaum vorstellbar, daß der BND hier nicht seine Finger drin hatte.
War es möglich, daß das Tankflugzeug Sophie gefunden hatte? Vielleicht. Konnte sie del Mestre vertrauen? Eine gute Frage, für die es jetzt aber zu spät war. Ihr blieb nichts übrig, als bis Montag zu warten und zu hoffen, daß er bei der Weitergabe der Information an den GBA nicht vergaß zu erwähnen, woher er sie hatte. Diese Sache konnte eine Tür für sie aufstoßen. Das wußte sie, aber das wußte auch del Mestre, und sie fragte sich, ob das in seinem Interesse lag. Zwar wurde in der Bundesanwaltschaft Kollegialität großgeschrieben, aber doch bloß auf dem Briefpapier, während in Wirklichkeit, durchaus zivilisiert, mit Säbel und Florett gefochten wurde und manchmal auch der Dolch zu seinem Recht kam.
Wie auch immer: Ein Erfolg im Fall Bucak würde die Karriere desjenigen, der ihn auf seine Fahnen heften konnte, mächtig nach vorne bringen, und Sophie, die betete, sie möge diejenige sein, sank erst, als der Morgen schon dämmerte, in einen schwitzigen Schlummer und träumte von dem düsteren Schloß ihrer Kindheit, in das sie vielleicht schon bald zurückkehren würde.
Als sie jetzt zum erstenmal von ihren Akten hochschaute, war es kurz nach eins. Ihr Magen knurrte. Sie verließ das Büro, um im Keller, wo die Sherpas des GBA ihre Aufenthaltsräume hatten, einen Müsliriegel aus dem Automaten zu ziehen. »Sherpas«. Wer hat sich den Namen wohl einfallen lassen? Auf Steindorffs Jungs paßt er jedenfalls besser als »Bodyguards«. Bei ihm müssen sie mehr schleppen als nur die Verantwortung für sein Leben.
Sophie fuhr mit dem Fahrstuhl bis ins Erdgeschoß. Sie ging an der Bronzetafel vorbei, die man zum Andenken an den 1977 von der RAF ermordeten Generalbundesanwalt Buback angebracht hatte, und sah, daß der Reinigungsdienst bei der Arbeit war. Das schmatzende Geräusch der Maschine, die über das Schachbrettmuster des Granitbodens glitt, begleitete sie die Treppe hinunter, bis Sophie im Keller angelangt war, sich nach links wandte und die Arrestzellen passierte, in denen gelegentlich auch Untersuchungshäftlinge vernommen wurden.
Sophie wollte gerade Geld in den Automaten werfen, als sie ein Geräusch hörte. Sie drehte sich um und sah, wie ein Mann von zwei Polizisten aus einer der Zellen geführt wurde. Er trug Business, war vielleicht vierzig Jahre alt und unschwer als Südländer zu erkennen. Del Mestre, bei einer Größe von knapp eins siebzig gut und gern zwei Zentner schwer, tauchte hinter dem Mann auf und wollte die Beamten zum Ausgang begleiten, als er Sophie entdeckte und stehenblieb.
Alles in ihr krampfte sich zusammen. »Das war doch Catli, nicht wahr?« fragte sie tonlos, nachdem del Mestre den Vollzugsbeamten einen Wink gegeben hatte und sie mit ihrem Häftling in der Tiefgarage verschwunden waren, um ihn mit einer grünen Minna zurück ins Gefängnis zu bringen.
»Ja, das war er. Ich gratuliere Ihnen, Sie haben …«
»Sie Scheißkerl! Sie verlogenes Miststück! Wie konnte ich nur so dumm sein, Ihnen zu vertrauen! Wir warten bis Montag, ja? Ich werde die Vernehmung durchführen, ja? Sie sind ein solches Schwein! Ein richtiges Schwein!« Sie spürte, wie ihr vor Wut und Enttäuschung die Tränen in die Augen schossen, und haßte den Gedanken, daß del Mestre sie so sah.
»Vielleicht sollten wir uns«, sagte er, »ehe Sie sich noch weitere Beleidigungen für mich einfallen lassen, zuerst einmal in Ruhe in mein Büro begeben. Ich fürchte, Sie verstehen nicht ganz, was hier passiert.«
»Ach, halten Sie doch einfach den Mund, dann denken die Leute, Sie hätten Charakter! Meinen Glückwunsch, ich muß zugeben, daß Sie das sauber eingefädelt haben! Ansonsten hoffe ich, Sie ersticken an Ihren Lorbeeren!«
Del Mestre hob nur leicht die Augenbrauen und rückte seinen Gürtel zurecht, über dem die kräftige Wampe sich wölbte.
»Sind Sie jetzt fertig?«fragte er.
»Ja, das bin ich. Mit Ihnen bin ich fertig, da können Sie sicher sein!«
»Gut, freut mich, das zu hören.«
Er wandte sich ab und ging zur Treppe, wo er noch einmal kurz stehenblieb. »Übrigens – Sie sollen zu Voigt hochkommen«, sagte er und ließ Sophie allein.
Sie stieß einen hilflosen Fluch aus, trat mit voller Wut gegen den Automaten und wußte nicht, ob sie lachen oder weinen sollte, als ein Müsliriegel in den Auswurfschacht fiel.
Der Fahrstuhl stoppte im fünften Stock. Sophie atmete durch. Das war der schwärzeste Tag ihrer Karriere. Del Mestre hatte ihr en passant klargemacht, daß sie die Spielregeln immer noch nicht kannte. Vor allem aber, das war das Schlimmste, daß man das Spiel ohne sie spielen würde. Sie zog den Schminkspiegel aus der Handtasche und sah die steile Kerbe auf ihrer Oberlippe, wo sich die weiche Haut zu einer trotzigen Schnute kräuselte. Die muß weg! dachte sie. Jetzt durfte sie alles mögliche sein, nur nicht trotzig. Selbstbewußt. Aber nicht verletzlich! Sie straffte das Kreuz, verließ die Kabine und steuerte mit festen Schritten das Büro der persönlichen Referentin des Generalbundesanwaltes an.
»Herein!« Susanne Voigt saß hinter ihrem Schreibtisch, hatte trotz der Kälte das Fenster einen Spaltbreit offen und arbeitete Akten durch. Als Sophie eintrat, hob sie nur kurz den Kopf und wies mit dem Kinn auf den Besuchersessel. »Bitte, Frau Wolf.« Sophie setzte sich, indes Voigt in aller Ruhe einige Dokumente abzeichnete und Sophie warten ließ wie bestellt und nicht abgeholt.
Sie war eine schlanke Frau von Mitte Vierzig. Alles an ihr vermittelte Strenge: das gedeckte, sicher irrsinnig teure Kostüm von Escada, der blonde Dutt in ihrem Nacken, der kleine schmallippige Mund, der immerfort spöttisch zu lächeln schien und grenzenloses Selbstbewußtsein signalisierte. Sie qualmte drei Schachteln Marlboro am Tag, und ihr größtes denkbares Unglück war laut Flurfunk, wenn der Zigarettenautomat in der Cafeteria kaputt war. Manche sagten, sie käme mit drei Stunden Schlaf aus, andere behaupteten, sie schliefe nie.
Voigt war Mitglied der Kanzlerpartei, Kreisvorsitzende in Heidelberg und Kandidatin für den nächsten Bundestag. Ihr Spitzname in der Bundesanwaltschaft war »Stalin«. Sophie versuchte sich die Frau im verrauchten Hinterzimmer einer badischen Gastwirtschaft vorzustellen, wo die Honoratioren des Ortsvereins bei Grauburgunder und Maultaschen tagten. Daß Voigt in ihrem Escada-Kostüm hinter einem Resopaltisch sitzen und aus einem Eckwertepapier zitieren sollte, war eine einigermaßen bizarre Vorstellung, bei der Sophie unmerklich lächeln mußte.
Stalin legte den Stift weg. Sie lehnte sich zurück und klopfte eine neue Marlboro aus der Packung. »Frau Wolf, Sie sind mit der Sache Bucak befaßt und wissen, daß wir in dieser Angelegenheit unter erheblichem Druck der Medien stehen. Wir konnten bis dato noch keine Festnahmen präsentieren, was uns vier Wochen nach der Tat ziemlich dumm aussehen läßt. Nun ja, wie es scheint, hat das Glück uns doch nicht ganz verlassen. Ich habe gestern mit Herrn del Mestre gesprochen, und er …«
»Frau Voigt, vielleicht sollten Sie erfahren, daß die Information, die zur Festnahme von Ufuk Catli führte, von mir stammte«, platzte Sophie heraus und verfluchte sofort ihre vorlaute Klappe.
»Ich weiß«, sagte Voigt spöttisch lächelnd, »Herr del Mestre hat mir davon erzählt und nicht vergessen, Ihren Anteil an diesem Erfolg gebührend zu würdigen.«
Sophie wäre am liebsten im Erdboden versunken.
»Das BKA hat in Mainz ein Treffen zwischen Catli und drei Männern observiert, die den Täterbeschreibungen von Bucak entsprechen«, fuhr Voigt gelassen fort. »Wir haben also vier Festnahmen. Bucak hat Catlis Kontaktleute anhand von Fotos einwandfrei identifiziert. Sie haben in ersten Vernehmungen bereits gestanden, an den Güdinger Morden beteiligt gewesen zu sein. Nur stellt sich ein weiteres Problem: Der Bruder von Catli ist beim BKA kein Unbekannter. Er verdient sich als V-Mann für die Wiesbadener ein bißchen was dazu und hat, wie es der Zufall will, schon vor Wochen von einer Waffenlieferung berichtet, die für die Frankfurter Dependance der Grauen Wölfe bestimmt ist. Keine Unbekannten für uns. Die Gruppe operiert unter dem Deckmantel eines deutsch-türkischen Freundschaftsvereins namens ›Türk-Föderation‹. Der Lieferant ist ein Zypriote, Dimitri Fasoulas. Er gehört zur Organisation von Anton Czarny. Die Waffen – vermutlich Sturmgewehre – werden in drei Tagen von Krakau nach Deutschland geliefert. Das BKA hat zwei verdeckte Ermittler in Krakau, die an Fasoulas bereits seit Monaten dran sind. Sie haben sein Vertrauen gewonnen und bereiten genau diesen Transport als ›kontrollierte Lieferung‹ vor. Die Fachaufsicht lag bisher beim Berliner Generalstaatsanwalt. Der GBA hat sein Evokationsrecht ausgeübt und den Fall in unsere Zuständigkeit überführt, wir haben Akteneinsicht … Tja, Frau Wolf, die Welt ist manchmal klein. Es sieht so aus, als hätten wir dank Ihrer Hilfe die Chance, eine Presse zu bekommen, an der wir uns in kalten Winternächten die Füße wärmen können.«
Sie drückte die Kippe aus, klemmte sich die nächste zwischen die dünnen Lippen und inhalierte tief, ehe sie weitersprach. »Sie sind jetzt etwas mehr als drei Jahre bei uns. Meines Wissens haben Sie bisher noch nie eine Aktion des Bundeskriminalamtes geleitet. Ist das korrekt?«
»Ja«, sagte Sophie, bemüht, Voigt ihre Erregung nicht spüren zu lassen.
»BKA-Präsident Richard Wolf ist Ihr Vater. Könnte das ein Problem darstellen?«
»Nicht für mich.«
»Gut. Dann werden Sie morgen nach Wiesbaden fahren. Die Aktion wird von der Abteilung OA durchgeführt. Gruppenleiter Thom ist Ihr Ansprechpartner. Ich glaube, Sie kennen sich von früher?«
»Er war ein Freund der Familie«, sagte Sophie steif.
»Wie nett, auf diesem Wege können Sie ja alte Freundschaften auffrischen. Das wäre dann alles.«
Sophie stand auf und ging zur Tür.
»Ach, Frau Wolf, nur ein kleiner Rat: Vielleicht wäre es angemessen, sich bei Herrn del Mestre zu entschuldigen.«
Voigt vertiefte sich wieder in ihre Akten, und Sophie zog die dick gepolsterte Tür hinter sich zu. Sie ging zum Fahrstuhl und sah, daß im Erdgeschoß die Reinigungsmaschine noch immer leise über den Boden schmatzte. Als sie wieder in ihrem Büro war, hatte sie das Gefühl, am Ende einer langen Reise zu sein.
Doch sie empfand keinen Triumph.
Angst kroch in ihr hoch und füllte sie vollkommen aus.
Sie ging zum Fenster und starrte hinaus und war ganz still. Die Scheiben vibrierten, als eine Straßenbahn vorbeifuhr. Sophie dachte an Bruckheimer, Reed & Macintire, die Anwaltskanzlei in Baltimore, bei der sie nach dem ersten Staatsexamen ein Praktikum absolviert hatte, an jene Nacht, in der sie von der Weihnachtsfeier kam und über die Thames Street ging und es so kalt war, daß ihre Hände in den Handschuhen froren.
Ihr Handy hatte vibriert. Sie hatte seine Stimme gehört. »Ich brauche dich. Ich weiß nicht, was mit mir ist. Hilf mir, bitte.«
Die Stimme hatte schwach und flehend geklungen. Sie konnte nicht glauben, daß es ihr Vater war. Sie hatte kein Wort gesagt. Dann war nur noch Rauschen in der Leitung gewesen, und Sophie hatte dagestanden, das Handy in der Hand, zitternd, ohne daß sie etwas dagegen tun konnte.
Die ganze Nacht über hatte sie überlegt, was sie tun sollte, war schon soweit gewesen, einen Flug nach Deutschland zu buchen, und tat doch nichts. Am nächsten Tag erfuhr sie aus dem Internet, daß ein Attentat auf ihren Vater verübt worden war. Es hieß, daß er nur leicht verletzt sei und er sein Leben einem seiner Sherpas verdankte. Dazu wurde ein Bild eingeblendet, auf dem ihr Vater rosig und gesund aussah.
Das war neun Jahre her. Sophie lehnte ihre Schläfe gegen das kalte Fensterglas und fühlte nichts und merkte an dem salzigen Geschmack in ihrem Mund, daß sie weinte.
DREI
Sie stand im Morgengrauen auf, trank eine Tasse Espresso, duschte und hockte dann eine halbe Stunde vor dem Kleiderschrank, ohne sich entscheiden zu können, was sie anziehen sollte. Schließlich entschied sie sich für ein Businesskostüm, das ausreichend Förmlichkeit ausstrahlte, packte Unterwäsche, Jeans und einen Pullover zum Wechseln in ihren kleinen Rimowa-Koffer und legte das Dossier über Fasoulas und Czarny sowie die Kurzakte Bucak obenauf. Eine Viertelstunde später war sie auf der Autobahn. Gegen neun passierte sie das Mannheimer Kreuz, die Nachrichten brachten das Übliche: »… tappen die Ermittlungsbehörden auch vier Wochen nach den brutalen Morden von Güdingen noch immer im dunkeln …« Es gab keine Meldung über die Verhaftungen in Frankfurt, was nicht verwunderte, denn Sophie war mit del Mestre, der ihre Entschuldigung huldvoll angenommen hatte, übereingekommen, eine Informationssperre zu verhängen, um die verdeckten Ermittler in Krakau nicht zu gefährden.
Stalin hatte von einer »kontrollierten Lieferung« gesprochen. Es bedeutete, daß das BKA den Waffentransport verdeckt und in Eigenregie organisierte. Ziel war, die Abnehmer dingfest zu machen – ein Standardverfahren, das zum Tagesgeschäft der Wiesbadener gehörte. Doch seit gestern dachte Sophie unentwegt darüber nach, warum ihr die Ermittlungsführung nicht von ihrem Referatsleiter Rupert Bresser, sondern von Voigt übertragen worden war. Sehr ungewöhnlich. Der GBA war im Haus gewesen. An einem Sonntag! Natürlich, er hatte die kontrollierte Lieferung evoziert, also in seine Verantwortung gezogen, doch das hätte er nicht persönlich machen müssen, Bresser übernahm so etwas normalerweise. Voigt, Steindorffs »general dogsbody«, hatte ihr Ohr stets dicht am Mund des Alten. Das Ganze lief also mit Sicherheit über die Chefetage, und man hatte Sophie den Fall gegeben, obwohl oder gerade weil man wußte, daß sie die Tochter des BKA-Präsidenten war.
Grund genug, auf der Hut zu sein.
Sie nahm die Abfahrt Wiesbaden-Erbenheim. Links des Autobahnzubringers sah sie die Shelter der Kampfflugzeuge auf der amerikanischen Airbase. Gewerbeparks, Tankstellen und Großmärkte huschten vorbei und machten an der sechsspurigen Mainzer Straße den Betonpalästen von Banken und Versicherungen Platz. Es war kurz vor elf, als Sophie die Stadt ihrer Kindheit erreichte.
Sie hatte noch fünfundvierzig Minuten Zeit, wollte auf keinen Fall zu früh sein und nahm deshalb den Umweg über das Nerotal, wo sie den Mercedes abstellte und ein Ticket für die Bergbahn löste. Zusammen mit einer amerikanischen Touristengruppe ruckelte sie in einem der kleinen historischen Waggons den Berg hoch. Die Bahn gewann ächzend an Höhe, das dichte Grün der Tannen, die zu beiden Seiten die Gleise säumten, brach schließlich auf und gab den Blick auf Wiesbaden und Darmstadt frei.
Der Himmel war klar und weit und mit zartem weißen Firn bedeckt. Sophie erinnerte sich, daß sie als kleines Mädchen manchmal mit ihrer Mutter hier hochgefahren war. Sie stieg an der Endstation aus und ging die wenigen Schritte zu dem griechischen Tempel, der auf dem Aussichtspunkt thronte. Sie setzte sich auf eine Bank, kuschelte sich in ihren Mantel, rauchte, und ihre Augen verweilten auf der schläfrigen Bürgerlichkeit der Stadt.
Über Dimitri Fasoulas, den Mann, der hinter dem Krakauer Waffentransport stand, war in Deutschland kaum etwas bekannt. Ein Zypriote, der bisher erst einmal aufgefallen war. Man hatte Mitte der Neunziger bei einer Grenzkontrolle in seinem Handschuhfach eine Beretta gefunden, für die er keinen Waffenschein besaß, doch das Verfahren wurde, da Fasoulas kein deutscher Staatsbürger war, gegen Zahlung einer Geldbuße eingestellt. Im BKA waren seine Fingerabdrücke lediglich routinemäßig in der AFIS-Datei gespeichert und zehn Jahre später, nach Ablauf der gesetzmäßigen Frist, ebenso routinemäßig wieder gelöscht worden.
Aber natürlich kannte Sophie den Namen des Mannes, für dessen Organisation Fasoulas arbeitete: Anton Czarny. Er war so berüchtigt wie geheimnisumwittert. Die Disc, die ihr bereits kurz nach dem Gespräch mit Voigt in der Geschäftsstelle der Bundesanwaltschaft ausgehändigt worden war, hatte jedes verfügbare Material enthalten, das es über ihn gab.
Czarny wurde als Sohn eines Tschechen und einer Russin in Moskau geboren und wuchs im sibirischen Omsk auf, wo sein Vater als Elektroniker in einer Rüstungsfabrik arbeitete, die Scarp-Raketen fertigte. Er ging schon früh zur Armee, kam zu den »Truppen besonderer Bestimmung« – jener Eliteeinheit, die man unter dem Namen »Spetsnaz« kannte – und absolvierte im Anschluß auf der Militärakademie Frunse eine Ausbildung zum Verhörspezialisten. 1984 wurde seine Einheit nach Afghanistan versetzt, wo sie Operationen hinter den feindlichen Linien durchführte. Man wußte mit Sicherheit, daß Czarny mit den Mudschaheddin ein Kompensationsgeschäft betrieb: Kalaschnikows gegen Heroin. Drei Jahre später setzte er sich von der Truppe ab. Seine Spur verlor sich im Nahen Osten.
Erst 1991 tauchte Czarny wieder auf. Er hatte auch nach dem Ende der Sowjetunion beste Verbindungen zu russischen Armeekreisen und lieferte Waffen an einen Neffen des libanesischen Premierministers. Dieser war das Oberhaupt der örtlichen Mafia, auf deren Lohnliste auch der Verteidigungsminister und der Chef des Nachrichtendienstes standen. Der Clan kontrollierte die libanesische Armee sowie den Polizeichef von Tripoli. Von dort wurde der Stoff, mit dem man Czarny für seine Waffenlieferungen bezahlte, über die Heroinpipeline nach Europa gepumpt. Aus dieser Zeit datierte auch der Beginn seiner Geschäfte mit den Grauen Wölfen. Deren Mutterpartei MHP hatte fünfzehntausend Mann ihrer Spezialeinheiten in den Osten der Türkei geschickt, wo sie einen gnadenlosen Vernichtungskrieg gegen die Kurden führten. Czarny half mit AK-47-Gewehren und Handgranaten. Der Legende nach sollte er sogar mit Alparslan Türkes, dem »Basbug« der Grauen Wölfe, befreundet gewesen sein.
Sophie schaute auf ihre Uhr, sah, daß es Zeit war, und ging mit dem Gedanken, daß ein ehemaliger sowjetischer Obrist und ein fanatischer Antikommunist wie Türkes ein hübsches Paar abgegeben haben mußten, zurück zur Bahnstation. Fünfzehn Minuten später saß sie wieder in ihrem Wagen. Die Straße schraubte sich in Serpentinen den Neroberg hinauf. Gründerzeitvillen lösten Sechziger-Jahre-Bauten aus Waschbeton ab.
Die Scheiben des Mercedes waren beschlagen, und Sophie fror.
Vor etwa zehn Jahren hatte Czarny sein Geschäft mit dem »Narco-Terrorismus« aufgegeben und sich ausschließlich auf Waffen spezialisiert. Laut BKA war er heute der größte Waffenhändler der Welt. Er hatte beide Parteien des Kaschmirkriegs, Indien und Pakistan, mit Panzern und Geschützen ausgestattet, sein Lieferkatalog aus dem letzten Geschäftsjahr las sich wie die Inventarliste eines russischen Armeearsenals: Panzerabwehrraketen für die Taliban, AKM-Gewehre, Katjuscha-Werfer und BMP-Schützenpanzer an Nordkorea, Stabminen, die für die Abu Sayyaf bestimmt waren. Sein Meisterstück war jedoch eine Ladung von russischen SA-6-Raketen, die er über die EOS-Trade in Tallinn, eine Tarnfirma des Dschihad-Terroristen Aslam Ghaffar, in die USA schickte. Dort wurde das Waffensystem von der US-Armee auf ihrem Übungsgelände in Fort Irwin/Kalifornien zur Gefechtssimulation genutzt. Daß die CIA dabei ihre Finger im Spiel hatte, war mehr als eine Vermutung.
Czarny besaß Wohnsitze in Asien, Rußland und auf Barbados, wo er unter der persönlichen Protektion des dortigen Innenministers stand. Er wurde von einer Art Privatarmee bewacht, die aus früheren Spetsnaz- und KGB-Leuten bestand, und war vermutlich einer der bestgeschützten Männer der Welt. Sophie fragte sich, wo Fasoulas in der Hierarchie der Organisation stand. Vermutlich nicht besonders hoch, denn die Lieferung von ein paar Maschinengewehren war für Anton Czarny wirklich keine große Sache.
Vor ihr tauchte der massige Gebäudekomplex des BKA auf. Noch war der Hauptsitz des Amtes in Wiesbaden. Aber der Umzug nach Berlin war bereits beschlossene Sache. Damit würde Sophies Vater sich nicht mehr herumschlagen müssen, nur sein Nachfolger. Er ist der letzte Präsident, der auf dem Neroberg herrscht, ein Relikt der alten Bundesrepublik.
Sie parkte in der Thaerstraße, atmete einmal kräftig durch und steuerte, den Rimowa-Koffer fest in der Hand, den Haupteingang an. Sophie legitimierte sich bei den Beamten, die an der Detektorschleuse Dienst taten. Sie erhielt einen Hausausweis, heftete ihn an und passierte, die neugierigen Blicke in ihrem Rücken spürend, die Röntgenkontrolle. Normalerweise bewegte sie sich mit der selbstsicheren Gelassenheit einer Frau, die weiß, daß sie schön ist. Sie war es gewohnt, daß Männer ihr nachschauten, doch diese Blicke, hier, hatten einen anderen Grund, das wußte sie.
»Frau Wolf?«
»Ja?«
»Entschuldigung, aber wir wurden soeben informiert, daß Sie zuerst zum Präsidenten sollen.« Sophie zögerte kurz, nickte dann und ging weiter. »Kennen Sie sich im Haus aus?« rief der Beamte ihr hinterher.
»Ja, ich kenne mich aus«, sagte Sophie. Sie erreichte über den gläsernen Verbindungsgang, BKA-intern »Beamtenlaufbahn« genannt, den Neubau am Tränkweg, betrat einen der Fahrstühle und fuhr hoch in den siebten Stock. Zu ihrer eigenen Verwunderung registrierte sie, daß ihre Hände nicht zitterten. Sie war ganz ruhig.
An der Flurwand der Chefetage hing eine kleine Galerie von Porträts der bisherigen Präsidenten, auch das ihres Vaters, doch Sophie warf keinen Blick darauf. Sie betrat das Vorzimmer, ohne anzuklopfen. Eine der beiden Sekretärinnen hob den Kopf, während die Finger der anderen, die Sophie den Rücken zudrehte, leise klackend über die Tastatur eines Computers huschten. Noch ehe Sophie sich vorstellen konnte, sagte die Sekretärin: »Sie können gleich reingehen, Frau Wolf. Ihr Vater erwartet Sie bereits.«
»Danke.« Wieder spürte sie diesen Blick.
Als Sophie die Tür öffnete, stand Wolf von seinem Schreibtisch auf und ging auf sie zu. Einen ängstlichen Augenblick lang dachte sie, er wolle sie umarmen, doch Wolf blieb einen Meter vor ihr stehen, lächelte nur unbeholfen und sagte: »Du siehst gut aus.«
»Du auch«, sagte Sophie.
Sie standen voreinander, in kaum erträglichem Schweigen, bis die Sekretärin hereinlugte. »Kaffee, Herr Präsident?«
Wolf schaute Sophie fragend an.
»Gern, danke.«
Die Sekretärin verschwand wieder, um wenige Sekunden später ein Tablett mit einer Kaffeekanne, zwei Tassen und einer kleinen Keksschale auf den Besprechungstisch zu stellen.
Dann war Sophie mit ihrem Vater allein.
»Hattest du eine gute Fahrt?« fragte Wolf, indes er den handgearbeiteten Humidor, der auf seinem Schreibtisch stand, aufklappte und eine Partagás herausnahm.
»Ja«, sagte sie.
Die umständliche Prozedur, mit der Wolf die Zigarre erst befühlte, dann anleckte und schließlich mit einem Streifen Zedernholz anzündete, war ihr noch so vertraut, daß es weh tat und sie den Blick abwandte, um sich in dem eigenwillig eingerichteten Zimmer umzuschauen. Ein orientalischer Teppich, in den mittelalterliche Kampfszenen eingewoben waren, bedeckte den größten Teil des Bodens. Gerahmte Fotos schmückten die holzgetäfelten Wände. Sie zeigten Porträts von Tuaregkriegern und Impressionen einer Wüstenlandschaft. Wolf hatte seine Kindheit in Marokko verbracht, wo Sophies Großvater der erste Botschafter der Bundesrepublik gewesen war. Preußischer Diplomat, drei Jahre Buchenwald, bis 1956 im Auswärtigen Amt, dann Rücktritt aus Protest gegen die Wiederbewaffnung. Weiße Haare, die sich anfühlten wie Watte. »Papa?«–»Ja?«– »Kommt Großvater heute zu Besuch?«– »Ja. Aber spiel bitte auf deinem Zimmer, du weißt, es macht ihn immer nervös, wenn du hier unten rumtobst.«
Auf dem Schreibtisch herrschte kreatives Chaos. Akten und Dossiers türmten sich zu einem Berg, mäanderten bis hinab auf den Boden, und der Tag war absehbar, an dem Wolf den Weg zu seinem dick gepolsterten Sessel nicht mehr finden würde. Ferien in Agadir. Kisten voller Akten. Vater und Mutter, schweigend. Sherpas, die beim Sandburgenbauen halfen. Einsiedlerkrebse, arglos vor der Flut.
Sie setzten sich jeweils ans Stirnende des Konferenztisches.
Zwischen ihnen klafften vier Meter eisige Luft.
»Ich bin eigentlich davon ausgegangen, daß Siegfried mein Ansprechpartner im Haus ist«, sagte Sophie. Sie tat Zucker in ihren Kaffee, nahm einen Schluck, griff nach den Gitanes.
»Ist er auch. Du sollst lediglich wissen, daß ich gestern mit dem GBA telefoniert habe. Ich habe ihm gesagt, daß du meiner Meinung nach zu unerfahren für die Leitung dieser Aktion bist. Nun ja, leider sind er und ich nicht immer einer Meinung. Es war nichts Persönliches. Ich hoffe, du verstehst das.«
»Aber ja. Sonst noch etwas?«
»Wie würdest du das Verhältnis zwischen euch und uns definieren?«
»Ganz einfach: Ihr macht, was wir euch sagen.«
»So steht’s auf dem Papier. Aber glaub mir, nur weil Steindorff sich gern damit brüstet, daß wir Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft sind, bin ich noch lange nicht sein Büttel. Seit ich im Amt bin, hat der GBA mir noch nie eine Anweisung erteilt. Er weiß auch, warum, und es wäre hilfreich, wenn du das nicht vergißt. Für dich und für mich.«
»Es ist allgemein bekannt, was du vom GBA hältst. Um mir das zu sagen, hättest du deine kostbare Zeit nicht opfern müssen. Darf ich davon ausgehen, daß das jetzt alles war?«
»Fürs erste.«
Sophie machte ihre Zigarette aus und ging zur Tür.
»Es kann nicht immer so bleiben zwischen uns, das weißt du«, sagte Wolf, der ebenfalls aufgestanden war.
Sophie drückte das Kreuz durch und ging hinaus, durchquerte mit hoch erhobenem Haupt das Vorzimmer, wandte sich auf dem Flur nach links, und erst, als die Fahrstuhlstür zuschnappte, wurde ihr bewußt, daß sie am ganzen Körper schweißnaß war.
Hinter dem achtgeschossigen Haupthaus, das einen terrassenartigen Riegel zur Straße bildete, erstreckte sich ein zwei Hektar großes, parkähnliches Gelände mit mehreren Nebengebäuden. Sophie gelangte über die Beamtenlaufbahn in den Altbau. Hier, wo die Labors und Asservate der Kriminaltechnik beheimatet waren, hatte man ihr im zweiten Stock ein Büro zugeteilt.
Als sie eben den Koffer geöffnet und die Akten herausgenommen hatte, kam Siegfried Thom herein.
Sophie lächelte. Sie umarmten sich.
»Gut siehst du aus«, sagte Thom.
»Hat mein Vater auch gesagt.«
»Oh, Pardon.« Er senkte gespielt zerknirscht den Blick. Thom war Anfang Fünfzig, mittelgroß und schmal, wenn man von dem kleinen Bauchansatz absah. Seine Haare waren weizenblond, fast weiß. Er hatte die glatte, helle Haut und den gedehnten Akzent der Friesen. Es gab wohl keinen Mitarbeiter von ihm, der sich erinnern konnte, wann er einmal laut geworden wäre. Selbst in den hitzigsten Diskussionen blieb er sachlich. Das konnte provozieren. Und sollte es bisweilen auch.
»Na, hat er dich leben lassen?« fragte Thom, setzte sich, das linke Bein, das von einer Schußverletzung steif geblieben war, lang ausgestreckt, und schob eine Dunhill in eine Zigarettenspitze aus Perlmutt, um mit dandyhaft gespitztem Mund zu rauchen.
»Oh, es war ein nettes Gespräch. Fast wie in alten Zeiten.«
»Er liebt dich. Du mußt ihm nur zeigen, daß er es darf.«
»Ich habe mich sehr gefreut, dich wiederzusehen, Siegfried. Wollen wir jetzt zum Geschäft kommen?«
»Natürlich«, sagte Thom. Allein das feine Zucken um die Mundwinkel verriet, was er dachte. »Ich vermute, du hast eine Menge Fragen.«
Sophie setzte sich ihm gegenüber, griff nach einer der Akten und legte sie auf ihren Schoß. »Ihr habt zwei verdeckte Ermittler in Krakau?«
»Broszat und Vandreyke. Heute nacht wird ein weiterer meiner Männer zu ihnen stoßen. Schrader. Er fährt den Lkw.«
Sophie stockte einen Moment. »Gregor Vandreyke?«
Thom nickte mit unbewegtem Gesicht. »Ja, er war der Sherpa, der deinem Vater damals das Leben gerettet hat.«
Für den Bruchteil einer Sekunde sah Sophie sich in jener Nacht in Baltimore mit klopfendem Herzen über die Straße laufen und hörte den Schnee, der wie zerstoßenes Glas unter ihren Schuhen knirschte.
Sie zwang sich, das Bild auszublenden, und fragte statt dessen: »Welche Legende benutzt er?«
»Spediteur für Baumaschinen. Illegale Aktivität als Lieferant von Semtex-Sprengstoff an die ETA. Er hat sechs Monate gebraucht, bis Fasoulas ihm den Transport anvertraut hat. Vandreyke und Broszat haben sich bereits zweimal mit ihm getroffen. Einmal in Haifa, einmal in Zürich.«
»Warum läßt Fasoulas die Lieferung nicht von eigenen Leuten durchführen – es fehlt ihm doch wohl kaum an Logistik?«
Kopfschütteln. »Simple Risikominimierung. Sie benutzen Vandreyke als Subunternehmer. Er hat kein Herrschaftswissen. Wenn etwas schiefgeht, ist die Struktur der Organisation nicht in Gefahr.«
»Hat Fasoulas eine Keuschheitsprobe verlangt?«
»Hmm, er wollte eine kleine Gefälligkeit von Vandreyke. Eine nicht registrierte Beretta. Haben wir arrangiert.«
»Hat er Vandreykes Liquidität überprüft?«
»Ja, in Zürich. Wir hatten ein Bankschließfach angemietet, und Vandreyke hat Fasoulas eine Million Euro in bar gezeigt.«
Sophie notierte sich das. Solche Geldvorzeigeaktionen waren ein wichtiger Bestandteil des Geschäfts. Die Kartelle wollten sich bei ihren potentiellen Partnern vergewissern, daß sie über genügend Kapital verfügten. Auf diesem Weg hatte Vandreyke also bewiesen, daß er flüssig und damit ernst zu nehmen war.
»Woraus besteht die Lieferung genau?«
»Kalaschnikows. Wir vermuten, daß sie aus dem Einbruch in das Nato-Depot vor drei Monaten stammen. Du weißt schon, Bratislava.«
»Und ihr seid sicher, daß sie für die Grauen Wölfe bestimmt sind?«
»Absolut. Fasoulas ist ein sehr mißtrauischer Mann und führt nie ein Telefonat über Handy, weil er Angst hat, abgehört zu werden. Er benutzt ausschließlich öffentliche Telefonzellen. Vandreyke hat in Haifa beobachtet, daß er immer dieselbe Zelle nahm, ein paar Straßen von seinem Hotel entfernt. Der Mossad hat für uns eine warme Stube gebastelt. Wir haben fünf Telefonate abgehört, die Fasoulas mit Catlis Bruder in Frankfurt geführt hat.«
Sophie lächelte. Thoms BKA-Karriere hatte während der RAF-Zeit in den siebziger Jahren begonnen. Niemand außer den Männern, die damals im Einsatz waren, nannte eine Abhöraktion noch »warme Stube«.
»Das beste ist, wir gehen rüber in mein Büro«, sagte Thom, »dort habe ich alle nötigen Unterlagen.«
»Wieso, sitzt du nicht mehr in der Äppelallee?« fragte Sophie verdutzt.
Die in Wiesbaden belassenen Beamten der für Organisierte Kriminalität zuständigen Abteilung OA, in der Thom als Gruppenleiter über sechs Referate herrschte, waren, stählern eingezäunt und mit Hundelaufstreifen gesichert, in der alten Hindenburgkaserne untergebracht; ein viktorianisches Gemäuer, auf dessen Fluren es nach Bohnerwachs und ranzigen Reinigungsmitteln roch. Der Rest, mehr als dreihundert Männer und Frauen, war bereits in Berlin stationiert.
»Dein Vater wollte, daß ich mit meiner Kerntruppe hierherkomme. Wir sind jetzt im sechsten Stock, unter der Chefetage«, sagte Thom.
»Aha«, sagte Sophie gedehnt, und Thom lächelte.
Er war von ihrem Vater, der vor einer halben Ewigkeit Ausbilder an der Polizeiführungsakademie Hiltrup gewesen war, persönlich ausgebildet worden, und Wolf, dem nur noch ein knappes Jahr Zeit bis zur Pensionierung blieb, hatte nie einen Zweifel daran gelassen, daß er in Thom einen Mann sah, der für höchste Positionen im BKA prädestiniert war. Er wurde allgemein als Kronprinz gehandelt. Daß er nun auch noch so dicht beim Präsidenten saß, war ein Signal, das man schwerlich übersehen konnte.
Sophie erinnerte sich, wie sie als kleines Mädchen auf Thoms Schoß gehockt und den Märchen gelauscht hatte, die er ihr mit sanfter, einschläfernder Stimme vorlas. Er war in ihrem Elternhaus unterhalb des Nerobergs ein und aus gegangen. Ihr Vater schätzte seinen Rat mehr als den jedes anderen Menschen; für Sophie war er immer so etwas wie ein Onkel gewesen.
»Seit dem Attentat wohnt er im Amt«, sagte Thom. Sophie schaute ihn fragend an. »Du weißt, wie er sich im Bereich OK engagiert. Er steht auf der Todesliste der Kartelle. Und von Al Qaida wird er auch nicht geliebt. Dein Vater wollte nicht, aber der Innenminister hat darauf bestanden, daß er eine Wohnung hier im Haus bezieht.«
»Die von Herold, oben im fünften Stock?«
»Nein, im DV-Gebäude, gleich hinter seinem Amtszimmer, wo früher der Ruheraum war. Dort hat man ein paar Durchbrüche gemacht. Sie haben ihm sechs Zentimeter Panzerglas und Sicherheitsstufe I verpaßt.«
Er schien zu erwarten, daß sie etwas sagte, doch sie drückte nur die Gitane aus, klemmte ihre Akten unter den Arm und ging mit ihm hinaus auf den Flur.
»Von wem hast du eigentlich den Job gekriegt?« fragte Thom beiläufig.
»Stalin.«
»Ach. Hockt die immer noch auf Steindorffs Schoß?«
»Ja, schmeißt mit ihren Launen um sich wie ein Funkenmariechen mit Kamellen.«
Sie mußten beide lachen.
»Weißt du schon, wo du wohnst?«
»Im Crown Plaza.«
»Sophie?«
»Ja?« Sie blieb stehen und schaute Thom an.
»Versteh mich nicht falsch, aber … nun ja, es ist ungewöhnlich, daß der GBA einer Staatsanwältin, die noch keine Erfahrung mit dem BKA hat, einen solchen Auftrag erteilt.«
»Und?« fragte Sophie steif.
»Ich weiß nur nicht, was dahintersteckt. Steindorff streichelt nicht mal seinen Hund ohne Hintergedanken. Sei vorsichtig, ja?«
Sophie nickte stumm. Sie nahmen die Treppe.
VIER
Lajosz Kiraly lenkte den S-Klasse-Daimler, den er vor zwei Tagen in Lublin gestohlen hatte, über den Krakauer Innenstadtring. Links ragte das düstere Gemäuer der polnischen Königsburg in die Höhe, hinter sich wußte er die Scheinwerfer des Lieferwagens, an dessen Steuer Sascha Roth saß. Sie überquerten die Weichsel. Schartige Eisbrocken trieben unter der Brücke hindurch und sahen auf dem träge fließenden Grau des Wassers wie Schimmelbesatz aus. Kiraly fuhr, Roth im Schlepptau, in zügigem Tempo auf der vierspurig ausgebauten Wielicka in Richtung Tarnów. Bald hatten sie die Lichter der Stadt hinter sich gelassen. Der Ostwind schleppte Wolken heran, die Schnee brachten. Er fiel in dicken Flocken und verwandelte sich auf der Fahrbahn in braunen Matsch.
Kurz vor Kosocice bog Kiraly von der Schnellstraße ab. Sie passierten ein abgelegenes, halb verfallenes Gehöft und rumpelten über einen Feldweg, um wenige Minuten später ihr Ziel zu erreichen. Kiraly stoppte am Rand des früheren sowjetischen Manövergeländes, dessen Schlammwüste in die Dunkelheit wucherte. Er besprach mit Roth die nötigen Dinge, was kaum länger als eine Minute dauerte, denn sie hatten die ganze letzte Woche damit verbracht, jedes Detail auszuarbeiten.
Roth stemmte zwei Standscheinwerfer aus dem Laderaum des Lieferwagens, verband sie mit der Autobatterie und richtete sie aus etwa zwanzig Metern Abstand auf den Daimler, während Kiraly, den Gewehrkoffer unter dem Arm, zu einem der Wachtürme stapfte und die Leiter hochstieg. Er hockte sich auf die Steinbank und sah in vierhundert Metern Entfernung die schwach angestrahlte Limousine. Die Lichtverhältnisse waren realistisch. Kiraly klappte den Gewehrkoffer auf und setzte, eine Melodie nachsummend, die er vorhin im Autoradio gehört hatte, das langläufige Scharfschützengewehr zusammen. Zuletzt schraubte er das Orion-Nachtsichtvisier, dessen Halterung eine Eigenkonstruktion war, direkt über das Magazin und nahm den Vorsatzfilter ab. Kiraly legte das Gewehr auf die Fensterkante und preßte die Flansche des Suchers gegen sein rechtes Auge. Das Licht wurde von dem Orion fünfzigtausendfach verstärkt. Er sah, daß Roth das Geländemotorrad bereits aus dem Lieferwagen herausgeschoben hatte.
Kiraly setzte ein Headset auf. »Alles klar?« fragte er.
»Alles klar«, quäkte Roths Stimme aus dem Ohrstöpsel.
Er trug einen Rucksack über seiner Lederkluft und entfernte sich mit der Enduro etwa hundert Meter von dem Daimler, ehe er wendete und mit Vollgas losfuhr. Neben der Limousine stoppte er, griff mit einer fließenden, hundertmal geübten Bewegung über die Schulter, zog die fünfundsiebzig Zentimeter lange Steyr-ACR aus dem Rucksack und schoß den rechten vorderen und hinteren Reifen platt.
»Jetzt!« flüsterte Kiraly.
Sein Zeigefinger erreichte den Druckpunkt. Die Kugel verließ mit einer Mündungsgeschwindigkeit von achthundertfünfzehn Metern pro Sekunde den Lauf, sirrte durch die Speichen der Enduro und traf die Hintertür des Daimlers. Im gleichen Augenblick riß Roth die ACR hoch. Er schoß auf die hintere Scheibe. Sie zerplatzte in einem Glasregen, doch Roth feuerte weiter, immer auf den gleichen, jetzt imaginären Punkt. Die Kugeln fanden kein Hindernis mehr, flogen durch die leeren Fensterhöhlen, und Roth hörte erst auf, nachdem er in schneller Folge exakt zwanzig Schüsse abgegeben hatte.
»Zu langsam«, sagte Kiraly. »Noch mal.«
Roth lud die ACR nach und fuhr wieder auf seine Ausgangsposition. Sie wiederholten das Ganze zwölfmal, stets mit dem gleichen Ablauf. Und immer traf Kiraly mit traumwandlerischer Sicherheit dieselbe briefmarkengroße Stelle in der Hintertür, ohne daß, selbst nach dem letzten Schuß, die Eintrittsöffnung wesentlich größer geworden wäre.
Schließlich war Kiraly zufrieden. Er schraubte das Gewehr auseinander und traf sich mit Roth vor dem Lieferwagen. Sie schoben die Enduro in den Laderaum, verstauten die Scheinwerfer und fuhren, im Bewußtsein, daß sie noch mehr als sechs Stunden Zeit hatten, zurück in die Stadt. Den Daimler, in dessen Karosserie sich nur ein einziges Loch befand, ließen sie stehen.
Erst als sie wieder die Weichsel überquerten, schaute Kiraly nach rechts, wo Roth schweigend auf dem Beifahrersitz kauerte. »Gut gemacht, Kleiner«, sagte Kiraly lächelnd. »Das nächste Mal zeige ich dir, wie man einen Menschen mit einer Zigarettenschachtel tötet.«
Um Mitternacht fiel der Schnee immer dichter. Er wehte wie Asche gegen die Außenmauer des Hotels Cracovia und stob über die Kante des angekippten Badezimmerfensters der Suite, die Gregor Vandreyke sich mit Ines Broszat teilte.
Vandreyke drückte das Fenster zu und machte das Licht aus.
Als er in Broszats Zimmer kam, lief eine Soap im Fernsehen. Polnische Untertitel, der Ton war ausgeschaltet. Broszat hockte auf dem Bett und reinigte ihre Dienstpistole mit Waffenöl. Sie trug einen superkurzen Stretch-Mini, war perfekt geschminkt und hatte die Haare zu einer Mähne hochtoupiert.
Mit ihr konnte man vieles in Verbindung bringen. Aber keine Sig Sauer .9 mm.
Sechs Monate waren Broszat und Vandreyke jetzt im verdeckten Einsatz. Sie spielten ein Pärchen, wobei Broszat die Rolle der sehr blonden, etwas nervigen Begleiterin des weltläufigen Geschäftsmanns Vandreyke alias Kurt Bongartz zugefallen war.
Sie sah zu, wie Vandreyke vor dem Spiegel seine Krawatte band. Er war groß und durchtrainiert. Schwarze Augen brannten in den Höhlen, tiefe Runen zerfurchten das Gesicht. Kaum zu glauben, daß er erst auf die Vierzig zuging. Broszat konnte, obwohl sie ihn besser kannte als die meisten anderen Menschen, nicht die geringste Nervosität bei ihm entdecken. Wieder einmal verblüffte er sie mit der Ruhe jeder seiner Bewegungen.
Sie würde ihm jederzeit ihr Leben anvertrauen.
Als er sein Jackett anzog, buchtete das Waffenholster den Stoff kaum merklich aus. Zwar war die Sig Sauer die BKA-Dienstpistole, doch Vandreyke bevorzugte eine österreichische Glock 17, deren Magazin dreiunddreißig Patronen aufnahm. Sie war komplett aus Kunststoff gefertigt, auf keinem Röntgendetektor zu erkennen und sehr praktisch bei Flughafenkontrollen.
Er stellte einen Fuß auf einen Stuhl und schob das Hosenbein hoch. Broszat sah, daß er zusätzlich eine Walther TPH in das Wadenholster gleiten ließ. Sie dachte an Fasoulas, den Mann, den Vandreyke gleich treffen würde. Er war der vorsichtigste Mensch, der ihr jemals begegnet war. Dimitri Fasoulas hatte Krakau offenkundig mit Bedacht ausgewählt, weil hier zur Zeit das internationale Kurzfilmfestival stattfand und seine beiden Bodyguards, ein Libanese und ein Syrer, denen Broszat und Vandreyke die Spitznamen Plisch und Plum gegeben hatten, in dem Trubel, den Besucher aus aller Welt veranstalteten, nicht weiter auffielen. Genau wie die beiden verdeckten Ermittler war er im Cracovia abgestiegen, einem düsteren Kasten aus sozialistischen Zeiten, dessen Betonriegel zwischen dem Festivalkino und dem Jordana Park in die Höhe ragte.
Gestern waren sie mit ihm in einem französischen Restaurant am Rynek essen gewesen. Während Fasoulas, Broszat und Vandreyke im hinteren Teil des Restaurants saßen, hatten Plisch und Plum einen Platz gewählt, von dem aus sie sowohl den Tisch von Fasoulas als auch die Eingangstür ständig im Auge hatten. Dimitri Fasoulas, groß und hager, tiefe Magenfalten rechts und links der Nase, hatte mit Vandreyke kein Wort übers Geschäft gewechselt und statt dessen von Afghanistan erzählt. Von Geschossen, mit denen die Sowjetarmee in den Achtzigern experimentiert hatte; Treibladungen, die im Körper ein zweites Mal explodierten. Von den Mudschaheddin, die Schafherden als Minenräumer vor sich her trieben. Von den ausgebrannten Tonnen der Napalmbomben, in denen alte Frauen Hirsebrei für die Kämpfer kochten. Aber auch von einem Tal im Hindukusch, wo über dem leuchtenden Rot der Mohnfelder die schneebedeckten Gipfel der Siebentausender thronten.
Broszat hatte sich die ganze Zeit über gefragt, was einen Zyprioten griechischer Abstammung wie Dimitri Fasoulas nach Afghanistan verschlagen haben könnte. Aus einem Nebensatz glaubte sie herausgehört zu haben, daß er beim Internationalen Roten Kreuz gewesen war. Vielleicht hatte er so Czarny kennengelernt. Aber das war nur Spekulation.
Vandreyke zog seinen Mantel an und sagte: »Es ist Zeit.«
»Willst du wirklich allein gehen?«
»Natürlich.«
Sie zögerte kurz, dann sagte sie nur: »Viel Glück.«