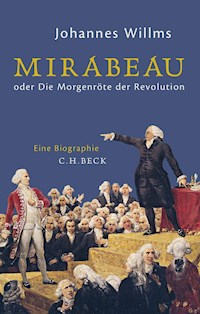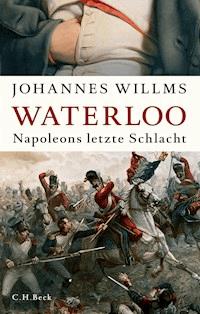12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die typische Pariserin ist verführerisch und kapriziös, und zu einem waschechten Franzosen gehören die Boulekugeln ebenso wie Baskenmütze oder Weißbrotstange … Adieu Klischee! Johannes Willms, seit Jahren mit Frankreich verbunden, blickt hinter die Kulissen. Mit den Tücken des Linksabbiegens und der Hundeliebe seiner Nachbarn ist er so vertraut wie mit der Pünktlichkeit ländlicher Handwerker und dem Erfolgsrezept für die einzig wahren Pommes frites. Er weiht uns in das Wunderwerk TGV ein, zeigt uns die verwunschenen Weinberge des Languedoc und den waldreichen Lubéron – und die ethnische Vielfalt der Metropolen, die in der Fußballnationalmannschaft ihren vollkommenen Ausdruck findet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Ausgabe
4. Auflage 2009
ISBN 978-3-492-95449-5
© Piper Verlag GmbH, München 2005 Umschlagkonzept: Büro Hamburg Umschlaggestaltung: Birgit Kohlhaas, Egling Umschlagabbildung: Ellen Rooney / gettyimages Karte: cartomedia, Karlsruhe
An welchen Äußerlichkeiten erkennt man einen Franzosen?
Zu den weltweit verbreiteten typischen Merkmalen des Franzosen zählen die Baskenmütze, die unter dem Arm getragene Weißbrotstange, die baguette, sowie der an der Unterlippe klebende Zigarettenstummel. Die Französin hingegen ist elegant und raffiniert gekleidet, gilt zumeist als kapriziös, bisweilen auch als energisch und ist von einem sehr ansprechenden Äußeren, für das, je nach Geschmack, Brigitte Bardot oder Fanny Ardant, Jeanne Moreau oder Emmanuelle Béart als Vorbild dienen.
Es ist also vor allem das Kino, dem wir unsere Stereotypen über die Franzosen verdanken, weshalb einem Nicht-Franzosen der Schauspieler Jacques Tati beispielsweise als ganz und gar echter Franzose gilt. Der tritt zwar nie mit einer Baskenmütze, sondern mit einem Hut auf, und statt der baguette trägt er selbst bei strahlendem Wetter einen zusammengerollten Regenschirm unterm Arm. Auch sieht man ihn nie mit Zigarette, sondern mit einer Pfeife. Warum also gilt Tati als die Verkörperung des typischen Franzosen? Vermutlich wegen seiner hageren Gestalt, die der stets zu kurze Popelinmantel noch betont. Vor allem dürfte es seine Haltung sein, insbesondere sein vorgeschobener Kopf, der seinem Gang etwas Staksiges und Zögerndes verleiht, ganz so, als mühte er sich, eine extreme Kurzsichtigkeit zu überspielen.
Selbstverständlich verkörpert Tati eine Karikatur, stellt sein Agieren eine Überzeichnung dar. Fragt sich nur, wovon? In Frankreich jedenfalls sind seine Filme weitaus weniger beliebt als im Ausland. Können die Franzosen also nicht über sich selbst lachen? Doch, das können sie zweifelsohne, aber eben nicht unbedingt in seinem Fall, was damit zusammenhängen dürfte, daß sie sich in ihm nicht wiedererkennen.
Ganz anders hingegen verhält es sich mit Asterix, der neben General de Gaulle der weltweit bekannteste Franzose unserer Zeit ist. Wollte man aus dieser Feststellung jedoch die Vermutung ableiten, beide seien irgendwie gleichermaßen repräsentativ für das Selbstbild, das die Franzosen von sich haben, so irrte man sehr. De Gaulle wird als einsame Ausnahmeerscheinung, als ein für das Land glücklicherer Widergänger Napoleons bewundert, über dessen bekanntes und bisweilen sehr exzentrisches Gebaren man sich oft und gern, aber stets respektvoll amüsiert. Mit Asterix hingegen, den man aber keinesfalls als einen Gegenentwurf zum General mißverstehen darf, können sich die Franzosen vorzüglich identifizieren, weil er ihnen als ihr mild-ironisches Spiegelbild gilt.
Als Karikatur findet Asterix deshalb soviel Anklang, weil er in sich alle Gegensätze, Vorzüge und Nachteile, die sich die Franzosen gerne selbst nachsagen, verkörpert. Zwar ist er eher häßlich und entschieden kleinwüchsig, dafür aber auch listenreich und verschlagen, stets tapfer und nie unterzukriegen. Seine ganze Erscheinung ist von geradezu außergewöhnlicher Durchschnittlichkeit, und schon gar nichts in seinem Auftreten und Gebaren verrät etwas von den Eigenschaften, die in ihm schlummern. Dem entspricht sein Herkommen: Es ist keineswegs die Stadt, schon gar nicht Paris, sondern die Provinz, das kleine Dorf, das irgendwo in den Weiten Frankreichs verloren liegt. Um so mehr aber ist er ein aufrechter Gallier, ein Franzose schlechthin, einer, der sich nicht fürchtet, allein die Welt in die Schranken zu fordern, selbst wenn die Hölle voller Römer wäre. Eben die stehen ein für das andere, das Fremde, das Nicht-Französische, über das Asterix ebenso seinen Spott ausgießt wie über die allzu hohe Meinung seiner Landsleute von sich selbst und über die von ihnen bewunderten Leistungen wie die angeblich nur sie auszeichnenden Vorzüge.
Asterix ist nicht zuletzt auch deshalb so populär, weil er auf ausnahmslos alles, was französischen Schulkindern an Vorbildlichem über das eigene Land und dessen Geschichte eingetrichtert wird, die Parodie bietet. Ein Mantra des einst selbst in den entlegensten französischen Kolonien gelehrten Grundschulpensums lautete: »Unsere Vorfahren, die Gallier …« Eine andere, durch ständige Wiederholung zur Gewißheit gehärtete Behauptung stellt die ebenfalls durch Schulerziehung eingeimpfte und deshalb weitverbreitete Selbsteinschätzung dar, besonders logisch und rational zu sein, zu der sich auch Asterix voller Stolz bekennt, um dann nur zu häufig diesen Anspruch durch sein Tun und Lassen zu widerlegen.
Daß die Franzosen keineswegs logischer oder rationaler begabt sind als andere Völker, davon kann jeder ein Lied singen, der die Hilfe von Handwerkern braucht. Als wir unsere Pariser Wohnung durch den Erwerb eines ihr unmittelbar benachbarten Einzimmerappartements vergrößern konnten, zeigte sich, daß dessen Boden eine gute Handbreit tiefer lag. Den Parkettleger focht dies nicht an, wollte der doch ohne weitere Überlegung den Höhenunterschied durch eine Schwelle, über die man immer stolpern würde, betonen. Das ließ sich gerade noch dadurch vereiteln, daß man ihn auf die wesentlich elegantere und vor allem jede Stolpergefahr bannende Lösung aufmerksam machte, die Niveaudifferenz durch einen Lattenrost und Sperrholzplatten, auf denen das Parkett verlegt wurde, auszugleichen.
Dieses Beispiel verrät viel über das Geheimnis des gewachsenen urbanistischen Charmes von Paris, der sich allzu häufig solcher Flickschusterei verdankt, die von einer wahrhaft nationalen Leidenschaft, der bricolage, kündet, die eigenen vier Wände durch Handwerkelei und Bastelei nicht nur zu verschönern, sondern vor allem den zur Verfügung stehenden knappen Raum optimal auszunutzen. Die französische »Wohnkultur« ist ein weites Feld, dessen Erforschung und Darstellung ein eigenes Buch rechtfertigte. Allerdings bräuchte es dazu vermutlich lebenslangen Forscherfleiß, denn kaum etwas sonst wird in Frankreich dem Auge eines anderen so gut verborgen wie die eigene Wohnung. Wie es darin für gewöhnlich aussieht, darüber liefert kein Film Aufschluß.
Unlängst wurden wir im Bistrot unfreiwillig Ohrenzeuge eines Gesprächs, dem wenigstens ein Fingerzeig zu entnehmen war. Der Termin der Hochzeit der Tochter nahte. Das Datum stand zwar schon seit längerem fest, und eigentlich hatte man sich darauf auch vorbereiten wollen, aber … Natürlich hatte man noch nichts unternommen. Gewiß, ein Restaurant für die Feier war reserviert, ein Menü bestellt worden. Allein in der Wohnung war nichts passiert, war die aus diesem Anlaß beabsichtigte gründliche Renovierung ein ums andere Mal aufgeschoben worden und jetzt war es zu spät, damit überhaupt noch beginnen zu wollen. Was also tun, wenn die künftigen Schwiegereltern der Tochter zu Besuch kämen? Welchen Eindruck würden diese haben? Eine schier ausweglose Situation, aber der Gesprächspartner wußte dennoch guten Rat. Es genüge völlig, so meinte der, wenn man lediglich die Seiten der Türen neu streiche, die den Eltern des Bräutigams notwendig bei ihrem Höflichkeitsbesuch ins Auge fielen. Das mache allemal einen guten Eindruck, der seine Wirkung gewiß nicht verfehle …
Der Selbstanspruch, siehe den Parkettleger, ist das eine, die Wirklichkeit das andere. Da sich die daraus resultierenden vielfältigen Widersprüche kaum in einer Person glaubwürdig vereinen ließen, bekam Asterix von seinen Erfindern einen, seinen besten Freund zur Seite: Obelix. Der ist in allen Stücken das genaue Gegenteil seines Kumpels Asterix: Obelix ist naiv, ziemlich einfältig, streitsüchtig, hochgewachsen und dabei über alle Maßen beleibt, was verrät, daß er besonders daran interessiert ist, stets gut und reichlich zu essen.
Erst durch sein Alter ego Obelix wird Asterix wirklich als Karikatur kenntlich, wird deutlich, daß auch das Wesen der Franzosen mehr als nur die Fassade ihres Selbstanspruchs aufweist und daß dieses eine Summe vieler Ungereimtheiten und Widersprüchlichkeiten ist, die im Falle der beiden Witzfiguren – wie oft im wirklichen Leben Frankreichs – darin zu gewisser Versöhnung miteinander kommen, daß man sich erst einmal zu Tisch setzt, um dann ausgiebig darüber zu diskutieren, was man wie zubereitet essen will.
Das unzertrennliche Duo Asterix und Obelix zeigt mittelbar auch, daß sich die Franzosen stärker als andere Nationen an einer Idealvorstellung ihrer selbst orientieren: Man ist zwar Franzose, sieht sich aber immer mit der erzieherischen, ja eminent zivilisatorischen Herausforderung konfrontiert, wirklich ein Franzose zu werden. Maß und Maßstab dafür liefern vor allem die Protagonisten der großen Literatur. Versuchte man die Quersumme von deren hervorstechenden, selbstverständlich durchweg positiven Eigenschaften zu ziehen, dann sähe das Ergebnis ungefähr wie folgt aus: Einen Franzosen kennzeichnen gleichermaßen große intellektuelle Fähigkeiten wie eine künstlerische Empfindsamkeit. Die erste Eigenschaft findet ihren Niederschlag in den von Geist funkelnden, witzigen und ausgesucht höflichen Umgangsformen, in der unübertrefflichen Fähigkeit, durch Worte für sich einzunehmen, und zuallererst natürlich darin, die eigene Sprache grammatikalisch korrekt zu beherrschen.
Vermutlich ist kein Volk in die eigene Sprache so verliebt wie die Franzosen. In keinem anderen Land wäre es vorstellbar, daß ein schmales Buch mit dem Titel »La Grammaire est une chanson douce«, »Die Grammatik ist ein zartes Lied«, das Erik Orsenna 2001 veröffentlichte, ein Bestseller mit fast einer halben Million verkaufter Auflage würde. Nirgendwo sonst wird auch so sehr darauf geachtet, das eigene Idiom vor sprachlichen Verunreinigungen zu bewahren. Das ist die vornehmste Aufgabe der Académie, jener Kongregation von vierzig »Unsterblichen«, die sich in Fragen der mustergültigen Beherrschung des Französischen als Vorbild begreifen.
Solche Fürsorge der eigenen Sprache gegenüber mag ein Amerikaner oder auch ein Deutscher lächerlich oder übertrieben finden; nicht so ein Franzose, denn für ihn ist die eigene Sprache das wichtigste Element seiner Selbstvergewisserung, seiner Identität. Erst die Beherrschung des Französischen macht einen Franzosen zum Franzosen. So will es das republikanische Dogma, das mit der Revolution aufkam und demzufolge ein citoyen, ein Bürger Frankreichs, derjenige ist, der sich zu Frankreich und zur französischen Kultur bekennt, will sagen, zum esprit français, in dem die Essenz der Identität Frankreichs konzentriert ist und der seinen vollkommenen Ausdruck in der Sprache findet, die schon lange vor der Revolution mit dem Gemeinplatz vom »génie de la langue française« charakterisiert wurde. Für seine Sprache nimmt deshalb ein Franzose selbstverständlich in Anspruch, daß sie die Persönlichkeit der Nation ausdrückt, ihr historisches Werden so gut wie ihre schöpferische Einzigartigkeit, mit denen sie sich von allen anderen unterscheidet.
Dieser sprachlich-kulturelle Nationalismus ist spezifisch französisch und das mit gutem Grund, denn die Durchsetzung der Errungenschaften der Revolution war aufs engste mit dem Siegeszug des Französischen über andere Sprachen oder Dialekte, das Okzitanische, Bretonische, Italienische, Deutsche oder dem auf dem Land weitverbreiteten patois, verbunden. Dieser Prozeß kam erst im 20. Jahrhundert zum Abschluß, als ihn nicht mehr allein die Schule vermittelte, sondern das Fernsehen. Dem war jedoch keine Dauer beschieden, weil Sprache ein Wesen von nicht zu bändigender Vitalität ist. Das »klassische« Französisch, die Sprache Racines und Voltaires, machte eine auf Zentralisierung und Uniformierung eingeschworene Verwaltung zur Regel. Das Gesprochene und Geschriebene sollte damit dem vorherrschenden klassizistischen Kunstideal entsprechen, das eine verbindliche und harmonische Weltsicht darstellte, die sich als Zivilisation qualifizierte.
Dieser Anspruch war natürlich viel zu elitär, um jemals allgemeine Geltung zu erlangen. Deshalb bedient man sich längst vieler sozial- oder altersspezifischer »Umgangssprachen«, mit denen sich die je besonderen Perspektiven und Lebenswirklichkeiten viel angemessener ausdrücken lassen. Ebenso vergebens sind auch alle Kreuzzüge, zu denen französische Sprachpuristen gegen das franglais, das Eindringen englischer Wörter und Wendungen in die Umgangssprache aufrufen. Wer allen Ernstes vorschlägt, beispielsweise statt »strip-tease« das klassisch-französische effeuillage oder gar chatouille-tripes zu verwenden, macht sich nur lächerlich.
Einen Nicht-Franzosen, selbst wenn er die Sprache gut beherrscht, quält aber weniger das ausgepichte und regelstolze französische Sprachbewußtsein als vielmehr das damit eng verknüpfte Behagen, mit der eigenen Sprache zu jonglieren, ihr ständig neue Facetten, Nuancen oder verborgene Bedeutungen abzuluchsen oder manches mit anderen Worten einfach doppelt, wenn nicht gar dreifach zu sagen. Nicht selten wird diese selbstverliebte Sprachartistik so weit getrieben, daß der zur Rede stehende Gegenstand hinter dem funkelnden und blitzenden Wortfeuerwerk verschwindet oder von einem undurchdringlichen Bedeutungsdunkel verschluckt wird.
Für ersteres liefern vorzügliche literarische Debatten reiche Anschauung, das zweite widerfährt einem häufig bei der Lektüre so eminenter Geister wie Jacques Lacan, Roland Barthes oder Jacques Derrida. Mitunter wandelt einen dabei auch der Verdacht an, mitverantwortlich für solche Dunkelheit sei die Rezeption deutscher Philosophen wie Heidegger, Husserl oder Hegel, deren Sprachgestus und Begrifflichkeit einem Franzosen als reiner Horror erscheinen müssen. Vergleichsweise einfach läßt sich hingegen die Sprache »dekodieren«, derer sich Politiker oder Firmenchefs bedienen, wenn sie sich um eine möglichst unverfängliche, unverbindliche oder schlicht ihren Gegenstand verschleiernde Ausdrucksweise bemühen. Das Gegenstück zum »Amtsdeutsch«, dessen schauerlichste Erfindung der Begriff »Endlösung« und dessen noch heute beliebtestes Verb »durchführen« ist, heißt im Französischen »langue de bois«, wörtlich übersetzt »Holzsprache« oder »hölzerne Sprache«.
Neben der virtuosen Beherrschung der Sprache gilt als zweiter wichtiger Aspekt des französischen Zivilisationsideals, daß der Franzose eine besondere künstlerische Ader hat. Alles, dem er im Leben begegnet, möchte er durch Kunst adeln, in eine Form und Ordnung bringen und ornamental verschönern. Schönheit fällt dabei in eins mit Regelmäßigkeit, mit Übersichtlichkeit. Kurz, es gilt: beauté c’est clarté, was soviel bedeutet, daß äußere und innere, ästhetische und moralische Schönheit ihren vollkommenen Ausdruck in geistiger wie formaler Klarheit und Nüchternheit, mit einem Wort in »Vernunft« finden. Die französische Idee der Zivilisation erfüllt sich darin, daß der Mensch der Natur seinen Willen aufzwingt, sie nach seinem Verständnis und Geschmack zu formen sucht. Die Zivilisation begreift den Menschen als selbstbewußtes Werkzeug, die Kräfte der Natur zu zähmen, zu ordnen, sich dienstbar zu machen zu Zwecken, die er ihnen setzt und die vor dem Urteil der Vernunft, das weder Überraschungen duldet noch gar Abweichungen von ihrer Norm, bestehen müssen.
Am bekanntesten für diesen alle Abschweifungen verbietenden »Klassizismus« unbedingter Ausdrucksstrenge, in dem sich die discipline de la civilisation ausspricht, sind die streng geometrischen Gartenanlagen mit ihren zirkulären Rabatten, Kugelbäumen und grünen Heckenmauern, ihren illusionistischen Perspektiven und künstlichen Einsamkeiten, die das Unordentliche der Natur der Ordnung der Vernunft, der Zivilisation, dem Selbstbild des Menschen unterwerfen.
Ein anderes Beispiel bieten die strengen Linienführungen der Haussmannschen Hausfassaden, die zahlreichen Pariser Straßenzügen ihr unverwechselbares Gepräge geben und deren Zierat sich am strengen Kanon eines entsprechenden Musterbuchs orientiert. Daher erfreuen sich in Frankreich wie nirgendwo sonst »Stilmöbel« einer großen, bis heute ungebrochenen Beliebtheit. Mit dem zivilisatorischen Fetisch der clarté, der sich solchermaßen auch dem billigsten Möbelstück mitteilt, das auf Louis XIII., XIV., XV., XVI. oder Empire furniert und gedrechselt ist, kann deshalb selbst die kleinbürgerlichste französische Wohnstube prunken.
Eine unübersehbare Verfallserscheinung dieses durch ein »klassizistisches« Schönheitsideal regulierten Kunstwollens stellt jedoch jene Möblierung mit allerhand Artefakten dar, die überall in Frankreich an den Rändern der Autobahn zu gewärtigen sind: geometrische Formen, mit unauffälligen Farben bemalt, über deren Bewandtnis oder künstlerische Aussage man lange grübelt, ohne je zu einem schlüssigen Ergebnis zu kommen. Es handelt sich dabei um eine Art »Autobahnkunst«, die man beim Vorbeirauschen nur deshalb im Augenwinkel flüchtig wahrnimmt, weil sie zu den Blutspuren der auf der Windschutzscheibe zerplatzten Insekten in irgendwie unschlüssigem Kontrast steht.
Rätselhafterweise herrscht das »klassizistische« Schönheitsideal auch in einem Lebensbereich, wo man es am allerwenigsten vermuten möchte, zumal sich hier spontan die Vermutung aufdrängt, daß es geradezu im krassen Widerspruch steht zu der Sache, um die es geht. Das Thema ist heikel, nicht unbedingt für Jugendliche geeignet, muß aber dennoch zumindest angedeutet werden. Einen ersten Fingerzeig liefern die bekannten Pariser Revue-Theater wie »Moulin Rouge« oder »Crazy Horse«, auf deren Bühnen sparsamst verhüllte nackte Weiblichkeit bei raffinierter Beleuchtung, die das, worauf Man(n) erpicht ist, mehr verdunkelt als erhellt, in allerlei Ballettformationen und tänzerisch-akrobatischen Evolutionen zur Schau gestellt wird.
Das Ergebnis ist ein erotisches Feuerwerk, ein Hochamt zivilisierter Fleischeslust, das zwar wie ein puritanischer Sinnenrausch anmutet, einem aber in diesem Drill und dieser Eleganz nirgendwo sonst geboten wird. Dieselbe geometrische Klarheit und Übersichtlichkeit, jene Wesensmerkmale des idealen Kunstschönen, finden sich auch wieder in den Schilderungen von Ausschweifungen der erotischen oder schlicht pornographischen Literatur, die seit der Aufklärung eine in Frankreich durchaus respektierte Gattung darstellt. Den Orgien, die in den Schriften des Marquis de Sade mit viel Liebe zum Detail ausgebreitet werden, geben sich Gruppen von Menschen beiderlei Geschlechts hin, die zu bisweilen hochkomplizierten, artistische Körperbeherrschung voraussetzenden Konfigurationen, zu wahren Pyramiden, Kaskaden oder sonstigen kubistischen Verschlingungen nackter Leiber arrangiert sind. Unterliegt bei de Sade die Ausschweifung einer Formstrenge, deren Schilderung nicht zuletzt wegen dieser zwanghaften Ordnung des Ordnungswidrigen ins unbeabsichtigt Parodistische abgleitet, kommt, um ein bekanntes Beispiel aus unseren Tagen zu bemühen, im pornographischen Erfolgsroman »Histoire d’O« von Pauline Réage das »klassizistische« Ideal vor allem in der Ausschmückung der Schauplätze, der Garderoben sowie in dem hier herrschenden strengen Reglement weiblicher Unterwerfung zum Vorschein.
Das klassizistische Ideal ist natürlich auch nur eine Behauptung, die auf das Besondere zielt und sich im Alltag, der kaum mit Louis-Vuitton-Koffern, Hermès-Handtaschen oder anderen Versatzstücken klassischer französischer Eleganz möbliert ist, nicht durchsetzen läßt. Das zeigt sich in aller Deutlichkeit an der Gestaltung französischer Autos, die sich durch ein regelrechtes »Mickey-Mouse-Design« auszeichnen, das mit seiner eigenwilligen Formensprache dem Klassizismus geradezu Hohn spricht, sich aber eben deshalb in Frankreich größter Beliebtheit zu erfreuen scheint.
Dabei mag es sich um ein »typisch deutsches« Urteil handeln, wie ein Franzose sofort wortreich anmerken würde. Das Beispiel lehrt noch etwas anderes: Weder der eigene Anspruch noch gar die Stereotypen, die das spezifisch Französische dingfest zu machen suchen, vermögen das französische Wesen in seiner ganzen bunten Vielgestaltigkeit zu erfassen. Wie andere Völker lassen sich auch die Franzosen nicht nach bestimmten Kategorien oder Schemata rubrizieren, klassifizieren, in Schubladen und Kladden einordnen, auch wenn ihr ausgeprägtes sprachliches, kulturelles oder nationales Selbstbewußtsein solches nahelegt. Bei genauerem Studium erweist sich dieses französische Selbstbewußtsein nämlich als eine komplexe Mischung sehr vieler sehr menschlicher Leidenschaften, weshalb es so inspiriert, seine Zusammensetzung zu ergründen, denn dabei erfährt man viel über sich selbst.
Im krassen Widerspruch zum Klassizismus-Ideal, das eine über Generationen geförderte kulturelle Verfeinerung beansprucht und das deshalb eine nie erreichbare Richtgröße darstellt, gibt es eine Wesensart, die allen Franzosen gemeinsam ist: Sie können ihr Herkommen aus der bäuerlichen Lebenswelt nicht verbergen. Das verrät sich in so mancherlei, am zuverlässigsten aber darin, was man als Bauernschläue bezeichnet. Die offenbart sich im unwiderstehlichen Drang, den kleinsten Vorteil, der sich einem zu bieten scheint, rücksichtslos auszunutzen.
Die einleuchtendste Illustration dafür liefert der Franzose als Autofahrer. Sein Blick ist stur nach vorne gerichtet, seine ganze Wahrnehmung nur darauf fixiert, wo sich im Verkehrsgewühl eine Lücke auftut, in die er hineinsteuern kann. Zwar sind auch französische Autos serienmäßig mit Außen- und Innenspiegeln versehen, aber derer besinnen sich Automobilisten grundsätzlich nur, wenn sie rückwärts einparken müssen. Französinnen am Steuer hingegen wissen, daß grundsätzlich alle Spiegel lügen, weshalb sie auch beim Einparken lieber ihren Ohren vertrauen.
Folglich verstopft solche Fahrweise vor allem während der Stoßzeiten die Kreuzungen, auf denen sich der Verkehr zu wahren gordischen Knoten schürzt, die sich aber irgendwann und irgendwie auf rätselhafte Weise von allein wieder auflösen. Eine andere Spezialität des französischen Autolenkers ist das Linksabbiegen. Um bei der ersten Grünphase der Ampel die Chance zu haben, bei diesem Richtungswechsel über die Kreuzung zu kommen, ordnet er sich ganz rechts ein, um dann mit einem Kickstart aus der Pole-position heraus quer an allen anderen Autos vorbei, die sich ebenfalls in Bewegung setzen, nach links zu schießen, um in der zweiten oder dritten Reihe der Linksabbieger angesichts des heranrollenden Gegenverkehrs zum Stehen zu kommen. Nicht selten endet dieses waghalsige Manöver damit, daß ein Linksabbieger aus der ihm entgegengesetzten Fahrtrichtung, der mit nämlicher Kühnheit sein Gefährt steuerte, ihm dann genau gegenübersteht. Da ruckt zunächst nichts mehr vor und zurück, weshalb der vermeintliche Vorteil, mit nur einer Grünphase die Kreuzung zu queren, verlorengeht.
Trotz alledem jedoch sind die Franzosen die besten, elegantesten, rücksichtsvollsten, ruhigsten und geschmeidigsten Autofahrer. Nie führt ein Spurwechsel hier zu Tätlichkeiten, die man dem anderen mit der Lichthupe androht, nie wird Empörung laut, wenn der Vordermann an der Ampel nicht gleich mit Vollgas anfährt. Ach, und dem Franzosen ist das Blech seines Autos allenfalls nur so lange heilig, wie dieses ganz neu glänzt. Ist diese Phase vorbei, parkt man nur noch nach »Gehör« ein, eine Praxis, für die man in Deutschland sofort wegen Fahrerflucht angezeigt würde.
Ein anderes, oft zu beobachtendes Betragen, das der bäuerlichen Wurzel entspringt, liefert der Sturm auf die stets raren Taxen an Flughäfen und Bahnhöfen. Dort spielen sich oft Szenen ab, die von ungefähr an die Flucht der einstmals Grande Armée über die Beresina erinnern. Auch hier gilt: »Sauve qui peut!«, Rette sich wer kann, und Frauen mit Kindern, ehrwürdige Greise, Reisende, die schweres Gepäck schleppen, haben hier allemal das Nachsehen, das sie sich mit lauten Beschimpfungen jener zu kompensieren suchen, die wendiger oder nur unverschämter waren.
Ähnliche Szenen, wenngleich im Ton gedämpfter, spielen sich auch an den Kartenschaltern oder Garderoben von Theaterfoyers, an Kinokassen oder an Bushaltestellen ab. Immer wird gedrängelt, geschoben, gestoßen, hat man hinter oder neben sich einen Konkurrenten, der mit gleichgültiger Miene, aber mit Einsatz seines Körpers versucht, sich einen vermeintlichen Vorteil zu verschaffen.
Eine nur als heimtückisch zu bezeichnende Variante läßt sich häufig an den Kassen von Supermärkten vorzugsweise während der Abendstunden beobachten. Wie überall sind dann auch in Frankreich die Rentner auf den Beinen, die den ganzen Tag über mit anderen Pflichten so beschäftigt waren, daß sie erst jetzt, wie alle anderen arbeitenden Menschen auch, die Gelegenheit finden, ihre Haushaltsbesorgungen zu erledigen. Naht man sich nun mit einem Paket Kaffee in der Hand im Sturmschritt einer Kasse, die von der weisen Supermarktgeschäftsleitung eingerichtet ist für eilige Kunden, die nicht mehr als fünf Artikel bezahlen müssen, löst sich von der Regalreihe, die unmittelbar vor dieser Rettung und Entkommen verheißenden Schranke stehen, unweigerlich eine alte Dame, die ihren mit allerhand Katzennahrung vollgestopften Einkaufswagen dem letzten in der Schlange Wartenden ins Kreuz schiebt. Natürlich hat sie wesentlich mehr als jene fünf Artikel, die hier den Zugang limitieren, zusammengesucht, aber welche Supermarktkassiererin wird eine alte Dame auf ihr Versehen hinweisen und sie dazu nötigen, sich an einer anderen Kasse anzustellen …
Wenn sich der eine einen Vorteil sichert, und sei er noch so gering, so hat der andere das Nachsehen, das sich aber stets mit Gelassenheit zu tragen empfiehlt, denn sonst steigert man nur noch das Triumphgefühl des anderen. Zu diesem Benehmen gibt es aber noch eine weitere Variante, die weniger darauf bedacht ist, den anderen zu übervorteilen, als vielmehr zu schädigen, vorzugsweise den Nachbarn.
Die Tageszeitung »Le Parisien« erzielte vor Jahren mit einem kurzen Werbefilm in den Kinos wahre Stürme an Heiterkeit. Zu sehen war ein Mann mit Anzug und Schlips, der einen Aufzug in einem sichtlich teureren Haus betritt. Sobald er die Fahrstuhltür geschlossen hat, gibt er mimisch unzweideutig zu verstehen, daß ihn ein Geruch belästigt, dessen Ursache an seinen Schuhsohlen zu haften scheint. Unterdessen ist er an seinem Stockwerk angelangt, verläßt den Fahrstuhl vorsichtigen, schleichenden Schritts, zieht sodann den Schlüsselbund aus seiner Hosentasche und naht sich einer Wohnungstür. Vor der liegt ein großer Fußabstreifer, an dem er schnell, aber sorgfältig, die Sohlen seiner eleganten Schuhe von Hundekot säubert, um dann blitzschnell in der daneben liegenden Wohnungstür zu verschwinden. – Die lautstarke Schadenfreude des Kinopublikums ob dieser Szene läßt sich leicht damit erklären, daß jeder Lacher sich damit bei einem Tun ertappt sehen konnte, das ihm unter nämlichen Umständen auch zuzutrauen wäre.
Unvermeidlicherweise erhebt sich jetzt die mißtrauische Frage: Sind denn alle Franzosen so? Nein, natürlich nicht. Es gibt hier wie überall sonst sicherlich zahlreiche Ausnahmen von der Regel. Eben deshalb hat man ja Regeln, um sich über die Ausnahmen zu freuen, die, wenn sie einen schon nicht im Glauben an den unaufhaltsamen sittlichen Fortschritt der Menschheit bestärken, doch das Bild, das sich einem bietet, bereichern. Das gilt namentlich für Paris, wo man rasch zur Einsicht gelangt, daß keineswegs alle Franzosen die republikanische Schulweisheit für sich in Anspruch nehmen können, nach der ihre Vorfahren die Gallier gewesen seien. Damit werden zum einen die Franken unterschlagen, die schließlich dem Land und seinen Bewohnern den Namen gaben. Zum anderen geraten damit all jene Bürger außer acht, die allein auf Grund ihrer anderen Hautfarbe kaum solche Ahnen für sich reklamieren können.
Wie sehr im Wortsinne »bunt« Frankreich in den letzten 150 Jahren geworden ist, zeigt eine Fahrt mit der Métro, der Pariser Untergrundbahn. An welchem Bahnhof man immer aussteigt, ist man zweifellos zwar in Paris, aber doch gleichzeitig auch in einer anderen Welt, wenn nicht gar auf einem anderen Erdteil. Wer die Kathedrale von St. Denis im Norden besucht, in der die französischen Könige begraben sind, glaubt sich nach Afrika versetzt. Wer dem Théâtre des Bouffes du Nord zustrebt, der passiert Straßenzüge, die Geschäfte säumen, in denen aufwendige indische Brautmoden ausgestellt sind, während unweit davon entfernt im Viertel um die Rue de la Goutte d’Or reges afrikanisches und arabisches Markttreiben herrscht. Im 13. Arrondissement ist das Chinesenviertel, machen Geschäfte und Restaurants mit asiatischen Schriftzeichen auf sich aufmerksam, dampft es aus vietnamesischen Suppenküchen oder chinesischen Wäschereien, kann man in verborgenen Ecken von Tiefgaragen buddhistische Tempel besuchen. Verläßt man die Métro an der Station Sentier im 2. Arrondissement, durchwandert man Straßen und gedeckte Passagen, in denen sich Konfektions- und Stoffgeschäfte dicht an dicht reihen, deren Inhaber Juden zumeist orientalischer Abstammung sind. Jene Läden hingegen, die in jedem Arrondissement meist in kleineren Seitenstraßen anzutreffen sind und bis spät in die Nacht geöffnet haben und sich als wahre Bazare entpuppen, selbst wenn sie vermeintlich nur Obst und Gemüse zum Verkauf anbieten, sind alle fest in der Hand nordafrikanischer Einwanderer.
Daran zeigt sich nicht nur der Kosmopolitismus, den Paris mit vielen anderen Weltmetropolen gemeinsam hat, sondern diese ethnische Buntheit beweist auch, daß Frankreich ein Einwanderungsland ist. Nach plausiblen Schätzungen stammt sogar jeder dritte Franzose von Vorfahren ab, die sich irgendwann einmal in Frankreich niedergelassen haben. Verläßliche Statistiken dazu gibt es nicht, denn in Übereinstimmung mit der republikanischen Weltanschauung sind seit dem 19. Jahrhundert die Erhebungen aller Daten verpönt, die Aufschluß geben könnten über das ethnische und nationale Herkommen oder das religiöse Glaubensbekenntnis der Bürger. Deshalb ist es keine allzu große Übertreibung, als gegen den seit den 1980er Jahren aufschäumenden Fremdenhaß, den sich die französischen Rechtsextremen um Jean-Marie Le Pen mit dem Slogan »Frankreich den Franzosen« zunutze zu machen suchten, Demonstranten skandierten: »Wir sind alle Einwanderer der ersten, zweiten, dritten, vierten Generation!«
In Frankreich wie in anderen europäischen Ländern, begleitete der Zustrom von Landesfremden die industrielle Revolution, die ein großes Reservoir von Arbeitskräften verlangte. Daß sich dieses Phänomen in Frankreich besonders ausprägte, obwohl das Land im 19. Jahrhundert die meisten Einwohner aller europäischen Staaten hatte, erklärt sich aus einer sozialhistorischen Besonderheit der Revolution, die als eine ihrer markantesten Folgen eine große Vermögensumverteilung einleitete: Durch die Enteignung der riesigen Besitztümer von Adel und Klerus wurde die Masse der vordem landlosen Bauern zu Eigentümern an Grund und Boden, die fortan an ihrer Scholle klebten, die sie recht und schlecht ernährte. Das erläutert auch, wir sollten es in Erinnerung behalten, warum die Franzosen so ausgeprägt Land und Landleben lieben, viele Städter noch heute um ihre bäuerlichen Wurzeln wissen und ihrem »terroir« auf mannigfache Weise die Treue halten.
Die Schwerindustrie, um die Mitte des 19. Jahrhunderts in den Bergbauregionen im Nordosten Frankreichs entstanden, lockte deshalb zunächst Arbeitsimmigranten aus dem benachbarten Belgien an. Ihnen folgten Italiener, osteuropäische Juden, Polen, Armenier, Russen und nicht zuletzt zahlreiche Deutsche. Vor allem in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts war Frankreich auch Ziel zahlreicher Flüchtlinge, die hier Schutz vor Verfolgung in ihren Heimatländern suchten. Die bislang letzte große Einwanderungswelle erlebte Frankreich in den 60er Jahren. Die wirtschaftliche Hochkonjunktur veranlaßte damals die Anwerbung von Arbeitskräften aus den ehemaligen französischen Kolonialgebieten, besonders von Nordafrikanern. Das dauerte bis 1974 fort. Dieser Zustrom überwiegend nichteuropäischer Immigranten macht dem Land bis heute zu schaffen, zumal deren Integration wegen des notorisch schwachen Wirtschaftswachstums sehr ins Stocken geriet, während gleichzeitig die illegale Einwanderung kontinuierlich zunahm.
Das, und keineswegs die als besonders »fremd« erlebte Kultur, der diese Einwanderer entstammen, erschwert deren soziale Eingliederung erheblich. Daraus folgt eine Ghettoisierung, die Ausbildung von urbanen Problemzonen, in denen sich diese Immigranten ballen und sich mit ihren Problemen und enttäuschten Erwartungen weitgehend allein gelassen sehen. Das wiederum führt zu zahlreichen Konflikten, die einem Fremdenhaß Nahrung geben, den die extreme Rechte für sich politisch zu verwerten sucht. Besonders problematisch daran ist, daß vor allem die zweite Generation, also die bereits in Frankreich geborenen Kinder dieser Zuwanderer, sich um die Aussicht auf einen raschen Aufstieg betrogen fühlt, der allein ihre Integration ermöglichte. Daß die meisten Spieler der erfolgreichen französischen Fußballnationalmannschaft entweder beurs sind, wie die Angehörigen dieser zweiten Generation von Franzosen nordafrikanischer Abstammung genannt werden, oder Kinder von Immigranten aus anderen Teilen des einstigen Empire français sind, stellt nur die große Ausnahme von einer ansonsten erschreckenden Regel dar.
Ende der Leseprobe