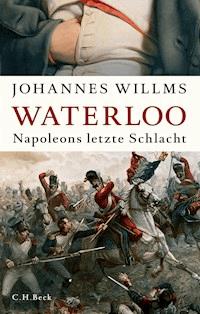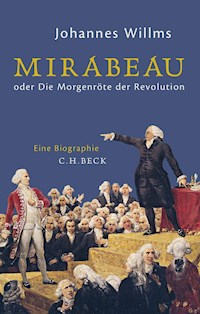
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Verfolgt vom eigenen Vater, stets am Rande des Ruins mit Schulden jonglierend, legendär hässlich von Gestalt, aber atemberaubend erfolgreich bei den Frauen, ein Vulkan an Energie und Kraft, beredsam wie ein Gott - so zieht der junge Graf Mirabeau seine Kometenbahn durch das vorrevolutionäre Frankreich. Doch dann schlägt seine historische Stunde. Als die Revolution beginnt, sind die Revolutionäre noch ohne Plan. Einer aber hat ihn: Honoré Gabriel de Mirabeau. Er will, dass aus dem absolutistisch regierten Frankreich Ludwigs XVI. endlich eine konstitutionelle Monarchie wird, in der dem Dynasten ebenso klare Grenzen gesetzt werden wie Parlament und Regierung. Nur so wird der König seinen Thron behalten können und die Revolution jenem Terror entgehen, dessen Exzesse Mirabeau hellsichtiger kommen sieht als jeder andere. Brennend vor Ehrgeiz zieht Mirabeau alle Register im Kampf um die Macht. Mit Bravour und glänzender Sachkenntnis erzählt Johannes Willms das abenteuerliche Leben eines Mannes, der an beiden Enden brannte und mit 42 Jahren an völliger Erschöpfung stirbt, kurz bevor die Revolution in ihre radikale Phase eintritt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Johannes Willms
MIRABEAU
oder
Die Morgenröte der Revolution
Eine Biographie
C.H.Beck
ZUM BUCH
Verfolgt vom eigenen Vater, stets am Rande des Ruins mit Schulden jonglierend, legendär hässlich von Gestalt und atemberaubend erfolgreich bei den Frauen, ein Vulkan an Energie und Kraft, beredsam wie ein Gott – so zieht der junge Graf Mirabeau seine Kometenbahn durch das vorrevolutionäre Frankreich. Doch dann schlägt seine historische Stunde.
Mit Bravour und glänzender Sachkenntnis erzählt Johannes Willms das abenteuerliche Leben eines Mannes, der an beiden Enden brannte und mit 42 Jahren an völliger Erschöpfung stirbt, kurz bevor die Französische Revolution in ihre radikale Phase eintritt.
ÜBER DEN AUTOR
Johannes Willms war Feuilletonchef und Kulturkorrespondent der «Süddeutschen Zeitung» in Paris. Er hat zahlreiche Werke zur Geschichte Frankreichs vorgelegt, darunter eine große Biographie Napoleons (Gesamtauflage 30.000 Exemplare) sowie zuletzt «Tugend und Terror. Geschichte der Französischen Revolution» (2014) und «Waterloo. Napoleons letzte Schlacht» (2015).
INHALT
Prolog
Erstes Buch: Unordnung und frühes Leid
Erstes Kapitel: Familienbande
Zweites Kapitel: Ein ungeliebter Stammhalter
Drittes Kapitel: Kleine und große Fluchten
Viertes Kapitel: Die Schule der Einsamkeit
Zweites Buch: In den Vorzimmern der Macht
Erstes Kapitel: Licht und Schatten der Freiheit
Zweites Kapitel: Kritik und Krise
Drittes Kapitel: In diplomatischer Mission
Viertes Kapitel: «Ich, als Bürger, zittere um die königliche Gewalt»
Fünftes Kapitel: «Immer zwischen Misthaufen und Palast»
Drittes Buch: Richelieu der Revolution
Erstes Kapitel: Die Mühen der Ebene
Zweites Kapitel: Der Ancien Régime implodiert
Drittes Kapitel: Der große Anlauf
Viertes Kapitel: Im Sold des Königs
Fünftes Kapitel: Als Frosch im Milchtopf
Sechstes Kapitel: «Die politische Apotheke»
Siebtes Kapitel: Die letzte Illusion
Anhang
Anmerkungen
PROLOG
ERSTES BUCH
ERSTES KAPITEL – FAMILIENBANDE
ZWEITES KAPITEL – EIN UNGELIEBTER STAMMHALTER
DRITTES KAPITEL – KLEINE UND GROSSE FLUCHTEN
VIERTES KAPITEL – DIE SCHULE DER EINSAMKEIT
ZWEITES BUCH
ERSTES KAPITEL – LICHT UND SCHATTEN DER FREIHEIT
ZWEITES KAPITEL – KRITIK UND KRISE
DRITTES KAPITEL – IN DIPLOMATISCHER MISSION
VIERTES KAPITEL – «ICH, ALS BÜRGER, ZITTERE UM DIE KÖNIGLICHE GEWALT»
FÜNFTES KAPITEL – «IMMER ZWISCHEN MISTHAUFEN UND PALAST»
DRITTES BUCH
ERSTES KAPITEL – DIE MÜHEN DER EBENE
ZWEITES KAPITEL – DER ANCIEN RÉGIME IMPLODIERT
DRITTES KAPITEL – DER GROSSE ANLAUF
VIERTES KAPITEL – IM SOLD DES KÖNIGS
FÜNFTES KAPITEL – ALS FROSCH IM MILCHTOPF
SECHSTES KAPITEL – «DIE POLITISCHE APOTHEKE»
SIEBTES KAPITEL – DIE LETZTE ILLUSION
Abbildungsverzeichnis
Erstes Buch
Zweites Buch
Drittes Buch
Personenregister
Gabriele Henkel in Freundschaft
Prolog
Unter den Revolutionären ist Mirabeau eine Ausnahme. 1789 war er 43 Jahre alt und damit älter als die meisten, die das damalige Geschehen unmittelbar beeinflussten wie etwa Danton, Robespierre oder Saint-Just. Von diesen unterschied er sich auch durch sein politisches Denken und Wollen. Das zeigt das Corpus seiner programmatischen Schriften, die ausnahmslos vor 1789 publiziert wurden. Diese Veröffentlichungen belegen, dass Mirabeau die Revolution nicht nur ersehnte, sondern auch vom Untergang des Ancien Régime überzeugt war. Als die Revolution eintrat, war er deshalb der Einzige unter den Akteuren, der wusste, was er politisch wollte. Mirabeau verfügte über eine Vision, die seinen Ehrgeiz, eine bedeutende Rolle zu spielen, mit einem Konzept verband, das Frankreich eine neue, zukunftsorientierte Ordnung verhieß. Dessen tragende Pfeiler waren die konstitutionelle Monarchie, die Geltung der bürgerlichen Grund- und Freiheitsrechte und die repräsentative Versammlung der Generalstände, die sich als Nationalversammlung qualifizierte. Diesem Konzept, das in mancher Hinsicht wie eine Vorwegnahme der V. Republik anmutet, die Charles de Gaulle 1958 durchsetzte, hielt er allen Anfeindungen, Widerständen und Enttäuschungen zum Trotz bis zuletzt die Treue.
Auch wer zu früh kommt, den bestraft das Leben. Seit Eröffnung der Generalstände, denen er als Abgeordneter des Dritten Stands von Aix-en-Provence angehörte, trat er beharrlich für einen Schulterschluss von Monarchie und Volk ein. Dieses Bündnis von König und Revolution sollte einerseits auf die rückhaltlose Anerkennung der neuen revolutionären Gesellschaftsordnung seitens der Monarchie wie andererseits auf die ebenso unbedingte Zustimmung der Revolution zur Krone als Organ der Exekutive basiert sein. Das Konzept jedoch hatte zu Lebzeiten Mirabeaus keine realistische Chance. Verantwortlich dafür war insbesondere die Unfähigkeit Louis XVI zu begreifen, dass allein ein neues, von der Revolution akzeptiertes Verständnis seiner Rolle den weiteren Bestand der Monarchie gewährleisten konnte. Die hartnäckige Borniertheit der Krone trug entscheidend dazu bei, der revolutionären Dynamik jene Wucht zu verleihen, die sich erst im Paroxysmus der Schreckensherrschaft erschöpfte.
Schillers Einsicht, gegen die Dummheit kämpfen selbst die Götter vergebens, bezeichnet die Tragik Mirabeaus. Um ihr zu entrinnen, ging er das Risiko ein, sich als geheimer Berater des Hofes zu verdingen. Das, so hoffte er, verschaffe seinen Ratschlägen endlich Gehör beim König. Die üppig honorierte Tätigkeit, die stets geargwöhnt, aber erst nach seinem Tod und dem Sturz Louis XVI 1792 aufgedeckt wurde, lieferte seinen politischen Gegnern die willkommene Gelegenheit, sein Ansehen gründlich zu ruinieren. Das über fast zwei Jahre sich hinziehende Gezerre um den Verbleib von Mirabeaus sterblicher Hülle, mit deren feierlicher Beisetzung unmittelbar nach seinem Tod Anfang April 1791 im Pantheon dieses Bauwerk seine bis heute gültige Bestimmung erhielt, liefert dafür die makabre Illustration.
Für die damals über Mirabeau verhängte Damnatio memoriae bewirkte auch 1851 die Publikation der von ihm verfassten geheimen Noten an den Hof keine Revision, weil die Deutungshoheit der Revolution rund 200 Jahre lang von der Sicht seiner Widersacher, den Parteigängern der Jakobiner um Robespierre, beherrscht wurde. Ausnahmslos alle diese Noten sind Bruchstücke der politischen Konfession Mirabeaus, die seine unabhängige Gesinnung belegt und damit das über ihn gefällte Urteil, er habe sich an den Hof verkauft, als propagandistische Nachrede erweist. Ein schönes Beispiel dafür liefert die Denkschrift vom 28. September 1790: «Ich habe immer gesagt, dass die Revolution vollendet ist, aber noch nicht die Verfassung; dass die verschiedenen Errungenschaften, die unmöglich rückgängig zu machen sind, die königliche Gewalt eher gestärkt als geschwächt haben; dass im Laufe eines einzigen Jahres die Freiheit über mehr Vorurteile triumphiert hat, die der Staatsgewalt nachteilig waren, mehr Feinde des Thrones vernichtet, mehr Opfer zum Besten der nationalen Prosperität erbracht hat, als die Autorität des Königs im Laufe der Jahrhunderte bewirkt hätte. Ich habe stets darauf hingewiesen, dass die Entmachtung des Klerus, der Parlements, der Pays d’états, des Lehnwesens, der Kapitulationen der Provinzen, der Privilegien aller Art, eine große, der Nation wie dem Monarchen gleichermaßen zugutekommende Errungenschaft ist.»[1]
Mirabeaus Überlegungen und Ratschläge waren keineswegs gegenrevolutionär, sondern der verzweifelte Versuch, einen denkfaulen und geistesschlichten Monarchen davon zu überzeugen, dass der Verlauf, den die Revolution bislang genommen hatte, sich durchaus mit dessen wohlverstandenen Interessen vereinbaren ließ.
Februar 2016
Erstes Buch
Unordnung und frühes Leid
Erstes Kapitel
Familienbande
Ich bin Franzose, jung und unglücklich. Das sollte genügen, um Ihre Majestät für mein Los zu interessieren. Ich trage einen bekannten Namen. Ihre Vorfahren nahmen vor fast fünf Jahrhunderten meine Familie auf, die vor dem Wüten der Parteikämpfe aus Italien geflohen war.»[1] Mit diesen Worten begann Honoré-Gabriel Riquetti Comte de Mirabeau ein an Louis XVI gerichtetes Schreiben, mit dem er um den königlichen Gnadenerweis bat, aus dem Staatsgefängnis von Vincennes bei Paris entlassen zu werden.
Die italienische Herkunft war eine familiäre Überlieferung. Die Vorfahren der Mirabeau stammten demnach aus Florenz, von wo sie im 13. Jahrhundert, um den Streitereien zwischen Guelfen und Ghibellinen zu entrinnen, in das Städtchen Seyne in Südostfrankreich geflohen seien.[2] Von adeligem Geblüt, hätten sie ursprünglich den Namen Arrighetti getragen, der dann im Laufe der Zeit zu Riquetti verschliffen wurde.[3] Das ist ebenso blühender Unsinn wie der damit verknüpfte Anspruch, die Familie gehöre seit dem Mittelalter dem französischen Hochadel an.[4] Urkundlich dokumentiert ist überhaupt erst ein Jean Riquetti, der als einer der reichsten Kaufleute Marseilles 1564 eine Angehörige des alten provençalischen Adels, Marguerite de Glandèves, heiratete. Damit verknüpft war eine Steigerung des sozialen Status, den Jean Riquetti sechs Jahre später mit dem Kauf von Schloss Mirabeau nebst zugehörigen Ländereien an der Durance demonstrierte, als er dem Namen Riquetti den Titel eines écuyer de Mirabeau hinzufügen konnte.[5]
Jean Riquetti hatte die erste Sprosse sozialen Aufstiegs erklommen, den dessen Nachfahren fortsetzten, indem sie wichtige Ämter in Marseille oder der Provence bekleideten, vorteilhafte Ehen schlossen und schließlich auch damit erfolgreich waren, ihren Söhnen die Aufnahme in den Malteserorden zu verschaffen. Dabei zeigte es sich jedoch, dass der Adelstitel, den die Riquetti als écuyers de Mirabeau geltend machten, noch sehr wackelig war. So wurden die Söhne nur nach der preuve secrète, d.h. der Erklärung von vier Angehörigen altadeliger Geschlechter, die sich für ihren gesellschaftlichen Rang verbürgten, in den Ritterorden aufgenommen.[6] Diese Unsicherheiten wurden erst 1685 beseitigt, als Louis XIV geruhte, die Ländereien von Mirabeau in den Rang einer Markgrafschaft zu erheben. Fortan konnten sich die Riquetti mit dem Titel eines Marquis de Mirabeau schmücken.[7]
Die gesellschaftliche Aufwertung des Geschlechts symbolisierte der Großvater Mirabeaus, der am 28. November 1666 geborene Jean-Antoine Riquetti, der im Alter von 21 Jahren bereits zum Chef der Familie wurde.[8] Dieser Jean-Antoine war ein Haudegen, der zwanzig Jahre lang in allen Kriegen Louis’ XIV focht, ehe er im spanischen Erbfolgekrieg in der Schlacht von Cassano am 16. August 1705 so schwer verwundet wurde, dass man ihn für tot hielt und auf der Walstatt liegen ließ. Auf wundersame Weise gerettet und geheilt, trug er seither den rechten Arm in einer Schlinge, und den Kopf stabilisierte eine silberne Nackenstütze. Als Invalide errang Jean-Antoine die Bewunderung der ebenso schönen wie reichen Françoise de Castellane, die er 1706 heiratete. Seine zwanzig Jahre jüngere Frau gebar ihm sieben Kinder, sechs Jungen und ein Mädchen, von denen aber nur drei Söhne den Tod des Vaters am 27. Mai 1737 überlebten: Victor, genannt der Marquis de Mirabeau, Charles-Elzéar, der spätere Bailli, und Louis-Alexandre, der Chevalier. Mit dem Tod des Vaters wurde dessen ältester Sohn Victor entsprechend dem altrömischen Brauch, der in weiten Teilen Südfrankreichs noch gültig war, zum Familienoberhaupt, kümmerte sich um seine zwei jüngeren Brüder und seine verwitwete Mutter, mit der er bis zu ihrem Tod 1769 unter einem Dach lebte.
Louis-Alexandre, der am 6. Oktober 1724 geborene Jüngste der Brüder, wurde im Alter von 13 Jahren im Rang eines Seconde-Lieutenant in einem Infanterieregiment untergebracht, in dem ein Vetter der Mirabeaus, der Moralist Luc de Clapiers Marquis de Vauvenargues, Offizier war. «Ihr Bruder», so ließ Vauvenargues den Marquis am 13. Juni 1738 wissen, «war für acht oder zehn Tage in der Festung eingesperrt wegen einer Insubordination gegenüber M. de Misère [i. e. einen seiner Vorgesetzten im Regiment]; gestern Morgen ist er wieder entlassen worden. In seinen Absichten lässt er sich nicht beirren, und er ist ebenso willensstark wie Sie; das ist auch im Übrigen der einzige Fehler, den man ihm vorwerfen kann, denn ansonsten ist er sehr liebenswürdig und einsichtig.»[9]
Zwar wurde Louis-Alexandre wiederholt bei Beförderungen übergangen, aber das minderte keineswegs seine Begeisterung für das Kriegshandwerk, die er als Teilnehmer an zahlreichen Schlachten und Treffen des bis zum Frieden von Aachen im Oktober 1748 andauernden Österreichischen Erbfolgekriegs beweisen konnte. Dieses Engagement, das dem väterlichen Vorbild alle Ehre machte, verschaffte ihm schließlich mit 24 Jahren eine Hauptmannsstelle.
Das Avancement war das eine Erlebnis, das Louis-Alexandre entzückte; ein anderes, das ihm zur gleichen Zeit widerfuhr, war die Begegnung mit Marie Gabrielle Hévin de Navarre, einer Schauspielerin, die dem Harem angehörte, den der französische Oberbefehlshaber Marschall Moritz Graf von Sachsen um sich geschart hatte. Die Bekanntschaft mit der schönen Mlle. Navarre muss dem Hauptmann Riquetti umso mehr den Kopf verdreht haben, als diese es darauf abgesehen hatte, sich den in Lebens- und Liebesdingen unerfahrenen jungen Krieger als Ehemann zu kapern. Einen entsprechenden Versuch hatte sie zuvor schon beim Dichter und Bühnenautor Jean-François Marmontel unternommen, der sich jedoch nicht zu dem Schritt bereitfand, den ihm die Geliebte mit großem Nachdruck nahelegte. So jedenfalls schildert es Marmontel in seinen Memoiren, der auch ausführlich davon berichtet, dass sich die Navarre nun dem Chevalier de Mirabeau zugewandt und diesen derart erfolgreich becirct habe, dass er sie heiratete.[10]
Diese für die damaligen Moralvorstellungen unverzeihliche Mesalliance, von der sich Lustspiel- und Romanautoren verschiedentlich anregen ließen, vernichtete den Ruf des Comte de Mirabeau, wie er sich jetzt nannte. Daran änderte auch nichts, dass kurz nach der Hochzeit seine Frau 1749 in Avignon starb. In diese dem Papst gehörende Stadt hatte sich das Paar vermutlich geflüchtet, um sich vor dem Zorn der Mutter und der beiden älteren Brüder Mirabeau zu schützen, die Himmel und Hölle in Bewegung setzten, die Ehe zu verhindern. Avignon blieb auch in den kommenden Jahren das Exil des Witwers. Die Acht, die von der Familie über das «schwarze Schaf» verhängt wurde, währte bis 1755. Damals passierte der Markgraf von Bayreuth auf dem Weg nach Italien Avignon, wo er den Comte de Mirabeau kennenlernte und ihn in seine Dienste nahm. Bald darauf figurierte der Comte als Erster Kammerherr im Conseil des Markgrafen. In dieser Eigenschaft wurde er zweimal, 1757 und 1759, in diplomatischer Mission nach Paris entsandt, eine Verwendung, mit der er sich wieder die Achtung seiner Brüder erwarb.[11]
Damit aber auch die Mutter ihrem jüngsten Sohn den Fehltritt vergaß, musste der sein Witwerdasein gegen eine neue und diesmal standesgemäße Ehe eintauschen. Diese Bedingung der alten Frau wurde erfüllt, als der Comte de Mirabeau im Oktober 1760 bei seinem ältesten Bruder in Begleitung seiner ihm frisch angetrauten Gemahlin, einer Gräfin Kunsberg, in Paris erschien. Als der Comte schon im Jahr darauf ohne Nachkommen starb, kehrte seine junge Witwe nach Paris zurück, wo sie bis zu ihrem Tod im 1772 im Haus des ältesten Bruders zusammen mit dessen Mutter lebte.[12]
Im Unterschied zum jüngsten Bruder, dessen Bedeutung für Mirabeau von lediglich anekdotischer Natur war, übte der andere Bruder, der Bailli, wegen der engen Beziehungen, die ihn mit dem Marquis verbanden, einen größeren Einfluss auf den Werdegang des Neffen aus. Das vergalt ihm dieser damit, dass er dem Onkel als Einzigem aus der Familie stets ungeteilten Respekt zollte. Der Bailli, ein Ritter des Malteserordens, tat seit 1730, zuletzt als Kapitän, Dienst in der königlichen Kriegsmarine und wurde 1752 zum Gouverneur der Karibikinsel Guadeloupe ernannt. Als er diesen Posten drei Jahre später aus Gesundheitsgründen quittierte, kehrte er nach Frankreich zurück, wo er 1761 als Generalinspekteur der nordfranzösischen Küstengarde Verwendung fand. Nachdem sich seine Hoffnungen zerschlugen, zum Marineminister Louis’ XV berufen zu werden, ging er nach Malta, dem Hauptsitz des Malteserordens. Dort übernahm er für zwei Jahre das Generalat der Galeeren, mit dem er seine 31jährige Karriere in der Marine beendete.[13]
Das Generalat, das dem Bailli eine glänzende Position verschaffte, war mit einem hohen Preis verknüpft. Nicht nur musste er rund 140.000 livres für seine Investitur und den Unterhalt dieser Charge aufwenden, sondern er sah sich auch genötigt, ein Gelübde abzulegen, das ihn zu Armut und Ehelosigkeit verpflichtete. Das war eine Entscheidung, die ihm umso weniger leichtgefallen sein dürfte, als er just zu dieser Zeit eine Frau kennenlernte, die, wie er den Bruder wissen ließ, das Ebenbild der eigenen Mutter in jüngeren Jahren sei. Wäre er seinen Herzensregungen gefolgt, hätte er diese «Dame aus Calais» sicherlich geheiratet. Allein der ältere Bruder, der Marquis de Mirabeau, redete ihm das erfolgreich aus und veranlasste den Bailli, das Gelübde der Ehelosigkeit abzulegen.
Den Jüngeren in diese Bahn zu lenken, veranlassten zwei Überlegungen, denn dessen Zölibat würde dem Ältesten, nachdem der jüngste Bruder kinderlos gestorben war, die Gewähr bieten, das Geschlecht der Riquetti de Mirabeau im Mannesstamm fortzusetzen. Garant dafür war der am 9. März 1749 geborene Honoré Gabriel Comte de Mirabeau. Zum anderen spekulierte der Marquis darauf, dass dem Bailli nach dem Generalat eine lukrative Kommende des Malteserordens zufallen würde, die ihn nicht nur für seine Aufwendungen entschädigte, sondern von der auch ein gehöriger Batzen übrig bliebe, von dem der Kinderlose den älteren Bruder und dessen Familie unterstützen könnte. Diese Spekulation erfüllte sich auch glänzend, denn der Bailli erhielt nach dem Ende seines Generalats eine Kommende, die 39.000 Livres jährlich abwarf, ein Ertrag, den er auf 45.000 Livres zu steigern hoffte. Das versprach eine schöne Zugabe zum Familieneinkommen des Marquis, der stets in Geldnot war. Auch gelang es ihm, den sparsam lebenden Bailli zu überzeugen, auf Schloss Mirabeau seinen Wohnsitz zu nehmen, das dieser erst während der Revolution wieder verließ, um nach Malta zu gehen, wo er 1794 starb.[14] Damit überlebte der Bailli nicht nur den Marquis, der am 13. Juli 1789 in Argenteuil starb, sondern auch den Neffen, dessen windungsreicher Lebensweg den beiden Brüdern unerschöpflichen Stoff für den regen Briefwechsel lieferte, in dem sie zeitlebens standen.[15]
Victor de Riquetti, der Vater von Mirabeau, wurde am 4. Oktober 1715 in Pertuis geboren. Seine Kindheit verbrachte er auf Schloss Mirabeau unter dem Regiment eines Vaters, dessen erzieherische Maxime auf unnachsichtige Strenge gegenüber den eigenen Kindern lautete. Als Vauvenargues in einem Schreiben vom 13. März 1740 die einschlägigen Vorstellungen des Marquis zurückwies, versetzte er diesem: «Was die Art der Überredung anbelangt, mit der Sie den Chevalier zu überzeugen suchen, werden Sie keinerlei Erfolg haben, wenn er von demselben Schlag ist wie wir. Ihr System ist es, mit Nachgiebigkeit ans Ziel zu gelangen; ich dagegen möchte das ohne Umschweife oder mit Gewalt erreichen.»[16]
Nach dem Besuch einer Jesuitenschule in Marseille wurde Victor mit dreizehn Jahren in das Regiment Duras gesteckt, das der Vater lange Zeit kommandiert hatte. Das war nicht ungewöhnlich, denn Kinder und Jugendliche wurden im 18. Jahrhundert als Erwachsene angesehen und mussten sich deren Pflichten und Anforderungen unterwerfen. Nach dreijährigem Militärdienst bezog der Marquis in Paris eine «Akademie», ein Internat, in dem die Zöglinge in Reiten, Fechten und anderen Fertigkeiten unterwiesen wurden, die für eine militärische Karriere erforderlich waren. Für den Sechzehnjährigen bedeutete der Umgang mit Gleichaltrigen das Erlebnis einer bislang unbekannten Freiheit, die er umso mehr auskosten konnte, als er dem Leiter dieser Akademie nicht den Brief des Vaters aushändigte, mit dem dieser zu unnachsichtiger Strenge gegen seinen Zögling angehalten wurde. Das berichtet er im «Journal de ma vie», das er acht Jahre später zu Papier brachte und in dem er freimütig Auskunft gab über die damaligen Streiche und harmlosen jugendlichen Ausschweifungen. «Ein wacher und unternehmungslustiger Provinzler ist bald der Herr auf dem Pariser Pflaster, und ich machte mich zum Chef einer Truppe belangloser junger Leute.»[17] Diesem ausgelassenen Treiben machte im Dezember 1731 eine Pockeninfektion ein Ende, die ihn nötigte, sich in Isolation wie ein «Pestkranker» unter erheblichen Kosten in einem Zimmer fern der Akademie pflegen zu lassen.
Kaum wiederhergestellt, verkündete er zwar, allen Ausschweifungen entsagen zu wollen. Der Vorsatz war indes wohlfeil, denn ihm folgt das Eingeständnis, dass sein ohnehin schon leerer Beutel durch die Bestreitung der Krankheitskosten vollends erschöpft sei, «und mein Vater stellte sich allen Forderungen gegenüber so taub, dass ich gar nicht erst wagte, sie zu wiederholen.»[18] Wie der weiteren Erzählung zu entnehmen ist, änderte aber auch diese Not nichts an der Fortsetzung der Vergnügungen, die schließlich in der Liebe zum schönen Geschlecht ihren Höhepunkt fanden. Die Angebetete des Marquis war eine junge Schauspielerin namens Dangeville, der er auf recht tölpelhafte Weise den Hof machte: Tagelang umschlich er das Haus, in dem die Angebetete lebte. Schließlich erregte er damit die Aufmerksamkeit einer Magd, der er sich mit derart glühenden Worten eröffnete, dass diese ihre Herrin in Kenntnis setzte, die, neugierig geworden, ihm ein Stelldichein vorschlug. «Ich war hingerissen, allein ich musste zittern, als ich auf sie wartete.»[19]
Hier bricht das Manuskript jäh ab, weil der Marquis in späteren Jahren zur Schere griff, um den Bericht über diese erste erotische Eskapade zu zensieren. Wie diese ausging, verrät jedoch ein späterer Eintrag: «Mein Freund Saconay tröstete mich in der Verzweiflung über den Schmerz, als ich mich von meiner Geliebten trennen musste. Mein Vater bestand unnachsichtig auf seinem Befehl, und am 13. Juni 1732 brach ich nach vielen Tränen und Treueschwüren auf. Dessen ungeachtet heiratete sie schon sechs Monate später den Baron de C…, dessen beträchtliches Vermögen sie durchbrachte.»[20] Im Regiment war eine Kompanie frei geworden, die der Marquis auf Geheiß des Alten sofort übernehmen sollte, um damit den Fuß auf die erste Sprosse der militärischen Karriereleiter zu setzen, auf der er über kurz oder lang zum Chef des Regiments aufsteigen würde.
Das war das den Angehörigen des Schwertadels geläufige Karrieremuster, das aber im 18. Jahrhundert nicht mehr so reibungslos wie früher funktionierte, weil das Regime des Absolutismus immer mehr von Nepotismus und Klientelismus überwuchert wurde. Diese Erfahrung musste auch der Marquis machen, sobald er am 19. Dezember 1735 wieder in Paris war. «Ich hatte mich hier nur während meines Besuchs der Akademie aufgehalten; jetzt hatte ich das Empfinden, dass mein Aufenthalt eine völlig andere Bewandtnis habe. Ich sollte mich nur in der guten Gesellschaft bewegen, in Versailles [i. e. bei Hofe] vorgestellt werden, hier mein Verlangen [i. e. Chef eines Regiments zu werden] äußern und jeglichen Umgang mit jungen Leuten meiden. Ich erkannte also deutlich, was zu tun sei, allein nicht, wie ich es machen sollte.»[21]
Der Vater hatte sich nur mit guten Ratschlägen beschieden, seinem Sohn aber nicht verraten, wie diese in die Praxis umzusetzen seien. Also kam der auf den Einfall, sich an einen Onkel zu wenden, der Kammerherr des Duc de Maine war, ihm aber die ersehnte Hilfe verweigerte. «Mein Onkel beschied mich unmissverständlich, dass Paris nicht der Ort sei, an dem man seinen Neffen bei Hofe einführt.» Man müsse sich einfach nur vordrängen und sein Glück versuchen.[22] So vorzugehen widerstrebte ihm zwar, aber im Januar 1736 überwand er sich und ging nach Versailles. Hier traf er auf einen Oberstleutnant seines Regiments, der ihn mit dem Kammerdiener des Kardinal de Fleury, des Premierministers Louis’ XV, bekannt machte, welcher es aber entschieden ablehnte, sich trotz der ihm offerierten 10.000 Livres für den Wunsch des Marquis nach einem Regiment einzusetzen.
Nachdem er mit diesem ersten Versuch gescheitert war, kehrte er erst einmal nach Paris zurück. Auf einem Maskenball in der Oper entlarvte sich der Marquis als rechter Provinztölpel, dem die Pariser Etikette unbekannt war. Das muss dem Onkel zu Ohren gekommen sein, der sich nun dazu aufraffte, den Neffen in Versailles einzuführen, ihn zunächst dem Kardinal de Fleury, danach auch dem Justiz- und dem Kriegsminister vorzustellen und ihm schließlich auch eine Audienz beim König, der Königin und dem Dauphin zu erwirken. Danach sollte es wieder nach Paris zurückgehen, aber der Marquis verweigerte sich dem und blieb lieber in Versailles mit der einleuchtenden Begründung, dass es für ihn wesentlich billiger sei, hier zu leben, zumal ihm für die eine Mahlzeit, mit der er sich pro Tag begnügte, nichts abverlangt wurde. Damit reihte er sich in die Schar jener Bittsteller ein, die tagein, tagaus in den Vorzimmern des Königs und des Kardinals herumlungerten und vergebens darauf lauerten, die Aufmerksamkeit auf sich und ihr Begehren zu lenken. «Wenigstens fünfmal am Tag war ich zugegen, wenn der Kardinal sein Amtszimmer verließ. (…) Jeden Abend wohnte ich dem traurigen Geschehen bei, wenn der Kardinal um neun Uhr zu Bett ging, und ich mich erst danach zurückzog.»[23]
Es war wieder der Onkel, der ihm Geld gab, seine Schulden zu bezahlen. Davon blieb ihm noch etwas, als er nach Paris zurückkehrte, wo er sich tagsüber nur von einer Tasse Kaffee und einem Croissant ernährte. Mit diesem Hungerleiden war es vorbei, sobald ihm der Vater einen Wechsel von 2000 Livres für seinen Unterhalt zukommen ließ, von denen er sich auch einen Lakaien und einen Laufburschen für Besorgungen leistete, die von ihm in aufwendige Livreen gesteckt wurden.
Victor de Riqueti, Marquis de Mirabeau
Unverrichteter Dinge, was den Erwerb eines Regiments anbetraf, aber von Kopf bis Fuß aufwendig herausgeputzt und begleitet von Diener, Lakai und Laufburschen, reiste der Herr Marquis in der Postkutsche Ende Mai 1736 wieder zu seinem Regiment. Mit der Schilderung eines Duells mit einem Regimentskameraden bricht der Journal de Jeunesse im Juni 1736 abrupt ab. Ein Jahr später starb der strenge Vater Jean-Antoine. Victor Riquetti Marquis de Mirabeau wurde damit zum Chef der Familie. Im Alter von 21 Jahren verfügte er über ein Jahreseinkommen von 16.000 Livres, eine Summe, von der sich gut leben ließ, auch wenn er davon aufgelaufene Schulden in unbekannter Höhe begleichen musste. Vor allem aber war er von nun an sein eigener Herr.
Welche Pläne er hegte, das offenbart der rege Briefwechsel, den der Marquis in den nächsten vier Jahren mit dem gleichaltrigen Moralisten Vauvenargues führte: Den Marquis plagten literarische Ambitionen. Außerdem war er stets ein eifriger Leser gewesen, eine Beschäftigung, die seine «scribomanie» förderte. Die Korrespondenz mit Vauvenargues, der damals noch nichts von dem veröffentlicht hatte, was seinen Ruhm begründete, war für den Marquis eine literarische Übung, zumal er die großen literarischen Fähigkeiten seines Briefpartners erkannt hatte und diesen wiederholt dazu ermunterte, ein großes Werk zu schreiben.
Auch wenn Vauvenargues sich den Anschein gab, die Anerkennung seines literarischen Talents zu ignorieren,[24] ließ der Marquis nicht locker, zumal ihm zu Beginn ihres Briefwechsels Hoffnungen auf literarischen Ruhm gemacht wurden: «Mein Name und Ihre Briefe werden gemeinsam veröffentlicht werden; auf diese Weise werden sich Vermögen und Ruhm einstellen», schrieb ihm Vauvenargues am 5. September 1737.[25] Eine derart schmeichlerische Prognose nahm der Marquis durchaus ernst und vergalt sie in gleicher Münze: «Aber welche höchst angenehme Karriere eröffnen Ihnen nicht Ihre Talente in dem Bereich, den man die République des lettres nennt! Wenn Sie nur ein Einsehen hätten, wie viel höchst unterschiedliches Vergnügen uns eine gut begründete Anerkennung in diesem Bereich verschaffte!»[26]
Zunächst bestimmte den Ehrgeiz des Marquis aber noch ganz das Vorbild des Vaters, weshalb er vor allem darauf brannte, sich durch kriegerischen Ruhm einen Namen zu machen. Das teilte er Vauvenargues in demselben Brief mit, in dem er ihn auch wissen ließ, dass er mit einem zweiten Versuch, sich in Versailles um ein Regiment zu bewerben, gescheitert sei. Stattdessen sei sein Freund Crillon damit erfolgreich gewesen, obwohl der sechs Jahre Armeedienst weniger geleistet habe als er.[27] Wie groß seine Enttäuschung war, zeigt sein Brief an Vauvenargues vom 30. April 1738: «Der Ehrgeiz verzehrt mich auf ganz eigenartige Weise: Es sind weder Ehren, nach denen ich giere, noch Geld oder Wohltaten, sondern ein Name, um endlich jemanden vorzustellen. Um das zu erreichen, braucht es aber einen Posten. Diese Art von Ehrgeiz hat mich verschiedene Optionen erwägen lassen, einschließlich der in der augenblicklichen Lage verlockenden, mich für ein Regiment in ausländischen Diensten zu entscheiden, von dem ich wüsste, wie ich es bekäme.»[28]
Das blieben aber nur Gedankenspielereien. Stattdessen blieb er bei seinem Regiment, das nach Bordeaux verlegt wurde. Neben einem freundschaftlichen Umgang, den er dort mit Montesquieu pflegte, tat er sich als eifriger Schürzenjäger hervor, der es auf nicht weniger als sechs Affären brachte. Schon die Zahl verrät, dass er diese Liebeshändel nicht allzu ernst nahm. Dem entsprach auch das vorläufige Resümee, das er Vauvenargues im Oktober 1739 mitteilte: «Ich hatte mein Debüt mit einer wahrhaftigen Leidenschaft, darauf folgten verschiedene Liebschaften, und ich schließe jetzt mit einer Liebe, die, wie ich mir ausmale, mein ganzes Leben andauern wird.»[29] Dieser, seiner vermeintlich letzten großen Liebe, so erfährt man aus diesem Brief ebenfalls, habe er noch das Geleit bis zur französischen Grenze gegeben, um dann nie wieder etwas von ihr zu hören.
Alle diese Ausschweifungen endeten im Katzenjammer: «Die Wollust, mein lieber Freund, wurde der Henker meiner Phantasie, und ich werde sehr teuer für meine Narrheiten und die Verkommenheit der Sitten bezahlen müssen, die mir zur zweiten Natur geworden sind.»[30] Anlass dieser Einsicht war ein erneuter Fehlschlag, endlich Regimentsinhaber zu werden. Mit vagen Aussichten hatte sich der Marquis im Januar 1740 in Versailles eingefunden, um wieder leer auszugehen, weil man einem Dreizehnjährigen den Vorzug gab, ein Affront, der ihn dazu veranlasste, den Dienst zu quittieren.[31] Der Entschluss blieb zunächst noch ohne Konsequenz, denn er nahm 1742 für einige Monate am Feldzug in Bayern teil, von dem er im Dezember nach Paris zurückkehrte, um einen allerletzten Versuch zu unternehmen, ein Regiment zu erhalten, der ebenfalls scheiterte. «Jetzt», so schrieb er, «hielt ich mich an das, was ich vorbereitet hatte, um mit allen Ehren aus dem Metier meiner Väter auszuscheiden.»[32] Dieser Schritt wurde am 7. März 1743 vollzogen.
Der Marquis erwies sich als ein glühender Verteidiger der alten Familientradition. Vor allem jedoch war er auf das Ziel fixiert, die Mirabeaus vom Odium ihrer provinziellen Herkunft zu befreien und ihnen einen Namen von nationaler Bedeutung zu verschaffen. Dieser Ehrgeiz war beim Marquis mit ausgeprägter Selbstgerechtigkeit verknüpft, die Vauvenargues wiederholt geißelte: «Es will mir scheinen, dass die Härte und die Strenge Männern welchen Standes auch immer, nicht zupasskommen, denn es ist ein erbärmlicher Stolz, sich selbst ohne Fehler zu bedünken, und es ist ein wahrlich hassenswerter Makel, zugleich fehlerhaft und von unnachsichtiger Strenge zu sein. (…) Ein Mann ohne Leidenschaften und ohne allen Charakter lässt mich gleichgültig; aber der harte und unnachsichtige Mann, der aus einem Guss ist, vollgestopft mit strengen Maximen, trunken von seiner Tugend, der Sklave überkommener Ideen, die er nie reflektiert hat, der Feind jeglicher Freiheit, einen solchen Mann meide ich, den verachte ich.»[33]
Vauvenargues entwarf damit das Charakterbild des Marquis de Mirabeau. Die Eigenschaften, die den Moralisten daran abstießen, würden sich unter den Wechselfällen des Lebens nur noch weiter ausbilden und verfestigen. Darunter zu leiden hatte dessen ganze Familie, insbesondere aber der älteste Sohn, der Stammhalter und Träger des Namens Mirabeau, dem endgültig das gelingen sollte, wonach der Vater zeit seines Lebens gestrebt hatte. Zunächst jedoch, nachdem er der Karriere beim Militär endgültig entsagt hatte, galt es einen Lebensentwurf zu realisieren, der im Einklang mit seinem Naturell und seinen Ambitionen stand. Zwar versicherte er Vauvenargues noch im Oktober 1739, dass er keinerlei Vorliebe für Paris empfinde, weil diese Stadt ihn bislang nur enttäuscht habe,[34] aber kaum drei Monate später lässt er ihn schon wissen, dass er sich dort ein Haus gekauft habe, dessen Möblierung ihn ruiniere.[35]
Das war erst ein Anfang, denn am 13. März 1740 überraschte er Vauvenargues mit der Mitteilung: «Ich habe auch ein Stück Land zwanzig Meilen von Paris entfernt gekauft; ein schönes Gemäuer, liebreizende Einsamkeit, im August in unmittelbarer Nähe zu einem Gewässer, im Dezember sitzt man im Trockenen; in der Stadt große Salons, auf dem Land kleine Gemächer, verlässliche Freunde, im Blickpunkt der Öffentlichkeit, voilà, mein Leben.»[36]
Was der Marquis spürbar gut gelaunt und stolz auf die Entscheidungen, die seinem weiteren Leben die Bahn wiesen, dem Freund mitteilte, markierte den Beginn einer Katastrophe, die immer wieder abzuwenden er bis an sein Ende beschäftigt sein sollte. Das Haus in Paris, für dessen Erwerb er 30.000 livres bezahlte, war eine Bruchbude, «un cadavre de maison», wie er selbst sagte, in die er in den nächsten Jahren über 70.000 livres stecken musste. Schließlich verkaufte er dieses Anwesen mit einem empfindlichen Verlust, um sich ein wesentlich kleineres, dafür aber sofort bewohnbares Pariser Heim zu erwerben.[37] Ähnlich viel Geschäftssinn bewies er auch beim Kauf des Landsitzes von Bignon, für den er 112.000 livres bewilligte, obwohl sich die gesamte Liegenschaft nach seinem eigenen Urteil im Zustand völligen Verfalls befand.[38] Deren Instandsetzung dauerte Jahre und verschlang alle Einnahmen, die ihm daraus zuflossen. Mit anderen Worten: Dank dieser unüberlegten Erwerbungen hatte er binnen kürzester Zeit die Einkünfte aus seinem Erbe erheblich geschmälert und sah sich genötigt, mit jährlichen Nettoeinnahmen von nur rund 6000 livres auszukommen.
Dieser Betrag war zu gering, um in Paris standesgemäß zu leben und dem Namen Mirabeau den gehörigen Eklat zu verschaffen. Um dieser Verlegenheit rasch zu entrinnen, verfiel er auf den Ausweg einer Ehe mit einer reichen Frau, den auch viele seiner Standesgenossen in ähnlicher Notlage einschlugen. Was dem Marquis die Spekulation unwiderstehlich machte, die er mit seiner Heirat der am 3. Dezember 1725 geborenen Marie Geneviève de Vassan verknüpfte, war, dass sie als einzige Nachfahrin einer recht begüterten Familie im Limousin mit einer üppigen Erbschaft rechnen konnte. Zwar beschränkte sich dieses Vermögen nur auf umfangreichen Landbesitz, der aber über 30.000 livres jährlich an Erträgen abwarf, eine Summe, die sich bei umsichtigerer Bewirtschaftung sicherlich steigern ließe. Das war die langfristige Verlockung; eine andere, die sich wesentlich schneller auszahlte, würde die üppige Mitgift sein, die von der Braut in die Ehe eingebracht werden würde. Mlle. de Vassan war also eine Messe wert.
Diese Aussicht verblendete den Marquis de Mirabeau derart, dass er alle Warnungen ignorierte. Der künftige Schwiegervater, der Brigadier de Vassan, den der Marquis seit Jahren kannte und von dem er keine hohe Meinung hatte, erwies sich als rechter Knicker, denn als Mitgift für seine einzige Tochter wollte er sich nur zu einer Rente von 4000 livres jährlich verpflichten. Dieser bescheidene Betrag sollte ihr aber nicht in barem Gelde angewiesen werden. Vielmehr handelte es sich dabei um Erträge von einem Gut, die ihr zugesprochen werden sollten. Außerdem wartete de Vassan mit der Eröffnung auf, dass er mit seiner Frau nicht in Gütergemeinschaft lebe, die sich folglich das Recht vorbehalte, nach Belieben über den größten Teil ihres Vermögens zu verfügen. Das alles waren Voraussetzungen, so möchte man meinen, die den Marquis hätten veranlassen müssen, sich den Gedanken an diese Ehe aus dem Kopf zu schlagen. Doch er unterzeichnete am 11. April 1743 den von einem Notar aufgesetzten Ehevertrag.
Was ihn an dieser Verbindung blendete, war die Aussicht, in den Besitz schöner Domänen in den westlichen Provinzen Frankreichs, im Limousin, Périgord und Poitou zu gelangen. Zusammen mit den Liegenschaften in der Provence eröffneten ihm diese die Chance, zum Zirkel der ersten Familien in Frankreich aufzuschließen. Diese Vorstellung hatte ihn so sehr in ihren Bann geschlagen, dass keine gegenteiligen Erfahrungen sie zerstören konnten, wie er sie jetzt in rascher Folge machen musste. Unmittelbar nach Unterzeichnung des Ehevertrags reiste er zum Schloss seiner Braut im Limousin. Selbst der sehr nachteilige Eindruck, den seine Schwiegermutter auf ihn machte, hinderte ihn nicht daran, die Ehe am 21. April 1743 zu schließen. Die zweite große Enttäuschung folgte auf dem Fuße, als das junge Paar das Landgut besuchte, das erst nach beträchtlichen Investitionen die bescheidene Mitgift abzuwerfen versprach.[39]
Alle diese Widrigkeiten beförderten nur den Wahn, die Mirabeaus durch Landbesitz zu einer bedeutenden Familie Frankreichs zu machen. 1752 kaufte er dem Duc de Rohan für 450.000 livres die Duché de Roquelaure in der Gascogne ab, die 13 Kirchspiele, 23 Pachthöfe sowie Wiesen und Wälder umfasste. Wie üblich schloss er den Handel, ohne das Herzogtum zuvor inspiziert zu haben. Umso größer war die Enttäuschung, als er feststellen musste, dass der Besitz längst nicht so prächtig war, wie ihn der Verkäufer geschildert hatte. Nach acht Jahren verkaufte er das Herzogtum mit Verlust an die Krone. Ähnlich erfolglos erwiesen sich auch andere Geschäfte des Marquis wie beispielsweise die Spekulation mit einem Bleibergwerk. Beim Tod des Schwiegervaters 1756 war zwar eine kleine Erbschaft angefallen, und auch die Mitgift seiner Frau ließ sich endlich realisieren, aber mit diesem Geld mussten umgehend diverse Schulden getilgt werden.
Der Ehrgeiz des Marquis zwang ihn dazu, in einer wirtschaftlich prekären Situation zu leben. Seine Lage wurde vollends verzweifelt, als sich die Hoffnung zerschlug, durch das Erbe seiner Frau endlich in den Besitz eines Kapitals zu gelangen, das ihm Luft zu verschaffen versprach. In der Erwartung auf diesen Gewinn hatte er jahrelang klaglos eine Ehe geführt, über die er erst, nachdem sich seine Frau 1762 von ihm getrennt hatte, das harte Urteil fällte: «Die zwanzig Jahre, die ich mit ihr zusammenlebte, waren eine zwanzig Jahre dauernde Nierenkolik.»[40] Dazu steht offenbar nicht im Widerspruch, dass sie ihm elf Kinder gebar, von denen sechs in jungen Jahren starben.
Tatsächlich waren es die Zuwendungen des Bruders, von denen der Marquis in den letzten zehn Jahren vor seinem Tod seine Existenz fristete, wie die Bilanz seines Einkommens zeigt, die er 1779 unter dem Titel «Mon état, tant à charge qu’à décharge, en l’année 1779» aufstellte. Darin beziffert er seine jährlichen Einnahmen aus Grundrenten auf 85.000 livres. Dem standen Kredite und Wechsel in einer Summe von 678.740 livres gegenüber, für die aufs Jahr berechnet Zinsen in Höhe von 51.648 livres zu zahlen waren. Demnach blieb ihm noch ein verfügbares Einkommen von 29.000 livres, das seine Frau für sich beanspruchte und mit der von ihr eingereichten Scheidungsklage auch erstritt.[41]
Die Qualen, die ihm die eine seiner Manien verschaffte, konnte der Marquis durch die Erfolge, die er mit seiner «scribomanie» erzielte und die seinen Geltungsdrang befriedigten, wenigstens vor sich selber kompensieren. Das gelang ihm umso leichter, als die eine mit der anderen Manie aufs Engste verschränkt war, wie das in seinem Nachlass befindliche Manuskript mit dem anspruchsvollen Titel «Testament politique» zeigt, in dem der 32-jährige Verfasser seinen Nachkommen die Grundsätze erläutert, nach denen er sein Haus verwaltet hatte.
Das stark entwickelte aristokratische Selbstgefühl des Marquis schlägt sich in dieser Schrift nieder in einer entschiedenen Opposition gegen den barocken Verwaltungsstaat des Ancien Régime. Er kritisierte dessen zentralisierende und monopolisierende Tendenz der Gewaltausübung, die den politischen Einfluss des Adels immer mehr aushöhlte und gleichzeitig dessen ständische Vorrechte als bloßen Popanz unangetastet ließ. Konkret zielte das vor allem darauf, die Steuerprivilegien des Adels wie dessen Befugnisse in der Gerichtsbarkeit oder die gutsherrlichen Einnahmen gegen die Begehrlichkeiten des Staates zu verteidigen. Dies, so gibt er aber auch zu bedenken, würde umso besser gelingen, wenn sich der Adel der Pflichten besänne, die er gegenüber seinen Vasallen und Untertanen habe.
Das Hauptmotiv seines «Testament politique» entfaltete der Marquis in seiner ersten anonym publizierten Abhandlung «l’Utilité des Etats provinciaux», die 1750 erschien. Die aus Vertretern der drei Stände, Klerus, Adel und Dritter Stand, gebildeten Ständeversammlungen in den einzelnen Provinzen beschrieb er als ein wirksames Mittel gegen die unheilvoll voranschreitende Zentralisierung. Wegen der ständischen Zusammensetzung der Vertretungskörperschaften in den jeweiligen Provinzen hätte der Monarch keine Ursache, um seine Autorität zu fürchten; im Gegenteil, er zöge nur Nutzen daraus. Dies gelte umso mehr, wenn seine Untertanen nach den unwandelbaren Gesetzen der Billigkeit regiert würden. Steuern etwa, die diese Ständeversammlungen erheben, hätten dann die Geltung freiwilliger Gaben, die bereitwillig geleistet würden.
Ständeversammlungen mit Steuerbewilligungsbefugnis gab es Mitte des 18. Jahrhunderts aber nur noch in einigen wenigen Provinzen, den sog. Pays d’états, während sie in den Pays d’élection bereits verschwunden waren. In diesen wurde die jährlich zu leistende Steuerlast vom Provinzgouverneur, dem Intendanten, als Pauschalbetrag festgesetzt, den dessen Steuerbeamte auf die einzelnen Gemeinden und Bürger umlegten, ein Verfahren, das jeglicher Form von Willkür bei der Festlegung der Steuerschuld Tür und Tor öffnete.[42] Der Marquis de Mirabeau erhob deshalb in seiner Denkschrift die Forderung, überall in Frankreich wieder Versammlungen der Provinzstände einzuführen, die ein wesentlich gerechteres Steuersystem gewährleisteten, das die Zustimmung der Untertanen fände und dessen Erträge jenes andere Verfahren der Besteuerung in den Pays d’élection weit übertreffe.
Die Überlegungen des Marquis besaßen eine geradezu revolutionäre Sprengkraft, die nicht nur der frühere Außenminister Louis’ XV, René Louis de Voyer d’Argenson, bemerkte, der sie Montesquieu zuschrieb und der in seinem Tagebuch am 9. Juli 1750 notierte: «Das ist nur das erste einer ganzen Reihe solcher Bücher, die erscheinen werden und die frei zirkulieren zu lassen sehr gefährlich ist, denn sie wecken in den Untertanen Begehrlichkeiten, die man ihnen verweigert und um deren Vorteile man sie mit einer unerträglich anmutenden Ungerechtigkeit bringt.»[43] D’Argenson hatte eine sehr zutreffende Witterung, denn das vom Marquis de Mirabeau aufgeworfene Thema war bis zum Beginn der Französischen Revolution eines der Hauptthemen der politischen Debatten.
Ein weiteres, wesentlich umfangreicheres Buch, das der Marquis de Mirabeau 1757 unter seinem Namen und mit dem etwas rätselhaften Titel «l’Ami des hommes ou traité de la population» veröffentlichte, machte ihn zu einem berühmten Mann. Thema dieses Buchs war nicht eine Institution, die es zu reformieren gelte, sondern der Staat insgesamt. Den Staat vergleicht der Marquis mit einem Baum; die Wurzeln, aus denen er seine Nahrung zieht, sind die Landwirtschaft, der Stamm die Bevölkerung, die Zweige die Industrie, also Manufaktur und Handwerk, während die Blätter schließlich Handel und Künste symbolisieren. Doch die Wurzeln seien krank, weshalb der Baum abzusterben drohe. Das sei nur abzuwenden, wenn man die Landwirtschaft nach besten Kräften fördere. Das gelte insbesondere für die bäuerlichen Schichten, deren Existenz in Frankreich durch mancherlei Lasten, Fronden und Abgaben nachhaltig bedroht sei. Besonders grotesk erschien es dem Marquis, dass die Arbeit des Landmanns geradezu verachtet werde, denn seine Erzeugnisse wurden durch Binnenzölle in ihrer Zirkulation behindert und verteuert.
Damit ist das Stichwort für den Angriff auf die herrschende Volkswirtschaftslehre des Merkantilismus gefallen. Die bloße Geldmenge sei nicht mit nationalem Reichtum gleichzusetzen, Gold und Silber ins Land zu locken bedeute keineswegs, auch dessen Wohlstand zu mehren. Vielmehr gelte es, den Handel zu liberalisieren, ihn von Vorschriften, Inspektionen und Deklarationen zu befreien. Vollends beseitigt werden müssten die Schutzzölle zwischen den Ländern, zumal nur die allgemeine Handelsfreiheit Aussicht böte, künftige Kriege von vorneherein zu bannen. Schließlich sieht er auch das Kolonialwesen sehr kritisch, denn in den überseeischen Besitzungen würden die Franzosen nur zu Wilden, diese aber nicht zu Franzosen werden.[44]
Die Vorschläge muten auf den ersten Blick geradezu revolutionär an, was sie aber keineswegs sind: Die ständische Gliederung wie die sie bestimmenden Privilegien sollen weiterhin Bestand haben. Die Stände gelten geradezu als Garantie für die gesellschaftliche Ordnung, die in den «Sitten» verwurzelt ist, die in Haus und Familie gepflegt werden. Wenn sie verfallen, geht auch der Staat seinem Ruin entgegen. Entscheidend seien deshalb die guten Beispiele, die zu geben vor allem der Adel des Landes verpflichtet wäre. Am besten erfülle er diese Aufgabe durch patriarchalisches Schalten und Walten auf dem Familiensitz in der Provinz in sicherer Distanz zu dem verführerischen Treiben am Hof zu Versailles oder dem verschwenderischen Luxus von Paris, dem ein «kräftiger Aderlass» zu Gunsten der Provinz zugedacht wird.
Dieses weitschweifige, mit Redensarten und bisweilen krausen Wortschöpfungen gespickte Buch, das in den ersten vier Jahren wenigstens vier Auflagen erlebte, machte seinen Verfasser weit über die Grenzen Frankreichs hinaus bekannt.
Für einige wenige Jahre sah sich der Marquis mit Lob und Anerkennung förmlich überschüttet. 1786, drei Jahre vor seinem Tod, erinnerte er sich in einem Brief an einen seiner italienischen Verehrer mit von Ironie gemischter Wehmut an diese längst vergangene Glanzzeit: «Die Pariser Begeisterung, die allenthalben das Beispiel gibt, schlug mir mit einer Heftigkeit entgegen, wie sie sich nur hier und in anderen großen von Gaffern bevölkerten Städten manifestiert, äußerte sich in Aufläufen, in der Nachfrage nach Kopien meines Porträts, das damals im Salon gezeigt wurde und das man in allen Sitzungssälen der Pays d’états, die mich einbürgerten, aufhängte, stiftete dazu an, 12 sous für die Stühle in der Messe zu zahlen, die ich besuchte, meinen Töchtern, die noch Kinder waren, die Ehe vorzuschlagen, mich um Rat anzugehen, zu Diners einzuladen, veranlasste Frauen dazu, mir nachzustellen, und was weiß ich noch alles.»[45]
Der vielleicht schönste, jedenfalls folgenreichste Triumph des Marquis war, dass François Quesnay, der Leibarzt von Madame Pompadour, auf ihn aufmerksam wurde und ihn zu einer Unterredung einlud. Dieses Gespräch, das der Marquis ausführlich in einem Brief an Jean-Jacques Rousseau schilderte,[46] machte ihn zu einem Apostel der physiokratischen Lehre, deren bislang erfolgloser Künder Quesnay war, der sich ebenso wie der Ami des hommes gegen die herrschende Doktrin des Merkantilismus wandte und stattdessen die Landwirtschaft zu fördern suchte. Das waren die zwei Punkte, in denen beide übereinstimmten. In dem Gespräch, das der Marquis mit Quesnay führte, überzeugte dieser Mirabeau davon, «den Pflug vor die Ochsen gespannt» zu haben. Quesnay meinte damit, dass nach Mirabeau allein die Bevölkerungszahl die Quelle des Nationalreichtums ausmache, während es sich seiner Meinung nach genau umgekehrt verhalte, also die Anzahl der Einwohner von der Höhe des Nationalvermögens abhänge, das er allein als den «produit net», also den Ertrag der landwirtschaftlichen Produktion nach Abzug aller Kosten definierte.
Wie sehr den Marquis dieses neue Evangelium überzeugte, zeigt sein vergeblicher Versuch, auch Rousseau zur Lehre der Physiokratie zu bekehren, die er ihm mit den Worten schmackhaft zu machen suchte: «Alles physische und moralische Wohl der Gesellschaft lässt sich in einer Hinsicht bündeln: Steigerung des Reinertrags. Jeder Angriff auf die Gesellschaft wird durch die Tatsache determiniert: Verminderung des Reinertrags. Auf den beiden Schalen dieser Waage kann man die Gesetze, Sitten, Gebräuche, Laster und Tugenden abwägen.»[47]
Dieses Dogma des Reinertrags lief in der Konsequenz auf einen Frontalangriff auf den Ancien Régime hinaus. Die ganze Härte der Last an direkten Steuern musste fast ausschließlich der Dritte Stand tragen; vor allem für die Ärmeren noch weitaus drückender waren jedoch die indirekten Steuern auf Salz und Getränke, die Grenz- und Binnenzölle sowie die Mautzahlungen, die von Steuerpächtern umso rücksichtsloser eingetrieben wurden, als deren Ertrag über ihren Gewinn entschied. Nach Ansicht der Physiokraten sollte sich aber künftig das gesamte Steueraufkommen aus einer einzigen Quelle speisen: aus dem Reinertrag, dem «produit net», der in der Landwirtschaft erwirtschaftet wurde. Eine Grundertragssteuer als einzige Einnahme des Staates hätte angesichts der im Ancien Régime geltenden Steuerprivilegien jedoch einen derart hohen Steuersatz notwendig gemacht, dass der Ruin der kleinbäuerlichen Massen die unvermeidliche Folge gewesen wäre. Diese Einsicht nötigte dazu, im Interesse eines möglichst hohen Steuerertrags bei noch verträglichen Steuertarifen die Abschaffung aller Steuerprivilegien von Adel und Klerus ins Auge zu fassen.
Auf Drängen Quesnays veröffentlichte der Marquis de Mirabeau 1760 ein weiteres Buch, mit dem der Versuch unternommen wurde, das Steuerwesen nach den Vorstellungen der Physiokraten zu reformieren. Der Zeitpunkt zur Veröffentlichung der «Théorie de l’impôt», wie der Titel des neuen Werks lautete, war geschickt gewählt, denn Frankreich war in Aufruhr wegen neuer Steuern, die von der Krone zur Finanzierung des ruinösen Siebenjährigen Kriegs gefordert wurden und die Parlements sich weigerten zu registrieren.[48] Außerdem stand eine Erneuerung der jeweils für eine Laufzeit von sechs Jahren abgeschlossenen Verträge mit den Steuerpächtern an. Kurz, Thema wie Inhalt des neuen Buchs würden auf breites Interesse stoßen, das auch nicht enttäuscht werden sollte, denn neben seiner bereits bekannten Forderung, die Erhebung und Aufteilung der Steuern in ganz Frankreich den Provinzialständen anzuvertrauen, machte er sich für die Grundertragssteuer stark, die durch eine allgemeine Kopfsteuer ergänzt werden sollte. Abgesehen vom Octroi, den städtischen Warensteuern, sollten alle weiteren Konsum- und Verbrauchssteuern wie insbesondere die verhasste Gabelle, die Salzsteuer, fortfallen. Zum Weiteren sah er die Einführung einer schrankenlosen Freiheit des Handels vor und, was bei den davon betroffenen reichen Finanziers auf besondere Empörung stoßen musste, die Beseitigung des Steuerpachtunwesens.
Das war ein Gedanke, der den Steuerpächtern zuwider sein musste, die keine Mühe hatten, beim König einen Lettre de cachet durchzusetzen, den ketzerischen Marquis in Vincennes bei Paris einzusperren. Mit Rücksicht auf die große Popularität Mirabeaus war diese Strafmaßnahme auf die lediglich symbolische Dauer von einer Woche befristet und endete am 24. Dezember 1760. Weitaus ungemütlicher für ihn war deshalb, dass sich an diese Entlassung eine Verbannung auf seinen Landsitz Bignon anschloss, der in der kalten Jahreszeit ein denkbar unwirtlicher Wohnort war. Er wusste diesem erzwungenen Exil zwar rasch ein Ende zu setzen, was ihn aber nicht daran hinderte, sich als «Märtyrer des öffentlichen Wohls» aufzuspielen, wie sein Sohn spottete.[49]
Der Spott, den der Sohn unermüdlich über den Vater in Briefen und Flugschriften ausgoss, war fortan die Begleitmusik für dessen unaufhaltsamen Absturz aus den Höhen des Ruhmes. Diese Wende kam für ihn umso überraschender, als mit der Ernennung Turgots zum Finanzminister 1774, der sich anschickte, viele der vom Marquis entwickelten Reformvorstellungen zu verwirklichen, seine Saat aufzugehen schien. Um diese Erwartung war es aber bereits im Mai 1776 mit dem Sturz Turgots und der Liquidierung aller begonnenen Reformen geschehen. Nicht genug dieses Unglücks, überwältigte den Marquis de Mirabeau jetzt auch die häusliche Misere, die in einem virulenten Familienzerwürfnis und einem sich hinziehenden Scheidungsprozess mit der von ihm getrennt lebenden Frau bestand. Das wie seine notorischen finanziellen Bedrängnisse vergällten ihm seine letzten Lebensjahre. Vor allem aber musste ihn schmerzen, dass die Öffentlichkeit jetzt das Urteil des Sohnes längst teilte, der in einem öffentlichen Brief vom 15. Dezember 1776 über ihn geschrieben hatte: «Wegen dieses Prozesses [i. e. den langwierigen Rechtsstreit mit seiner Frau] ist der Öffentlichkeit allgemein bekannt, dass der Ami des hommes ein solcher weder für seine Frau noch für seine Kinder je war.»[50]
Zweites Kapitel
Ein ungeliebter Stammhalter
Am 9. März 1749 wurde dem Marquis de Mirabeau in Bignon ein fünftes Kind geboren. Es war eine schwere Geburt, denn der Kopf des Neugeborenen war ungewöhnlich groß. Gabriel-Honoré war der zweite Sprössling männlichen Geschlechts. Gleichwohl fiel ihm die Rolle des Stammhalters zu, weil der am 16. März 1744 geborene Victor-Charles-François 18 Monate zuvor an den Folgen einer Vergiftung gestorben war; er hatte im Haus des manischen Vielschreibers ein Tintenfass ausgetrunken.
Aus der frühen Kindheit Mirabeaus ist zu berichten, dass er mit drei Jahren an den Blattern erkrankte. Die Narben, die zurückblieben, entstellten sein Gesicht dauerhaft. Daran hat er sein Leben lang schwer getragen,[1] zumal die Blatternnarben Folgen hatten, die sein weiteres Schicksal beeinflussten. So rühmten sich die Riquettis, ein Geschlecht gutaussehender Männer zu sein. Wegen des von Blatternnarben verunstalteten Gesichts konnte Mirabeau diesem Ideal nicht entsprechen. Das war eine Ursache der Abneigung, die sein Vater gegen ihn hegte und die unter den Jahren stetig größer wurde, bis sie in Entzweiung und Feindschaft von Vater und Sohn einmündete. Die Saat dieses Zerwürfnisses ging schon in der Kindheit Mirabeaus auf. Das zeigen gelegentliche briefliche Äußerungen. Am 9. Oktober 1754 etwa schrieb der Marquis dem Bailli: «Dein Neffe ist so hässlich wie der von Satan.»[2]
Es waren aber nicht nur die Blatternnarben, die den Vater verstörten. Das Kind hatte für ihn auch eine große Ähnlichkeit mit dem verachteten Schwiegervater, weshalb der Marquis behauptete, es sei dessen vollkommene «portraicture».[3] Schließlich nährte der Heranwachsende den Verdacht, er schlüge dem jüngsten Bruder, dem «schwarzen Schaf» der Familie, nach. Davon abgesehen liegen die ersten 15 Lebensjahre des Stammhalters im Dunklen, denn im regen Briefwechsel des Marquis mit dem Bailli wird der Neffe nur selten erwähnt.[4] Der Vater war mit seiner Schriftstellerei beschäftigt und schenkte dem Sohn auch deshalb wenig Aufmerksamkeit, weil dessen Erziehung einem M. Poisson anvertraut wurde, der ein Verwalter der Güter war.
Diese Erziehungspraxis war nicht ungewöhnlich. Der Nachwuchs sollte in der Furcht vor Strafe und nicht im Erlebnis von Zuneigung groß werden. Das fasste der Marquis in die Maxime, es sei nicht ratsam, wenn die Väter Kameraden ihrer Söhne seien. Die Zugewandtheit des Vaters ebenso wie der Glanz im Auge der Mutter sind für ein Kind grundlegende Erlebnisse. Beide musste Mirabeau vermissen. Das würde böse Folgen haben, wie der Baron Carl Heinrich von Gleichen erkannte. Gleichen hatte sich in Bayreuth mit Louis-Alexandre de Mirabeau angefreundet und verkehrte häufiger in dessen Haus. «Wenn M. Mirabeau sich als ein schlechter Vater und Ehegatte präsentierte», schrieb er in seinen Erinnerungen, «muss man auch einräumen, dass er eine Frau hatte, die mit ihrem Betragen über die Stränge schlug, und einen ältesten Sohn, den man vor dem Schafott bewahren musste. Die despotische, erniedrigende und hasserfüllte Art und Weise, mit der dieser Sohn in seinem Vaterhaus behandelt und jeglicher Zuversicht beraubt wurde, nur weil er hässlich war und sich durch die ihm verhängten Strafen nicht zähmen ließ, erstickte in ihm das Ehrgefühl und den Ehrgeiz, die sich auf dem Grund seiner tapferen Seele finden lassen müssen, verstärkte die Wildheit seiner Leidenschaften und schärfte seinen Verstand, der sich von dem seiner Eltern nicht nur unterschied, sondern diesem auch überlegen war. Ich habe ihnen wiederholt gesagt, dass sie aus ihm einen großen Schurken statt einen bedeutenden Mann machten. Er wurde dann das eine wie das andere.»[5]
Das Urteil wird durch den Mémoire bestätigt, den Mirabeau für den Vater Ende des Jahres 1777 aufschrieb. «Ich könnte von mir sagen», heißt es darin, «dass ich von meiner Kindheit, von meinen ersten Schritten in dieser Welt an, nur wenige Zeichen Ihres Wohlwollens empfangen habe; Sie behandelten mich schon mit Strenge, bevor ich diese rechtfertigte; Sie hätten deshalb schon sehr früh erkennen müssen, dass dies meine natürliche Leidenschaft anfachte, statt sie zu zügeln; dass es gleichermaßen einfach gewesen wäre, mich zu mäßigen oder mich zu verwirren; dass der erste Weg mich ans Ziel, der zweite aber mich von ihm abbrachte; dass ich nicht geboren war, um als ein Sklave behandelt zu werden.»[6]
Mit 15 Jahren wurde Mirabeau unter dem Pseudonym eines M. de Pierre-Buffière, dem Namen eines Besitzes in der Nähe von Limoges, der den Schwiegereltern gehörte, im Februar 1764 in die Obhut eines neuen Erziehers in Versailles gegeben. Dieses Erziehungsexil währte kaum drei Monate. Danach bezog Pierre-Buffière Ende Juni 1764 das Pariser Internat eines Abbé Choquart. Den drei Jahren, die er sich hier aufhielt, verdankte Mirabeau im Wesentlichen seine Kenntnisse der alten und neuen Sprachen, von Zeichnen und Musik. Außerdem wurden Fechten, Reiten, Schwimmen und Tanzen gelehrt. Der Aufenthalt in diesem Internat, in dem er sich unter Gleichaltrigen bewegte, war der wahrscheinlich glücklichste Abschnitt in der Jugend Mirabeaus. Kaum 18 Jahre alt geworden, wurde er nach dem Vorbild von Vater und Großvater ins Militär gesteckt. Der Marquis bestimmte dafür ein Kavallerieregiment, das in Saintes an der Charente stationiert war. In der Kleinstadt traf Mirabeau im Juli 1767 ein. Das Regiment war mit Bedacht gewählt, denn dessen Chef, ein Oberst de Lambert, war ein Anhänger der Physiokratie und damit in gewisser Weise ein Schüler des Ami des hommes.
Zunächst schien alles zur Zufriedenheit des Vaters zu verlaufen, der sich im April 1768 an Kriegsminister Choiseul wandte, dem Sohn eine Offiziersstelle zu geben. Kaum drei Monate später erhielt der Marquis vom Regimentschef die Nachricht, sein Sohn, der frischgebackene sous-lieutenant, sei von seiner Einheit und aus Saintes verschwunden, nachdem er beim Spiel 80 louis an Schulden gemacht habe. Diese Nachricht, so schrieb der Vater seinem Bruder, dem Bailli, habe ihn nicht sonderlich aufgeregt. «Ganz im Gegenteil war ich beinahe beruhigt, dass er sich einer Eskapade schuldig gemacht hatte, wie sie so ähnlich auch anderen unterlaufen könnte.»[7] Diese milde Reaktion des Marquis überrascht. Erinnerte er sich der eigenen Schulden, die er in diesem Alter machte? Oder hatte er bei seinem Sohn mit Schlimmerem gerechnet? Um die anfängliche Gelassenheit des Alten war es jedoch geschehen, sobald er von einem Freund, dem Duc de Nivernois, an den sich der Sohn mit der Bitte um Vermittlung beim Vater gewandt hatte, erfuhr, dass dieser sich in Paris aufhielte. Dem Schreiben, das der Sohn an den Duc gerichtet hatte, war andeutungsweise zu entnehmen, dass er mit seinem Vorgesetzten, Oberst de Lambert, in einen gravierenden Konflikt geraten sei, dessen Austragung größtes Aufsehen erregen würde, weshalb er die Flucht vorgezogen habe.
Was diese Andeutungen besagen, ist nicht zweifelsfrei zu ergründen. Eine Vermutung ist, der erst 26jährige Oberst de Lambert und der sous-lieutenant Mirabeau seien Rivalen um die Gunst einer Schönen gewesen. Eine andere ist, de Lambert habe ihm ins Gewissen geredet, weil er im Sturm der Gefühle ein Eheversprechen abgelegt habe, dessen Vollzug nach den geltenden Standesregeln als gravierender Fehltritt angesehen worden wäre. Dafür spricht auch die Reaktion des Vaters, der bei Minister Choiseul einen Lettre de cachet für Pierre-Buffière erwirkte, der dessen sofortige Arretierung und unbefristete Inhaftierung in der Festung auf der Île de Rhé vor La Rochelle befahl. Das war eine drastische, aber auch sehr wirksame Maßnahme, um den Stammhalter wie dessen Familie vor einer Schande zu bewahren, in die sie sich durch den jüngsten Bruder des Marquis schon einmal gestürzt sah.[8]
Die Haft, von der nicht die Rede sein konnte, denn Pierre-Buffière konnte sich auf der Insel und sogar in dem gegenüber auf dem Festland gelegenen La Rochelle frei bewegen,[9] währte ein halbes Jahr. Die Freiheit verstand er auf seine Weise zu nutzen, wie einem Brief des Marquis an den Bailli vom 10. April 1769 zu entnehmen ist: Der Sohn hätte für seine Eskapaden in den letzten acht Monaten mehr als zehntausend livres ausgegeben, die er zusammengeliehen habe.[10] Das war für den Vater Anlass genug, die Verbannung des Sohnes aufheben zu lassen, zumal sich eine weit wirksamere Disziplinarmaßnahme anzubieten schien. In Korsika, das die Republik Genua an Frankreich abgetreten hatte, waren Aufstände ausgebrochen. Um diese niederzuwerfen, wurde im Frühjahr eine französische Armee aufgestellt, zu der auch die neu gebildete Légion de Lorraine gehörte. Mirabeau schloss sich dieser Einheit an, die Ende April 1769 in Toulon nach Korsika eingeschifft wurde. Der Feldzug war eine militärische Promenade, auf der Mirabeau kaum an Kampfhandlungen teilnahm und die schon im Mai endete. Umso größer war jetzt Mirabeaus Gefallen am Kriegshandwerk. «Ich bin durch und durch», so ließ er seine Schwester, Madame de Saillant, noch elf Jahre später im September 1780 wissen, «ein Mann des Kriegs, denn nur dann bin ich gelassen, ruhig, freudig erregt ohne alle Übertreibung und fühle, an Statur zu wachsen».[11] Auch wenn der Ausflug nach Korsika seine einzige kriegerische Erfahrung blieb und er danach das Militär quittierte, gab er sich gern den Anschein, als sei das seine wahre Berufung.[12]
Das Jahr, das Mirabeau auf Korsika verbrachte, nutzte er dazu, die Insel zu erkunden. Seine Beobachtungen inspirierten ihn, eine Geschichte der Korsen während der letzten vierzig Jahre zu schreiben, mit der er die «Verbrechen» der Genuesen anprangern wollte. Das Manuskript, so schreibt er im Vorwort zum Essai sur le despotisme, sei ihm von seinem Vater abgenommen worden. Ohne Zweifel habe es vor Fehlern gestrotzt, hätte sich aber dennoch ausgezeichnet durch «Lebhaftigkeit, Wahrheit, Gedanken und Fakten».[13]
Als Mirabeau alias Pierre-Buffière wieder nach Frankreich zurückkehrte, erfuhr er, dass sein Onkel, der Bailli, sich in Aix-en-Provence aufhielt. Sofort fasste er sich ein Herz, diesen zu überrumpeln. Das gelang ihm umso besser, als der Onkel den Neffen nur vom Hörensagen kannte, wie der Bericht des Bailli von dieser ersten Begegnung an den Bruder vom 15. Mai 1770 zeigt: «Gestern Abend, lieber Bruder, wurde ich völlig überrascht. Ein Soldat überbrachte mir eine Nachricht von M. de Pierre-Buffière, der mich um einen Besuch bat. Ich antwortete ihm, dass er kommen solle. Ich war entzückt, ihn zu sehen. Ich weiß nicht, ob ich, wie man sagt, eine Leber als Herz habe, aber das meinige schwoll an, als ich ihn sah. Ich fand ihn hässlich, auch wenn er keine abstoßende Physiognomie hat, und er besitzt hinter den Pockennarben und den Zügen, die sich sehr verändert haben, ganz das Air des armen toten Comte [i. e. Louis-Alexandre de Mirabeau] in seiner Haltung, seinen Gesten, seinem Ausdruck etc. Wenn er nicht schlimmer als Nero ist, wird er besser als Marc Aurel sein, denn ich bin mir sicher, zuvor noch nie einer solchen Intelligenz begegnet zu sein. Mein armer Kopf war davon wie betäubt.»[14]
Nach dieser handstreichartigen Eroberung des Onkels sollte Mirabeau in ihm seinen besten Verbündeten und eifrigen Fürsprecher haben.
Dem Bailli bereitete es Vergnügen, mit dem Neffen Umgang zu haben: «Ich wiederhole es Dir gegenüber», schrieb er dem Marquis am 21. Mai, «entweder ist er der ausgebuffteste persifleur der ganzen Welt, oder er wird der Mann in Europa sein, der am besten geeignet ist, Papst, Minister, General oder Admiral, Kanzler oder vielleicht auch Landwirt zu werden. Mit zweiundzwanzig Jahren warst Du schon etwas, aber noch nicht einmal die Hälfte. (…) Auf unserem Spaziergang heute Morgen las er mir das Vorwort einer Geschichte Korsikas vor, von der er sagte, dass sie nur die letzten vierzig Jahre behandele, in der er aber auch eine Zusammenfassung der Vorgeschichte dieser Epoche geben wird. Ich versichere Dich, dass Du mit zweiundzwanzig das so gut nicht hinbekommen hättest, während ich mit vierzig noch nicht einmal den hundertsten Teil davon geschafft hätte.»[15]
Mirabeau hielt sich nur für drei Tage in Aix-en-Provence auf, ehe er wieder zu seinem Regiment reiste.
Im darauffolgenden August machte er sich auf Einladung des Vaters auf den Weg nach Aigueperse im Limousin, wo sich der Marquis auf einem Besitz aus dem Erbe seiner Frau aufhielt. Nachdem er den Onkel erobert hatte, musste Mirabeau nun auch den misstrauischen Vater davon überzeugen, ein würdiger Stammhalter und Träger des Namens zu sein. Der Aufenthalt in Aigueperse war ein Exerzitium, das der Vater mit einer ausführlichen Moralpredigt begann, auf die der Sohn replizierte. Die Eindrücke, die der Alte vom Sohn gewann, hat er in einem Brief an den Bruder resümiert: «Was zum Teufel fängt man an mit diesem sanguinischen Überschwang? Welches Terrain ist ausgedehnt genug für ihn? Mir ist niemand außer der Kaiserin von Russland geläufig, für die dieser Mann für eine Ehe geeignet wäre.»[16] Damit kündigte sich an, dass auch der Vater sich von den Fähigkeiten des Sohnes überzeugen ließ und die bislang gehegten Vorurteile ablegte. Das Wohlwollen währte zwei Jahre, in denen der Sohn zum ersten Mal in seinem Leben das Vertrauen des Alten genoss. Den Umschwung hatte der Bailli vorhergesehen, weshalb er sich dem Marquis mit dem Rat nahte, den Sohn als Vermittler in dem zunehmend erbitterter werdenden Streit mit der Mutter einzusetzen.[17]