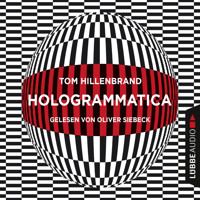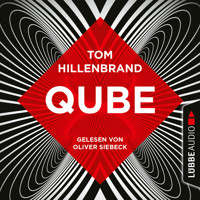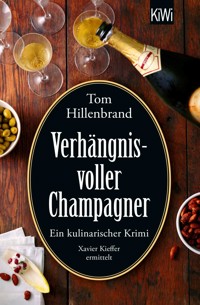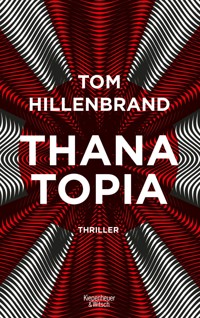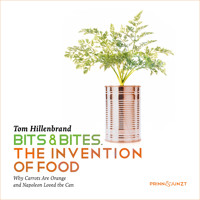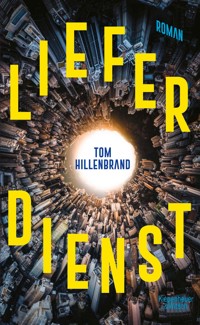9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Xavier-Kieffer-Krimis
- Sprache: Deutsch
»Xavier Kieffer ist der beste Kochtopf-Detektiv der Geschichte.« Die Welt Frankreichs legendärer Gastroführer »Guide Gabin« lädt zu einem rauschenden Fest in seinem neuen Firmenmuseum in Paris, und der Luxemburger Koch Xavier Kieffer ist mittendrin. Während der Feier verschwindet eines der Exponate – die extrem seltene Ausgabe des »Guide Bleu« von 1939, von der nur wenige Exemplare existieren. Kieffer beginnt, Nachforschungen anzustellen. Bald erfährt er, dass wegen der Sternebibel bereits mehrere Menschen sterben mussten. Aber was ist so gefährlich an einem über siebzig Jahre alten Restaurantführer? Was ist das Geheimnis des blauen Buchs? »Diese kulinarischen Krimis sind so gut, dass es schwerfällt, lange auf Nachschlag zu warten.« Radiolounge
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Tom Hillenbrand
Gefährliche Empfehlungen
Ein kulinarischer Krimi Xavier Kieffer ermittelt
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Tom Hillenbrand
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Tom Hillenbrand
Tom Hillenbrand, geboren 1972, studierte Europapolitik, volontierte an der Holtzbrinck-Journalistenschule und war Ressortleiter bei SPIEGEL ONLINE. Seine Sachbücher und Romane haben sich bereits Hunderttausende Male verkauft, sind in mehrere Sprachen übersetzt und standen auf der SPIEGEL-Bestseller- sowie der ZEIT-Bestenliste. Für »Drohnenland« wurde er u.a. mit dem Friedrich-Glauser-Preis für den besten Kriminalroman des Jahres ausgezeichnet.
www.tomhillenbrand.de
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Frankreichs legendärer Gastroführer »Guide Gabin« lädt zu einem rauschenden Fest in seinem neuen Firmenmuseum in Paris. Eingeladen ist auch der Luxemburger Koch Xavier Kieffer. Während der Feier verschwindet eines der Exponate – die extrem seltene Ausgabe des »Guide Bleu« von 1939, von der nur noch wenige Exemplare existieren. Kieffer beginnt Nachforschungen anzustellen. Bald stößt er auf eine Leiche. Ermordet wegen eines Buchs? Was ist so gefährlich an einem über siebzig Jahre alten Restaurantführer? Seine Recherchen führen ihn tief in die Geschichte Frankreichs und in die der französischen Küche. Und plötzlich gerät der Koch selbst in Gefahr …
»Unglaublich spannend und süffig – wie ein Glas französischer Champagner« Saarländischer Rundfunk
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2017, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © Masterfile/Royaltyfree; Buch: © Stefan Balk – Fotolia.com
ISBN978-3-462-31598-1
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
Epilog
Glossar: Küchenlatein
Dank
Leseprobe »Verhängnisvoller Champagner«
Für Maphi
1
Er bildete sich ein, den Pulverdampf zu riechen, dessen beißend-säuerliches Aroma auf der Zunge zu schmecken. Doch das war nur seine überbordende Fantasie. Die Front lag viel zu weit weg, als dass man sie hätte erschnuppern können. Nur hören konnte man den Krieg. Captain John Fisher vernahm das ferne Wummern der Panzergeschütze. Anfangs war er bei jedem Knall zusammengezuckt, inzwischen waren die Granaten und Kanonen für ihn nur noch Hintergrundgeräusche. Genauso wenig, wie ihn der Morgenverkehr auf dem Ocean Parkway beim Schreiben seiner Theatermonologe gestört hatte, hinderte ihn der Krach, den die Nazis ein paar Kilometer weiter östlich veranstalteten, am Codieren.
Fisher erhob sich von dem Feldbett, auf dem er bis eben liegend die Armeezeitung »The Stars and Stripes« gelesen hatte, und ging zur offen stehenden Vordertür der Nissenhütte. Draußen dämmerte es bereits. Vor den Baracken waren mehrere Jeeps geparkt, ein paar Soldaten schlenderten vorbei, vermutlich auf dem Weg zum Abendessen. Auch Fishers Magen knurrte, aber das mit dem Dinner würde warten müssen. Er richtete seinen Blick nach oben. Der Himmel über ihm war ein einziges Dunkelblau, nur ein verirrtes Schäfchen von einer Wolke zog vorbei. Es würde eine sternenklare Nacht werden. Fisher fragte sich, ob das Wetter drüben im Reich ebenso gut war. Falls ja, würde dies den alliierten Bomberpiloten heute Nacht die Arbeit erleichtern. Der Captain musterte das Flakgeschütz auf einem der Wachtürme. Der blaue Himmel war theoretisch auch für General Pattons Third Army gefährlich. Nach allem, was er wusste, war die deutsche Luftwaffe jedoch nicht mehr zu Angriffen in der Lage. Fisher war seit acht Wochen in Frankreich. Während dieser Zeit hatte er nicht einen einzigen deutschen Jäger gesehen. Er seufzte leise. Hitler waren nur die Panzer geblieben. Davon hatte »der Führer« allerdings verdammt viele, weswegen sie weitaus langsamer vorankamen, als es die Salonstrategen in Washington geplant hatten.
Er schloss das Barackentor und legte den Riegel vor. Bei dem, was er als Nächstes zu tun hatte, konnte er keine Zuschauer gebrauchen. Fisher ging zu einem der Tische, an dem die Funker tagsüber ihre Arbeit verrichteten. Sein Vater stammte aus Hamburg und seine Mutter aus Belgien, weswegen der Captain hervorragend Deutsch und Französisch sprach. Diese Kenntnisse waren derzeit äußerst gefragt, weshalb man Jonathan Fisher zum Chef der Fernmeldeeinheit gemacht hatte. Dabei war er von Haus aus Dramaturg und technisch völlig unbewandert. Bereits zu Hause eine Sicherung auszuwechseln, brachte ihn normalerweise an seine Grenzen. Ein Beobachter hätte sich deshalb fragen können, ob ein mittelmäßig erfolgreicher Theatermann aus Brooklyn eine gute Wahl für solch einen Job war. Aber Fragen stellen war bei der Army nicht sonderlich gern gesehen. Und so wusste nur der Divisionskommandeur der 26th Infantry Division, Major General Paul, dass Fisher in Wahrheit gar nicht für die Army arbeitete. Sondern für jemanden in Washington D.C.
Der Offizier setzte sich und schaute auf seine Armbanduhr. In gut fünf Minuten ging es los. Rasch schaltete Fisher den kleinen Empfänger ein, der vor ihm auf dem Tisch stand. Als die Röhren warm wurden, stieg ihm ein süßlicher Duft in die Nase, der Geruch von Bakelit. Er holte Block und Bleistift aus der Schublade und legte sie vor sich hin.
Aus dem Radio erklang Musik, irgendein Chanson, das er nicht kannte. Mit ihm saßen in diesem Moment Millionen Franzosen vor den Empfängern und hörten ebenfalls Radio Londres. Der französischsprachige Sender der BBC versorgte das besetzte Frankreich mit leichter Musik und neuesten Nachrichten – vor allem mit Meldungen über den Kriegsverlauf, die der verhasste, von den Nazis kontrollierte Propagandasender Radio Paris totschwieg oder völlig verzerrt wiedergab. Fisher musste grinsen. Radio Paris berichtete immer noch, General Rommel werde die Alliierten binnen Tagen zurück ins Meer treiben – dabei standen sie schon fast vor Paris.
Das Chanson ging zu Ende, es ertönte dissonantes Klaviergeklimper. Dazu sang ein Mann nach der Melodie von »La Cucaracha«: »Radio Paris lügt, Radio Paris lügt – Radio Paris ist nämlich deutsch! Radio Paris lügt, Radio Paris lügt – Radio Paris ist nämlich deutsch!«
Erneut schaute Fisher auf die Uhr. Zurzeit lief das Unterhaltungsprogramm, das mit Satiren und Witzen über die Nazis gespickt war. Erst um neun begann seine Sendung. Er nutzte die verbleibende Zeit, um seine noch auf dem Feldbett liegende Tasche zu holen und sie neben den Tisch zu stellen. Ihren Inhalt würde er gleich benötigen, zumindest hoffte er das. Es war bereits der dritte Abend, an dem er hier saß, bisher jedoch, ohne die gewünschte Nachricht erhalten zu haben. Hoffentlich war nichts schiefgegangen. Im Krieg ging ja andauernd etwas schief. Fisher atmete tief durch. Man musste Geduld haben. Das hatten sie ihm während der Ausbildung immer wieder eingebleut. Aber Geduld war nicht gerade Fishers Stärke.
»Wissen Sie, was passiert ist?«, quäkte eine Stimme aus dem Radio.
»Nein, was denn?«, fragte eine andere.
»Gestern um neun Uhr zwanzig hat ein Jude einen deutschen Soldaten getötet, ihm die Brust aufgeschnitten und sein Herz gegessen.«
»Das ist unmöglich.«
»Wieso?«
»Erstens haben die Deutschen kein Herz. Zweitens essen Juden kein Schweinefleisch. Und drittens hören um diese Zeit alle in Frankreich die BBC.«
Lacher wurden eingespielt. Fisher lachte nicht. Er kannte den Witz bereits. Vier Paukenschläge folgten, drei hohe und ein tiefer, der Morsecode für V wie Victory. Der Army-Captain richtete sich auf. Es ging los.
»Hier London«, sagte ein Sprecher. »Sie hören nun einige persönliche Nachrichten.«
Fisher verharrte mit dem Bleistift in der Hand, bereit, sich Notizen zu machen. Er wusste, dass irgendwo ein Nazifunker saß und es ihm gleichtat.
»In der Villa ist es still«, deklamierte der BBC-Sprecher.
»Der Hund des Gärtners weint.«
»Die Sternschnuppe kehrt zurück.«
Jeden Abend sendete Radio Londres solche kryptischen Botschaften. Dahinter verbargen sich Codes, mittels derer Charles de Gaulles Freie Französische Streitkräfte mit Résistance-Zellen in ganz Frankreich kommunizierten. Und hoffentlich war diesmal auch eine Nachricht für ihn dabei.
»Die Schöne folgt unmittelbar. Wir sagen: Die Schöne folgt unmittelbar.«
»Das Phantom ist nicht geschwätzig.«
»Der Krug geht nicht ins Wasser.«
Fisher vermutete, dass es viele Tage gab, an denen sich hinter den seltsamen Sätzen überhaupt nichts verbarg. Wahrscheinlich ging es nur darum, die Deutschen kirre zu machen, mit diesem ständigen Raunen aus dem Äther, mit diesen von einer tonlosen Geisterstimme aus dem Feindesland verkündeten, vermeintlichen Menetekeln.
»Der Abt ist nervös. Wir sagen: Der Abt ist nervös.«
»Die Bibliothek steht in Brand.«
»Die Keule ist gekocht.«
Fisher merkte, wie sich seine Nackenmuskeln anspannten. Der Hinweis auf etwas Gekochtes war das Signal, dass die nächste Nachricht ihm galt. Sein Bleistift flog über das Papier.
»Das Felskliff ist fünf Meter hoch.«
»Die fette Frau tanzt. Wir sagen: Die fette Frau tanzt.«
Der Sprecher redete weiter, doch Fisher hörte nicht mehr hin. Stattdessen blickte er auf den Satz, den er soeben niedergeschrieben hatte: »Das Felskliff ist fünf Meter hoch.«
Endlich besaß er den ersten Schlüssel. Fisher beugte sich vor und griff in die geöffnete Tasche zu seinen Füßen. Er holte ein Buch heraus und legte es vor sich auf den Tisch. Mit den Fingern strich er über den kobaltblauen Einband. Dann machte er sich an die Arbeit.
2
Xavier Kieffer betrachtete den Umschlag des Buches. Er bestand aus kobaltblauem Leder; in dicken schwarzen Lettern hatte man die Worte »Guide Gabin« aufgeprägt. Darunter war eine Cartoonfigur, ein kleiner, kugelrunder Kerl mit Schnauzbart zu sehen, auf dessen Kopf eine immense Kochmütze saß. Sie war fast so groß wie das Männchen. Das Gabin-Maskottchen »Georges, le p’tit chef« lächelte breit. Mit Daumen und Zeigefinger der zum Mund erhobenen, linken Hand formte der kleine Koch einen Kreis, in der rechten hielt er einen überdimensionierten Holzlöffel. Kieffer drehte das Buch etwas, um den Rücken begutachten zu können. »France« stand darauf, außerdem »1935«. Er stellte den Gastronomieführer zurück in ein Regal, das mit weiteren kobaltblauen Büchern gefüllt war. Als Nächstes griff er sich die Ausgabe von 1995 und blätterte bis zu den Einträgen für Paris. Mit dem Finger fuhr er die Liste entlang. Es waren Namen mit Klang. Namen, die Kieffer nur allzu gut kannte: »La Tour d’Or«, »Le Sarkomand«, »L’Appel de la Pieuvre«.
»Suchen Sie etwas Bestimmtes, Monsieur Kieffer?«
Der Koch blickte auf und schaute in das Gesicht von Marianne Crevet, der Pressesprecherin des Guide Gabin. Er lächelte.
»Ja, nein. Ich schwelge in Erinnerungen.« Er hob das Buch, damit sie den Rücken sehen konnte.
»1995 hat das ›La Houle‹ seinen zweiten Stern bekommen. Ich war damals der Souschef.«
Kieffer hatte den kurzen Eintrag nachlesen wollen, mit dem der Gabin das Restaurant seinerzeit geadelt hatte. Dabei kannte er die Passage auswendig, auch nach so vielen Jahren noch. Ihre Variante des Hummer Thermidor hatte der Guide empfohlen, außerdem den Crevettensalat und die Bisque. Als damals der Anruf aus der Avenue de Breteuil gekommen war, hatten sein Chef und er Walzer getanzt, mitten in der Küche. Kieffer erinnerte sich daran noch sehr genau. Mit einem unbedachten Hüftschwung hatte er eine Kasserolle heruntergerissen und sich mordsmäßig den Oberschenkel verbrüht. Das Dauergrinsen war nach der Sternvergabe trotzdem mehrere Tage lang in seinem Gesicht festgefroren gewesen.
Kieffer musterte Crevet. Die Pressedame war höchstens dreißig, und er konnte an ihrem Gesichtsausdruck erkennen, dass sie noch nie vom ›La Houle‹ gehört hatte. »Ein Fischrestaurant im Fünften, nahe dem Pantheon«, fügte er an. »Seit zehn Jahren geschlossen.«
»Ah.«
Es entstand eine Pause. Rasch setzte Crevet ihr Pressesprecherinnenlächeln auf und zeigte auf das Regal, dem Kieffer den Guide entnommen hatte. Insgesamt mussten es an die tausend blauer Bücher sein.
»Falls Sie noch ein paar legendäre Restaurants nachschauen möchten: Wir haben in dieser Bibliothek erstmals sämtliche Ausgaben des Guide Gabin versammelt, für alle Länder, ab dem jeweiligen Ersterscheinungsjahr.«
Crevet ging das Regal entlang. Kieffer folgte ihr. Sie befanden sich im Obergeschoss des neuen Maison Gabin auf der Avenue Kléber. Die Bibliothek war an den Wänden einer umlaufenden Galerie angebracht. Als Kieffer hinabblickte, sah er den großen Empfangssaal im Erdgeschoss. Dessen Boden war mit einem prächtigen Mosaik verziert, das griechische Götter und Helden beim Tafeln zeigte. Geometrische Muster schmückten die Wände, überall gab es Einlegearbeiten aus Marmor und Metall. Aber auch Blumenmotive konnte er erkennen. Die gusseisernen Geländer der Balustrade etwa waren Ranken und Blüten nachempfunden. Über allem schwebte ein Oberlicht aus Bleiglas. Das Haus war eines der extravagantesten Gebäude in Paris, halb Art déco, halb Jugendstil. Kieffer wollte gar nicht wissen, was die Renovierung gekostet hatte.
Crevet blieb vor einem Regalabschnitt mit besonders verwittert aussehenden Exemplaren stehen. Einige davon waren nicht frei zugänglich, sondern lagen in einer Vitrine. Sie sahen sehr alt aus. Kieffer dachte zunächst, Crevet werde die Vitrine öffnen, aber stattdessen zog sie ein Exemplar aus dem Regal und blätterte darin. »Schauen Sie hier, 1968. Das war das Jahr, in dem die legendären Gebrüder Troisgros ihren dritten Stern bekamen.«
Kieffer nickte und musterte die Bücher hinter der Glasscheibe. Der früheste Band datierte aus dem Jahr 1922. Allerdings wusste er, dass der erste Gabin bereits ein Jahr zuvor erschienen war, 1921.
»Es fehlen aber ein paar«, sagte er. »Der allererste. Und zwischen 1938 und 1945 ist eine Lücke. Wegen des Kriegs.«
»Ja, da ist der Guide nicht erschienen. Neununddreißig gibt es, ist aber extrem selten«, erwiderte Crevet.
»Ich sehe den nirgends. Ist der so selten, dass nicht mal der Gabin eine Ausgabe hat?«
»Wir mussten ihn leihen, in der Tat. Ebenso wie einige aus den Zwanzigerjahren. Das war nicht ganz einfach, aber Madame Gabin hat da wohl einen speziellen Kontakt.«
Kieffer wollte fragen, wer dieser Kontakt sei, sah jedoch an Crevets Gesichtsausdruck, dass er darauf keine brauchbare Antwort bekommen würde.
»Die fehlenden Bände sind noch nicht eingetroffen, aber morgen zur Eröffnung wird die Sammlung vollständig sein.« Sie schaute nervös. »Hoffentlich.«
Der Koch blickte hinab in den Saal, wo einige Messebauer dabei waren, eine Bühne zu errichten. Die Eröffnung der neuen Gabin-Repräsentanz versprach ein Megaevent zu werden. Sterneköche aus aller Welt hatten sich angekündigt, berühmte Gastrokritiker, diverse Filmstars und mindestens die halbe französische Regierung. Sogar der Präsident würde angeblich anwesend sein.
Verwunderlich war das nicht. Beim Guide Gabin handelte es sich schließlich um ein nationales Heiligtum. Der Gastroführer stand für Frankreichs Anspruch, immer noch das Zentrum der Haute Cuisine zu sein – und die letzte Instanz, wenn es darum ging, zu beurteilen, was gute Küche ausmachte.
Kieffer war der Ansicht, dass die Franzosen ihre Bedeutung auf diesem Gebiet inzwischen maßlos überschätzten, aber das behielt er an diesem Ort lieber für sich.
»Kommt der Präsident denn wirklich?«, fragte er Crevet.
»Wenn ich es wüsste, dürfte ich es nicht sagen, nicht einmal Ihnen. Sie wissen ja, wie das inzwischen ist.«
Während Crevet ihn anschaute, wandte sie den Blick unmerklich nach links. Er verstand, was sie meinte. Am anderen Ende der Balustrade standen zwei Männer in dunklen Anzügen, die weder zum Gabin noch zu den Eventleuten gehörten. Die Kerle waren vermutlich von der Polizei oder dem französischen Geheimdienst. Falls der Präsident wirklich kam, würde es auf der Party von Sicherheitskräften nur so wimmeln.
Kieffer war nicht gerade scharf auf die Veranstaltung. Diese Art von gastronomischem Zirkus war einer der Gründe, warum er der Sterneküche den Rücken gekehrt und ein kleines Spezialitätenrestaurant in seiner luxemburgischen Heimat eröffnet hatte. Aber diese Party zu schwänzen – so schnöselig sie auch sein mochte –, war keine Option. Er hatte es ihr schließlich versprochen.
Etwas riss ihn aus seinen Gedanken. Aus dem Erdgeschoss drang der Klang erregter Stimmen nach oben.
»Dazu haben Sie absolut kein Recht! Das geht entschieden zu weit.«
»Ich bedaure, Madame. Wir haben strikte Order …«
»Wir haben Ihnen doch schon weitreichende Zugeständnisse gemacht.«
Kieffer ging zur Balustrade und schaute hinab. In der Mitte des Saals standen zwei Herren in schwarzen Anzügen. Sie wirkten wie Klone der beiden Männer, auf die Crevet ihn hingewiesen hatte. Ihnen gegenüber stand eine Frau in verwaschenen Jeans und Chucks, auf dem Kopf eine Baseballkappe, die ein großes goldenes »G« zierte. Sie sah aus, als gehöre sie zu den Bühnentechnikern oder vielleicht zu den Caterern. Die Frau hatte die Hände in die Hüften gestemmt und funkelte die beiden Sicherheitsleute wütend an. Einer der Klone wich etwas zurück. Kieffer musste lächeln. Wenn Valérie Gabin in Rage geriet, musste man sich in Acht nehmen. Niemand wusste das besser als er. Trotzdem fand er, dass sie gerade in diesen Momenten besonders hinreißend aussah.
Er hatte keinen Zweifel daran, dass seine Freundin problemlos mit einem ganzen Bataillon französischer Geheimdienstler fertig würde. Dennoch ging er zügigen Schrittes zur Treppe. Als er die breiten Stufen hinabgestiegen war, fand er sich in heillosem Chaos wieder. Überall im Erdgeschoss standen Kisten, Bühnenelemente und Stühle herum, Monteure und Handwerker wuselten hin und her. In einer Art Slalomlauf bewegte sich der Koch auf die Streitenden zu. Ohne ein Wort zu sagen, postierte er sich einen halben Meter hinter Valérie.
»… Sie wollen Jean Soubec vorschreiben, wie er sein Essen zu servieren hat?«, fragte sie. »Jean Soubec? Einem Kommandeur der Ehrenlegion? Der Mann ist ja wohl über jeden Zweifel erhaben.«
Bevor ihr Gegenüber etwas erwidern konnte, schüttelte Valérie ungläubig den Kopf und fuhr fort. »Völlig absurd! Soubec ist übrigens ein guter Freund Ihres Chefs. Der Präsident ist der Patenonkel seines jüngsten Sohnes.«
Einer der beiden Sicherheitsleute, ein vielleicht vierzigjähriger Mann mit Kuhaugen und kantigem Kinn, erwiderte: »Madame Gabin, es geht ja nicht um Monsieur Soubec. Aber können Sie für die über fünfzig Köche bürgen, die er mitbringt?«
»Sie haben deren Namen seit acht Wochen. Ausreichend Zeit, ihre Backgroundchecks zu machen.«
»Natürlich. Aber damals gingen wir noch davon aus, dass nur einige Minister anwesend sein werden. Wenn der Präsident kommt, reden wir von einem völlig anderen Gefahrenpotenzial, von einer anderen Sicherheitsstufe mit anderen Protokollen. Deshalb kann das Menü in dieser Weise nicht genehmigt werden.«
Auf der morgigen Party würde es – das war bei einer Feier des Guide Gabin natürlich zwingend – allerlei Leckereien geben. Die Gäste bekamen Fingerfood und Kanapees serviert, die von fünf Küchenchefs zubereitet wurden, die im vergangenen Jahr alle mit dem dritten Stern geadelt worden waren. Kieffer konnte sich nicht erinnern, je auf einer Feier gewesen zu sein, wo Fünfzehn-Sterne-Schnittchen gereicht worden wären. Und dies war nur das Essen fürs Fußvolk. Später am Abend würde einigen handverlesenen Gästen in einem kleinen Salon im hinteren Teil des Gebäudes ein Mitternachtsdinner serviert, bestehend aus sieben Gängen, zubereitet von niemand anderem als dem Großen Soubec, dem berühmtesten Koch der Welt. Seit über fünfzig Jahren besaß sein Restaurant im Lyonnais drei Sterne. Er musste weit über achtzig sein und kam nur selten nach Paris. Dass er dort noch einmal kochte, war ein Jahrhundertereignis, zumindest für die eingefleischten Gourmets, die bei diesem Dinner zugegen sein würden. Was es geben würde, wusste niemand. Man munkelte jedoch, Soubec habe ein völlig neues Gericht kreiert, das den Namen des Präsidenten trage. In Kieffers Augen war das fürchterliche kulinarische Arschkriecherei. Insofern teilte er die Meinung des Sicherheitsmannes, dass die Abendveranstaltung eigentlich untragbar war – wenn auch aus völlig anderen Gründen.
»Wollt ihr Soubec jetzt vorschreiben, was er kochen darf, oder was?«, blaffte Valérie Gabin.
»Nein, Madame. Es geht um die Cloches.«
»Die Cloches?«, wiederholte Valérie. Sie schaute ihr Gegenüber verständnislos an.
Statt zu antworten, vollführte dieses eine Handbewegung, woraufhin sein Kompagnon einen Tabletcomputer hervorzog und darauf herumwischte. Kurz darauf reichte er ihn seinem Kollegen, der ihn wiederum Valérie hinhielt.
»Dies ist ein Grundriss des Erdgeschosses, mit allen Umbauten, die der Guide hat vornehmen lassen. Die Küche ist hier, das Überraschungsdinner jedoch dort, auf der anderen Seite.«
»Ja, und?«
»Laufweg«, murmelte Kieffer leise.
»Ganz recht«, erwiderte der Sicherheitsmann. »Da Sie die ehemaligen Dienstbotengänge entfernt haben, um mehr Platz zu schaffen, müssen die Kellner mit ihren Tabletts zwangsläufig durch den großen Saal, in dem zu diesem Zeitpunkt eine Menge Leute sein werden. Richtig?«
»Ja, ich denke schon«, erwiderte die Gabin-Chefin.
»Das an sich wäre noch nicht so schlimm. Uns ist jedoch zu Ohren gekommen, dass Monsieur Soubec alle Speisen mit Cloches zu servieren gedenkt.«
»Vermutlich. Geht ja auch kaum anders«, sagte Valérie Gabin.
»Und warum nicht?«, fragte das Eisenkinn.
Kieffer konnte sehen, dass Valérie alle Mühe hatte, nicht die Beherrschung zu verlieren.
»Erstens«, antwortete sie gepresst, »weil Jean Soubec, gemäß der Tradition klassischer französischer Küche, stets silberne Cloches über seine Teller stülpt. Zweitens, weil das Essen sonst auf dem langen Weg durch den Saal Schaden nimmt.«
»Schaden? Sie meinen, es wird kalt?«
»Das ist Sterneküche auf höchstem Niveau, Monsieur Perrache. Die Luft im Saal wird nicht gut sein. Leute schwitzen, Leute husten. Die Teller offen durch den Raum zu tragen, das geht nicht. Und dann« – Sie lächelte dünn – »wäre da noch ein weiterer Aspekt.«
Kieffer kannte dieses Lächeln und hielt die Luft an. Der Geheimdienstler schaute fragend.
»Es ist ein gottverdammtes Überraschungsmenü! Soubec wird alle Gänge selbst annoncieren, erst dann nehmen die Kellner die Hauben ab. Keine Cloches, kein menu surprise. Wollen Sie dem Präsidenten wirklich diesen kleinen Spaß nehmen?«
Das Eisenkinn machte eine Geste unaufrichtigen Bedauerns. »Das Risiko ist aus unserer Sicht zu hoch.«
Kieffer hatte sich eigentlich heraushalten wollen, aber nun brach es aus ihm heraus. »Glauben Sie im Ernst, dass jemand eine Handgranate unter eine der Cloches legt? Das ist doch …«
»… lächerlich? Keineswegs. Wissen Sie, Monsieur …«
»Kieffer.«
»Ah, ja, Sie sind der Lebensgefährte von Madame Gabin. Aus Luxemburg, richtig? Monsieur Kieffer, die Russen haben im Kalten Krieg sogar Teller aus Plastiksprengstoff entwickelt, mit eingebautem Drucksensor. Sahen aus wie Meißner, aber wenn man versuchte, sein Entrecôte zu schneiden, explodierte der Teller. Ihnen mag das alles weit hergeholt erscheinen, aber es ist mein Job, alle Eventualitäten zu beachten. Unter einer Cloche könnte man so ziemlich alles verstecken – Messer, Pistolen, und ja, auch Handgranaten. Jede Cloche ist deshalb ein Sicherheitsrisiko.«
Valérie schüttelte müde den Kopf. Kieffer lächelte. »Vielleicht sollte der französische Geheimdienst einfach die Kellner stellen. Dann wäre Soubecs kulinarischer Sprengstoff vom Pass bis zum Tisch in Ihrer Hand.«
Der Koch hatte es als Witz gemeint, aber der Geheimdienstler nickte langsam.
»Das wäre wohl die beste Lösung. Wenn Sie erlauben, Madame, werde ich das mit Monsieur Soubecs Chef de Service besprechen?«
»Tun Sie, was Sie nicht lassen können«, sagte Valérie. Die beiden Männer verabschiedeten sich und verschwanden zwischen zwei Bühnenaufbauten. Als sie fort waren, legte Kieffer den Arm um seine Freundin. Sie seufzte. »Ich wusste, dass das anstrengend wird – die Sterneköche, die Bühne, die Presse, das ganze Brimborium. Aber diese Jungs hatte ich nicht auf dem Schirm.«
Sie schaute ihn aus ihren großen grünen Augen an. »Ich habe Angst, dass die mir den ganzen Event versauen.«
»Das werden wir nicht zulassen«, antwortete Kieffer. Er zeigte auf die Balustrade mit den Büchern, auf den riesigen, glitzernden Kronleuchter über ihnen. »Das ist alles schön geworden, da kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Spätestens nach dem dritten Glas Champagner nimmt diese Geheimdienstfuzzis niemand mehr wahr.«
»Hoffentlich.« Sie senkte den Kopf. »Diese Leichtigkeit, die so was früher hatte …«
Kieffer wusste nicht, was er darauf antworten sollte. Gern hätte er Valérie widersprochen, aber er wusste, dass sie recht hatte. Immer noch waren überall in der Stadt Polizisten postiert.
»Musst du noch was machen, Val?«
Sie seufzte. »Tausend Sachen.«
»Es ist aber schon halb elf, und wenn ich das richtig sehe, gibst du morgen früh schon wieder Interviews für die geneigte Weltpresse. Du solltest jetzt Schluss machen.«
»Ich kann doch eh nicht schlafen«, antwortete sie.
»Deine Augenringe sagen was anderes«, erwiderte Kieffer.
Sie verzog die Mundwinkel. »Da ist er wieder, der berühmte Luxemburger Charme. Außerdem habe ich Hunger.«
»Wieder den ganzen Tag nichts gegessen? Die Caterer schleppen hier doch seit heute Morgen tonnenweise Zeug rein.«
Sie zuckte mit den Achseln. »Keine Zeit gehabt.«
»Komm, wir fahren heim. Und ich koch dir was.«
»Außer Kaffee hab ich nichts da.«
»Ich weiß. Wie immer, oder? Keine Sorge. Ich lass mir was einfallen.«
Sie verließen das Maison Gabin. Nachdem sie die Straße überquert hatten, blieben sie kurz stehen und schauten noch einmal zurück. Das Gebäude lag im Dunkeln, sämtliche Fenster waren verhängt. Erst morgen sollte das goldene »G« über dem Eingang angeschaltet werden, ebenso wie die restliche Beleuchtung. Dann würden die neonfarbenen Umrisse des kleinen, dicken Georges sowie seine überdimensionierte Toque, seine Kochmütze, weithin sichtbar sein. Die Cartoonfigur stammte noch aus den Zwanzigerjahren, Valéries Werbeagentur hatte sie unlängst wiederbelebt. Sie sollte dem altehrwürdigen Guide etwas Retro-Charme verleihen.
Kieffer musste zugeben, dass das Gabin-Gebäude recht originell war. Architektonisch handelte es sich innen wie außen um einen Mischmasch aus verschiedenen Stilen. In der einem Bogen nachempfundenen Front war ein riesiges Buntglasfenster eingelassen, das den kleinen Georges zeigte. Rechts und links davon erhoben sich fensterlose Türmchen, von denen lange blaue Banner herabhingen, auf denen in goldenen Lettern »LE GUIDE BLEU« stand.
»Was war da eigentlich früher drin?«, fragte er Valérie.
»Bis in die Sechziger eine Papierfabrik. Danach verschiedene Restaurants. Dann gehörte es einer finnischen Telekommunikationsfirma. Als die pleiteging, habe ich zugeschlagen.«
Die beiden liefen ein Stück, bis sie zu einem am Straßenrand abgestellten Sportwagen kamen. Sie stiegen ein und fuhren Richtung Saint-Germain, wo sich Valéries Wohnung befand. Die Straßen waren leer gefegt; kaum eine Viertelstunde später parkten sie in der Tiefgarage und stiegen hinauf ins Erdgeschoss. Valérie gähnte. »Und wo willst du jetzt noch Zutaten fürs Kochen auftreiben? Hat doch nichts mehr offen.«
»Ich hab Quellen, von denen du nichts weißt. Geh schon hoch – ich komme gleich nach.«
Er drückte Valérie einen Kuss auf den Mund und sah ihr einen Moment nach, als sie die Treppe hinaufstieg. Dann wandte er sich ab und lief durch den Flur des Hauses zum Vordereingang. Er musste sich dafür sehr dünn machen, denn neben mehreren Fahrrädern und Kinderwagen stand der Eingang voller Gerümpel: zwei lädierte Louis-quatorze-Stühle, ein knallgrünes Ikea-Regal, ein halb erblindeter Kristallspiegel. Fluchend manövrierte sich Kieffer zwischen dem Plunder hindurch und trat hinaus auf die Straße. Dann ging er in Richtung seines Cafés.
Valérie und er führten eine Fernbeziehung seit mehr als fünf Jahren. Deshalb war Kieffer sehr oft in Paris. Nicht immer behagte ihm das. Paris war großartig, aber der Koch hatte nicht allzu viel für Trubel und Überraschungen übrig. Zu Hause, in der Luxemburger Unterstadt, lief er jeden Morgen denselben Weg zur Arbeit, er aß stets in denselben Bistros, und wenn er in eine Kneipe ging, dann war es stets dieselbe, zwanzig Meter von seinem Haus entfernt. Er mochte diese Beständigkeit; er brauchte sie.
Auch in Paris hatte er sich deshalb einen Ort gesucht, an dem er den Trubel aussperren konnte, an dem sich nie etwas zu verändern schien. Der Laden hieß »Trois Léopards«. Er hatte die Bar eher zufällig entdeckt; sie lag etwas abseits des Boulevard Saint Germain in einer kleinen Seitengasse, die so heruntergekommen aussah, dass sich nur wenige Menschen dorthin verirrten – schon gar nicht die Touristen, die Paris täglich überschwemmten. Wenn Valérie während einem seiner Wochenendbesuche wieder einmal überraschend arbeiten musste, ging Kieffer hierher.
Als er sich dem »Léopards« näherte, konnte er sehen, dass die Jalousie heruntergezogen und die Außenbeleuchtung abgeschaltet war. Aber drinnen brannte noch Licht. Vermutlich hatte Pierre, der Besitzer, wieder einmal abgesperrt, damit seine Stammkundschaft nach Herzenslust gegen das Rauchverbot verstoßen konnte. Kieffer klopfte. Er sah, wie eine Lamelle der Jalousie einen Fingerbreit beiseitegeschoben wurde. Das Schloss klackte, und die Tür schwang auf.
Pierre Bouvet musterte ihn mit in die ausladenden Hüften gestemmten Armen. »So spät kommst du aber selten. Wusste gar nicht, dass du in der Gegend bist.«
Kieffer klopfte dem Barbesitzer freundschaftlich auf die Schulter. »Ich bleib auch nicht lange.«
»Mmmh. Das höre ich sehr oft. Rein mit dir, junger Mann.«
Das Innere des »Trois Léopards« war erwartungsgemäß mit dichtem blauem Tabaksqualm gefüllt. Kaum vermochte er die andere Seite des kleinen Raums zu erblicken, wobei es auch nicht viel zu sehen gegeben hätte. Die Einrichtung beschränkte sich auf das Allernotwendigste: ein Zinktresen, ein paar Stühle und Tische. An den weiß getünchten Wänden hingen nicht einmal die obligatorischen Emaille-Werbetafeln. Den einzigen Farbfleck steuerte eine rote Flagge mit drei gelben Leoparden bei, die über der Bar hing – Bouvet war Normanne und mächtig stolz darauf.
Im »Trois Léopards« verkehrten einfache Leute; das Publikum war auch an diesem Abend entsprechend: Taxifahrer, Handwerker, ein paar junge Männer in den Uniformen einer Fast-Food-Kette. Sie saßen vor ihrem Pastis oder Wein und starrten in die Ferne, zu müde für Konversation.
Da sich der Qualm, wie Kieffer aus Erfahrung wusste, nur ertragen ließ, wenn man mitrauchte, zog er eine Schachtel Ducal aus seiner Jackentasche und zündete sich eine an.
»Was trinkst du, junger Mann?«
»Nur ein kleines Glas Pouilly-Fumé.«
Nachdem der Barbesitzer ihm den Wein gebracht hatte, sagte Kieffer: »Kannst du mir mit ein paar Sachen aus deiner Küche aushelfen?«
Der dicke Wirt zuckte mit den Achseln. »Vielleicht. Viel habe ich nicht da, schon gar keine feinen Sachen, wie sie der Herr Sternekoch benutzt.«
»Ex-Sternekoch. Ich brauch nur ein paar einfache Dinge. Kann ich mal schauen, was du hast?«
Bouvet brummte Zustimmung und geleitete ihn in eine winzige Küche. Sie war mit Gerätschaften vollgestellt, der Fußraum betrug kaum einen Quadratmeter. Es war Kieffer schleierhaft, wie man hier kochen konnte. Andererseits gab es bei Pierre auch kaum etwas außer Croque Monsieur und Crêpes. Er schaute in den Kühlschrank. Der Wirt hatte nicht zu wenig versprochen. Die Auswahl war wirklich kärglich. Er fand ein paar Äpfel, die schon etwas runzelig waren, ferner Zwiebeln und Kartoffeln. Weitere Vorräte schien Pierre nicht zu besitzen. »Was ist in der großen Tupperbox da?«, fragte er.
»Choucroute garnie. Mittagstisch von gestern.«
Kieffer öffnete die Plastikdose. Sie war voller Sauerkraut, dazwischen lugten Stücke gepökelten Schweinefleisches hervor. Er überlegte einen Moment. In seinem Kopf begann sich ein Plan zu formen. Er griff sich die Box und stopfte sich ein paar Zwiebeln und Kartoffeln in die Pattentaschen seiner Lederjacke. Zu guter Letzt nahm er sich noch zwei der runzligen Äpfel. Pierre Bouvet musterte ihn skeptisch.
»Du musst wirklich sehr hungrig sein. Das ist doch alles Ausschuss. Hätte ich morgen eh weggeschmissen. Was willst du denn daraus kochen?«
Kieffer lächelte. »Ein Drei-Gänge-Menü.«
3
Xavier Kieffer betrat das Wohnzimmer und stellte den Teller vor Valérie ab. »Menu surprise luxembourgeoise, zweiter Gang.«
Auf dem Teller lag etwas, das ein wenig wie ein platt gedrückter Kartoffelknödel aussah, den man in der Pfanne angebraten hatte.
»Und was ist das?«
»Tierteg. Sauerkraut mit Kasslerstückchen, vermischt mit Kartoffelpüree und dann angebraten.«
Valérie musterte ihn. »Ist das wirklich eine Spezialität bei euch oder hast du dir das gerade ausgedacht?«
Er schaute sie mit einem Ausdruck gespielter Entrüstung an. »Würde ich Scherze machen, wenn es um die Luxemburger Küche geht?«
Er stellte den zweiten Teller an seinem Platz ab und schenkte ihr noch etwas Weißwein nach. Valérie schnitt ein Stück Tierteg ab und probierte.
»Und?«
»Schmeckt besser als es aussieht. Erinnert mich ein bisschen an dieses niederländische Gericht …«
»Stamppot.« Er nickte. »Möglicherweise haben die Luxemburger das Gericht von den Holländern geklaut. Und dann in die Pfanne gehauen.«
Als ersten Gang hatte es Ënnenzopp gegeben, Zwiebelsuppe. Die war in Luxemburg beliebt, aber natürlich ebenfalls ein kulinarischer Import. Aber so war die Küche seines Landes nun einmal. Von jeder der vielen Besatzungsmächte, die das Großherzogtum über die Jahrhunderte heimgesucht hatten, war etwas zurückgeblieben. Ein Straßenname, ein Stück Stadtmauer oder eben ein Gericht.
»Tut mir leid, dass unser kleines Menü so frugal ist, aber mein Kumpel hatte nichts anderes mehr da. Außerdem wird dein morgiges Überraschungsmenü ja deutlich opulenter sein.«
Und vermutlich, dachte Kieffer sich, vergisst du eh wieder das Essen den ganzen Tag lang, obwohl die Kellner andauernd Häppchen an dir vorbeitragen. Umso besser war es, dass Valérie vor der großen Schlacht wenigstens einmal etwas Gescheites aß.
Schweigend verzehrten sie ihren Tierteg. Irgendwann sagte Kieffer: »Auf dem Weg zurück habe ich was Komisches gesehen.«
»Ja?«
»Ja, auf dem Boulevard kam mir ein Typ entgegen, über siebzig, sah ein bisschen aus wie ein Clochard. Und hinter sich zog er ein Wägelchen her, mit zwei Louis-quatorze-Stühlen drauf. Die stammen aus eurem Treppenhaus.«
»Aus unserem …?«
»Ich denke schon. Als ich losging, standen im Flur zwei, genau solche – und allerlei anderes Gerümpel. Als ich zurückkam, waren die Stühle fort. Der Penner muss sie mitgenommen haben. Ich frage mich allerdings, wie er reingekommen ist.«
»Hatte er rote Haare? Ganz wirr, und eine zerschlissene Ballonmütze auf dem Kopf.«
Kieffer überlegte einen Augenblick. »Ja, genau.«
Valérie lachte leise. »Er ist reingekommen, weil er den Digicode hat.«
»Ihr habt einem Clochard die Zahlenkombi für die Haustür gegeben?«
»Monsieur Vernaq ist kein Clochard. Er ist ein pêcheur de la lune.«
Pêcheur de la lune, Mondangler. Kieffer verstand überhaupt nichts. Valérie sah ihm seine Ahnungslosigkeit offenbar an. Als Antwort ließ sie ihre Rechte in einer halbkreisförmigen Bewegung durch das Wohnzimmer schweifen und sagte: »Wo glaubst du, kommt das alles hier her?«
Sein Blick folgte ihrer Hand, und er verstand. Valérie war eine Verfechterin jenes typisch parisischen Einrichtungskonzepts, das man als le style bobo bezeichnete. Bobo bedeutete bourgeois bohémien und stand für einen wilden Mix aus verschiedenen Stilen – halb Antiquariat, halb Studentenbude. Im Wohnzimmer seiner Freundin gab es einen Biedermeier-Kaffeetisch, der vor einem knallorangen Panton-Designersofa aus den Sechzigern stand. Den Esstisch, an dem sie saßen, taxierte er auf das späte 19. Jahrhundert, zwei der Stühle waren Louis-seize, Kieffer selbst saß auf einem Bergère. Alles war bunt durcheinandergemischt, alt und neu, teuer und billig, gut erhalten und schäbig.
»Ich dachte, du kaufst das Zeug auf irgendwelchen Flohmärkten, Saint Ouen zum Beispiel.«
»Manchmal. Aber dafür habe ich nur selten Zeit. Außerdem findet man die wirklich schönen Stücke nicht dort.«
»Sondern?«
»Hier fährt keiner was zum Sperrmüll. Die Pariser stellen ihr Zeug vor die Tür, und irgendwer nimmt es dann schon mit. Es gibt außerdem Profis, die durch die Straßen streifen, auf der Suche nach verwertbaren Möbeln und Antiquitäten. Das sind die pêcheurs de la lune.«
Sie schob sich das letzte Stück Tierteg in den Mund. »Bei unserem Mondfischer bestelle ich manchmal Sachen. Die Kommode da hinten zum Beispiel, die stammt von ihm. Wobei bestellen vielleicht nicht das richtige Wort ist.«
»Inwiefern?«
»Monsieur Vernaq ist ziemlich kauzig. Er hat kein Handy, geschweige denn E-Mail. Ich schreibe ihm kleine Zettel und sage ihm, was ich in etwa suche. Und wenn er es dann hat, bringt er es mir hoch. Deshalb hat er auch den Digicode. Damit er die Sachen abstellen und unser Gerümpel durchflöhen kann. Gerade vorgestern habe ich ihm geschrieben, dass ich einen persischen Läufer suche; einen schmalen, für das kleine Zimmer hinten. In Blau.«
»Und den findet er jetzt für dich?«
»Und das schneller, als man denkt. Der Typ ist ein Phänomen. Er hat Wahnsinnsquellen, vermutlich kennt er alle Antiquitätenhändler der Stadt. Oder er hat alle Digicodes.«
Sie schob ihren Teller weg. »So, jetzt kann ich nicht mehr.«
»Es gibt aber noch Nachtisch.«
»Noch etwas Luxemburgisches?«
»Einen Moment.«
Kieffer ging in die Küche und lugte in den Ofen. Das Dessert war fertig. Er nahm die zwei kleinen, feuerfesten Schalen heraus und brachte sie ins Wohnzimmer.
»Voilà. Gebaken Äppel.«
»In Belgien heißen die Rombosse«, erwiderte sie.
»Und in Deutschland Bratapfel«, sagte Kieffer. »Wie gesagt, unsere Küche ist ein Potpourri.«
Sie probierte ein Stück. »Weißt du, was ich glaube, Xavier?«
»Hmm?«
»Luxemburgisches Essen ist der style bobo unter den Küchen.«
Er lächelte. »Das hast du schön gesagt. Aber noch was anderes. Ich war vorhin mit Crevet oben auf der Galerie.«
Sie musterte ihn spöttisch. »Mit meiner hübschesten Mitarbeiterin. Und was habt ihr da oben so ganz allein gemacht?«
»Uns alte Gabins angeguckt.«
»Ah. Und?«
»Ein paar von den ganz alten fehlten. Vor allem den von 1921 hätte ich gern mal gesehen, den ersten. Hast du den hier?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, der ist sehr selten. Sammler zahlen hohe Summen dafür. Wir haben gar keinen.«
»Dann kauf doch einen.«
»Mache ich, wenn wieder Geld da ist. Dieser Flagship-Store war teurer als gedacht.«
Er musterte sie. Sie sah wirklich sehr müde aus.
»Das Geschäft …?«
»Läuft gerade nicht besonders gut. Wir haben zu viele alte Sachen im Portfolio.«
»Wie zum Beispiel?«
»Zeitschriften. Kartenmaterial. Bücher.«
»Und die sind alt?«
»Süßer, für jemanden, der immer noch ein Tastentelefon besitzt, mag das schwer zu verstehen sein, aber viele Menschen nehmen überhaupt kein Papier mehr in die Hand. Wir müssen den Guide auf links ziehen, ihn ins Internetzeitalter überführen. Das kostet leider erst mal sehr viel Geld und bringt wenig ein.«
Kieffer war es in der Tat unbegreiflich, warum die Leute neuerdings alles auf Tablets und Telefonen lasen. Ihm war der gedruckte Gabin lieber, von anderen Büchern und Zeitungen ganz zu schweigen. Aber er verstand das Problem. Die Gabin-Repräsentanz in Paris sollte den Gastroführer sichtbarer machen, sollte ihm die Coolness zurückgeben, die er früher besessen hatte. Hoffentlich funktionierte es.
»Und bei wem habt ihr die fehlenden Exemplare geliehen?«
»Die Nationalbibliothek hat welche im Präsenzbestand.«
»Und die rücken sie raus?«
»Eigentlich nicht. Ich habe es mehrfach versucht, aber diese Bibliothekare sind echte Zicken. Die wollten uns nur Kopien machen. Aber wie sieht das in unserer Ausstellung bitte aus?«
»Und wie hast du die Bibliothekszicken überzeugt?«
»Na ja, ganz zufällig ist Yves Brennan, der stellvertretende Leiter, ein entfernter Bekannter von mir. Er wollte auch erst nicht, aber ich habe ihn bestochen.«
Nun war es an Kieffer, ein bisschen eifersüchtig zu schauen.
»Mit Wein, Xavier. Eine Kiste Château Figeac von 2000.«
Das war ein Spitzenjahrgang. Billig war der nicht zu haben – Kieffer konnte verstehen, dass der Mann die Bücher rausgerückt hatte.
»Yves und so ein Geschichtsprofessor haben außerdem alte Artikel und Fotos aus den Archiven rausgesucht. Ich werde einiges davon morgen in meiner Rede verwenden.«
»Und die alten Guides kann ich mir morgen anschauen?«
»Bestimmt.« Sie gähnte. »So, das war sehr lecker, vielen Dank.« Valérie erhob sich und kam zu ihm herüber. Sie beugte sich herab und hauchte ihm einen Kuss auf die Wange. »Und jetzt schaue ich noch mal kurz in meine Mails.«
»Nichts da«, erwiderte er und erhob sich ebenfalls. »Du gehst jetzt ins Bett.« Er gab ihr einen sanften Schubs und schob sie in Richtung Schlafzimmer. Er war fast ein bisschen erstaunt, dass sie überhaupt keinen Widerstand leistete.
4
Wieder stand Kieffer auf der Balustrade und blickte hinunter in den großen Saal. Gäste drängten sich um Stehtische und aßen Canapés au foie gras oder Austern; sie standen in kleinen Grüppchen zusammen und unterhielten sich. Die Gabin-Party war ein großes Schaulaufen, alles was in der internationalen Küchenszene Rang und Namen hatte, war an diesem Abend hier versammelt. Er erkannte Elon Guerrier, den Chef des Pariser Dreisternerestaurants »L’Appel de la Pieuvre«, den berühmten spanischen Molekularkoch Loyola Cazarez und Matthieu Zettler – den Menschen mit den wohl meisten Sternen der Welt. Zettler betrieb insgesamt acht Restaurants. Zusammen besaßen sie sechzehn Sterne. Kieffer sah außerdem Jacques Perigot, den Food-Kolumnisten von »Le Monde«, mehrere Minister, Filmstars, sogar ein Ex-Präsident war gekommen. Nur vom aktuellen Amtsinhaber fehlte bislang jede Spur.
Der Saal unter ihm war nicht nur voller Menschen, sondern auch voller Gastronomiegeschichte. An den Wänden hingen große Emailletafeln, auf denen Georges, der kleine Koch, in verschiedenen Posen zu sehen war. Es handelte sich um Werbeschilder aus der Vorkriegszeit. Auf einem lugte Georges, auf den Zehenspitzen stehend, in einen riesigen Kochtopf. Darüber stand: »Vertrauen Sie nur dem Gabin!« Ein weiteres zeigte die Cartoonfigur in einem Kaftan, neben einem Kamel: »Entdecken Sie die Küche der Kolonien!«
Außerdem gab es auf Poster gezogene Fotos aller bisherigen Gabin-Chefredakteure, Aufnahmen alter Sternerestaurants und natürlich die Guides, die hinter ihm in den Regalen standen. Kieffer ging zu der Vitrine, in der die besonders seltenen Ausgaben verwahrt wurden. Dort, wo gestern noch einige Bände gefehlt hatten, sah er nun ein halbes Dutzend alt aussehender Bücher. Neben dem Regal stand ein Wachmann. Kieffer deutete auf die Vitrine. »Darf ich mir die mal genauer ansehen?«
Der Mann schüttelte den Kopf. »Bedaure, Monsieur, ich besitze keinen Schlüssel. Sie müssten jemanden vom Gabin fragen.«
Crevet würde ihm die Vitrine sicher aufschließen, aber sie hatte zurzeit vermutlich Besseres zu tun. Und so blieb Kieffer nur, durch die Glasscheibe zu starren. Er sah zwei sehr zerschlissene Gabins von 1921 und 1923, einen aufgeschlagenen, unbekannten Jahrgang sowie einen, auf dessen Rücken »1939« stand. Das blaue Leder des Einbands war voller Flecken und Kratzer. Er musterte die Seiten des aufgeschlagenen Bands. Selbst vor über siebzig Jahren hatte man den Guide bereits zweifarbig gedruckt. Es gab äußerst detaillierte Karten in Schwarz-Weiß, mit roten Markierungen für wichtige Gebäude oder Nationalstraßen.
Kieffer nippte an seinem Champagner. Es musste etwa zwanzig vor neun sein. Gegen neun Uhr würde Valerie die Veranstaltung offiziell eröffnen und einige Worte an die Gäste richten, um danach an den Festredner zu übergeben, der im Programm als »Überraschungsgast« angekündigt war. Kieffer schaute zur gegenüberliegenden Balustrade. Alle fünf Meter stand ein Anzugträger mit Knopf im Ohr. Und vorhin, da war er sich sicher, hatte er einen Schatten über eine Ecke des großen Oberlichts huschen sehen. Vermutlich waren die Kerle auch auf dem Dach.
Er nahm noch einen Schluck und ging dann in Richtung der Balkontür, um draußen eine Zigarette zu rauchen. Er war nicht der Einzige, der vor der Rede seinen Nikotinspiegel hochfahren wollte. Auf dem Balkon im ersten Stock tummelten sich bereits an die dreißig Personen. Kieffer zwängte sich durch die Menschentraube und postierte sich am Geländer. Vom Balkon aus konnte man die Avenue Kléber entlangschauen, bis zum Arc de Triomphe. Während er rauchte, fielen ihm zwei Köche auf, die hinter ihm standen, jeder eine Zigarre in der Hand. Den einen meinte er in Brüssel verorten zu können. Der andere war Vernon Hanschuh, ein Elsässer, der in New York ein Restaurant mit drei Sternen besaß und dort gerade noch zwei weitere eröffnet hatte. Kieffer war es schleierhaft, warum jemand sich so etwas antat. Schon die Arbeit als Souschef eines Zweisterners hatte ihn nervlich und körperlich beinahe ruiniert. Doch selbst wenn man den Druck aushielt und das notwendige Talent besaß: Warum hörte man nicht spätestens dann auf, wenn man drei Sterne ergattert hatte? Warum eröffnete jemand wie Hanschuh weitere Restaurants, Bistros und Bars? Vermutlich handelte es sich um eine Form von Geisteskrankheit.
»Die jungen Leute«, klagte Hanschuh gerade seinem Gegenüber, »arbeiten einfach nicht mehr mit der notwendigen Präzision.«
»Ja, das ist leider so«, sekundierte ihm der Belgier. »Keine Achtung mehr vor dem Handwerk.«
»Aber weißt du: Ich lasse sie jetzt immer erst mal ein Spiegelei machen. Es gibt ja meiner Meinung nach nur eine Art, das richtig zu tun.«
»Die Point-Methode.«
»Exakt. Und wenn sie nicht mal das hinkriegen, fliegen sie sofort wieder achtkantig raus.«
Die Point-Methode – Kieffer musste lächeln. Es war bereits fünfzehn Jahre her, dass er den Sternezirkus hinter sich gelassen hatte. Deshalb vergaß er mitunter, wie durchgeknallt diese Kerle alle waren. Selbst ein schnödes Spiegelei erhoben sie zum Kunstwerk. Um es zu braten – oder besser gesagt, um genau dies zu vermeiden –, gab es nur eine richtige Herangehensweise, und zwar die von der Küchenlegende Fernand Point vor über einem halben Jahrhundert festgelegte. Man ließ Butter in einer Pfanne zergehen, ohne dass sie brutzelte. Dann gab man ein frisches Ei vorsichtig auf einen kleinen Teller und ließ es in die Pfanne gleiten. Das Weiße musste stocken, aber nur so gerade eben, es sollte noch cremig sein. Danach transferierte man das Spiegelei auf einen vorgewärmten Teller, salzte, pfefferte und übergoss es zum Schluss mit warmer Butter – aber auf keinen Fall mit der aus der Eipfanne, sondern mit in einer weiteren Pfanne frisch zerlassener. Nun konnte man das perfekte Spiegelei genießen – so man nicht bereits verhungert war.
Kieffer ließ seine Zigarette fallen und trat sie aus. Er wollte sich gerade wieder hineinbegeben, als eine ihm nur zu gut vertraute Stimme sagte: »Hast du noch eine für mich, ché?«
Er drehte sich um und blickte in das Gesicht von Leonardo Jesús María Gutiérrez Esteban. Vor vielen Jahren hatten sie beide als Lehrlinge im Sternerestaurant »Renard Noir« geschuftet. Nun waren sie beide Köche – sehr unterschiedliche Köche.
»Hallo, Leo«, sagte Kieffer und hielt dem Argentinier seine Ducal-Schachtel hin. Der zog die Augenbrauen hoch, nahm sich eine Zigarette und entzündete sie.
»Dass du immer noch dieses Kraut rauchst, ché!?« Er zeigte mit seiner Linken auf die Gäste um sie herum. »Alle sind da, verdad? La fiesta del año.«
»Vermutlich. Bist du nur deswegen hergekommen?«
»No, ché gordo. Ich habe morgen noch einen Fernsehdreh. Wir machen PR für meine neuen Restaurants.«
»Wie? Gleich mehrere?«, erwiderte Kieffer. Esteban hatte ein nicht besonders gutes, aber sehr trendiges Restaurant in einem deutschen Nobelhotel besessen, bevor ihm das Geschäft sowie seine Ehe mit einer reichen Brauereierbin um die Ohren geflogen waren. Danach hatte sich der »Küchen-Leonardo«, wie die Presse den äußerst gut aussehenden Argentinier nannte, auf seine diversen Fernsehshows konzentriert.
»Ist eine Kette, ché. Einzelne Restaurants, das macht nix mehr her.«
Kieffer musterte Esteban zweifelnd. Erst jetzt fiel ihm auf, dass der Fernsehkoch ein etwas wunderliches Outfit anhatte. Er trug eine in den französischen Nationalfarben gehaltene Küchenuniform. Seine Kopfbedeckung war einem Béret nachempfunden; um seinen Hals hatte er ein rotes Tuch geknotet. Kurzum, er sah aus wie die schlechte Kopie eines Franzosen aus einem Werbekatalog. Als Esteban Kieffers Blick bemerkte, sagte er: »Nuestro uniforme. Gehört zum Konzept von ›La Bastille‹.«
»Das … was? La Bastille wie das Gefängnis?«
Esteban richtete sich auf und deklamierte: »Die Bastille. Der Ort, wo alles begann: die Französische Revolution, die Geburt der Republik. Der Beginn der aufregenden Geschichte einer Nation. Der Beginn des größten kulinarischen Abenteuers aller Zeiten!«
Der Argentinier grinste und klopfte dem verdutzten Kieffer auf die Schulter. »Gut, was? Hat sich meine Werbeagentur ausgedacht. Das wird ein Riesending, french fast casual.«
Kieffer nahm Esteban die Zigarettenschachtel weg, die dieser immer noch in der Hand hielt, und steckte sich eine weitere Ducal an. Wenn es stimmte, was er ahnte, hatte er sie dringend nötig.
»Noch mal ganz langsam. Du machst eine Restaurantkette auf, die Bastille heißt.«
»Sí.«
»Und die serviert französisches fast casual? Was auch immer genau das sein soll.«
»Exactamente. Kennst du ›Dolce Città‹? Das ist eine Kette von italienischen Restaurants.«
Kieffer kannte die Läden. Es gab sie inzwischen überall, und sie galten als Pizzerias der Zukunft. Im »Dolce Città« musste man sich sein Essen selbst holen. Die Speisen wurden vor den Augen der Gäste an Küchenstationen zubereitet. Das Konzept ließ sich folgendermaßen zusammenfassen: Tolle Inneneinrichtung, mittelmäßiges Essen, keinerlei Service.
»Und das«, fuhr Esteban fort, »mach ich jetzt auf Französisch. Ein modernes Bistro. Das wird riesengroß, ché, du solltest mal vorbeikommen.«
Esteban reckte den Hals, so als suche er etwas.
»Wo ist denn der erste Laden?«, fragte Kieffer. »Doch nicht hier in Paris?«
»Nein, Berlin. Mitte.«
»Ja, das leuchtet ein«, erwiderte Kieffer, aber Esteban hörte ihm nicht mehr zu. Sein Blick war an dem Hintern einer etwa fünfundzwanzigjährigen Frau hängen geblieben. Dieser schien die gesamte Aufmerksamkeit des Argentiniers zu fordern. Kieffer bemerkte, dass sich der Balkon merklich zu leeren begann. Vermutlich würde Valéries Rede gleich beginnen.
Kieffer tippte Esteban auf die Schulter. »Ich gehe runter. Kommst du mit?«
»Was? Ja, sí, sí.«
Sie drängten sich mit vielen anderen die Treppe hinunter. Der Saal war nun zum Bersten mit Menschen gefüllt. Kieffer konnte sehen, dass man die Galerie im ersten Stock abgesperrt hatte, vermutlich aus Sicherheitsgründen. Nur ein paar Fernsehreporter mit Kameras sowie die Sicherheitsleute standen noch auf der Balustrade. Valérie war gerade dabei, die Bühne zu betreten, die man gegenüber dem Haupteingang aufgebaut hatte. Sie trat an ein kobaltblaues Pult, an dessen Vorderseite ein großes »G« prangte. Die Menge verstummte.
»Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Kollegen. Ich darf Sie ganz herzlich zur offiziellen Eröffnung des Maison Gabin begrüßen, des ersten seiner Art. Viele von Ihnen kennen unser Hauptquartier in der Avenue de Breteuil; manche haben es vielleicht schon besucht.«
Ein Koch neben Kieffer schnaufte und murmelte: »Ja, aber bestimmt nicht freiwillig.« Was der Mann meinte, war, dass der Gabin Sterneköche mitunter in seine Heiligen Hallen zitierte, um mit ihnen über ihr Restaurant und ihr Menü zu sprechen. In der Regel wurden nur Wackelkandidaten vorgeladen, die um ihre Sterne bangen mussten. Kieffer war vor Jahren selbst einmal bei solch einem Gespräch gewesen. Er erinnerte sich nur ungern daran. Es war etwa so angenehm verlaufen wie eine Wurzelbehandlung.
»Anders als unser Redaktionshaus ist dieses Gebäude für die Öffentlichkeit gedacht. Lassen Sie mich dazu etwas tiefer in unsere Firmengeschichte eintauchen. Mein Großvater Auguste Gabin war das, was man im Frankreich der Zwanzigerjahre einen VRP nannte – voyageur représentant placier, ein Handlungsreisender. Er verkaufte Damenhüte und Strumpfbänder. Damals gab es sehr viele dieser VRPs, und sie alle mussten unterwegs irgendwo essen. Sie tauschten natürlich Tipps aus, und wenn ein Hotelier den VRPs beispielsweise einen Rabatt einräumte oder die Portionen sehr ordentlich waren, sprach sich das schnell herum.
Mein Großvater galt als eine der besten Quellen für solche Tipps. Denn er liebte es, gut zu essen. Nach ein paar Jahren kannte er in jedem Städtchen seines Gebiets die guten Restaurants. Er führte sogar Buch darüber.«
An der Wand hinter Valérie erschien das Foto eines kleinen dunkelblauen Notizbuchs. Es sah sehr alt aus. Auf seiner Vorderseite war ein vergilbtes Etikett angebracht, auf das jemand in einer peniblen Handschrift »Où manger?« geschrieben hatte, »Wo essen?«. Darunter stand »A. Gabin«.
»Was Sie hier sehen, meine Damen und Herren, ist eines von Augustes legendären carnets bleus, gewissermaßen der Vorläufer des Guide. In diesen Heftchen notierte er sich Reiseerfahrungen und Gedanken, aber vor allem die Namen der Restaurants, die ihm gefielen. Seine kulinarischen Eindrücke fügte er hinzu. Soweit wir wissen, hatte Auguste anfangs nicht vor, seine Restaurantsammlung zu veröffentlichen. Er wollte lediglich das, was wir alle wollen – gut essen.«
Auf der Leinwand hinter Valérie wurden einige der vergilbten Innenseiten gezeigt. Sie waren mit derselben peniblen Handschrift bedeckt und enthielten Einträge wie: »›Les Fleurs‹, Roanne. Die consommé Maintenon exzellent. Poularde Lambertye etwas fad. Gute tarte Tatin.VRPs bekommen 1/4 Liter vom Tafelwein gratis.«
Valérie zeigte auf die Bücher, die in den Regalen oben auf der Galerie zu sehen waren. Die Blicke der Menge folgten ihr. »Nie hätte Auguste Gabin, gelernter Metzgergeselle und Hutverkäufer aus wirtschaftlicher Not, gedacht, dass irgendwann derart viele Bücher seinen Namen tragen würden. Linker Hand sehen Sie dort oben unseren berühmten Guide Bleu, mit dem alles begann und der auch heute noch unsere wichtigste Publikation ist. Wir haben hier erstmals alle existierenden Ausgaben versammelt. Sie sind herzlich eingeladen, sie sich später anzusehen. Aber inzwischen sind auch Kochzeitschriften dazugekommen, Reiseführer, Karten und Hotelverzeichnisse, die Sie ebenfalls im Obergeschoss einsehen können.
Meine Damen und Herren, warum entschied sich mein Großvater seinerzeit, aus seinem Hobby ein Geschäft zu machen? Weil ihm etwas auffiel, das anscheinend noch niemand anderes zuvor bemerkt hatte. In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg traf er in den Gasthöfen und Restaurants Frankreichs immer mehr Reisende, die anscheinend nicht geschäftlich unterwegs waren – Ausflügler und Touristen. Autos waren erschwinglich geworden, und Pariser, Lyoner oder Marseiller verließen die Großstädte und machten in ihren Secqueville-Hoyaus und Renaults die ersten Landpartien. Immer öfter fragten nun Leute, die keine VRPs waren, Auguste nach Restauranttipps. Und da witterte er ein Geschäft.
Er hatte, wie wir heute wissen, den richtigen Riecher. Bereits die erste Ausgabe des Gabin aus dem Jahr 1921 war ein voller Erfolg. Heute steht der Guide Bleu mehr als irgendeine andere Publikation für gutes Essen. Meine Damen und Herren, wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, finden Sie überall im Haus Tafeln und Multimedia-Schirme, auf denen die Geschichte des Gabin erklärt wird. Ich hoffe, Sie fühlen sich bei uns wohl. Und nun habe ich schon viel zu viel geredet. Ich brauche jetzt dringend ein Glas Champagner.«
Wohlwollendes Gelächter im Saal.
»Ich freue mich nun, Ihnen unseren Festredner ankündigen zu können. Wir sind geehrt, ihn heute Abend hier zu haben. Ich kenne ihn seit vielen Jahren, und seine kulinarischen Kenntnisse sind mindestens so groß wie seine politischen Verdienste. Meine Damen und Herren, François Allégret, der Präsident der Republik.«
Ein Raunen ging durch den Saal. Anders als Kieffer schienen viele der Gäste tatsächlich überrascht zu sein. Allégret kam hinter einem Bühnenaufbau hervor, umarmte Valérie mit strahlendem Lächeln und gab ihr Küsschen auf beide Wangen. Auch Kieffer kannte Allégret persönlich, noch aus der Zeit, als dieser Bürgermeister von Paris gewesen war. Damals hatte er dem Politiker geholfen, als ein Koch während eines von ihm ausgerichteten Galadinners tot umgefallen war. Seit Valéries Busenfreund im Élyséepalast saß, war Kieffer ihm allerdings nicht mehr begegnet. Wie immer war Allégret perfekt gekleidet, er trug einen maßgeschneiderten dunkelblauen Anzug. Zudem sah er – anders als sein teigiger Vorgänger im Amt – ausgesprochen gut aus. Allégret besaß ein Dressman-Gesicht mit Charakterkinn und hohen Wangenknochen, dazu lockiges, kastanienfarbenes Haar mit ersten grauen Strähnen. Allerdings war ihm, fand Kieffer, etwas von seiner eleganten Leichtigkeit verloren gegangen. Allégret, der Bürgermeister, hätte die Stufen zum Rednerpodest lockeren Schrittes genommen, zwei auf einmal. Nun ging Allégret nicht mehr – er schritt, in gemessenem Tempo, den Kopf emporgereckt. Vermutlich musste man als Präsident eines bedeutenden Landes so gehen.
Allégret wandte sich dem Publikum zu. »Meine Damen und Herren. Valérie Gabin hat uns soeben erzählt, wie Auguste Gabin auf die Idee kam, einen Restaurantführer herauszugeben – aus Liebe zum Essen. Monsieur Gabin – wenn ich diese Anekdote noch hinzufügen darf – verstand nicht nur etwas vom Essen. Ihm war es außerdem wichtig, jedes Mahl zu zelebrieren. Bevor er ein Restaurant betrat, zog er sich zunächst feine Kleidung an. Er legte seine staubigen Reiseklamotten ab und zwängte sich in Vatermörder und Frack. Erst dann ging er zu Tisch.«
Gekicher im Publikum.
»Ja, das mag uns heutzutage kauzig erscheinen. Aber es zeigt, mit welchem Ernst er bei der Sache war. Und dieser Ernst, diese Akribie sind, davon bin ich überzeugt, dem Gabin bis heute erhalten geblieben. Deshalb ist er mehr als nur irgendein Restaurantführer.«
Allégret schaute ergriffen. »Der Gabin ist ein nationaler Schatz. Er zeigt der Welt, wie ernst wir Franzosen das Essen nehmen, er hilft uns, die herausragende Stellung der französischen Küche in der Welt …«
Weiter kam Allégret nicht, denn in diesem Moment sprang ein Mann auf die Bühne. Kieffer konnte nicht erkennen, wo der Kerl herkam. Aber es schien offensichtlich, dass er auf Ärger aus war. In seinen erhobenen Händen hielt er ein Schild, auf dem »Milch und Eier sind Mord« stand. Er reckte es in Richtung der Fernsehkameras und brüllte etwas. Das Einzige, was Kieffer verstand, war das Wort »vegan«. Der Aktivist versuchte, sich Allégret zu nähern. Er kam nur drei Schritte weit, dann warfen sich zwei muskelbepackte Personenschützer auf ihn.
In der Menge entstand Unruhe. Als die Sicherheitsleute den Protestler im Schwitzkasten aus dem Saal zerrten, gab es vereinzelten Beifall. In diesem Moment ging das Licht aus. Nur einige leuchtende Rechtecke waren zu sehen, die Handys jener Gäste, die hatten filmen oder fotografieren wollen. Nun begann die Menge in Panik zu geraten, Menschen schrien, Kieffer wurde von jemandem angerempelt. Er stand immer noch am Fuße der Treppe. Zu Valérie zu gelangen, die sich irgendwo auf der anderen Seite des Saals in der Dunkelheit befinden musste, erschien dem Koch aussichtslos. Deshalb stieg er die Stufen hinauf, das Geländer umfassend. Während er sich nach oben tastete, nahm die Unruhe im Saal unter ihm weiter zu.
Er wusste nicht, wie lange der Strom ausgefallen war, aber es konnten kaum mehr als dreißig Sekunden gewesen sein. Dann flackerten die Deckenstrahler, kurz darauf war es wieder so hell wie zuvor. Von der Balustrade aus musterte Kieffer die Lage. Eine Champagnerpyramide am Rande des Saals war zusammengebrochen; sonst schien nichts Schlimmes passiert zu sein. Er konnte gerade noch sehen, wie ein Tross Personenschützer den Präsidenten aus der Halle brachte. Die Gäste schrien durcheinander, einige drängten zum Ausgang, andere waren unschlüssig, was sie als Nächstes tun sollten. Ein paar Minuten verstrichen.
Kieffer sah seine Freundin, die nun wieder ans Rednerpult trat. Valérie sah bleich aus. Mit leicht zitternder Stimme erklärte sie: »Meine Damen und Herren, bitte entschuldigen Sie diesen Zwischenfall. Es handelte sich offensichtlich um die Protestaktion eines radikalen Veganers. Der Stromausfall scheint durch eine Überlastung der Sicherungen hervorgerufen worden zu sein und hat vermutlich nichts mit dem Vorfall zu tun. Ich sage ›vermutlich‹, weil wir uns nicht sicher sein können. Um jedwede Gefährdung auszuschließen, haben die Sicherheitsbehörden deshalb angeordnet, dass die Veranstaltung abgebrochen werden muss. Ich bitte Sie, sich in aller Ruhe zu den Ausgängen zu begeben. Es tut mir leid.«