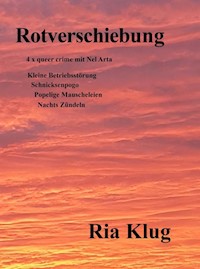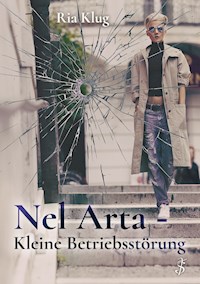Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Querverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In den achtziger Jahren gehörte Riva zu den Roten Brigaden, dem italienischen RAF-Pendant. Nach kurzer Haft auf der berüchtigten Gefängnisinsel Asinara tauchte er in Berlin unter, weil er sich von Ex-Genossen verfolgt und bedroht wähnte. Obwohl Riva sich inzwischen zu einer queeren Person verändert hat, entdeckt ihn zufällig der ehemalige Brigadist Sandro. Riva versteckt sich, denn er weiß nicht, dass Sandro es als Informant des LKA nur auf Hinweise zu einem unentdeckten Geldversteck der Bewegung 2. Juni abgesehen hat. Sandro betreibt ein brisantes Doppelspiel: gegen das LKA und gegen drei flüchtige Ex-RAFler, mit denen er vorgeblich kooperiert, damit sie in Freiheit bleiben. Nach einem misslungenen Raubüberfall macht sich die lesbische Ex-RAF-Genossin Silke ebenfalls auf die Suche nach dem Gelddepot und muss dafür zahlreiche Kontakte aus der ehemaligen linken Szene in Westberlin wiederbeleben. Die Suche nach Riva und dem Geld wird für alle Beteiligten lebensgefährlich …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Handlung, die Figuren und manche Schauplätze dieses Romans sind fiktiv. Ähnlichkeiten mit lebenden und toten Personen sind unbeabsichtigt.
Erste Auflage September 2018
Lektorat: Lara Ledwa
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag und grafische Realisierung von Sergio Vitale
unter Verwendung eines Fotos von mauritius images/Nathan Wright/Alamy
ISBN 978-3-89656-650-8
Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis an:
Querverlag GmbH
Akazienstraße 25, 10823 Berlin
www.querverlag.de
1
Die Nacht war weit genug fortgeschritten, um ausreichend Personen hervorzubringen, die sich durch Alkohol oder andere Drogen ihrer eigenen Realität angenähert hatten. Manche schleppten ein ganzes Arsenal an großstädtisch-dissoziativen Optionen mit sich herum.
Es würde Ärger geben.
Nach ein paar Jahren in der Szene hatte Riva dafür ein Gespür entwickelt.
Der Typ trug zu Bermudas und Chucks eins von diesen lächerlichen Hütchen, die gerade modern waren. Er gehörte zu einer gemischten Gruppe und unterhielt die Umstehenden in der Schlange mit lautem Geschwätz und dreister Anmache auf Englisch. Manche Frauen gingen auf Abstand, andere suhlten sich in seiner Aufmerksamkeit.
Der Typ hielt sich für einen tollen Hecht, dachte Riva. Groß, sicher fast zwei Meter, schlaksig und er konnte nicht stillstehen. Typisch Berlinbesucher, denen der Flair der Stadt oder irgendetwas anderes zu Kopf gestiegen war.
Diese jungen Männer neigten dazu, sich und ihr Kampfgewicht zu überschätzen.
Da Sascha gerade drinnen gebraucht wurde, musste Riva den Job alleine machen. Eigentlich sollten sie zu dritt Dienst schieben, aber Laszlo hatte sich kurzfristig krank gemeldet. Für Riva stellte das kein Problem dar, er hatte sich daran gewöhnt, Dinge alleine zu tun. Das galt eigentlich für sein gesamtes Dasein.
Riva nahm sich das nächste Grüppchen vor. Die Jungs sahen studentisch aus, also eher harmlos, und schienen nicht betrunken. Er ließ sie die Taschen und Rucksäcke öffnen und kontrollierte kurz die Inhalte auf verbotene Mitbringsel.
Keine Waffen, keine Pillen, keine Beutel mit verdächtigem Inhalt, keine Getränke. So lautete die strikte Anweisung. Neben der Tür parkte ein verbeulter Einkaufswagen. In dem sammelten sie die verbotenen Flaschen. Manche kippten sich den Inhalt noch schnell in den Rachen, bevor sie nach Atem ringend die Pullen zu den anderen klappern ließen und ihren Begleiter_innen hastig hineinfolgten.
Verdächtig aussehende oder aggressive Typen abweisen, so lautete der Arbeitsauftrag für Riva und seine Kollegen. Wie das zu interpretieren war, unterschied sich je nach diensthabendem Türsteher.
Für Riva gehörte der Typ mit dem Hut zur Kategorie der Aggressiven. Er spürte deutlich, wie ihn diese Form der Männlichkeit abstieß, sein Urteil also persönlich gefärbt war. Trotzdem würde er ihn nicht hineinlassen. Den Ärger würde er in Kauf nehmen.
Es war eine Gelegenheit, einen von diesen aufgeblasenen Gockeln in seine Schranken zu weisen.
Zwei Schwarzhaarige mit dunklem Teint ließen sich widerstandslos wegschicken. Roman hatte den Türstehern vor einer Stunde gesagt, »von denen keine mehr, sind genug drinne, das gibt nur Ärger«.
Der weiße Schlaks lachte höhnisch hinter den Abgewiesenen.
Komm du nur, dachte Riva. Mal sehen, wer lacht, wenn du abziehen musst. Sein Groll gegen Romans aufgeblasenes Chefgehabe konzentrierte sich auf dieses Gegenüber.
Meistens entledigte sich Riva der Jacke, um seine Muskeln zu zeigen. Das unterband Konflikte oft schon im Ansatz. Diesmal verzichtete er darauf, als der Schlaks auf ihn zutrat.
Der Typ nahm die Hände aus den Hosentaschen. Das Innenfutter zog er dabei mit heraus und grinste Riva von oben an.
Ich habe nichts dabei, sollte das offenbar heißen.
Riva schüttelte leicht den Kopf und zeigte zur dunklen Straße. »Go.«
Der Typ zuckte kurz zusammen, dann lachte er auf. »Hey, you’re kiddin’, bro.« Er wollte sich vorbeidrängeln.
Riva trat ihm in den Weg. »I’m not your bro. Get off!«
»C’mon, enano«, meinte der Typ. Er drängelte weiter.
Riva stemmte die Füße fest auf den Betonboden und schob die Schulter vor. Er begriff, dass der Typ ihn wegen seines Akzentes für einen Spanier hielt, denn enano entsprach dem italienischen nano und bedeutete Zwerg. »Stop!«, sagte er laut.
Hinter dem Typen beobachteten die Umstehenden gespannt, was passieren würde. Riva kannte die Blicke schon. Er hatte Lust zu schlagen, aber Roman hatte ihnen eingeschärft, so wenig Gewalt wie möglich anzuwenden. Keine ernsten Verletzungen und keine Skandale, nichts, was anderntags in der Zeitung stehen würde.
Als Boss konnte er das verlangen.
Aber die Wut in Riva brauchte ein Ventil.
»I wanna get in there«, krakeelte der Schlaks. Mit einem schnellen Ausweichmanöver versuchte er an Riva vorbeizukommen. Eine Faust, aus Hüfthöhe abgefeuert, traf ihn in die Seite. Er torkelte gegen den Flaschenwagen und japste.
»Get off!«, sagte Riva noch mal.
Der Typ sah sich kurz nach seinen Begleiter_innen um. Dann riss er eine Flasche aus dem Wagen und wendete sich Riva zu.
»Bastard«, zischte er, schaffte es aber nicht, mehr als auszuholen.
Riva war schneller. Er schlug den Arm nach oben. Die Flasche sauste hinter dem Typen in hohem Bogen davon. Zwei von Riva mit Inbrunst abgefeuerte Körpertreffer krümmten den Schlaks. Er sank in die Knie.
Riva fuhr herum. Ein dunkel Gelockter, der ihm näher kommen wollte, erstarrte. Er gehörte zur Entourage des Schlakses.
Riva war nicht sicher, was der andere vorhatte, verspürte jedoch Lust, noch ein paar Schläge auszuteilen.
»Get off and take him away«, sagte Riva mit einem Wink zum vor sich hin hustenden und röchelnden Typen.
»All of you«, fügte er hinzu, dabei zeigte er auf die ganze Gruppe. Er musste die schimpfenden Frauen übertönen.
Aus der Schlange hatte sich ein Halbkreis gebildet. Alle wollten sehen, was passierte und ob es zu einer größeren Schlägerei kommen würde, das war Riva klar.
Sein Blick blieb an einem Gesicht hängen. Auf seinem Rücken bildete sich eine Gänsehaut, die hinauf in den Nacken kroch.
Er spürte, wie ein Zittern seine Knie erfasste.
»Was ist hier los?«, hörte er Sascha neben sich sagen.
»Mir … ist schlecht«, hauchte Riva. »Ich muss …« Er drehte sich um und hastete hinein. Die Treppe hinab musste er das Geländer fest packen, um nicht zu stolpern. Seine Arme und Beine fühlten sich an wie aus Gummi. Jegliche Kraft war aus ihnen gewichen. Er zwängte sich durch die Menge auf dem unteren Dancefloor, an der Theke vorbei und auf die Toilette. Gerade noch rechtzeitig. Sobald er in einer Kabine stand und den Kopf über der Schüssel hatte, übergab er sich.
Wie lange Riva dort verharrt hatte, mit den Händen auf dem Spülkasten abgestützt, würgend und schwitzend, wusste er nicht. In den Wirbel von Gedanken drang Saschas Stimme, die nach ihm rief.
Riva richtete sich mühsam auf. Mit zittriger Stimme meldete er sich.
Sascha rüttelte an der Tür. »Was ist los? Mach auf!«
Riva schob den Riegel zurück und öffnete langsam.
Sascha starrte ihn an. »Du bist käseweiß. Ist dir nicht gut?«
»Der Magen«, murmelte Riva.
»Scheiße. Geht’s wieder? Ich muss zurück an die Tür.« Sascha zog geräuschvoll Schnodder hoch.
»Ich weiß nicht«, sagte Riva. »Ich glaube, ich muss nach Hause.«
»Scheiße«, sagte Sascha und musste erneut Schnodder einsagen. »Sag Roman Bescheid, er muss dann drinnen selbst aufpassen. Den Türjob schaffe ich auch alleine.« Er eilte hinaus.
Rivas Abmeldung nahm Roman in seinem Bürokabuff mit den Monitoren missmutig entgegen. »Was war da draußen los?«, wollte er mit einem Nicken zum Monitor, der den Eingangsbereich zeigte, wissen.
»Nur ein Wichser, der Ärger machen wollte. Aber jetzt ist mir kotzübel«, sagte Riva leise. Er starrte auf den Bildschirm. Aus den Gesichtern der Wartenden stach keins heraus.
Roman schob sich die wirren Haare aus der Stirn. »Soll ich den Laden etwa alleine schmeißen? Laszlo wird noch ein paar Tage fehlen. Wenn nur noch Sascha arbeitet, hab ich ein Problem.«
»Ich habe mir sicher nur den Magen verdorben«, sagte Riva, um dem Boss die Befürchtung zu nehmen, er könne auch morgen nicht arbeiten.
Roman nickte seufzend. »Ich will nicht, dass das einreißt. Ich brauche zuverlässige Leute. Morgen will ich dich wieder hier sehen.«
Riva stakste auf wackeligen Beinen zum Hofausgang. Dieser Arsch, dachte er. Wenn er wenigstens anständig bezahlen würde, dann hätte er moralischen Anspruch auf mehr Leistung.
Aber Roman wusste genau, wer auf diesen Job angewiesen war und von ihm ausgepresst werden konnte.
Im Hof hatte Riva sein Fahrrad wie die anderen Radler_innen aus der Belegschaft bei den leeren Getränkekisten im Schuppen abgestellt.
Den Durchgang zur Straße versperrte ein Gittertor. Riva spähte hinaus. Die Clubbesucher_innen lärmten auf dem Vorplatz. Hier wirkte dagegen alles vollkommen ruhig, wie es für die Stunden vor Sonnenaufgang üblich war.
Ob er erkannt worden war, wusste Riva nicht. Eigentlich unmöglich, aber sicher war das keineswegs. Er sagte sich, sein Argwohn sei hauptsächlich durch die Angst gespeist und die Panik ziemlich übertrieben.
Er schob das Rad hinaus und verschloss das Tor sorgfältig hinter sich.
Matter Glanz lag auf geparktem Autoblech, das die Straße dicht säumte. Riva schwang sich in den Sattel und rollte auf den holperigen Asphalt. Langsam radelte er ohne Licht an der Feuerwache vorbei. Dabei drehte er sich mehrmals um, ohne eine verdächtige Bewegung wahrzunehmen.
Als er wenige Minuten später am Comeniusplatz auf die Kopernikusstraße stieß, hatte er sich einigermaßen beruhigt.
Allmählich fragte er sich, ob er wirklich Zero gesehen hatte. Vielleicht hatte er nur geglaubt, dieses Gesicht gehöre Zero. Ein Resultat seiner ständigen unterschwelligen Angst, er könnte einem seiner früheren Genoss_innen begegnen. Zero gegenüberzustehen wäre die schlimmste aller Begegnungen.
Ab der Warschauer Straße gab es mehr Verkehr und mehr Nachtschwärmende. Er musste sich auf das Fahren konzentrieren, denn Straßenbahnschienen und zerschlagene Flaschen begleiteten seine Route.
Sowohl beim Abbiegen von der Wühlischstraße als auch beim nächsten Einbiegen auf die Neue Bahnhofstraße nahm Riva einen hellen Wagen wahr. Weiß oder silbergrau, mehrere Wagenlängen hinter ihm; der Wagen folgte der gleichen Route.
Sofort überfiel Riva wieder die Furcht, die sich bloß in eine angespannte Warteposition zurückgezogen hatte.
Er überlegte, ob er den gewohnten Weg nehmen sollte, entschied sich aber kurzerhand anders. Er folgte der Straße weiter, um rechts durch die Grünanlagen kurz vor der Frankfurter Allee, unter dem Bahndamm hindurch, seine Unterkunft zu erreichen. Mit einem Auto konnte ihm dorthin niemand folgen.
Es sah aus, als würde der Wagen abbremsen, als Riva von der Gürtelstraße in die Anlage hinter dem mächtigen Wohnblock abbog, der sich an der Wilhelm-Guddorf-Straße entlangzog. Davon überzeugen konnte er sich nicht, denn der dunkle Weg erforderte seine ungeteilte Aufmerksamkeit.
In der S-Bahnunterführung zum Kietzer Weg stand eine tiefgründig glänzende Pfütze, aus der ein paar Scherben herausstachen.
Riva rollte langsam die Scherben umkurvend durch die schmatzende Wasserfläche. Zerklüftetes Kopfsteinpflaster empfing ihn auf der anderen Seite. Die nur knapp zweihundert Meter lange Straße am Fuß des Ringbahndamms lag völlig ruhig vor ihm.
Er hielt vor dem hohen Tor aus rohen Brettern, in das eine kleine Tür eingelassen war, kramte den Schlüssel heraus und öffnete.
Eine S-Bahn rumpelte Richtung Frankfurter Allee und übertönte jedes Quietschen der rostigen Türbeschläge, bis Riva sie sorgfältig hinter sich verriegelt hatte.
Nichts regte sich auf dem Gewerbehof, wo er in einer Baracke an der Mauer zum Nachbargrundstück hauste. Früher diente sie als Büro eines Gerüstbaubetriebs, für den sie irgendwann zu klein geworden war.
Er schob das Rad in den winzigen Verschlag auf der Rückseite der Behausung, sicherte es und sperrte auch den Zugang ab. Danach entriegelte er den Eingang. Auch hier brauchte er mehrere Schlüssel. Für jedes der beiden Vorhängeschlösser einen und einen anderen für das Türschloss selbst. Manchmal nervten ihn die Begleiterscheinungen seines Abgrenzungsbedürfnisses, das er selbst als neurotisch empfand. Aber ohne all diese Schlösser kam er noch viel weniger zurecht.
Die Baracke bestand aus zwei recht niedrigen Räumen. Hinter dem Eingang lag das Zimmer, das Riva, wenn er sich sicher fühlte, zum Wohnen und Schlafen benutzte. Davon zweigte ein etwas kleineres ab, das als Küche und Bad diente. Nachdem er sich mit Hilfe der beiden Vorhängeschlösser eingesperrt hatte, drapierte er den schweren Vorhang, der die Tür verdeckte, wieder ordentlich. Dazu brauchte er kein Licht. Er blieb ruhig stehen und lauschte. Nichts, absolut nichts.
Trotzdem wollte sein Unbehagen nicht weichen.
Riva zog die Fahrradlampe aus der Jackentasche und leuchtete sich einen Weg ins Bad. Eigentlich hätte er auch Licht machen können. Der Rollladen vor dem kleinen Wohnraumfenster war heruntergelassen und dichtete gut ab. Das Bad war bis auf ein Oberlicht fensterlos.
Er zog die wackelige Stehleiter unter das Oberlicht, stieg hinauf, entriegelte und öffnete die Luke. Wieder lauschte er zuerst, dann zog er sich hinaus aufs Dach. Die Teerpappe fühlte sich kühl und rau unter seinen Händen an.
Auf das Flachdach gekniet, hatte er einen guten Überblick über die Grundstücke entlang der Straße. Nirgendwo regte sich etwas.
Riva richtete sich auf, stieg auf die Mauerkrone, die über der Grundstücksgrenze thronte, und schlich geduckt darauf entlang. Über ein weiteres Flachdach erreichte er die Rückwand des mittleren der drei baufälligen Häuser, die wie ein Monument des Niedergangs an der Wartenbergstraße dem Tod entgegendämmerten. Diese Häuser aus der Kaiserzeit hatten vieles überlebt. Weltkriege mit Bombennächten, Inflationen und Krisen, vierzig Jahre DDR, aber der Liegenschaftspolitik der Nachwendezeit würden sie schließlich erlegen sein. Riva, der den Kapitalismus trotz allem immer noch verachtete, profitierte davon, dessen war er sich bewusst. Durch einen gut getarnten Kellerschacht stieg er in den muffigen und feuchten Untergrund. Den Weg durch den Keller ins Nachbarhaus hatte er für sich von Gerümpel und Müll befreit. Seit die bodennahen Öffnungen zu den Häusern zugemauert waren, kam nichts Neues dazu.
Bis zum ersten Stockwerk konnte er die Fahrradleuchte ohne Weiteres benutzen. Die zugemauerten Fenster verhinderten, dass der Schein hinausdrang. Weiter oben half der matte Schimmer, den die Großstadtlichter über Berlin ausbreiteten. Manchmal unterstützt vom Mondschein.
Die Treppe stellte eine ernstzunehmende Gefahr da. Der Regen, der durch die fehlende Dacheindeckung ins Gebäude fiel, durchweichte schon lange tragende Bauteile. Von der Geschossdecke zum Dachboden existierten nur noch kümmerliche Reste. Das herabgestürzte Material lagerte feucht und schwer auf dem Boden darunter und hatte auch diesen schon stellenweise durchbrechen lassen.
Inmitten dieses Verfalls hatte sich Riva eine besonders versteckte Zuflucht geschaffen. Den Schutt hatte er durch ein Loch in ein darunterliegendes Zimmer gekippt. Ein paar Bohlen sicherten die Stelle, an der sein Zelt aufgeschlagen stand. Den begehbaren Weg dorthin kannte er genau.
Zuerst stellte er sich an eine offene Fensterhöhle und spähte hinaus. Links von ihm zogen sich die blanken Rippen der S-Bahngleise über den Damm, der zum Ring führte. Direkt unter ihm die stille Wartenbergstraße.
Er tastete sich durch die Etage zur Hofseite.
Nichts. Noch nicht mal eine Katze oder eine Ratte raschelte irgendwo. Diese Stille brachte Rivas Nerven zum Vibrieren. Er unterdrückte den Wunsch, laut »Wer ist da?« hinauszuschreien.
Nach ungefähr einer Viertelstunde konnte er sich endlich losreißen. Er schlich zum Zelt, öffnete behutsam den Reißverschluss und schlüpfte hinein. Genauso langsam und leise schloss er den Regenschutz und das Innenzelt. Er sank auf die Isomatte, zog Schuhe und Socken aus und krabbelte in den Schlafsack. Aus einer Seitentasche fischte er ein LED-Leselicht, schaltete es ein und sichtete seine Vorräte. Es gab einen Karton mit haltbaren Lebensmitteln und etliche Flaschen Wasser. Er suchte eine Packung salziger Kekse und eine Brotbox voller Trockentomaten heraus. Kauend zog er einen Schuhkarton heran, nahm langsam den Deckel ab und griff hinein.
Nach einigen Minuten hatte er ungefähr ein Dutzend Fotos vor sich ausgebreitet. Seine Eltern mit ihm im Kinderwagen. Riva bei der Kommunion. Obwohl seine Eltern der Kommunistischen Partei Italiens angehört hatten, war ihm dieses Ritual nicht erspart worden. Das weiße Kleid hatte er nicht gemocht. Und doch … Seit fast zwanzig Jahren hatte er sie nicht mehr gesehen. Auch die Großeltern nicht, auf deren Olivenhain er gerne die Ferien verbracht hatte. Er wusste nicht mal, ob sie noch lebten. Manchmal war der Wunsch, ihre Stimmen zu hören, so groß, dass er kurz davor war, sie anzurufen.
Riva räumte alles beiseite und knipste das Leselicht aus. Im Dunkeln versuchte er sich das Bild des sonnigen Hangs mit den krumm verwachsenen Olivenbäumen ins Gedächtnis zu holen. Silbrig raschelnde Blätter. Rotbraune Erde, gespickt mit Steinen. Thymian und Rosmarin verströmen ihr Parfum in der warmen Luft.
Eine S-Bahn rumpelte vorbei und feiner Regen tupfte behutsam das Überzelt. Jedes Knirschen und Kratzen im Gebäude schreckte ihn auf und ließ ihn lauschen, ob sich jemand herumtrieb oder näherte.
Irgendwann versank Riva in schmerzendem Trost und konnte dem Schlaf nicht mehr widerstehen.
2
Hans-Jörg zog das Hosenbein hoch. Die dunkle Behaarung war licht genug, um den Blick auf ein blauviolettes Muster aus Blutgefäßen freizugeben. Sie wölbten sich an mehreren Stellen weit aus der blassen Haut heraus. Klarfeld erinnerte der Anblick an Landkarten, wie sie früher in der Schule an Kartenständern hingen. Der Nil und seine Zuflüsse. Die blaue Verdickung des Assuan-Staudamms im Wüstenocker. Das Delta bei Alexandria. Es fehlte nur das tiefe Grün der fruchtbaren Uferlandschaft. Obwohl …
»Schmerzen. Das muss behandelt werden. Bis da unten.« Hans-Jörg zeigte mit der offenen Handfläche. »Mit ein bisschen Sprechstundenambulanz ist nix mehr zu machen.«
»Sieht wirklich scheiße aus«, sagte Silke. Sie hatte sich ein Kissen als Nackenstütze genommen und die bestrumpften Füße auf den Couchtisch gelegt.
»Weiß ich selbst, Genossin«, zischte Hans-Jörg. Er zündete sich eine neue krumpelige Selbstgedrehte an.
Silke lachte freudlos auf. »Wir sind keine Genossen mehr, aber du kannst es einfach nicht lassen.«
Hans-Jörg schnaufte, während er das Hosenbein wieder hinunterzupfte. »Du rauchst selbst, Mensch.«
»Das Rauchen meine ich nicht. Obwohl du es lassen solltest, wenn du immer noch revolutionärer Vorkämpfer spielen willst. Es schwächt die Kampfkraft …« Silkes Lachen mündete in einen Hustenanfall.
»Das Rauchen ist bloß ein Nebenwiderspruch des Kapitals. Ich sehe mich weiter als Kämpfer gegen das System. Wir haben nur vorübergehend …«
Nicht schon wieder, dachte Klarfeld. Jedes Mal, wenn es auf ideologische Themen kam, stritten sich Silke und Hans-Jörg. Auf Ideologie kamen sie dauernd, egal, worum es ging. Hans-Jörg, der dickköpfige Romantiker, konnte nicht akzeptieren, dass der bewaffnete Kampf zu Ende war. Silke betätigte sich dann als Zynikerin, die das Sticheln nicht lassen konnte. Enttäuscht waren sie sicher beide, genauso wie er selbst. Klarfelds selbstgewählte Aufgabe bestand aber darin, den Laden zusammenzuhalten.
Sie brauchten sich doch, wir alle brauchen uns, dachte er wütend und schlug mit der flachen Hand auf die Tischplatte. »Das bringt doch nichts, Hans-Jörg. Wir sind Politrentner und die Bewegung, an deren Spitze wir marschieren wollten, gibt es nicht. Lass uns lieber überlegen, wo du dich behandeln lassen könntest und wie viel das kosten wird. Wie ist es eigentlich mit deinen Zähnen? Da muss doch sicher auch was passieren.«
Hans-Jörg lehnte sich Grimassen schneidend im Sessel zurück. Alt kam er Klarfeld vor, alt und müde. Von Falten konnte keine Rede mehr sein. Zerfurcht war der passende Ausdruck für Hans-Jörgs Gesicht. Früher hatte er richtig gut ausgesehen. Als ihm die dunklen Haare noch in die Stirn fielen. Bevor sie ausfielen und seine Zähne noch gesund aussahen. Aber jetzt? Nun ja.
»Giulio könnte es vielleicht machen«, brummte Hans-Jörg.
»Hat der überhaupt fertig studiert?«, fragte Silke beiläufig. Sie hatte sich einen Spiegel vom Stapel auf dem Tisch geholt und blätterte darin.
»Glaub schon. Im Knast war er jedenfalls nicht. Die Genossen haben dichtgehalten«, meinte Hans-Jörg.
Das Gerede von Genossen nervte auch Klarfeld. Die Genossen hockten im Knast, Exgenossen krochen vorm Staat zu Kreuze oder hatten sich gar ins Lager der Reaktionäre und Faschisten geschlagen.
Und sie selbst, was waren sie denn noch? Alte Knacker, die sich ihre Rente zusammenklauen mussten. Es wurde immer schwieriger und den Lebensabend in Gefängnissen verbringen wollten sie alle nicht. Aber das blühte ihnen, wenn sie nicht vorsichtig waren. Die Hinrichtungen von Feinden des Volks und Vertretern des Systems und die unvermeidlichen Tode ihrer Helfershelfer wurden vom Schweinestaat als Mord bezeichnet und der verjährte nicht. Angeblich. Ein ganzer Haufen echter Mörder aus der NS-Zeit war davongekommen. Manche gar mit goldenem Handschlag. Politische Justiz, so erklärte sich das. Die Gleichheit vor dem Gesetz und Unabhängigkeit des Justizapparates, alles bloße Propaganda. Sand in die Augen der Untertanen, sonst nichts. Früher, ja, früher waren sie Genossen gewesen. Kämpfer gegen die Unterdrückung. Gegen den Imperialismus. Doch das war vorbei.
»Hast du Kontakt zu Giulio?«, fragte Klarfeld.
»Leider nein.« Hans-Jörg schüttelte den Kopf. »Ich habe bloß von Cheskow gehört, dass Sandro gesagt hat, der praktiziert irgendwo in der Toskana.«
Silke prustete.
Klarfeld sah zu ihr hinüber. Sie grinste und schüttelte leicht den Kopf. Klarfeld zog kurz die Brauen zusammen. Zickig, dachte er. Silke ist unbefriedigt. Ihr fehlt eine Liebhaberin. Es ist halt nicht nur unsere revolutionäre Potenz verloren gegangen.
»Hans-Jörg, du weißt, dass Cheskow unzuverlässig ist«, sagte er bemüht nüchtern. »Ende der Achtziger hat er mit Karl-Heinz zusammengewohnt. Es muss nichts heißen, aber wer so säuft wie Cheskow …«
»Nur weil Karl-Heinz ein Scheißverräter ist, muss das doch nicht heißen, Cheskow ist auch einer. Gut, er trinkt zu viel, aber …« Hans-Jörg brach ab, zuckte mit den Schultern und legte die Hände auf die Oberschenkel, um sie zu massieren.
Klarfeld beobachtete die Bemühungen Hans-Jörgs, die Durchblutung anzuregen. »Wie viel Geld haben wir noch?«
Die Frage richtete sich an Silke. Früher hatte es Klarfeld manchmal gestört, dass Silke das Geld verwaltete. Es erinnerte ihn an seine Eltern. Der Vater lieferte seinen Lohn bei der Mutter ab und sie teilte Taschengeld zu.
Inzwischen hatte er sich daran gewöhnt oder er war abgestumpft und froh, eine Aufgabe weniger zu haben.
»Ungefähr dreißigtausend«, erwiderte Silke, ohne von ihrer Zeitschrift aufzuschauen.
Sie schwiegen. Im Zimmer verdickte sich die Wolke aus Zigarettenrauch und Frust zusehends. Klarfeld war sich sicher, dass ihnen allen die Dringlichkeit, Geld zu beschaffen, bewusst war. Er vermutete, dass sie alle keine Lust dazu verspürten. Mit jedem Raub verbanden sich Risiken und es kam vor, dass die Beute so mickrig ausfiel, dass sie gleich noch mal irgendwo zuschlagen mussten.
»Hast du eine Vorstellung, was die Behandlung kosten wird?«, fragte Klarfeld.
»Nein, woher? Ich muss erst mal jemanden finden, der bereit ist, das für einen alten Guerillero zu machen. Wie ich an Giulio rankommen soll, ohne Cheskow zu fragen, weiß ich nicht. Mit Sandro will ich nicht darüber reden. Was gehen den meine Beschwerden an?«, erwiderte Hans-Jörg.
»Dann frage Cheskow, aber sei vorsichtig. Gib nichts preis, was er nicht unbedingt wissen muss. Und trefft euch an einem Ort, wo du sicherstellen kannst, dass er nicht überwacht wird. Tempelhofer Feld, zum Beispiel.«
Hans-Jörg stöhnte. »Ich bin nicht gut zu Fuß, das kannst du dir vielleicht vorstellen.«
»Muss ich dich daran erinnern, dass wir gesagt haben, wir sorgen durch unser Vorgehen solidarisch für die Sicherheit aller anderen?«, meinte Klarfeld. »Risiken muss jeder für sich selbst tragen, das ergibt sich daraus folgerichtig. Die Kosten für Behandlungen tragen wir ebenfalls solidarisch.«
»Ja, ja«, murmelte Hans-Jörg. Er drehte den nächsten Glimmstängel, der genauso krumm und knubbelig wie all seine Vorgänger geriet.
Es wurde Zeit. Klarfeld erhob sich, trat zur Balkontür und öffnete sie weit. Er spähte hinunter auf die Argentinische Allee. Minutenlang, in denen alle schwiegen.
»Sandro kommt«, sagte er. Mit einem Schritt hinaus verschaffte sich Klarfeld eine bessere Beobachtungsposition.
Wie abgesprochen, marschierte Sandro auf der gegenüberliegenden Straßenseite vorbei. Er würde an der nächsten Ampel die Straße überqueren und zurückkommen. Während dieses Manövers konnte Klarfeld prüfen, ob ihm jemand folgte. Sandro würde klingeln und Codeworte in die Sprechanlage geben. »Ich bin’s, mach auf« für „es ist alles in Ordnung“ was Klarfeld durch Öffnen bestätigen würde, wenn er gleicher Meinung war. »Ist Eddi zu Hause?«, für Gefahr. In dem Fall würde Sandro einfach weitergehen. Wenn er nicht klingelte, sondern sofort am Haus vorbeigehen würde, bedeutete das: Haut sofort ab. Sie würden ihre Fluchttaschen nehmen und das Haus zur Rückseite verlassen, zügig, aber ruhig durch die Grünanlagen zwischen den Blocks laufen und sich trennen.
Sandros Besuch war also stets mit einer gewissen Spannung verbunden.
Wir spielen Räuber und Gendarm, dachte Klarfeld, während er die Straße nach verdächtigen Personen absuchte. Dazu noch ziemlich paranoid.
Die Baumreihe, die den Häuserblock von der Straße trennte, entwickelte frisches Grün. Nicht mehr lange, und der Beobachtungsposten war wertlos. Zumal der Balkon gegenüber dem anschließenden Teil des Wohnblocks zurücksprang, was ohnehin das Sichtfeld gehörig einschränkte. Die Paranoia erforderte also baldiges Umziehen.
Es klingelte. Klarfeld war schon auf dem Weg zur Sprechanlage.
»Ich bin’s, mach auf«, klang es verzerrt aus dem Lautsprecher.
Klarfeld atmete auf und betätigte den Öffner.
3
Behördenflure waren letztlich überall gleich. Deswegen war Sandro froh über den Treffpunkt. Mitten unter Touristen mit Blick auf die Spree. Ein paar Meter weiter spielte ein Typ Saxofon. Weit genug weg, um nicht zu stören, und doch so nah, dass sie als interessierte Zuhörer gelten konnten, die zudem die Frühlingssonne genossen.
Sandro nippte an seinem Kaffee.
»Also?«
Das fing ja gut an. Wenn Welsch dermaßen einsilbig loslegte, hatte er sicher schlechte Laune.
»Gibt’s Probleme?«, fragte Sandro.
»Das will ich wissen«, erwiderte Welsch.
Er war drauf und dran, das Bild von den Freunden, die sich zum zwanglosen Gespräch in die Sonne gesetzt hatten, zu zerstören. Sandro sah sich kurz um. Ihn befiel unvermittelt das Gefühl, alle Welt wüsste, dass er sich mit Welsch zu einem konspirativen Gespräch niedergelassen hatte. Sein Verstand sagte, die Blicke der Vorbeigehenden galten nur der Bank, auf der sie so viel Platz wie möglich eingenommen hatten, damit sich niemand dazusetzte.
»Also?«, fragte Welsch erneut.
Sandro holte tief Luft. Er musste Welsch etwas geben und durfte keinen Fehler machen. »Bezüglich des Verstecks habe ich nichts herausgefunden.«
Welsch schwieg einen Moment. »Haben Sie einen Bericht geschrieben?«, fragte er schließlich.
»Ja, sicher.« Sandro griff in die Jackentasche und zog zwei vierfach gefaltete Blätter heraus.
Welsch nahm sie und steckte sie ein. »Kurze Zusammenfassung«, sagte er.
Sandro sah zum Saxofonspieler hinüber. Dann drehte er den Kopf zu Welsch und kam näher. »Ich habe dreimal mit Cheskow geredet, aber der ist meistens so betrunken, dass er nicht weiß, was er redet. Mit Marco Gantner von der Roten Hilfe war ich zweimal zum Essen, da bin ich ebenfalls nicht weitergekommen.«
»Sehr mager«, meinte Welsch beiläufig. »Ich weiß nicht, ob das den finanziellen Aufwand lohnt.«
Das konnte Sandro nur als unverhohlene Drohung verstehen und sicher war es auch so gemeint. Er musste etwas liefern, so viel war klar. »Ich glaube, ich habe Valentina Rizzitelli gesehen. Hier in Berlin«, entfuhr es ihm spontan, um sich zu entlasten.
»Valentina Rizzitelli?«, fragte Welsch nachdenklich. »Wer ist das? Suchen wir die?«
»Sie steht auf der Liste derer, die sich der Überwachung entzogen haben.«
»Interessant. Wo?«
»Im Rockets. Das ist ein Club am …«
»Weiß ich.« Welsch wischte den Erklärungsversuch beiseite. »Wo wohnt Rizzitelli?«
Sandro hob bedauernd die Schultern. »Keine Ahnung. Ich habe sie verfolgt, aber sie ist mir auf einem Fahrrad entwischt. Mit dem Auto konnte ich nicht folgen.«
Welsch verzog das Gesicht. Ihm war die Unzufriedenheit deutlich anzumerken. »Das hilft uns jetzt nur wenig«, brummte er.
Ein junges Paar blieb nahe bei der Bank stehen und sah zu, wie ein Touristenboot flussabwärts vorbeizog. Die Lautsprecheransagen für die Passagiere auf dem vollbesetzten Oberdeck hallten herüber. Die Regierungsgebäude und der nahe Hauptbahnhof gaben dem Fremdenführer genügend Stoff zum Aufschneiden.
Sandro und Welsch schwiegen, bis sich die beiden entfernt hatten.
»Rizzitelli arbeitet in dem Club als Türsteher.«
Welsch drehte den Kopf vom Fluss zu Sandro. »Türsteher? Eine Frau?«
Sandro rief sich die Person in Erinnerung, die er gesehen hatte. Er fragte sich, wie schon zuvor, ob er sich nicht irrte. Aber das Gesicht kannte er so gut, dass er glaubte, er konnte sich nicht irren. Außerdem passten Haarfarbe und die geringe Körpergröße. Nur die Figur und der raspelkurze Haarschnitt verunsicherten ihn. »Sie sah aus wie ein Kerl. Das muss Bodybuilding sein.«
»Pah«, machte Welsch abfällig. »Nutzt uns das irgendwie?«
»Keine Ahnung. Aber es wäre sicher interessant herauszukriegen, was sie hier treibt. Wir brauchen jemanden, dem die alten Genossen vertrauen und der Kontakt zu ihnen herstellen kann. Sie wollen doch rauskriegen, wo der nächste Raubüberfall stattfindet. Oder etwa nicht?«
»Doch, doch«, meinte Welsch. »Interessant für uns ist außerdem, ob die an ein altes Gelddepot rankommen können.«
Sandro schüttelte langsam den Kopf. »Ob es eins gibt, ist nicht bewiesen.«
»Natürlich gibt es eins«, erwiderte Welsch energisch, dämpfte aber dann hastig seine Lautstärke. »Die haben mehr eingesackt, als sie ausgegeben haben. Wir haben das mehrfach nachgerechnet. Zwei Aussteiger haben uns bestätigt, dass unsere Rechnung stimmt.«
Sandro zuckte mit den Schultern. Sollte Welsch glauben, was er wollte, wenn er schon nicht von dieser Überzeugung abzubringen war. Die wichtigere Frage lautete, wie er das Depot vor Welsch ausfindig machen konnte und ob es jemand schon ausgeräumt hatte.
»Haben Sie mit dieser Rizzitelli sprechen können?«
»Nein.«
»Hat sie Sie gesehen? Ich meine erkannt?«
Sandro schnaufte. »Das kann ich nicht sagen. Ich denke eher nicht. Ich stand in der Schlange vorm Einlass und sie war damit beschäftigt, einen Typen zu vermöbeln.« Die Erinnerung brachte ihn kurz zum Beben.
»Spricht etwas dagegen, sie zu kontaktieren? Sie könnten vorfühlen, ob sie etwas weiß und uns unterstützen würde.«
Sandro zögerte mit der Antwort. Die Idee behagte ihm nicht, obwohl er schon erwartet hatte, dass Welsch ihn zur Kontaktaufnahme auffordern würde. Schlagartig wurde ihm klar, es wäre besser gewesen, die Klappe zu halten. Spontaneität gehörte in seiner Situation zu den Todsünden. »Besser nicht. Wir hatten damals tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten«, sagte er. Welsch hörte gerne Metatexte über die politischen Konstellationen der Vergangenheit und nun würde er sie liefern. Er hoffte ihn damit von dem heiklen Punkt abzulenken. »Es ging um den Kurs der Brigate Rosse. Rizzitelli war dafür, Kontakt zu den Geheimdiensten aufzunehmen. Die waren beauftragt, den Jaltaer Status aufrechtzuerhalten, den Roosevelt, Stalin und Churchill vereinbart hatten. Danach gehörte Italien eindeutig zum Westen und durfte keinesfalls kommunistisch werden. Uns war klar, dass etliche der Anschläge von einer Gruppe begangen wurden, die aus verschiedenen Behörden rekrutiert worden war. Alles, um den historischen Kompromiss zwischen der KPI und den Christdemokraten zu verhindern, indem in der Öffentlichkeit alles Linke unter Terrorverdacht geraten sollte. Rizzitelli meinte deswegen, wir müssten SISDE unterwandern, um an Informationen zu kommen und damit sie nach unserer Pfeife tanzen.«
Welsch sah ihn scharf an. »Und Sie waren dagegen, den italienischen Geheimdienst zu unterwandern? Immerhin haben da weit über tausend Leute aus unterschiedlichen Behörden gearbeitet, die alle überprüft werden mussten. Die Chancen standen also nicht schlecht. Insbesondere bei der bekannten Schlampigkeit der Italiener.«
Sandro war wütend, hielt dem Blick aber stand. Eine Frage der Ehre und Selbstachtung. »Genau. Ich war jung und radikal und glaubte, wir schaffen es auch so.«
Welsch lachte. Er strich sich die von einer Brise zerzausten Haare aus der Stirn. »Aber bei mir wird nicht unterwandert, um das mal ganz klar zu sagen.« Sein Blick ruhte schwer auf Sandro. »Und Rizzitelli war nicht jung und radikal?«, fragte er nach einer kurzen Pause.
»Doch, aber eben anderer Meinung. Ich habe mich irgendwann doch zum historischen Kompromiss bekannt. Wie das bei Rizzitelli heute ist, kann ich nicht einschätzen. Aber sie hasste mich und es wäre vielleicht besser, wenn ich erst mal nicht mit ihr in Kontakt trete. Über ihren Job müssten Sie eigentlich leicht rauskriegen, wo sie wohnt. Besser, wenn ich sie vorsichtig beobachte, bis wir wissen, wie sie zu mir und den alten Genossen steht.«
Welsch schwieg. Das nächste Schiff ließ auf sich warten. Fußgänger waren weit weg und der Saxofonist hatte eine Pause eingelegt. Eine für Berlin untypische Stille trat ein. Sandro hoffte, Welsch würde seine Erklärungen plausibel finden. Noch eine unberechenbare Spielfigur unauffällig aufs Feld zu bringen, konnte sich als sehr nützlich erweisen.
»Haben Sie irgendwelche Ideen, wie Sie weiterarbeiten wollen?«, fragte Welsch nach geraumer Zeit.
In diesem Moment endete die Stille. Das Saxofon erklang und ein Ausflugsboot schob sich vom Kanzleramt kommend in ihr Sichtfeld.
»Eine habe ich Ihnen ja eben beschrieben. Dann Cheskow weiter löchern und sehen, ob ich bei der Roten Hilfe auf jemanden treffe, der mir was erzählt.«
»Bis jetzt hat das nichts gebracht. Warum soll sich daran etwas ändern?«
»Bleibt mir denn etwas übrig, außer dranbleiben und bohren?«, fragte Sandro zurück.
»Ich brauche Ergebnisse«, sagte Welsch düster. »Die Kosten erfordern bald eine Rechtfertigung.«
Darauf hatte Sandro keine Antwort. Die brennendste Frage für ihn lautete, wie lange er an dem Konstrukt aus Halbwahrheiten und Mehrdeutigkeiten noch weiterbauen konnte, bevor ihn Welsch abservieren würde. Geschehen würde das, wenn der Leiter der Fahndungsgruppe keine Aussicht mehr sah, seine Karriere mit einem Ermittlungserfolg abzurunden. Welschs Vorrat an Geduld schien zur Neige zu gehen. Sandro musste sich bald eine Notfallstrategie zulegen, das wurde ihm gerade sehr deutlich.
Welsch erhob sich. »Ich sehe zu, was ich über Rizzitelli in Erfahrung bringen kann. Von Ihnen möchte ich zeitnah konkrete Ergebnisse bekommen. Spätestens Ende nächster Woche treffen wir uns wieder.« Er nickte Sandro zum Abschied zu und ging.
Sandro sah ihm nach. Welsch holte eine Münze aus der Tasche seines Trenchcoats und warf sie in den geöffneten Instrumentenkoffer des Saxofonisten. Dann spazierte er die Rampe von der Uferpromenade zum Hauptbahnhof hinauf. Augenblicke später geriet er außer Sicht.
Die Sonne wärmte Sandros Gesicht. Der Kaffee war kalt geworden und schmeckte viel zu bitter. So bitter, wie der Gedanke an Valentina. Natürlich war es Liebe, sagte er sich. Zugegeben, er hatte sich nicht immer fair verhalten. Im Gegensatz zu ihr. Trotzdem schmerzte es, sie mit diesen Muskelbergen und der Aggressivität zu sehen. Warum hatte sie sich so verändert? Sandro schloss die Augen und versuchte nachzudenken.
4
Die ausgebreitete Straßenkarte knisterte unter Klarfelds Händen, wenn er sein Gewicht verlagerte, um eine Stelle anzuzeigen. »Hier fährt er immer entlang. Muss er ja, wegen der Baustelle. Ab hier hat er dann mehrere Möglichkeiten. Also müssten wir zwischen der Schildhornstraße und der Kreuznacher Straße die Aktion durchführen. Einverstanden?«
»Im Prinzip ja«, antwortete Hans-Jörg. Er schob seine Lesebrille ein Stück weiter den Nasenrücken hinunter. »Ich frage mich bloß, ob wir nicht lieber zu dritt zuschlagen sollten. Was Sandro angeht, habe ich ein blödes Gefühl.«
»Ich frage mich, ob du nicht an kleinbürgerlichem Neid leidest, Hans-Jörg«, warf Silke ein.
»Blödsinn«, zischte Hans-Jörg. Er beugte sich von dem Hocker vor, um seine Beine zu massieren.
Silke lachte auf. »Cheskow gegenüber bist du gutgläubig, obwohl der labil ist und dazu noch säuft. Sandro unterstützt uns und knüpft Kontakte, verschafft uns Informationen, aber ihm misstraust du. Das ist unlogisch.«
»Kleinbürgerlich ist deine Psychologisiererei.« Hans-Jörg zündete sich eine Zigarette an.
»Du beneidest Sandro, weil er sich relativ frei draußen bewegen kann. Ganz nebenbei leimt er das LKA und den Staatsschutz und hält uns aus der Schusslinie. Er ist noch aktiv, während wir nur noch rumsitzen und die Zeit totschlagen. Außerdem ist Sandro jünger und fitter als wir alle zusammen.«
»Ich frage mich, wer hier Sandro beneidet«, murmelte Hans-Jörg.
Klarfeld erhob sich, drückte die Knie durch und humpelte steifbeinig zum Fenster, um es zu öffnen. Langes Sitzen bekam ihm immer weniger. Der Verkehrslärm von draußen mischte sich mit dem Gequake aus dem Radio. Er beschloss, es wurde Zeit, wieder auf den Punkt zu kommen. »Alternativ könnten wir uns ein anderes Ziel wählen. Also wieder einen Supermarkt. Weniger riskant und aufwändig, aber auch weniger Ertrag. Zudem schaffen wir das locker zu dritt«, sagte er, als er wieder vor der Karte stand, die den Fußboden zwischen ihnen bedeckte.
Hans-Jörg wollte etwas sagen, aber ein Hustenanfall stoppte ihn.
»Soll ich helfen?«, fragte Silke. Sie wartete die Antwort nicht ab. »Das Kapital sollten wir an seiner empfindlichsten Stelle treffen. Das ist die Infrastruktur, also die Geldströme, die sollten wir unterbrechen und trockenlegen.« Sie brach in Lachen aus. »Wir schöpfen mit einem Löffelchen aus einem Ozean.«
»Du glaubst an überhaupt nichts mehr, was?«, meinte Hans-Jörg mit hustenkratziger Stimme.
»Aber ja doch, wir schöpfen immerhin mit revolutionärem Elan …«
»Hör auf, Silke, das hilft uns nicht weiter. Für uns besteht gewissermaßen die historische Notwendigkeit, Enteignungen zu unseren Gunsten vorzunehmen. Vielleicht sind wir keine Stadtguerilla mehr, keine Revolutionäre, aber immer noch Feinde des Systems. Als solche müssen wir für uns selbst sorgen. Zumindest zeigen wir so dem Klassenfeind, dass er nicht auf ganzer Linie siegen kann.« Klarfeld setzte sich in einen Sessel.
Silke erhob sich erstaunlich locker, wie Klarfeld fand, aus dem Schneidersitz von ihrem Bodenkissen. »Wollt ihr auch Kaffee?«, fragte sie.
Klarfeld nickte. »Kaffee ist prima.«
Von Hans-Jörg kam keine Antwort. Erst als Silke in der Küche war, meldete er sich wieder zu Wort. »Was ist mit Silke los? Warum zickt sie dauernd rum?«
Klarfeld zuckte mit den Schultern. »Gefällt dir etwa unser Dasein? Dauernd vorsichtig sein und mit denselben alten Nasen zusammenhocken? Wir sind so etwas wie ein altes Ehepaar zu dritt. Manchmal geht mir das auch ziemlich auf die Nerven. Zum Beispiel dein Gequalme und Gehuste.«
»Was bleibt mir denn noch außer Rauchen? Saufen vertrage ich nicht mehr und eine Frau kann ich auch nicht mehr aufreißen, mal so unter uns gesagt.« Hans-Jörg hustete sich Schleim von den Bronchien. »Silke muss ja nicht immer bei uns rumhängen. Sie könnte in ihrer Bude bleiben.«
»Ja, könnte sie«, meinte Klarfeld. »Das heißt aber mehr Risiko, wenn wir uns zu Besprechungen treffen müssen. Eigentlich braucht sie eher wieder eine fürs Bett, wenn du mich fragst.« Er verstummte, weil Silke mit Kaffeegeschirr zurückkam.
»Hab dir auch eine frische Tasse mitgebracht«, sagte sie und stellte Hans-Jörg einen weißen Kaffeepott vor die Nase.
Hans-Jörg sah kurz zu ihr auf. »Danke.«
»Entschuldige, ich nerve dich manchmal, das weiß ich. Du mich aber auch. Eigentlich ihr beide. Ich glaube, ich brauche Tapetenwechsel. Wenn wir den Coup gelandet haben, möchte ich ein paar Wochen verreisen. Okay?«
»Gute Idee«, erwiderte Klarfeld. »Wir könnten alle ein bisschen Abstand gebrauchen. Im Übrigen bin ich immer noch für den Geldtransporter, schon aus ideologischen Gründen und wegen der Symbolik. Wegen mir ohne Sandro, es kann immerhin sein, dass doch hinter ihm hergeschnüffelt wird.«
»Supermärkte sind der derselbe Kapitalismus wie Geldtransporte«, sagte Silke, bevor sie hinausging, um den Kaffee zu holen.
»Stimmt«, meinte Hans-Jörg hinter ihr her. »Aber lieber einmal größer kassieren mit weniger Publikum.«
»Wir sind beide für den Transporter. Du?«, fragte Klarfeld, als Silke mit der Drückkanne das Zimmer betrat.
»Es war meine Idee, nicht eure. Wenn schon, dann Geldtransporter anstatt Supermarkt. Überzeugt davon bin ich trotzdem nicht. Aber egal, ihr hättet mich sowieso überstimmt«, lautete ihre Antwort.
»Wir wollen doch nicht diesem beschissenen Mehrheiten-Parlamentarismus dienen«, erwiderte Hans-Jörg. »Ich möchte das gerne ausdiskutieren und basisdemokratisch Konsens herstellen. Zu dritt müssten wir das hinkriegen.«
Silke lachte. »Na gut. Dann habe ich einen besseren Vorschlag: Wenn wir das Gelddepot im Grunewald ausfindig machen, sind wir mit einem Schlag unsere Sorgen los. Für ziemlich lange. Keine bewaffneten Aktionen mehr und kein Risiko.«
Klarfeld und Hans-Jörg schnauften unisono. »Ob das Depot noch existiert und wie viel Geld dort lagert, wissen wir nicht. Selbst wenn, wie sollen wir daran kommen? Wir haben schon alles versucht, ohne irgendeinen Erfolg«, sagte Klarfeld.
»Noch was«, grunzte Hans-Jörg. »In dem Versteck würden D-Mark liegen. Niemand kann Zigtausende in Euro eintauschen, ohne dass es auffällt.«
Mit einer gefüllten Tasse faltete sich Silke wieder auf dem Sitzkissen zusammen. »Ich hätte schon noch Ideen.« Sie trank einen Schluck. »Mir ist eingefallen, dass wir mit Helga reden könnten. Ich bin sicher, sie kann uns weiterhelfen. Helga wohnt irgendwo bei Osnabrück. Zum 2. Juni hat sie zwar nicht direkt gehört, war aber mit einer Genossin zusammen, die dazugehört hat. Wenn ich mich recht entsinne, haben die drei oder vier Mal in Banken jede Menge Geld abgezogen. Das müssten mehrere Hunderttausend gewesen sein. Bis sie geschnappt wurden, hatten sie nur wenig Zeit, was davon auszugeben, da sollte eine Menge übrig geblieben sein. Für den Umtausch brauchen wir viele Helfer. Jede Person eine kleinere Summe, schön über die Republik verteilt und zeitlich gestreckt. Dann klappt das schon.«
Eine Schweigepause entstand. Klarfeld erhob sich und stellte sich ans Fenster. »Und wenn sie sich nach der Entlassung das Geld geholt haben?«, fragte er schließlich.
Silke raschelte mit ihrem Kissen. »Glaube ich nicht. Die Bullen haben sie garantiert überwacht. Wenn sie es doch geholt hätten, wäre eine Menge Geld in der Szene im Umlauf gewesen, so wie es war, als Winfried und Conny das Depot der Kommandos O’Hara, Aker und Ensslin aufgelöst haben. Das ist aber nur einmal vorgekommen.«
Klarfeld drehte sich um und betrachtete Silke. Sie wirkte so überzeugt und selbstsicher, dass es einen Funken Hoffnung in ihm auslöste. »Ist diese Helga zuverlässig?«, fragte er.
»Früher war sie es. Im Prozess hat sie als Zeugin geschwiegen und dafür Beugehaft abgesessen.«
»Kannst du sie kontaktieren?«
»Ich müsste mich ein bisschen umhören. Ihre Schwester wohnt noch in Berlin, glaube ich. Sie war Requisiteurin im HAU.«
Klarfeld drehte sich um. »Gut, mach das. Sandro kann dir helfen. Aber ob etwas dabei herauskommt, wissen wir nicht. Es wäre natürlich sehr gut für uns. Der historischen Gerechtigkeit würde es ebenfalls dienen. Wegen ihrer Trittbrettfahrerei. Mit ihrem Berliner Klamauk haben die Typen vom 2. Juni unseren Kampf lächerlich gemacht. Dabei hätte es sie ohne uns nicht gegeben, noch nicht mal geben können. Also, weil wir schnell Kohle brauchen, würde ich sagen, wir nehmen uns den Geldtransporter trotzdem vor. Das heißt, den Ort für die Aktion besichtigen und festlegen, einen Plan aufstellen und die Bewaffnung bereit machen.«
Klarfeld spürte, wie ihn der Gedanke belebte. Ein bisschen vom revolutionären Elan steckte tatsächlich noch in ihm und ihnen allen würde es guttun, wenn sie aus ihrer Lethargie herauskämen.
»Lasst uns dem Kapital mal wieder richtig eins in die Fresse geben«, sagte er und musste dabei lachen wie lange nicht mehr. Es war Sarkasmus pur.
5
Arschloch, dachte Sandro, Arschloch, verdammtes. Wen er genau damit meinte, wusste er selbst nicht. Welsch, weil der Kriminaloberkommissar ihm diesen Scheißtyp von Verfassungsschützer an die Backe geklebt hatte, oder diesen Typ selbst. Jedenfalls hatte Welsch beim Durchforsten der Meldedaten Valentina Rizzitelli nicht gefunden. Vielleicht glaubte er Sandro nicht, dass es sie gab. Dachte, Sandro könnte sie erfunden haben, um zu kaschieren, dass er sonst keine brauchbaren Informationen lieferte.
Hilgert hieß sein Aufpasser, den Vornamen hatte er nicht verraten. Von Sandro ließ er sich siezen. Wahrscheinlich, um klarzumachen, dass er was Besseres war. Sandro hatte kurz überlegt, ob er sich mit Castellani, seinem Nachnamen, vorstellen sollte. Um im gewohnten Fahrwasser zu bleiben, hatte er sich dagegen entschieden.
Hilgert war in einem BMW gekommen. Der Wagen roch nach Kunststoff und dem Zigarettenqualm, den Hilgert unablässig produzierte. Er steuerte die Kiste, als wäre er kein Fahrzeuglenker, sondern ein Weltenlenker mit allen erdenklichen Privilegien. Er drängelte, bremste aus und nahm die Vorfahrt nach Belieben. Über die provozierten Hupkonzerte grinste er nur.
Für Sandro gab es in dieser Situation keine Möglichkeit mehr, mit Valentina so in Kontakt zu treten, wie er es sich überlegt hatte. Hilgert ließ keinen Zweifel daran, dass der Kontakt von Amts wegen erfolgen würde und Hilgert dabei den Ton angab.
»Die Kleine hat sich also ein paar Muskeln antrainiert«, sagte Hilgert belustigt. »Na, ich werde schon mit ihr fertig.«
Sandro kommentierte das nicht. Sein Nebenmann war eher fett als muskulös.
Hilgert sah ihn kurz von der Seite an. »Warum treiben Sie sich eigentlich in letzter Zeit so häufig in Zehlendorf rum?«
Sandro erstarrte für einen Moment. Hilgert war demnach schon länger auf ihn angesetzt. Natürlich war er sich bewusst gewesen, dass Welsch ihn beobachten ließ. Wie intensiv, blieb allerdings offen. Was wusste Hilgert also?
»Ich suche eben Klarfeld und Konsorten. Wussten Sie das nicht?«
»Natürlich«, erwiderte Hilgert, milde Verärgerung in der Stimme. »Aber warum in Zehlendorf? Hinweise in Ihren Berichten konnte ich nicht rauslesen.«