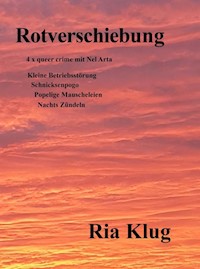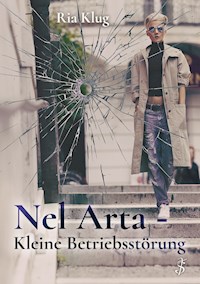Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Querverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: quer criminal
- Sprache: Deutsch
Karla ist knapp fünfzig, ehrgeizlose Germanistin und überzeugte Wahlberlinerin, die sich schon seit Jahren mit Taxifahren über Wasser hält. Eines Nachts stürzt ein angeschossener Mann in ihren Wagen, den sie unfreiwillig vor seinen Angreifern rettet und damit in Machenschaften der Organisierten Kriminalität verstrickt wird. Zudem hat sich Karlas Partnerin Britta, die beim Flüchtlingsrat aktiv ist, in eine andere Frau verliebt: Semret, eine geflüchtete Ärztin aus Eritrea, die Geld für die Anerkennung ihres Berufs in Deutschland auftreiben muss und deshalb immer wieder Verletzte behandelt, die nicht mit den Behörden in Berührung kommen wollen. Nachdem sie einen Angeschossenen verarzten soll, wird klar, dass sie alle drei ins Visier derselben Verbrecher geraten sind, die mit Teilen der Politik und der Polizei unter einer Decke stecken. Schnell müssen sie erkennen, dass nicht nur ihr Leben auf dem Spiel steht, sondern auch das zahlreicher anderer Menschen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Handlung, die Figuren und manche Schauplätze dieses Romans sind fiktiv. Ähnlichkeiten mit lebenden und toten Personen sind unbeabsichtigt.
Erste Auflage März 2017
Lektorat: Lara Ledwa
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag und grafische Realisierung von Sergio Vitale unter Verwendung eines Fotos von fotolia (© peapop).
ISBN 978-3-89656-635-5
Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis an:
Querverlag GmbH
Akazienstraße 25, 10823 Berlin
www.querverlag.de
1
September 2013
Im Lauf der Nacht war ein aggressiver Wind aufgekommen. In feuchten Böen fegte er über sie hinweg und kühlte alles aus. Sie fror entsetzlich. Allmählich stieg auch noch Übelkeit in ihr auf. Da sie nichts im Magen hatte, bestand jedoch kaum Gefahr, dass sie sich übergeben musste, und weil es nichts mehr zu trinken gab, war ihr Mund zu trocken, um auszuspucken.
Samel drängte sich Schutz suchend an sie, zumindest wollte sie es so fühlen. Seine Nähe schenkte ihr ein wenig Geborgenheit, anders als das unvermeidliche Gedränge der zu vielen Menschen auf diesem luftgefüllten Stückchen Hoffnung.
Sie wünschte, sie könnte schlafen, aber jedes Mal, wenn der Wind Gischt von einem Wellenkamm abriss und über das Boot verteilte, schreckte sie hoch. Das Stück Stoff, das sie bei El Dabaa, ein paar Tage westlich von Alexandria, aus einem Abfallhaufen gezogen und am Strand gewaschen hatte, war völlig durchnässt. Die halbe Nacht hatte es gewärmt, aber damit war es vorbei. Schwer lag es nun auf ihnen. Für eine Fahrt über das Meer war es genauso wenig geeignet wie sie selbst.
Trotzdem, es war ein gutes Stück Stoff von undefinierbarer Farbe. Tagsüber diente es als Sonnenschutz und nachts als Schlafdecke. Während sie nach Westen gefahren war, hatte sie sich die Zeit vertrieben, indem sie darüber spekulierte, was zum Muster gehörte und was bloß Flecken waren.
Da sie nicht mehr viel besaß, war ihr der Stofffetzen zur zweiten Haut geworden, zur Schutzhülle und zum Trost in der Einsamkeit.
Sie hätte gerne gewusst, wie spät es war. Im Osten gab sich die Andeutung eines bleichen Lichts zu erkennen.
Mittags, hatte der Bootsführer gesagt, würden sie ihre Füße in europäischen Sand setzen können.
Einfach würde sie es dort nicht haben, das war ihr klar. Andere hatten Wunderdinge erzählt, wie viel man verdienen könne, wenn man bloß irgendwo bei der Ernte half, und wie schnell man sich ein angenehmes Leben aufbauen könne.
Sie war Realistin genug, um darin ein Gutteil Wunschdenken zu erkennen. Dass es auch in Europa Fremdenfeindlichkeit gäbe, hatte sie gehört, und manche von denen, die den langen Weg aus dem Elend hinter sich gebracht hatten, kämen dort nicht mehr auf die Beine.
Aber wenigstens sollten die Willkür und die Gewalt, denen sie zu Hause und unterwegs ausgesetzt gewesen war, in Europa ein Ende haben. Dort gab es keinen jahrelangen Militärdienst, sondern Demokratie, Schulen und Universitäten, öffentliche Fürsorge und gute Arbeit. Sie war jung und würde sich anstrengen und das reichte ihr als Aussicht.
Zögernd wich die Nacht, allerdings war der Himmel bedeckt und das Meer, das sich gestern noch in ebenmäßig strahlendem Tintenblau präsentiert hatte, war nun zu einem abweisenden, stumpfen Grau verkommen. Weiß schäumend und ruppig türmten sich Wellen, soweit ihr Blick reichte.
Immer wieder sackte das Boot in ein Tal hinein, wurde angehoben und dabei von dem sich sträubenden Meer bespuckt.
Die Frau neben ihr stieß jedes Mal einen kleinen Schrei aus, wenn es bergab ging. Viele andere genauso.
Sie sah zum Bootsführer hinüber. Der bärtige Mann hielt das Ruder umklammert und starrte angestrengt voraus. Wind zerrte an seinem Hut und klappte die Krempe um, sodass er sie ständig zurechtzurren musste. Sein Gehilfe hockte vor ihm und hielt die restlichen Benzinkanister fest.
Niemand solle telefonieren, schon gar nicht mit der Küstenwache, hatte er ihnen eingeschärft. Es komme vor, dass sie abgedrängt würden, wenn sie noch nicht nah genug an Land seien und es keine Augenzeugen gebe.
Sie wusste nicht, ob sie ihm vertrauen konnte. Über die Schlepper wurden schlimme Dinge erzählt und sie hatte selbst schon schlechte Erfahrungen gemacht. Sie war im Sudan entführt und festgehalten worden, bis ihre Mutter in Eritrea das Lösegeld aufgebracht hatte. Trotzdem hatten die Schlepper sie und die anderen anstatt zu einem Boot in Libyen nur bis zur ägyptischen Grenze gebracht und dort einfach ausgesetzt. Immerhin fuhr dieser mit ihnen mit und er hatte sie auch über das vereinbarte Geld hinaus nicht ausgeraubt. Bis jetzt jedenfalls.
»Wie lange dauert es noch?«, fragte Samel leise.
»Nicht mehr lange, mein kleiner, tapferer Held«, flüsterte sie ihm ins Ohr. Sie hatte sich angewöhnt, ihn so zu nennen, nachdem er ihr erzählt hatte, dass die Polizei seine Mutter und seine beiden Geschwister auf dem Weg zum Strand geschnappt hatte. »Lauf!«, hatte seine Mutter geschrien und er war weggerannt. Die Polizisten hatten sich keine große Mühe gegeben, ihn einzufangen, und so konnte er das Boot erreichen, das ihn und all die anderen Eritreer nach Lampedusa, diesem Bröckchen von Europa, nach dem sie sich alle sehnten, bringen sollte.
»Mereet!« Dieser Ruf auf Tigrinya schreckte sie auf. Ein junger Mann hatte sich so gut es ging am Bug erhoben und zeigte voraus. Die Aussicht, Land zu sehen, veranlasste andere, sich ebenfalls aufzurichten und Ausschau zu halten.
»Down!«, brüllte der Bootsführer, während das Boot wieder in ein Wellental hineinschlug. Diesmal klatschte ein Schwall Wasser über die Bordwand.
Erschrockenes Geschrei erhob sich, Kinder weinten und der Bootsführer rief: »No panic, only three miles!«
»Kannst du schwimmen, Samel?«, flüsterte sie in das Ohr des Jungen, als sich kurz darauf ein weiterer Schwall Mittelmeer in das Boot ergoss.
Samel nickte, aber die Angst stand ihm im Gesicht. Kein Wunder, ihr ging es genauso. Sie hatte zwar hin und wieder mit der Familie Ferien am Roten Meer verbracht, wo Onkel und Tante wohnten. Eigentlich dachte sie gerne zurück an den langen Weg aus dem Hochland von Asmara hinab in die Tiefebene bei Massaua, durch die brütende Hitze der Wüste, vorbei am Flughafen, bis sie schließlich ganz tief im Süden die Freihafenstadt Assab erreicht hatten.
Das Haus von Onkel und Tante lag in einem schattigen Garten und war von Bougainvilleen überwuchert, in denen bunte Vögel sangen. Während ihrer Flucht hatte sie sich sehr oft zum Trost für die Qualen diese Bilder in Erinnerung gerufen und sich gefragt, ob sie jemals wieder dort hinkommen könnte. Der stets freundlich lachende Onkel hatte sich sehr viel Mühe gegeben, allen das Schwimmen beizubringen, und irgendwann konnte sie es auch. Aber dort war sie im glasklaren, warmen Meer geschwommen und der sandige Grund hatte zum Greifen nah gewirkt. Wie viel graues Wasser sich hier unter ihr befand, wusste sie nicht. Aber egal, ob einhundert oder eintausend Meter, diese Tiefen waren unfassbar.
In ihre Überlegungen hinein brach das Motorengeräusch ab. Nicht wie in den Momenten, wo sie den Benzinkanister wechseln mussten, was sich immer mit Aussetzern ankündigte. Diesmal brach es einfach ab.
Sie beobachtete, wie der Kanister gewechselt wurde und der Bootsführer an der Starterleine riss. Nichts. Er zog und zog. Der Motor blieb aus.
Sie hörte den Bootsführer trotz des Rauschens fluchen. Er übergab seinem Helfer das Ruder und klappte den Motor aus dem Wasser.
Ohne Antrieb wurde das Boot hin- und hergeworfen und nahm dabei mehr und mehr Wasser auf. Der Bootsführer schrie seinen Helfer an, zeigte mit dem Arm in den Wind, dann brüllte er über das Boot: »Water out!« Dabei wies er auf die Wasserflaschen, die zwischen den Füßen dümpelten.
Nachdem ein junger Mann verstanden hatte, was er wollte, folgten andere seinem Beispiel. Aber das Schöpfen mit den wenigen Flaschen konnte das eindringende Wasser nicht aufwiegen, das war ihr sofort klar. Sie zog die Plastiktüte mit dem billigen Ball zwischen ihren Beinen heraus und schob die Grifföffnungen der Tüte über ihre linke Hand. Sie hoffte, dieser Notbehelf würde sie tragen, wenn es darauf ankäme. Eine Schwimmweste, wie sie der Bootsführer trug, hatte sich kaum jemand der Mitfahrenden leisten können, deshalb war sie auf die Idee mit dem Ball verfallen.
Nur ein kleiner Teil der Flüchtlinge würde die Fahrt über das Meer nicht überleben, hieß es. Die Chance war also groß gewesen, heil anzukommen. Wie es jetzt damit stand, war ihr nicht klar. Aber da Tausende flohen, könnte dieses Boot mit ihren gut hundert zusammengedrängten Schicksalsgefährten zu den Verlusten zählen.
Sie sah, wie der Bootsführer eine Abdeckung vom Außenborder abnahm und von Gischtfahnen geduscht an der Apparatur herumsuchte. Es machte nicht den Eindruck, als wüsste er, was zu tun war. Die hohen Wellen, das Angstgeschrei und das hektische Wasserschöpfen wirkten wie die Vorboten der unausweichlichen Katastrophe.
Der Bootsführer überbrüllte den Lärm und streckte dem jungen Eritreer, den er sich vor der Abfahrt als Übersetzer ausgesucht hatte, ein Mobiltelefon entgegen. Sie konnte nicht verstehen, was gerufen wurde, aber der junge Eritreer schrie laut auf Tigrinya in das Handy.
Wild geschüttelt drehte das Boot mit der Breitseite in den Wind und die Wellen versuchten, es anzuheben und umzukippen.
Wer sich nicht festklammerte, wurde hin- und hergeworfen und drohte über Bord zu gehen.
Sie fasste nach Samels Hand. »Halte dich am Rand fest, egal, was passiert!«, rief sie ihm zu.
Die nächste hohe Woge ergoss ein Gutteil ihres Kamms in das Boot, unmittelbar darauf wurde es so weit angehoben, als sollte das Wasser wieder hinausgekippt werden. Sie hielt sich mit Samel für Momente hoch oben, dann drehte sich die Welt, das Meer war über ihr und stürzte auf sie herab. Hart schlug es über ihr zusammen, riss sie mit, drehte, wendete und zerrte. Sie klammerte sich an die Tüte mit dem Ball, die sie durch die Fluten zog. Weißliche Schleier füllten ihr Sichtfeld, aber dann kam ihr Kopf endlich wieder an die Oberfläche. Sie atmete salzige Luft. Abgerissene, zerpflückte Schreie drangen an ihr Ohr, aber sie sah nur Wellen und Gischt. Unter ihr und um sie herum spürte sie nichts als Wasser. Etwas Großes berührte sie, wurde an ihr vorbeigetrieben. Ein Stück bunter Stoff, der Kopf einer Frau, ein Mund, der nach Luft schnappte. Ein gurgelnder Schrei, ein Bündel wurde ihr entgegengestreckt. Sie griff nach dem Säugling. Eine Welle verschluckte alles. Die heftige Strömung walkte sie durch und fetzte schließlich die Tüte mit dem Ball von ihrem Handgelenk.
Als sie das nächste Mal über Wasser kam, war sie alleine. Kein Mensch, kein Boot, nur Wasser. Die Ahnung einiger gedämpfter Rufe aus einer undefinierbaren Richtung.
Sie steuerte die nächste Woge an und versuchte sich auf deren Rücken hochheben zu lassen. Für einen kurzen Moment konnte sie über ein paar Wellenkämme hinwegsehen. Ein wenig entfernt schaukelte etwas, das der Bootsrumpf sein musste. Die tanzenden Punkte dicht dabei mussten Köpfe sein. Sie glaubte sogar, die dunkle Masse Lampedusas zu erkennen.
Sobald sie zurück ins Wellental befördert worden war, wusste sie nicht mehr, in welcher Richtung sie diese Entdeckung gemacht hatte. Der nächste Wellenkamm, sagte sie sich, und dankte ihrem Onkel und allen höheren Mächten, dass sie schwimmen konnte.
2
Mai 2014
Deutschland hatte Semret sich stets kühl vorgestellt, verregnet und warme Kleider erfordernd. Nun setzte die Hitze ihr zu. Sie überlegte, ob sie die Reihe der Anstehenden vor dem Eingang verlassen und im Schatten der Bäume warten sollte, bis sie schneller drankommen würde. Vor ihr verschwand die Schlange im Dunkel des Gebäudes und sie fragte sich, was dort vor sich ging. Registrieren müsse man sich lassen, hieß es.
Aber was bedeutete das und wie ging das vor sich? So wie in Eritrea? Aggressive Beamte, rüder Ton, die Angst, sich zu verplappern? Asyl sei das Zauberwort, das sie sagen müsse. Kein Problem, das klang so ähnlich wie im Englischen.
Die Sonne brannte ihr auf Kopf und Schultern. Den letzten lauwarmen Schluck aus der Wasserflasche hatte sie schon längst getrunken, aber ihr fehlte die Kraft, um an der Zapfstelle mehr zu holen. Zumal auch da beträchtlicher Andrang herrschte. Das letzte Mal gegessen hatte sie gestern gegen Mittag und ihr Geld war alle. Sie musste also bleiben, denn angeblich bekam man Taschengeld, wenn man registriert war. Und einen Schlafplatz in einem Haus statt der Bank in einer Grünanlage, wo sie die letzte Nacht verbracht hatte.
Jetzt ging es weiter, die Menschen vor ihr bewegten sich auf den Eingang zu.
Nach ein paar Trippelschritten war es damit wieder vorbei. Sie hockte sich hin, damit der stämmige Mann hinter ihr sie beschattete. Allerdings strahlte der gepflasterte Boden enorme Hitze ab.
Eine junge weiße Frau mit einem Arm voller Wasserflaschen tauchte neben ihr auf. Kinder umringten sie, während sie den Wartenden davon anbot.
Aus der Hocke stemmte sie sich hoch, um eine Flasche zu ergattern. Sie streckte die Hand aus, dann aber gaben die Knie unter ihr nach. Der Kreislauf, es ist bloß der Kreislauf, das wusste sie. Die Beine des Stämmigen bremsten ihren Fall, trotzdem schlug sie mit der rechten Seite hart auf. Für einen Moment war sie weg, spürte nichts, sah nichts und hörte nichts.
3
Die schwarze Frau sackte unmittelbar neben ihr zusammen. Britta ging in die Knie, stellte die Flaschen ab und schob ihr eine Hand in den Nacken, um ihren Kopf anzuheben. Der Mann, an dessen Beinen sie hinuntergerutscht war, trat lediglich mit hilfloser Miene einen Schritt zurück.
Britta nahm eine Wasserflasche. Es war die letzte, denn die Kinder hatten die anderen in Windeseile aus der Folie gerissen und mitgenommen. Sie öffnete den Verschluss, hob den Kopf der anderen weiter und drückte den Flaschenhals an die aufgesprungenen, blassen Lippen. Die Augenlider der Frau flatterten, dann blickten dunkle Pupillen Britta an. »Trink«, flüsterte sie und kippte die Flasche stärker. Wasser rann aus den Mundwinkeln über das Kinn, aber die Frau schluckte.
Nach einigen Augenblicken konnte sie die Flasche selber halten. Sie trank langsam und allmählich schwand die Blässe von ihren Wangen.
Britta fand sie erschreckend mager, fast schon ausgezehrt. Weit vorspringende Wangenkochen, die Stirn unter den kurz geschorenen Haaren wirkte kantig. Selbst die feingliedrigen Hände bestanden eigentlich nur aus von Haut überzogenen Knochen. Brittas Finger, die den Kopf der Frau hielten, spürten deren hervorstehende Halsmuskeln, die wie scharfe Grate vom Haaransatz zu den Schultern spannten.
»What is your name?«, versuchte es Britta auf Englisch.
»Semret«, kam es leise zurück.
»Do you need a doctor?«
Semret antwortete etwas, das entfernt nach Englisch klang. Britta verstand nur »doctor« und »me«. Sie fragte noch mal und diesmal glaubte sie zu verstehen, dass Semret behauptete, sie sei selbst Ärztin.
»You are a doctor yourself?«, fragte sie zur Sicherheit.
Semret nickte.
»You’re okay?«
Semret nickte wieder.
»From where do you come?«, fragte Britta weiter.
»Eritrea.«
»A very long way«, meinte Britta. Sie wollte das Gespräch am Laufen halten und glaubte, dass es Semret helfen würde, wenn sie von sich erzählen konnte.
Tatsächlich kam Semret ins Reden, wovon Britta allerdings vieles nicht verstand. Das Englisch klang in ihren Ohren so eigenartig, nahezu wie eine fremde Sprache. Sie musste viel nachfragen, stellte dabei jedoch fest, dass sie sich Stück für Stück an die Aussprache gewöhnte.
Anscheinend war Semret auf der Suche nach ihrer Tochter, aber als Britta anbot, das Kind auf dem Platz vor dem Amt zu suchen, während sie weiter anstand, wehrte sie ab. Die Tochter sei hoffentlich irgendwo in Berlin oder Deutschland und sie müsse auf dem Amt nach ihr fragen.
Als die Schlange erneut ein Stück vorrückte, half Britta Semret auf die Beine. Dabei wurde offenbar, dass Semret nicht nur sehr dünn war, sondern ihr auch nur bis zum Kinn reichte. Britta überzeugte sich, dass Semret alleine stehen konnte, und zog los, um ihr etwas zum Essen zu besorgen.
Von Semret wurde sie mit einem dankbaren Blick bedacht, als Britta ihr die Tüte mit dem belegten Baguette und eine weitere Flasche Wasser brachte.
Es tat gut zu sehen, wie sie aß und trank. Britta hätte sie am liebsten umarmt, ihre knochigen Schultern umfasst, um von ihrer eigenen Weichheit etwas hinüberfließen zu lassen. Aber da sie nicht das Rote Meer ein zweites Mal für Semret teilen konnte, bezähmte sie den Gedanken und begnügte sich damit, Semret in die Zentrale Aufnahmestelle hineinzubegleiten. Wenigstens würde sie ihr beistehen können, wenn sie hier auf Probleme stoßen würde. Den Angestellten wurde ein gelegentlich ziemlich rüder Ton nachgesagt.
4
September 2014
Zum Teufel, Metins waidwunder Blick würde sie wieder empfangen und Karlas schlechtes Gewissen weiter befeuern. Sie schwitzte heftig, als sie mit schnellen Schritten in den Hof einbog.
»Merhabalar, Kawa«, rief Erol ihr zu, während er mit einer grünen Gießkanne und einer Flasche Scheibenklar zur Zwei-eins-sechs-zwei eilte. Das elfenbeinfarbene Taxi wartete mit geöffneter Motorhaube auf seine Zuwendung.
Karla war erleichtert. Glück gehabt, es war zwar schon fünf nach, aber solange der Junge noch Wagenpflege betrieb, konnte sie ohnehin nicht los.
Vor allen Dingen vor der Nachtschicht vergaß sie oft die Zeit, sodass sie in rasender Geschwindigkeit ihre Sachen zusammensuchen und aus dem Haus zur U-Bahn hasten musste. Vier Stationen zur Hermannstraße hatte sie ungeduldig ertragen müssen, bevor sie zu Fuß weiter in die Silbersteinstraße hetzen konnte. Manchmal dachte sie, dass dieses schnelle Atmen durch die Anstrengung, in der Straße mit der schlechtesten Luft Berlins, sie irgendwann tot umfallen lassen würde.
Karla grinste. An diesem Abend hatte sie es überlebt. Zweifach sogar, denn so wie es aussah, hatte auch Erol getrödelt und Metins Blicke blieben ihr erspart. Erol war der Sohn vom Chef, aber ein lieber Junge, immer hilfreich, auch wenn er es nicht darauf anlegte.
Noch ziemlich außer Atem quetschte Karla ihren Rucksack unter den Fahrersitz, nachdem sie ihn passend für ihre Größe nach vorne geschoben hatte.
»Bitte, Kawa, nicht wackeln«, rief Erol.
Sie stieg behutsam aus und gesellte sich zu ihm.
»Nenn mich doch nicht dauernd Kawa. Sag mal, kannst du endlich Gökhan mal klarmachen, er soll nicht in der Taxe rauchen? Das stinkt furchtbar und außerdem lässt er seinen Müll dauernd liegen.«
»Fertig«, sagte Erol. Er klinkte den Haltestab aus und ließ die Motorhaube sanft in den Verschluss sinken.
Karla mochte die Art, wie er mit der Mechanik umging. Stets gefühlvoll und nie grob. Aber Erol mied auch Streit und das war lästig.
»Ich habe es ihm schon gesagt, aber er hört nicht auf mich. Papa denkt, du sollst dich nicht so anstellen, weil er auch raucht. Lüfte noch so lange, bis ich saubergemacht habe.«
Mit seinen langen, feingliedrigen Fingern zog er den Ascher heraus. Gökhan hatte einen Apfelgrieb zu den Kippen hineingequetscht.
Sie half Erol beim Einsammeln von Bonbonpapieren und verknüllten Futtertüten. Sie stopften alles in einen grüntransparenten Plastikbeutel, in dem noch ein Rest Fladenbrot seines Schicksals harrte.
Karla seufzte. »Ist dein Papa da?«
»Nein, der hat eine Tour nach Schönefeld.« Erol leerte den Ascher in die Tüte. Dann klopfte er ihn sachte auf das Pflaster, sodass der Belag herausstaubte. »Kannst du wieder mit mir einkaufen gehen?«, fragte er, während er den Ascher zurück an seinen Platz steckte.
»Schon wieder?« Karla schnaufte. So viel Spaß machte das auch nicht.
»Das dünne Zeug ist so schnell kaputt. Außerdem brauche ich wieder ein paar Sachen für das Gesicht.«
Da musste Karla grinsen. »Gerade damit kenne ich mich am wenigsten aus.«
Nun seufzte Erol. »Ich will dich nicht nerven, aber ich weiß nicht, wen ich sonst fragen soll. Wenn du ein bisschen Zeit mitbringst, lade ich dich danach zum Essen ein.« Er sah Karla so bittend an, dass sie nicht widerstehen konnte.
»Können wir uns dann diesmal was Näheres aussuchen? Es müssen ja nicht gleich die Neukölln Arcaden sein. Wie wär’s in der Schönhauser Allee, am Ring? Da kennt dich bestimmt auch niemand.«
Erol runzelte die Stirn. »Ja, vielleicht, ich muss überlegen … Können wir das dann entscheiden?«
Karla nickte. Diese Ängste konnten einem die Luft abdrehen. Er war zu bedauern, einerseits, aber wie lange wollte er sich davon quälen lassen? Es hatte keinen Sinn, vor den Ängsten davonzulaufen. Das verlängerte nur das Leiden.
Sie hatte ihn schon mehrmals behutsam darauf aufmerksam gemacht, bis jetzt allerdings ohne spürbaren Erfolg.
»Gut, dann mach ich mich los, bevor dein Papa zurückkommt. Ich weiß ja, wie er sich aufregt, wenn ich nicht pünktlich losfahre«, meinte Karla.
»Danke, Karla, meine Schwester.« Es war Karla ein wenig peinlich, dass Erol ein paar Tränen in den Augen hatte, als er sie kurz umarmte. Hatte sie wirklich so viel tiefe Dankbarkeit verdient?
»Das Fahrtenbuch und die Tasche mit dem Wechselgeld liegen drin, hast du gesehen?«, sagte Erol, als sie einstieg.
Karla tauchte ihre Linke in die Türablage. »Okie dokie«, erwiderte sie und drehte den Zündschlüssel.
Erol schloss die anderen Türen, während Karla die Spiegel justierte.
Beim Anschnallen überprüfte sie kurz, ob sie dünner geworden war. Dazu hatte sie den Gurt mit einem roten Faden markiert, den sie mit einer Nadel ins Gewebe gezogen hatte.
Vorläufig keine Veränderung, frustrierend nach einer Woche Diät.
Erol klopfte zum Abschied leicht aufs Dach.
Auf der Straße hielt sich Karla rechts, sie wollte wie immer als Erstes zum Ostbahnhof. Zehn Stunden Schicht lagen vor ihr und sie hoffte auf hundertfünfzig Euro Umsatz, was ihr knapp siebzig Euro ohne Trinkgeld einbringen würde. Während der Schichten überschlug sie häufig, wie viel Prozent von diesem gesteckten Ziel sie schon erreicht hatte.
Manchmal war es ermutigend, meistens jedoch frustrierend.
Eine knappe Viertelstunde später fand sie einen Platz in der Warteschlange am Taxistand vor dem Bahnhofsgebäude. Die Wartezeit an diesem Stand gehörte für Karla noch zu den angenehmsten. Sie traf Kolleginnen, es gab was zu sehen und wenn ihr kalt wurde, konnte sie sich in der Eingangshalle in Sichtweite zum Wagen aufwärmen.
Ende September wurde es nachts bisweilen schon ziemlich frisch.
»He, Kawa, hast du schon jehört? Der Taxenripper hat die sieben-zwei-drei abjerippt«, rief ihr Benni zu, ein Kollege aus dem Grüppchen, das sich zwei Wagen vor ihr gesammelt hatte.
»O nein, Mist. Wer ist gefahren?«, fragte Karla im Näherkommen.
»Kati, die Lange mit den braunen Haaren«, meinte Benni. Er zog eine Packung Zigaretten aus der Jackentasche.
»Verdammt, ist ihr was passiert?« Der Schreck bescherte ihr blitzartig weiche Knie. Zum ersten Mal kannte sie das Opfer persönlich und das ließ die Gefahr bedrohlicher denn je erscheinen.
»Wie man’s nimmt. Er hat ihr eins überjezogen und dann ein Messer an den Hals jesetzt. Ooch eene?« Benni hielt ihr die Packung hin.
Karla hob abwehrend die Hände. »Nein, ich hab doch aufgehört. Sie ist also nicht verletzt?«
»Na ja, Platzwunde und Schnitt hier.« Er strich über dem Kragen seiner abgewetzten Lederjacke am Hals entlang. Mit der Hand, die er sonst zum Sackkraulen benutzte. »Nicht arg tief, aber ziemlich lang.«
Zu weiteren Fragen kam es nicht, weil ein Schwall Menschen aus dem Bahnhof zum Stand strömte und die Taxis aufrücken mussten.
Karla beobachtete die Eingangshalle. Sie stellte sich vor, sie könnte Fahrgäste mit Gedankenkraft anlocken, scheiterte aber daran, dass sie jemanden aussuchen musste. Immer wieder irrte ihr Blick ab zu denen, die den Inhalt der Mülleimer untersuchten und Ausschau hielten.
Auswurf, abgehustet von der Gesellschaft, diese Umschreibung kam Karla in den Sinn.
Nur der Personenbeförderungsschein trennte sie selbst von dieser Art der Freiheit. Frei von Besitz, von Verpflichtungen, von Konventionen. Frei vom Respekt der Mitmenschen und nahezu unsichtbar. Manchmal spendierte sie ein Getränk oder etwas Kleingeld und hoffte, das käme zurück, sollte sie jemals dort landen.
Sie blätterte in der taz,die wieder mal voll war von Berichten über Ströme von Flüchtlingen, die knappen Unterbringungsmöglichkeiten in der Stadt und das Sterben auf der Flucht. Karla fragte sich, warum andauernd von Zustrom, Welle oder Flut gesprochen wurde. Diese Begriffe beschworen Bilder von Naturgewalten herauf, denen Europa ausgesetzt wäre und die den Wunsch nach Dämmen hervorriefen. Im Kommentar war dazu von Deutschen die Rede, die als größte Gruppe ein Drittel aller Schlepper stellten. Es sei deshalb unangemessen, auf arabische Schlepper oder welche vom Balkan zu zeigen.
Noch mehr Menschen, die auf öffentliche Fürsorge angewiesen sind, überlegte Karla. Da war die Arbeit von Aktivistinnen wie Britta im Flüchtlingsrat dringend nötig und doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Bitter zudem, dass Britta sich mehr um Flüchtlinge als um Karla kümmerte.
Eigentlich bewunderte sie dieses Engagement. Nur wünschte sie sich, dass Britta ihr öfter ebenso viel Aufmerksamkeit schenken würde. Es war hart, das nötige Geld zusammenzukratzen. Die Stadt vergab mehr Taxikonzessionen, als dem Einkommen der Fahrer guttat. Dafür gab es keine Hilfsorganisation, in der Britta ihr Helfersyndrom ausleben konnte.
Etwas später hatte Karla ihre erste Fuhre. Ein ältliches Ehepaar mit zwei großen Koffern wollte in die Buchholzer Straße nach Blankenfelde.
Eine Tour, die mehr als ein Fünftel des angepeilten Umsatzes einbrachte. Der verstörende Angriff auf die Kollegin war sofort vergessen.
Karla öffnete den Kofferraum. Der Mann wollte sich beim Einladen nicht helfen lassen. Karla stieg wieder ein. Selbst schuld, wenn er einer Frau nichts zutraute.
Während sie das elfenbeinfarbene Gefährt durch die junge Nacht steuerte, saßen die beiden auf der Rückbank, starrten hinaus und schwiegen. Karla beobachtete sie hin und wieder und fragte sich, ob jede Zweierkiste so endete.
Erst als sich das Taxi dem Ziel näherte, ergriffen sie das Wort. Es war ein Streit um die Frage, in welcher Tasche der Hausschlüssel steckte.
Vor einem knuffigen Einfamilienhaus mit akkuratem Vorgarten lud Karla ihre Fracht ab. Beim Wenden dachte sie daran, ob wegen der Ruhe und des weitläufigen Grüns der Umgebung Neid angebracht wäre. Aber sie taugte nach den vielen Jahren in Berlin nur noch als Stadtpflanze, so viel war sicher. Diese Randlage wäre für sie nur zum Eingehen geeignet.
Zurück wählte sie den Weg durch Pankow in die Berliner Straße. Auf der Strecke sollte am ehesten eine Fuhre aufzugabeln sein.
Da sie kurz vor der Brücke über die S-Bahnstrecke nach Bernau immer noch alleine war, bog sie in Richtung U-Bahnhof Pankow ab.
In Höhe des Amalienparks hielt sie ein Mann an. Er trat ein paar Schritte auf die Fahrbahn und bewegte schwerfällig einen Arm wie eine Winkerkrabbe.
Karla rollte heran. Der ist besoffen, dachte sie kurz vor dem Anhalten. Er schwankte und schnitt Grimassen, dabei presste er den anderen Arm unter dem halb offenen Mantel auf den Leib. Während sie noch zauderte, ob sie besser weiterfahren sollte, öffnete er schon die hintere Tür und warf sich aufstöhnend in den Sitz.
»Losfahren«, schnaufte er.
Karla drehte sich zu ihm um.
»Ist Ihnen übel? Bitte kotzen Sie nicht in den Wagen, das würde teuer für Sie.«
Er wedelte energisch mit der Hand.
»Losfahren, schnell.«
»Hören Sie, ich weiß nicht, wohin. Außerdem müssen Sie sich erst anschnallen.«
Der Mann warf einen Blick durch die Heckscheibe. Seine freie Hand fuhr in die Manteltasche und kam mit einer Pistole wieder zum Vorschein.
»Los, los, los!«, presste er heraus.
Die Waffenmündung zeigte ungefähr auf ihre Kopfstütze. Karla erstarrte. Der Taxenripper, er hatte sie erwischt, ausgerechnet sie.
»Bitte, wenn es um das Geld geht …«, keuchte sie.
»Fahren!«, schrie der Mann. Die Pistole zuckte in die Höhe und ein Schuss löste sich mit scharfem Knall. Es staubte aus der Dachpolsterung.
Karla schrie vor Angst, hatte sich jedoch so weit unter Kontrolle, dass sie losfahren konnte.
»Schneller, schneller«, kam es von hinten. Sie gehorchte, so gut es ging.
Ihre Hände zitterten und sie bekam nur schwer Luft. Trotzdem konnte sie sich durch das gewohnte Fahren etwas beruhigen. Der Mann wollte sie offenbar nicht unbedingt verletzen und Stehlen hätte er auch einfacher haben können. Was wollte er also?
»Wohin?«, fragte sie an der Kreuzung zur Berliner Straße.
»Weiter, weiter, schnell …«
Die Ampel sprang auf Grün und Karla brauste im verschärften Taxentempo, Fahrspuren wechselnd auf die nächste Kreuzung zu.
Sie erlaubte sich kurze Blicke in den Rückspiegel. Der Mann war sicher etwas älter als sie, etwa Mitte fünfzig, und trug die noch teilweise dunklen Haare streng aus der hohen Stirn gekämmt. Ein paar Strähnen hatten sich herausgelöst und hingen wirr herunter.
Er drehte sich dauernd um und spähte in die Gegend.
»Links«, sagte er kurz vor der nächsten Kreuzung.
Karla drängelte in die Abbiegespur, was heftiges Gehupe zur Folge hatte.
»Gut, gut«, kam es von ihrem Fahrgast, als sie bei Gelb über die Kreuzung in die B 96 preschte.
Er sprach mit einem Akzent, den sie nicht einordnen konnte.
Karla beobachtete ihn, wie er sich langsam entspannte. Dann zog er die linke Hand aus dem Mantel. Sie glänzte von hellem Blut. Heilige Scheiße!
Karla musste das Lenkrad fest packen, denn ein Beben schüttelte sie. Hitzewellen und Gier nach Sauerstoff. Nur die Routine verhinderte, dass sie den Wagen gegen einen Kleinbus steuerte. Ihr Blick zuckte immer wieder zum Innenspiegel. Sie konnte kaum begreifen, was sie sah.
Die Hand konnte der Mann bewegen, sie wirkte unverletzt. Demnach musste eine Wunde irgendwo unter der Brust stark bluten.
Sie überlegte, ob sie den Mann nicht sofort in das nächste Krankenhaus bringen müsste. Die scharf hervortretenden Kaumuskeln und die Schweißtropfen, die sich einen Weg von seiner Stirn bahnten, zeigten, dass er Schmerzen litt.
Sie glaubte inzwischen auch, dass er verfolgt wurde. Oder sich verfolgt fühlte. Obwohl kein Polizeiwagen zu entdecken war, weit und breit.
Trotzdem wurde der Mann unruhig. Die Linke steckte wieder im Mantel, mit verdrehtem Kopf hielt er durch die Heckscheibe die Straße im Blick. Die Hand mit der Waffe lag auf der Rückenlehne der hinteren Sitzbank bereit.
Ein dunkler, bullig wirkender Geländewagen erregte seine Aufmerksamkeit. Dieser Wagen kam auf der linken Spur langsam näher. Durch das blendende Scheinwerferlicht konnte man keine Insassen erkennen.
Der Blick des Mannes blieb auf das massive Gefährt geheftet, während es sich allmählich an ihnen vorüberschob.
Er zog den Kopf zwischen die Schultern und duckte sich stöhnend. Die Pistolenmündung blieb auf die getönten Scheiben des anderen Wagens gerichtet.
Karla zog unwillkürlich ebenfalls den Kopf ein. Ihr Magen rumorte. Sie machte sich zum Vollbremsen bereit.
Dann war der Geländewagen vorbei und nichts geschah. Im Innenspiegel beobachtete Karla, wie ihr Fahrgast sich vorsichtig wieder aufrichtete und die Waffe sinken ließ.
In dem Moment, als er den Mund zum Schreien öffnete, hatte Karla die Gefahr selbst erkannt. Der Geländewagen zog den Weg versperrend nach rechts und bremste heftig. Dabei öffneten sich beide rechte Türen und Gestalten beugten sich heraus. Hell leuchtende Gesichter im Licht des Taxis. Pistolen in den Händen.
Karla schrie ebenfalls, riss das Steuer nach rechts in die Lücke zwischen den geparkten Fahrzeugen.
Die linke Stoßfängerecke erwischte die Beifahrertür des Geländewagens. Die Tür knickte um und für einen Wimpernschlag schrammte das Taxi am Kotflügel des anderen entlang.
Karla gab sofort wieder Gas, denn die Lücke erwies sich als die Einmündung eines schmalen Seitenwegs.
Sie fegte in die Durchfahrt zwischen den Häuserblocks. Ihr wurde sofort klar, dass sie in eine Sackgasse eingebogen war. Der Fahrweg führte genau auf einen der Blocks zu.
Auf gut Glück bog sie gleich wieder rechts ein. An einem Parkplatz und einer Grünfläche vorbei. Auf dem breiten Gehweg die Rückseite des langgestreckten Wohngebäudes entlang.
»Bitte, bitte, bitte«, flüsterte sie, erinnerte sich an die noch brennende Dachlampe und schaltete sie aus. Das Fahrlicht ebenfalls. Drückte den Notfallknopf, obwohl der immer noch nicht funktionieren würde.
Sie hatte Glück, der Weg war frei. Nur eine dunkel gekleidete Person mit einem Fahrrad. Sie entwischte dem Kühler knapp. Karla erlitt einen Anfall von Schnappatmung.
Der Block beschrieb einen weiten Bogen, weg von der Hauptstraße zu einer Seitenstraße.
Bevor Karla dort einbiegen konnte, musste sie wegen ein paar Fußgängern stark abbremsen. Sie hörte deren Flüche und Verwünschungen, schrie »Ja, ja, ich muss hier durch« und gab wieder Gas, sobald der Weg frei war.
Sie erinnerte sich, dass hier ein Gewirr von schmaleren Straßen mit kleinen Blocks auf sie wartete.
Einige der uniformen Dreigeschosser beherbergten die Botschaften von Bonsaistaaten wie Kuba, Kapverden und Eritrea.
Sie bog in die Ibsenstraße ab, fragte sich dabei, ob zu häufiges Abbiegen die Gefahr erhöhte, dass sie wieder auf den Geländewagen stießen. Der suchte sicher nach ihnen.
»Soll ich die Polizei rufen?«, fragte sie ihren Passagier. Der verfolgte leise stöhnend und zusammengekrümmt die Route.
Er schüttelte heftig den Kopf. Dazu hob er in einer kraftlosen Geste die Pistole.
Karla verstand es als Drohung. Also kein Griff zum Telefon.
Zum ersten Mal, seit sie für Taxi-Yilmaz fuhr, wünschte sie sich, sie wären an einer Funkzentrale beteiligt.
»Krankenhaus?«, fragte sie.
»Nein, nein, fahren, weiter.« Die Stimme des Mannes knirschte jetzt wie grober Sand.
Sie wischte sich die schweißnassen Hände an der Hose ab. Hoffentlich starb der ihr nicht im Wagen. Es hörte sich fast so an.
Ein Feuerzeug klickte. Der Mann steckte sich eine Zigarette an, die er zwischen den Lippen baumeln ließ. Wegen der Waffe schwieg Karla. Nicht provozieren, nur davonkommen. Wer eine Waffe bereithielt, konnte rauchen, wo er wollte.
Ein entgegenkommender Wagen blendete mit Lichthupe. Es dauerte, bis sie begriff, dass sie die Frontscheinwerfer wieder einschalten sollte.