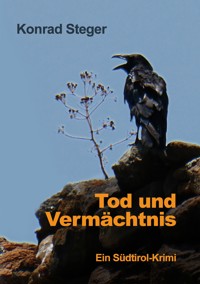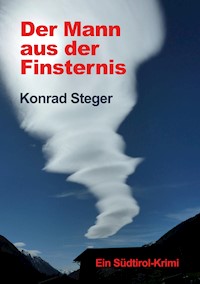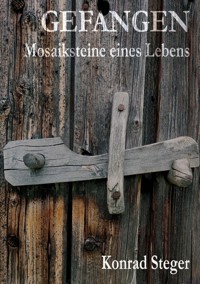
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In 42 kurzen Textabschnitten lässt die historische Erzählung "Gefangen. Mosaiksteine eines Lebens" die Zeit vor mehr als 100 Jahren im damaligen Tirol lebendig werden. Die kurzen, locker aneinander gereihten Kapitel erzählen von der schwierigen Kindheit des ledigen Kindes Pelagius, vom Erwachsenwerden, der harten Realität in einer bäuerlichen Welt, vom Kämpfen ums Überleben, von Einsamkeit, Trennung, Abschied und Krieg. Trotz aller Schwierigkeiten und Prüfungen, die Pelagius bewältigen muss, ist der Grundtenor des Textes lebensbejahend.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Konrad Steger
Gefangen
Mosaiksteine eines Lebens
www.tredition.de
© 2024 Werk und Coverfoto: Konrad Steger
Coverdesign ©Markus Leitner
Portraitfoto ©Martin Zimmerhofer
Verlagslabel: tredition
ISBN Hardcover: 978-3-384-36070-0ISBN E- Book: 978-3-384-36071-0
Druck und Distribution im Auftrag:tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für den Inhalt ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen durch den Verlag, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Vorwort
Im 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts, als es in Tirol noch keine Sozialversicherung für die Arbeiter in der Landwirtschaft gab, wurden die Ärmsten der Armen, die alten und kranken Mägde und Knechte zu einem sozialen Problem für die Dorfgemeinschaften. Hatten diese Bedauernswerten keine Bleibe, wo sie ihre letzten Tage verbringen konnten, wurden sie zu „Anlegern“, das hieß sie mussten bei einem Bauern oder wohlhabenden Handwerker in Kost und Wohnung genommen werden. Diese verpflichteten sich, einen oder zwei Anleger für eine vereinbarte Zeit zu sich zu nehmen und zu versorgen. Nach Ablauf dieser Tage schob man sie ins Nachbarhaus ab. In den entlegensten Gebieten Tirols gab es solche Zustände noch nach dem Ersten Weltkrieg.
Eins
Die Atemwolke stand noch eine Weile vor ihm, dann zerfaserte und verwehte sie in der kalten Morgenluft. Der Schnee knirschte kalt unter den schweren Nagelschuhen des Mannes, der auf einen Haselstecken gestützt, den schmalen, stetig ansteigenden Steig hinaufstapfte. Eine schwer beladene Buckelkraxe drückte ihn nieder. Der Knecht hatte keinen Blick für die Rauchsäulen unten im erwachenden Tale, die von den geduckten Schindeldächern aufstiegen und als graue Schleier über dem Dorfe hängen blieben.
Knarrend öffnete sich das Gatter. Ein Seil, auf dem ein Stein aufgefädelt war, schlug es mit einem dumpfen Knall wieder zu; dann stand der Mann vor dem Tor des Hofes. Ein Hund kläffte und stürzte herbei, eine rasselnde Kette hinter sich herziehend. Der Knecht beachtete ihn nicht, verschwand gebückt im Toreingang, betrat polternd die Stube und setzte die Buckelkraxe auf der Ofenbank ab.
„Gott sei Dank ist er nun hier, der Krüppel, verdammt schwer ist er gewesen!“
Der Knecht atmete keuchend, während er aus den Trageriemen der Kraxe schlüpfte. Dann zerrte er an der Decke, mit der das geladene Bündel zugedeckt gewesen war. Auf dem Strohsack, der auf der Buckelkraxe lag, kauerte ein bleicher, hagerer, stoppelbärtiger Mann, der vor Kälte zitterte.
Er solle ihn zum Ofen setzen, er sei ja halb erfroren, rief eine Frauenstimme, sie bringe ihm eine Brennsuppe, er habe sicher noch nicht gefrühstückt. Das habe er nicht, brummte der Knecht, und jetzt seien sie dran ihn eine Woche zu behalten. Bei ihnen sei er schließlich lange genug gewesen. Dann hob er das zitternde Bündel aus der Kraxe und setzte es zum Ofen. Ein säuerlicher Geruch stieg ihm in die Nase. Angewidert spürte er die Nässe auf seinem nackten Unterarm.
„Jetzt hat der arme Kerl auch noch in die Hose gemacht, aber das geht mich ja nichts mehr an“, dachte der Knecht erleichtert und schlüpfte wieder in die Tragriemen der Kraxe. In der Stubentür begegnete er der Bäuerin. Er verneinte die Frage, ob er nicht auch eine Brennsuppe wolle, sofort. Er müsse schnell in die Frühmesse, es sei höchst an der Zeit, brummte er schon im Gehen.
Als er den Hof hinter sich gelassen hatte, bückte sich der Mann nach einer Handvoll Schnee und rieb sich damit im Gehen schnell über seinen Unterarm. Mit schnellen Schritten stapfte er dem Tale zu. Einmal wunderte er sich noch wie leicht seine Kraxe geworden war; er spürte die Last auf seinem Rücken überhaupt nicht mehr.
Zwei
Mit geschlossenen Augen lag der Mann auf dem Strohsack in der Schlafkammer. Undeutlich drang das Gebetsmurmeln des Abendrosenkranzes aus der Stube zu ihm, die hohe Vorbeterstimme des Bauern, dann das dumpfe, monotone Nachbeten der anderen.
Pelagius sah die Stube vor sich. Unzählige Male, Abend für Abend war immer das Gleiche gewesen, und es würde auch in Zukunft so sein. Auf den Stubentischen blakten und rußten die Petroleumlampen, deren Lichtschein die Männer und Frauen im Raum kaum erreichte. Alle knieten auf der Ofenbank und an den Fensterbrettern, meist regungslos ins Finstere starrend und leierten mechanisch die immer gleichen Gebete herunter, waren in ihre eigenen Gedanken versunken.
Nur der Wechsel des Dienstplatzes hatte eine Abwechslung in seinen grauen Alltag gebracht. Gespannt hatte er als neuer Dienstbote darauf gewartet, wie der Bauer den ersten Abendrosenkranz begann. Der erste Abend schon gab Auskunft darüber, wie lange die Gebete in diesem langen Jahr dauern würden. Die frommen Bauern sangen und dehnten die ewiggleichen Wörter der ewiggleichen Gebete zu unendlicher Länge wie ihm schien und hängten immer gleiche Litaneien an. Andere Bauern rasselten die Gebete herunter wie eine durch einen Ring laufende Kette, schluckten Silben und Wörter, fielen den Nachbetenden schon ins Wort, noch ehe das letzte Wort ausgesprochen war. Somit war getan, was eben getan werden musste.
Ausgeliefert gewesen war er jenen wie diesen Bauern, auf Gedeih und Verderb, den Frommen sowie den anderen. Fehlte ein Dienstbote beim Abendrosenkranz oder beim Gebet, mit dem im Sommer der beginnende Morgen begrüßt werden musste, so konnte ihn der Bauer sofort vom Hofe jagen. Pelagius hatte im Laufe der Jahre gelernt während dieser Abendrosenkränze in seine eigene Welt abzutauchen. Die ewiggleiche Melodie der Gebete ließ ihn, kaum hatte der Bauer mit dem Singsang begonnen, in seine Gedanken versinken. Er bedeckte sein Gesicht mit den Händen, verspürte nichts und sah nichts, während er die Worte mit den anderen Mägden und Knechten mechanisch nachbetete. Und dann begannen vor seinen Augen Bilder aufzusteigen, die seine Seele wärmten; es waren immer die gleichen Bilder. Die Gedanken an die wenigen Umarmungen und Küsse, die er erlebt und seine Seele wärmten, die Bilder von blühenden Sommerwiesen und von glitzernden Schneefeldern in der Wintersonne. Und so waren ihm mit der Zeit die frommen Bauern gar nicht so unrecht, denn so konnte er seine Träume länger leben, bevor er wieder, wie aus einem Schlaf erwachte und in die Wirklichkeit zurückgeholt wurde.
Solche Inseln in der Zeit waren auch die endlosen Messen in der Kirche mit ihrem ewig gleichen Ablauf.
Als Kind hatte Pelagius noch über das geheimnisvolle Geschehen an den hohen kirchlichen Festtagen gestaunt. Er liebte den Weihrauchduft, der solche Feiertage erfüllte und beißend im Kirchenschiff lag. Er liebte den Himmelfahrtstag, wenn während der Messe eine Statue, die den siegreich auferstandenen Christus darstellte, zum Himmel schwebte. Wie gebannt starrte er dann auf die Holzstatue, auf das ausdruckslose, bärtige Gesicht des Herrn, auf den ausgestreckten Arm mit dem Kreuzbanner in der Hand. Die Statue stieg, vom Gesang des Kirchenchores begleitet, langsam in die Höhe und drehte sich dabei langsam. Pelagius wusste, was dann geschehen würde. Wenn die Christusstatue zwischen Himmel und Erde schwebte, würden aus einer Öffnung im Kirchengewölbe fünf Engel herabschweben, um den siegreich auferstandenen Christus zu empfangen. Die fünf Engelsstatuetten hüpften und tanzten dabei manchmal so freudig und wild, dass es Pelagius angst und bange wurde. Manchmal kam es zu Zusammenstößen unter den Engeln. Dann klapperte es hölzern und nicht selten splitterten dann Holzteile ab, Flügel, Arme und Beine, und fielen auf die staunenden Betrachter hinab. Einmal hatte sich sogar das Banner aus der Hand der Christusfigur gelöst und war flatternd in das Kirchenschiff gestürzt. Doch Pelagius machte sich keine Sorgen um die verunglückten Engel, er wusste sie waren unsterblich, sie waren die Beschützer der Menschen. Wie sollte diesen Geistwesen ein Zusammenstoß etwas anhaben können? Und tatsächlich, am nächsten Himmelfahrtstag erschienen die fünf Engel vollkommen genesen wieder, sie sahen aus wie neu und wie immer schon. Nur eine Frage stellte sich Pelagius oft: Wenn die fünf Engel nach und nach durch eine Öffnung im Himmelsgewölbe wieder verschwunden waren und die Christusstatue am Himmelstor angelangt war, erschien ein dicht behaarter Arm und half dem Heiland heil durch die enge Öffnung zu schlüpfen. Wem gehörte dieser Arm, dem Petrus, oder gar dem Himmelvater selbst?
Auch um Pfingsten spielte sich in der Kirche Geheimnisvolles ab. Aus der besagten Öffnung im Kirchengewölbe erschien dann eine strahlend weiße Taube und senkte sich, während sie sich weit im Kreis drehte, auf die Gläubigen herab.
„Der Heilige Geist kommt über euch und erleuchtet die Gläubigen“, so hatte der Pfarrer den staunenden Kindern in der Schule erklärt.
Die Osterfeiertage. Pelagius war fasziniert vom geheimnisvollen Geschehen rund um das Osterfest.
In der Karwoche verstummten im Kirchturm die Glocken, und das laute, hölzerne Klappern der Ratsche ersetzte das Geläut. Pelagius hatte sie einmal gesehen, es war eine große Holzwelle mit spiralförmig angeordneten kleinen Zapfen. Wenn der Mesner die Walze drehte, hoben die Zapfen rasend schnell die an einer Seite befestigten Holzlatten an und ließen sie wiederum krachend zurückschnellen.
Am Gründonnerstag füllte das Ostergrab den ganzen hinteren Altarraum aus, und die Osterkugeln flackerten in allen Farben. Pelagius wusste, dass hinter den farbigen Glaskugeln Öllämpchen brannten, und diese tauchten den Kirchenraum in ein geheimnisvolles, schillerndes Licht. An diesen Tagen betraten der Pfarrer und die Ministranten den Kirchenraum durch ein kleines Türchen im Ostergrab.
Wenn Pelagius die Worte der Leidensgeschichte hörte, sah er eine faszinierende, fremde Welt vor sich. Er sah die Stadt Jerusalem, die römischen Soldaten in ihren Brustpanzern und mit ihren Lanzen, er sah, wie Jesus Blut schwitzte, hörte die dreimalige Verleugnung des Petrus und den dreimaligen Schrei des Hahnes. Er sah den schändlichen Verrat des Judas, er sah das abgehauene, Ohr des Knechtes Malchus im Staub liegen und die heftig blutende Wunde. Er sah die Gefangennahme Jesu auf dem Ölberg und seine Verurteilung. Er sah, wie Pontius Pilatus seine Hände in Unschuld wusch und die Geißelung. Er sah, wie Jesus das Kreuz auf Golgotha, die Schädelhöhe, schleppte und Simon von Cyrene, welcher Jesus half das schwere Kreuz zu tragen und Veronika mit dem Schweißtuch, in das sich unauslöschlich das Schmerzensgesicht Jesu eingebrannt hatte. Er sah die Nägel und hörte die Hammerschläge, er spürte den bitteren Geschmack des Essigs auf seiner Zunge, welcher Jesus auf einem Schwamm gereicht wurde, er sah den Stich in die Seite und hörte wie Jesus in seiner Verzweiflung „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ rief. Und schließlich sah er, wie Jesus starb, der Himmel sich verdunkelte und der Vorhang des Tempels zerriss. Und er stellte sich vor, wie die Soldaten um die Kleider des Herrn würfelten, sie zerschnitten und unter sich aufteilten, er sah die trauernde Mutter, die weinenden Frauen und die Grablegung Jesu.
Pelagius freute sich auf den Karsamstag, denn er wusste, während der Auferstehungsfeier geschahen in der Kirche dramatische Dinge. Während der Pfarrer das „Christus ist erstanden“ anstimmte und sang, erschien aus dem Ostergrab wie von Geisterhand der auferstandene Christus. Die zwei Grabwächter, die Juden in ihren seltsamen Gewändern und mit den Lanzen in der Hand, stürzten wie vom Blitz getroffen krachend zu Boden, und die Vorhänge, mit denen die Kirchenfenster verdunkelt gewesen waren, fielen herab.
„Recht geschieht den Juden!“, jubelte Pelagius im Stillen, „nun müssen sie dafür büßen, dass sie Christus ans Kreuz genagelt haben!“
Doch der Zauber der Kindheit währte nicht ewig; nach und nach fiel er von ihm ab wie bröckelnder Gips. Die Monotonie, die Voraussehbarkeit der immer gleichen Handlung, das mechanische Aufstehen, Niederknien und Niedersitzen, die immer gleichen Worte der Pfarrer hatten ihn abgestumpft. Noch erschreckten ihn die Beschwörung der Hölle und des Teufels durch die Bußprediger. Die Jesuitenpater kamen in regelmäßigen Abständen in die Pfarrei zur Volksmission, die ein absoluter Höhepunkt im kirchlichen Leben des Dorfes darstellen sollte. Die Volksmissionare wollten neuen Schwung, neuen religiösen Eifer in das Leben der Leute bringen. Und brachten doch nur Unruhe mit sich. Im Kirchenschiff herrschte betretene Stille, wenn sie von der Kanzel herunter tobten, drohten und schrien. Die Todsünden! Sie malten die Leiden der Hölle und des Fegefeuers in so grellen und schrecklichen Farben, dass die Leute erschraken und erschauerten. Der Satan sei immer präsent, das Böse lauere überall, in schlechten Büchern und Zeitschriften, in denen satanische Ziele verfolgt würden. In einer schönen Frau, die ihren Körper allzu aufreizend zur Schau stelle. Der Teufel lauere in den schlechten Gedanken, in den Sehnsüchten an die verbotene Lust, er vergifte die Seelen der Menschen, welche sich selbst Lust verschafften oder gar vorehelich sündigten. Menschen, die zwar das Schlechte bereuten, aber immer wieder rückfällig würden, seien auf immer und ewig verloren.
Die Leute verstummten angesichts der furchtbaren Drohungen von Hölle und ewiger Verdammnis. Sie duckten sich und lebten ein Leben voller Angst, Scham und schlechtem Gewissen, oder sie gingen daran zugrunde, wie das achtzehnjährige Mädchen, das man nach einer Bußpredigt von einem Dachsparren herunterhängend in der Scheune gefunden hatte. Pelagius hörte davon erzählen, dass sie ein heimliches Verhältnis mit einem jungen Knecht gehabt, und sie ein Kind erwartet habe.
Drei
Wo denn Pelagius eigentlich aufgewachsen sei, fragte der Gereuter seine Frau, und beugte sich ächzend zum schweren Federbett zu seinen Füßen hinunter, um es zurecht zu klopfen.
Ein armer Hund sei der, er habe zeitlebens nichts Gutes gehabt, seufzte die Bäuerin. Aufgewachsen sei er beim Lärcher, zwei Dörfer weiter, ein lediges Kind, von der Kofeldirn, und niemand wisse genau, wer der Vater sei. Sie habe ihn weggeben müssen, er wisse ja. Er sei halt das ganze Leben bei den Bauern herum geschupft worden, bis er nicht mehr habe arbeiten können, wie es halt immer so sei.
Sie solle nur dafür sorgen, dass es ihm halbwegs gut bei ihnen gehe, dem armen Teufel, murmelte der Gereuter und drehte sich zur Bretterwand. Bald darauf atmete er tief und gleichmäßig. Die Gereuterin bückte sich noch zum Dielenboden hinunter und tastete nach der kleinen Holzluke unter dem Bett. Langsam strömte die Wärme des Stubenofens, welcher unter ihnen noch glühte, durch die Öffnung in die Kammer.
Vier
Pilaaatus, Pontius Pilaaatus, Pilaaatus! Noch immer hallten die Spottrufe seiner Kameraden auf dem Weg zur Schule in seinen Ohren nach, als der Lehrer eintrat. Augenblicklich wurde es still. Wenn der Lehrer da war, wenigstens dann, fühlte sich Pelagius halbwegs sicher. Inmitten des beinahe fünfzigköpfigen Haufens war er nicht anders als alle anderen. Er sah genauso aus wie sie, das wusste er, er war einer unter den vielen verschwitzten, ärmlich gekleideten und von groben Männerfäusten kurz geschorenen Buben. Unter ihnen waren auch Mädchen im Kittel und Schurz, die langen Haare zu Zöpfen geflochten; an den Füßen trugen sie alle genagelte, grobe Holzschuhe.
Der Lehrer hatte zwar ein wenig gestutzt, so hatte Pelagius geglaubt zu sehen, als er am Anfang des Schuljahres alle Namen aufgerufen hatte, und als schließlich sein verhasster Name den Raum erfüllte. Er stand da, geduckt und mit hochrotem Kopf, im Hintergrund glaubte er leises Kichern zu hören, und er hatte den Eindruck gehabt, dass ihn der Lehrer etwas länger gemustert hatte als die anderen. Aber schließlich durfte er sich wieder setzen, und der Lehrer fuhr fort, als ob nichts gewesen wäre.
Pelagius machte es keine großen Schwierigkeiten die Buchstaben und Zahlenfolgen zu lernen, die der Lehrer vorne an die große Schiefertafel schrieb. Ja, die Freude hatte seine Wangen gerötet, als er seine kleine Schiefertafel musterte und ihm lobend auf die Schulter klopfte. Es freute ihn, als er auf dem Täfelchen Wörter las, die seine eigene Hand geschrieben hatte.
Nur einmal war es in der Klasse zu einem Zwischenfall gekommen. Der Lehrer hatte auf seinem Rücken einen Zettel gefunden, auf dem in krakeliger Schrift
„Pilatus ist ein Esel“ stand. Der Urheber der Gemeinheit war schnell gefunden. Der Lehrer hatte ihn anhand seiner Schrift schnell identifiziert und zerrte ihn an den Ohren vor die Klasse. Der Übeltäter musste beide Hände vorstrecken und der Mann schlug mit seinem Haselstecken darauf, dass es nur so klatschte.
Sein mächtiger Schnauzbart hatte dabei vor Zorn gezittert. Von nun an hatte Pelagius einen erbitterten Feind mehr, aber seine Ruhe in der Klasse.
„Warum habe ich nur diesen schrecklichen Namen?“, fragte Pelagius am Abend desselben Tages die alte Magd Rosa, bei der er so gerne saß, weil sie ihn manchmal, selten zwar, an sich drückte und ihm sanft über den Kopf strich.
„Warum habe ich keinen normalen Namen, warum heiße ich nicht Johann, Josef oder Stefan wie die anderen Buben?“
Ein dunkler Schatten huschte über das faltige Gesicht der Magd.
„Ja“, sagte sie und schluckte, „auch deine Mutter wollte diesen Namen nicht, aber es lag nicht in ihrer Hand. Vieles liegt nicht in unserer Hand“, und sie strich ihm wieder sanft über sein Haar.
„Es muss wohl alles so sein, wer weiß schon wozu das alles gut ist, ich meine, dass der da oben uns leiden macht, obwohl wir niemandem etwas zuleide getan haben?“
„Hat mir der da oben auch diesen schrecklichen Namen gegeben?“
„Nein, das war der Pfarrer, aber es geschah in seinem Namen“.
Die alte Magd klang traurig, und ihr Blick war in die Ferne gerichtet. Pelagius schaute sie mit fragenden Augen an.
Fünf
Das ganze Dorf, das ganze Tal sprach über die Geschichte, und die Menschen im nahen Städtchen lachten über die angeblich so hinterwäldlerischen Dörfler. Auch die Zeitungen machten sich über die Bauernweiber lustig.
Die sieben Weiber hätten sich dem weißhaarigen k. u. k. Schulinspektor vor dem Schulzimmer in den Weg gestellt und seien mit Holzknüppeln bewaffnet gewesen. Die Weiberleute hätten ihm den Zutritt zum Klassenzimmer verwehrt, stellte das Bezirksgericht bei der Verhandlung fest. Sie hätten geschrien und getobt, den löblichen Inspektor und den ihn begleitenden Bauernvorstand verbal und körperlich auf das Gröbste attackiert. Sie hätten ihn aus dem Schulzimmer gedrängt, ihn dabei beschimpft und beleidigt. Sie ließen sich ihre Kinder nicht verderben, nicht den Glauben nehmen, sie ließen diese neumodischen gotteslästerlichen Sitten nicht zu. Und dabei seien die Ausdrücke „lutherischer Hund“, „Satan“ und „Luzifer“ gefallen, sagte der entsetzte Inspektor aus. Er sei gezwungen gewesen zu fliehen, augenblicklich, denn sonst wäre er verprügelt worden oder noch schlimmer. Er hätte gar um sein Leben fürchten müssen. Die offensichtliche Anführerin der Weiber, da sei er sich ganz sicher, habe ihm noch ein Holzscheit nachgeworfen, welches ihm am Hinterkopf getroffen und verletzt habe.
Er habe nur seine Pflicht getan, und habe eine Inspektion durchführen wollen, ganz so wie es das neue Schulgesetz verlange. Und das schreibe nun mal vor, dass weltliche Schulinspektoren diese durchführten. Er vermute auch, die Pfarrer hätten gegen ihn gehetzt, weil sie selbst nicht mehr die Inspektionen hätten durchführen dürfen.
Aber da hatte der Richter schnell abgewinkt.
Die Frauen hätten noch Glück gehabt, erzählten sich die Leute später, das Gericht habe noch einmal Milde walten lassen, da die „fanatischen Weiber“, so hatte der Richter gesagt, geglaubt hätten, der Schulinspektor wolle ihre Kinder vom rechten Glauben abbringen. Sie seien noch einmal mit einer Ermahnung davongekommen, allerdings sei die Anführerin, Antonia Mair, zu drei Wochen Arrest verurteilt worden, die sie im Bezirksgericht habe absitzen müssen. Nach drei Wochen sei sie aber sichtlich erholt heimgekommen. Und dann habe sie erzählt, es sei ihr noch nie so gut gegangen wie während ihrer Haft. Einmal in ihrem Leben habe sie nicht arbeiten brauchen, und auch die Kost sei sehr gut gewesen. Sonntags habe es sogar Fleisch gegeben! Wenn nur nicht die Sorge um ihre kleinen Kinder und um ihren Mann gewesen wäre, der nun einmal mit der Erziehung der Kinder keine glückliche Hand habe!
Sechs
Die Sensen rauschten in weiten Bögen durch das schuhhohe, trockene Gras und warfen am Ende des Schwunges Büschel aus, welche in langen gleichmäßigen Zeilen auf dem Hang liegen blieben. In immer gleichen Abständen rissen die Mäher die Wetzsteine aus den hölzernen Behältern, den Kümpfen, und die Sensen sangen metallen auf, als die Männer den Wetzstein rasch, die Seiten wechselnd, dreimal über die Schneide zogen. Dann plumpste der Wetzstein wieder in den Kumpf und die Sense rauschte erneut durch das Gras. Schweigend und Schritt für Schritt kamen die Mäher voran, stemmten sich in ihren schweren, genagelten Schuhen verbissen und breitbeinig gegen den Berg. Langsam kroch ihnen von den Schrofen her die Sonne entgegen. Sie fraß den Schatten und ließ die Lärchen in einem hellen Grün erstrahlen, die Krüppelkiefern in einem dunklen. Die Tauperlen auf dem Gras leuchteten auf und glitzerten in der Sonne.
Der Großknecht riss seinen Hut vom Kopf und wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn.
„Wasser holen, Pelagius!“
Sein Brüllen hallte in den Bergen wider. Er ließ den Wetzstein in den Kumpf fallen und mähte verbissen weiter.
Pelagius zuckte mitten in seiner Bewegung zusammen. Seine Aufgabe war es gewesen die Mahden, die abgemähten Grasbüschel der drei Mäher gleichmäßig über den Hang auszubreiten, damit die Sonne das Heu trocknen konnte.
Gestern waren sie vom Tal zur Bergmahd heraufgestiegen. Er, der Bub und die drei Knechte, alle voll beladen mit Essbarem, Pfannen und Töpfen, Sensen und Rechen. Unter wilden Flüchen wurden an einem Seil zwei Ziegen mitgezerrt. Sie würden zwei Wochen hierbleiben, das wusste Pelagius, bis alle Hänge abgemäht, das Heu getrocknet und in die Schupfen eingelagert war. Sie würden von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang arbeiten und abends todmüde ins Heu kriechen. Morgens würde sie der Großknecht mit einem derben Stoß oder mit seinem Gebrüll wecken.
Zweimal am Tag musste ein Knecht das Essen zubereiten, am Morgen eine Brennsuppe, zu Mittag gab es einen Mehlbrei in einer rußigen Pfanne, die der Knecht nach dem Essen mit einer Grassode ausputzte und dann in eine Ecke warf.