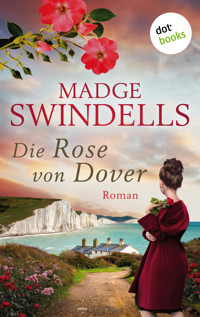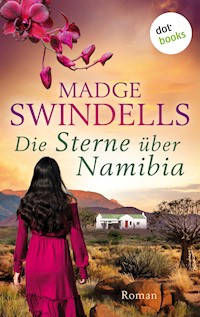5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn ein Geheimnis zur tödlichen Gefahr wird: Der Spannungsroman »Gegen alle Widerstände« von Erfolgsautorin Madge Swindells als eBook bei dotbooks. Wie lange kann man vor den Schatten der Vergangenheit fliehen? – Das wohlhabende Dorf Temple Minnis im Südosten Englands scheint ebenso malerisch und ruhig zu sein wie sein dunkler See … doch verbirgt sich hinter der idyllischen Fassade ein Abgrund? Seit Jahren hüten die Dorfbewohner ein Geheimnis: Sie haben einen Mörder gedeckt und so ein enges Netz aus Abhängigkeit und Angst geknüpft, dem sich seitdem niemand entziehen konnte. Doch nun, am Ende ihres Lebens, plagt die totkranke Schriftstellerin Melissa das Gewissen: Sie beschließt aufzuschreiben, was damals wirklich geschah – und bringt damit einen Stein ins Rollen, der nicht mehr aufgehalten werden kann! Jetzt als eBook kaufen und genießen: der Spannungsroman »Gegen alle Widerstände« von Madge Swindells. Wer liest, hat mehr vom Leben! dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 629
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wie lange kann man vor den Schatten der Vergangenheit fliehen? – Das wohlhabende Dorf Temple Minnis im Südosten Englands scheint ebenso malerisch und ruhig zu sein wie sein dunkler See … doch verbirgt sich hinter der idyllischen Fassade ein Abgrund? Seit Jahren hüten die Dorfbewohner ein Geheimnis: Sie haben einen Mörder gedeckt und so ein enges Netz aus Abhängigkeit und Angst geknüpft, dem sich seitdem niemand entziehen konnte. Doch nun, am Ende ihres Lebens, plagt die totkranke Schriftstellerin Melissa das Gewissen: Sie beschließt aufzuschreiben, was damals wirklich geschah – und bringt damit einen Stein ins Rollen, der nicht mehr aufgehalten werden kann!
Über die Autorin:
Madge Swindells wuchs in England auf und zog für ihr Studium der Archäologie, Anthropologie und Wirtschaftswissenschaften nach Cape Town, Südafrika. Später gründete sie einen Verlag und brachte vier neue Zeitschriften heraus, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Bereits ihr erster Roman, »Ein Sommer in Afrika«, wurde ein internationaler Bestseller, dem viele weitere folgten.
Die Website der Autorin: www.madgeswindells.com
Bei dotbooks veröffentlichte Madge Swindells ihre großen Familien- und Schicksalsromane »Ein Sommer in Afrika«, »Die Sterne über Namibia«, »Eine Liebe auf Korsika«, »Die Rose von Dover«, »Liebe in Zeiten des Sturms«, »Das Erbe der Lady Godiva« und »Die Löwin von Johannesburg« sowie ihre Spannungsromane »Zeit der Entscheidung«, »Im Schatten der Angst« und »Der kalte Glanz des Bösen«.
***
eBook-Neuausgabe Juni 2020
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2005 unter dem Originaltitel »Ripples on a Pond« bei Allison & Busby, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 2006 unter dem Titel »Das Flüstern des Wassers« bei Bastei Lübbe.
Copyright © der englischen Originalausgabe 2005 by Madge Swindells
Copyright © der deutschen Erstausgabe © 2006 Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach
Copyright © der Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung eines Bildmotives von shutterstock/Julia Sudnitskaya
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96655-264-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Gegen alle Widerstände« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Madge Swindells
Gegen alle Widerstände
Thriller
Aus dem Englischen von Michaela Link
dotbooks.
Prolog
Reif überzieht die nördlichen Downs und lässt das Gras welk und braun werden. Das Jahr hat seine Nemesis erreicht, die Schulden sind beglichen, und es bleibt nichts als Trauer.
Wenn er voller Qual auf das Jahr zurückblickte, das seine Welt verschlungen und beinahe zerstört hatte, betrachtete Simon stets die Nacht, in der Bela zurückgekommen war, als den Beginn seines Traumas. Genau das war der Moment gewesen, in dem das Pendel stillgestanden und der Rückschwung begonnen hatte. Damals hatte er nicht gewusst, wer sie war. Das war das Verrückte an der Geschichte. Und sie ihrerseits hatte keine Ahnung gehabt, was sie veranlasst hatte, in jener eisigen Januarnacht in seinem Wald Zuflucht zu suchen.
»Der Wald wirkte so sicher«, hatte sie ihm Monate später erklärt.
Lag es an seinem eigenen schlechten Gewissen, dass sie sich zu ihm hingezogen fühlte – damit er seine Schuld tilgen konnte? Mystiker sprechen von einer unbezwingbaren Kraft, die danach strebt, in der menschlichen Psyche ein Gleichgewicht zu schaffen. Im Osten nennen sie es Karma, ein Begriff aus dem Sanskrit, den man mit Aktion und Reaktion übersetzt. Jene, die ihre Schuld verdrängen, erschrecken zutiefst angesichts der Pünktlichkeit, mit der das Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Denn sobald das Pendel aus seiner Ruhe aufgestört wird, schwingt es zurück … Aktion gleich Reaktion! Aber diese Erkenntnis kam Simon erst sehr viel später.
***
Temple Minnis, 21. November 2002
Die Frau drehte sich um und kam langsam auf ihn zu. Einen Augenblick lang glaubte Simon in irregeleitetem Optimismus, sie habe ihre Meinung geändert und ihm verziehen. Aber dann sah er ihr in die Augen und wusste, dass er sie vielleicht verlieren würde. Sie hatte das Urteil über ihn gesprochen, hatte ihn für schuldig befunden und den Verlust akzeptiert, ihn vielleicht sogar willkommen geheißen.
»Ich habe dir gesagt, wie es war«, sagte er mit brüchiger Stimme. »Jetzt, nachdem du alles weißt, müssen wir es hinter uns lassen.«
Sie schüttelte den Kopf und wandte den Blick ab.
Er war ebenso traurig um Belas wie um seiner selbst willen. Einen Moment lang wäre seine Entschlossenheit beinahe ins Wanken geraten. Aber wie konnte er ihr die Wahrheit sagen? Wie hätte sie mit diesem Wissen leben können? Sie war blutjung. Er sehnte sich danach, sie in die Arme zu nehmen, aber wenn er es tat, würde er schwach werden. Gib ihr Zeit, dachte er. Irgendwann würde sie sich mit dem abfinden, was er ihr erzählt hatte, und sie würde ihm verzeihen.
Simon beobachtete sie; er liebte ihren Anblick und wünschte sich nichts mehr, als sie zu trösten, während sie in ihrer Handtasche kramte. Wenige Sekunden später bemerkte er zu seiner Überraschung, dass sie einen Revolver hervorgeholt hatte. Sie sah absurd aus, und ihm war zum Lachen zumute. Vielleicht lachte er tatsächlich. Als sie den Lauf der Waffe auf ihn richtete, erhob er sich halb, benommen vor Ungläubigkeit.
»Nein! Bela! Um Himmels willen …«
Er war außerstande, sich zu bewegen, als er sah, wie ihr Finger sich um den Abzug spannte. Als er herumwirbelte, nahm er keinen Schmerz wahr, nur den vollkommenen Verlust seines Gleichgewichts. Der Knall explodierte in seinen Ohren, als er zu Boden fiel.
Wie im Traum sah er Bela, die sich über ihn beugte, und spürte ihre Tränen, die auf sein Gesicht tropften. Die Waffe zeigte direkt auf ihn, Belas Mund war geöffnet, aber sie hielt die Augen geschlossen, während sie wieder und wieder abdrückte.
Seine Gedanken irrten umher. Es war, als ob er das Geschehen aus großer Ferne beobachtete.
Er hatte gehört, dass Sterbende ihr ganzes Leben in einer Abfolge von Bildern an sich vorbeiziehen sehen, aber für Simon hatte das Leben doch gerade erst begonnen, als er Bela im Wald begegnet war, im Mondlicht einer frostkalten Winternacht.
Teil 1Winter, 20. Januar 2001
Ihrer Blätter beraubt,einsam erstarrt,spürt die Weide, wie die Säfte steigen.
Kapitel 1
Mitternacht. Ein kräftiger Ostwind pfiff unter den Dachtraufen her und blähte die Vorhänge. Kalt strich die Luft über Simons Gesicht und schreckte ihn aus seinem sinnlichen Traum auf. Er zog sich die Decke fester um die Schultern, vergrub sich in das Federbett und suchte noch ein paar Sekunden lang Zuflucht zu seiner Fantasie, obwohl ihm die Erinnerung an den Traum bereits entglitten war. Es war Januar, und die erregten Schreie sich paarender Füchse hallten von den Hügeln wider. Nach achtzehn Jahren dürftigem Sex sehnte er sich noch immer nach Lust und Leidenschaft, aber in letzter Zeit schwand die Hoffnung darauf mehr und mehr.
Simon warf die Bettdecke zurück und stand auf, um das Fenster zu schließen. Der Himmel war mitternachtsblau, und ein gleichgültiger Mond durchschnitt die dünnen Wolken wie eine fahlgelbe Sichel. Hinter dem Gutshaus erhob sich der schlehenschwarze Wald mit einer brütenden Böswilligkeit, die Simon stets beunruhigte. Als ihm ein neuerlicher Windstoß übers Gesicht fuhr, vermeinte er einen leichten Duft von Holzrauch wahrzunehmen. Seltsam! Er ließ den Blick über die Scheunen schweifen, konnte von einem Feuer aber keine Spur entdecken. Dann stieg ihm der Geruch wieder in die Nase, und Simon seufzte, denn er wusste, dass er jetzt die Scheunen würde kontrollieren müssen.
Ein unerklärlicher Trieb drängte ihn zu seiner Frau, und er schob sich vorsichtig zur Pufferzone zwischen ihren tugendhaften Betten vor, wo der Wecker Wache stand und der tickende Sekundenzeiger sie an die verrinnende Lebenszeit erinnerte. Laura atmete schwer, eine Hand über der Decke, das blonde Haar auf dem Kissen ausgebreitet, während ihre Brüste sich verführerisch unter dem dunkelblauen Chiffon des Nachthemds abzeichneten. Über vierzig, aber immer noch reizvoll. Simon war der Schönheit stets verfallen gewesen, und allein der weiße Schimmer ihrer Haut erfüllte ihn mit wildem Verlangen.
Er schlüpfte in die alte Cordhose, die er immer anzog, wenn er die Schafe versorgte, und streifte einen dicken, schon sehr mitgenommenen Pullover über. Dann griff er nach der Taschenlampe und schlich die Treppe hinunter. Auf dem Weg vorbei an der Spülküche nahm er seinen Anorak vom Haken und zog sich die alten Stiefel an. Er verließ das Haus durch die Hintertür, ohne seinen Hund Sam zu beachten, der auf der verglasten Veranda lag und jaulte. Draußen herrschte unverkennbar Frost. Simon angelte einen Schal aus seiner Tasche, schlang ihn sich um den Hals und kostete das Gefühl der schneidend kalten Luft auf den Wangen aus.
Uber den Fußweg, der quer durch das Küchenbeet zum Obstgarten führte, lief er den steilen, eisglatten Hang hinunter zu den Ställen und den Nebengebäuden. Auf der anderen Seite des Hofs glänzten die Schweineställe im Mondlicht. Simon atmete tief ein und genoss die vielen Gerüche, die seine Welt ausmachten, Mist, Heu, der süßsaure Duft der Milchkammer und der warme Gestank seiner Säue. Und Rauch! Irrtum ausgeschlossen! Seine gescheckte Stute wieherte, stampfte mit den Hufen und warf den Kopf hin und her, bis Simon stehen blieb, um ihr das Maul zu reiben. Die Schweine grunzten und scheuchten mit ihrer Unruhe die Tauben von ihren Schlafplätzen auf, die mit panischem Flügelschlagen davonflatterten. Schließlich wandte Simon dem Hof den Rücken zu, nahm den Pfad, der an den uralten Friedhof grenzte, und stapfte in den Wald hinein.
Die Erde war wie im Winterschlaf erstarrt. Er horchte, vernahm jedoch nichts und ging weiter. Die dicht stehenden Eschen und Kastanien ließen das blasse Mondlicht kaum durch, und das Gestrüpp von Weißdorn, Holzapfel und Hartriegel zerkratzte ihm das Gesicht und verfing sich in seinen Kleidern. Seine Stiefel knirschten bei jedem Schritt – ein Geräusch, das die stille Nachtluft wie Gewehrschüsse zerriss.
Als er den Fluss erreichte, glaubte er, den traurigen Klang einer leisen, dunklen Stimme zu hören. Sie verstummte jäh, und er hörte nur noch das unentwegte Rascheln toter Blätter im Wind. Plötzlich sah er durch die Zweige Flammen züngeln. Wer kann das sein?, fluchte er. Landstreicher, Zigeuner oder einer der unzähligen Tramps, die ziellos und ruhelos umherschweiften? Vermutlich »Illegale«, die sich vor den Behörden versteckten. In diesen Zeiten wurde das Treibgut der Welt an die britischen Küsten gespült und zerriss das Gewebe des englischen Lebens. Und jetzt bevölkerten diese Leute sein Land – aber nicht mehr lange.
Während er das steile Ufer hinunterkletterte, keuchte er vor Zorn. Diese Immigranten waren symptomatisch für die Krankheit, die einen hochgeschätzten Lebensstil zerstörte. Er suchte sich einen kräftigen Stock und watete durch das eisige, hüfthohe Wasser des Flusses.
Trotz der Kälte schwitzend, kämpfte er sich die schlüpfrige Böschung hinauf. Vor ihm tat sich eine Lichtung auf, auf der ein alter Karren seit Jahren verrottete. Als Junge hatte er darauf gespielt, und jetzt war es, als stünde der Wagen in Flammen. Funken stoben auf, und auf vier großen Steinen stand ein riesiger Topf, der zischend vor sich hin dampfte und die Luft mit einem verlockenden Duft erfüllte. Die Eindringlinge hatten ein Lamm oder ein Huhn gestohlen. Mit zusammengepressten Lippen wappnete er sich für einen Kampf, aber die Lichtung war verlassen bis auf einen geländegängigen Campingwagen, der sich unter einer alten Eiche befand.
Als Simon auf das Feuer zueilte, stolperte er über die eiserne Deichsel des Karrens und fiel mit dem Gesicht nach unten in den Matsch. Er hörte ein Kind schreien, dann eine geflüsterte Antwort. Wenige Sekunden später berührte ihn jemand an der Schulter. Der Geruch eines schweren, moschusartigen Parfüms hüllte ihn ein, schwarzes Haar fiel ihm ins Gesicht, und eine leise Stimme fragte: »Haben Sie sich verletzt?«
Privatschulenglisch, registrierte Simon irritiert. Er fluchte kaum hörbar, als er aufstand, und empfand im ersten Moment nur Verwirrung angesichts des verschwommenen Anblicks einer Frau im Sari. Nachdem er ein paar Mal geblinzelt und sich die feuchte Erde aus den Augen gewischt hatte, sah er ihr Gesicht und hielt den Atem an. Irgendetwas an ihr berührte ihn, die Büchse der Pandora öffnete sich und tausenderlei Gefühle und längst begrabene Erinnerungen fluteten durch seine Gedanken: Hände, die sich samtweich anfühlten, mit kurzen, spitz zulaufenden Fingern, lachende Augen und bewegliche Lippen, die ihn ständig provozierten.
Während er die verbotenen Bilder abschüttelte, starrte er die Frau viel zu eindringlich an. Sie sah bleich aus im Mondlicht, ihre Haut war wie Alabaster, ihre Augen wirkten unnatürlich groß, und ihre Lippen waren viel zu voll und wohl geformt. Natürlich war das Ganze ein Streich, den ihm das Licht spielte, aber aus ihrer Kleidung zog er den Schluss, dass sie zumindest teilweise indischer Herkunft war. Sie erinnerte ihn an die absurd naiven, aber ungemein erotischen indischen Filme, die spätabends im Fernsehen liefen. Üppige geschürzte Lippen, exotische, mit Kohlestift umrandete Augen, schwarzes Haar, das ihr in Wellen über die Schultern fiel. Selbst die grüblerische Schwermütigkeit, die sie einzuhüllen schien, strahlte etwas berauschend Sinnliches aus. Ihr blasser Teint stand in eigenartigem Kontrast zu den exotischen Gesichtszügen.
Jetzt schob sie ihn am Arm auf einen Klappstuhl zu und trat dann zurück, um ihn mit warmen, fürsorglichen Augen zu mustern.
»Haben Sie sich verletzt?«
»Mir geht es gut, vielen Dank.«
Ein Kind begann leise zu weinen, ohne große Hoffnung darauf, gehört zu werden. So jedenfalls erschien es Simon, und das Geräusch rührte ihn.
»Nehmen Sie Platz, bitte. Ich bin gleich wieder da.« Sie wandte sich ab.
Eigentlich hatte Simon die Absicht gehabt, den Eintopf über dem Feuer auszukippen, um die Flammen zu ersticken, aber jetzt beobachtete er entwaffnet und besiegt, wie sein Huhn im kochenden Wasser inmitten von Zwiebeln, Tomaten, Möhren und Reis langsam aufplatzte. Ein Rosmarinzweig trieb auf der Oberfläche. Nette Idee, dachte er mürrisch. Für den Fall, dass es zu weiteren Diebstählen kommen sollte, prägte er sich die Autonummer des Campingwagens ein. Mit dem nächsten Blick erfasste er die Dinge, die die Frau mitgebracht hatte: eine Holztruhe mit einigen Kochutensilien, zwei Klappstühle und einen Campingtisch. Nicht gerade die übliche Zigeunerausstattung. Er wusste, dass er sie sofort hätte wegschicken müssen, aber Neugier und die atemberaubende Schönheit der Frau hielten ihn ab. Zitternd und durchnässt bis auf die Haut machte er sich darauf gefasst zu warten.
In seiner Nähe knackten einige Zweige. Als die Frau wieder aus der Dunkelheit hervor trat, trug sie ein Kleinkind auf der rechten Hüfte. An der linken Hand hatte sie ein kleines Mädchen von vier oder fünf Jahren, das sehnsüchtig den dampfenden Topf beäugte und in einer Sprache, die wie Arabisch klang, lebhaft redete. Die Kinder waren unglaublich dünn. Dem Kleineren lief die Nase, die Haut um seinen Mund herum war wund und sein Haar feucht. In den Augen des Mädchens schienen sich alle Kümmernisse dieser Welt zu spiegeln. Er war seltsam enttäuscht von der Frau.
»Ihr Sohn braucht einen Arzt.«
»Er war sehr krank, ist aber auf dem Weg der Besserung.«
Simon vermutete, dass sie auf der Flucht waren und sich deshalb versteckten, dass sie hier und da eine Kleinigkeit stahlen. Wahrscheinlich nahm die Frau mitunter auch Gelegenheitsarbeiten an, wenn sich die Möglichkeit dazu bot.
»Wer sind Sie? Was machen Sie hier?«, fragte sie ihn und drehte den Spieß um.
»Ich habe das Feuer gesehen. Der Eintopf riecht gut.« Er blickte lächelnd zu dem Topf hinüber und hoffte, ihr die Verlegenheit zu nehmen, weil sie sein Huhn gestohlen hatte. Aber sie verstand ihn falsch, und im nächsten Moment schimmerte Mitgefühl in ihren Augen auf.
»Oh!« Sie sog kaum hörbar den Atem ein, ein Geräusch, das wie ein Seufzer über ihre geöffneten Lippen kam. »Sie haben Hunger. Sie können natürlich mit uns essen. Es ist genug da für vier.«
Hielt sie ihn etwa für einen Asylanten? Simon hatte das schwarze Haar und den dunklen Teint seiner Mutter geerbt, zusammen mit ihren grünen Augen, die bei ihm jedoch eher braun als grün wirkten. Sah er nach seinem Sturz und in seiner abgetragenen Bauernkluft vielleicht aus wie jemand, der schlechte Zeiten durchmachte?
»Das Essen ist fertig. Es tut mir Leid, dass ich kein Brot habe.« Sie zuckte die Achseln, dann füllte sie mit einer Kelle Gemüse in einen Blechteller. Simon riss sich zusammen.
»Ich habe keinen Hunger, vielen Dank.«
»Ich bestehe darauf. Natürlich haben Sie Hunger. Sie brauchen sich nicht zu genieren.«
Sie gab ihm einen Teller, auf dem eine Zwiebel, ein Hühnerbein, ein wenig Gemüse und eine halbe Kartoffel lagen. Seltsam entrückt setzte er sich auf einen am Boden liegenden Baumstamm und versuchte, sein schlechtes Gewissen mit dem Gedanken zu beruhigen, dass es ohnehin sein Huhn war. Das ältere Kind schlang das Essen mit der tiefen Dankbarkeit echten Hungers herunter, aber der kleine Junge wimmerte fiebrig, und die Frau hatte Mühe, ihn zum Essen zu bewegen.
Mit beharrlicher Neugier tastete Simon sich an die Geschichte der Frau heran; er erzählte ihr von einem lang zurückliegenden Besuch im Nahen Osten und von seiner Bewunderung für die Architektur des alten Irak. Dann beschrieb er ihr die wilden Berge in der Nähe von Sarajevo, wo er Ski gelaufen war, und erwähnte sogar eine Tauchreise in die Türkei. Sie parierte seine Fragen geschickt, und er erfuhr lediglich, dass sie viel in der Welt herumgekommen war. Als sie schließlich erklärte, sie sei müde, stand er auf.
»Vielen Dank für die Mahlzeit. Vielleicht sollte ich mich vorstellen. Mein Name ist Shepherd … Simon Shepherd. Ich bestelle das Land hier.«
Erschrocken und ängstlich zuckte sie zusammen, und der Mund stand ihr halb offen. In Sekundenschnelle drohte sie die Fassung zu verlieren.
»Was ist los? Stimmt etwas nicht?« Er streckte die Hand nach ihr aus, aber sie trat einen Schritt zurück und hatte offensichtlich Mühe, sich wieder unter Kontrolle zu bekommen.
»Nichts. Ich muss Ihnen etwas erklären. Ich war zu müde, um weiterzufahren, deshalb habe ich hier Halt gemacht. Ich befinde mich widerrechtlich auf Ihrem Land. Das tut mir Leid.«
Er sah sie stirnrunzelnd an. »Sie können bleiben, solange Sie möchten. Wir haben reichlich Platz hier. Aber werden Sie denn zurechtkommen?« Ihm fiel auf, dass sie zitterte. Gleichzeitig jedoch strahlte sie irgendetwas nicht recht Fassbares aus, das jedes Mitgefühl verbot und Respekt verlangte.
»Natürlich. Hier gibt es weder Bomben noch Gewehre.«
»Wer sind Sie?«, hakte er nach. »Wo wollen Sie hin?«
»Ich heiße Bela Shah, und ich bin auf dem Weg nach Hause.« Sie streckte ihm die Handfläche entgegen, eine Geste, mit der sie ihn offenkundig wegschicken wollte.
Simon wünschte eine gute Nacht und wandte sich ab, obwohl er im Grunde gar nicht gehen wollte. Aber er wusste, dass er nicht bleiben durfte. Wer waren sie wirklich, und wo kamen sie her? Shah war ein moslemischer Name. Die Kinder konnten Araber sein, aber die Frau mit ihrer blassen Haut und den großen, glitzernden Augen sah schlicht einzigartig aus. Außerdem konnte er keine Ähnlichkeit zwischen der Frau und den Kindern entdecken, und dem Verhalten des älteren Kindes nach zu urteilen, vermutete er, dass sie nicht die Mutter der Kinder war. Sie konnte eine Wirtschaftsasylantin sein, die illegal eingereist war, aber ihre Stimme passte nicht im Mindesten zu dieser Erklärung. Warum also hatten die Kinder solche Angst? Und warum hatte sie ihn so erschrocken angesehen, als er ihr seinen Namen genannt hatte? Er war überzeugt, dass er ihr noch nie begegnet war. Und doch quälte ihn das seltsame Gefühl, dass er ihr nicht zum ersten Mal über den Weg lief. Es war, als hätte er sie vor sehr langer Zeit einmal gekannt.
Die ungelösten Rätsel beschäftigten ihn, während er zu seinem Haus zurückkehrte. Fasziniert und außerstande, das Erlebnis beiseite zu schieben, packte Simon einen Picknickkorb. Das Essen würde für den Abend genügen, aber der Gedanke an die ungewisse Zukunft ließ ihn an der Tür noch einmal innehalten. Die Ungeheuerlichkeit dessen, was er vorhatte, war beängstigend.
Simon, dem seine aufdringliche Hilfsbereitschaft peinlich war, lief zurück zum Wohnmobil. Welcher Wahnsinn hatte ihn getrieben, ihr zu gestatten, auf seinem Land zu bleiben? Er würde in ihre Verschwörung mit hineingezogen werden, und Gott allein wusste, dass ihm jede Hinterhältigkeit verhasst war. Die Lichtung lag still und dunkel da, als er zurückkam. Bela musste wohl schlafen. Also stellte er den Korb auf das Dach des Wohnmobils, wo er vor Füchsen und Dachsen sicher war, und ging wieder heim.
Am nächsten Morgen schien die Sonne von einem silbrigen Himmel auf frostharten Boden. Nachdem er das Melken der Kühe überwacht hatte, zählte er pedantisch jedes Huhn, aber zu seiner Überraschung fehlte kein einziges. Mit schlechtem Gewissen eilte er durch den Wald, mit einem vollen Milcheimer und einer Lammschulter, aber ein Häufchen durchnässtes, verkohltes Fleisch, eine vergessene Sandale und sein unterschwelliges Bedauern waren alles, was noch an die nächtlichen Gäste erinnerte.
Teil 2Frühling, 21. März bis 20. Juni
AlleinFlieht der furchtsame Puma das Morgengrauen.Es bleibt ein Gefühl des Verlustes.
Kapitel 2
Das verzweifelte Blöken der Schafe auf dem Hügel und Sams wildes Gebell weckten Simon noch vor Sonnenaufgang. Er stand schlaftrunken auf, schnappte seine Ausrüstung und sein Gewehr und machte sich zusammen mit seinem Hund auf den Weg.
Es war ein kalter Märzmorgen und noch immer stockfinster, als er das Brachland erreichte, wo Bäume und Büsche wild und unbeschnitten auf dem Kreideboden wucherten. Sinnlos, sich vorsichtig zu bewegen. Jeder Schritt knirschte auf dem gefrorenen Boden wie eine Serie kleiner Knallkörper. Simon hielt inne, um mit der Taschenlampe die Spuren auf dem Boden zu untersuchen. Sam zitterte vor Anspannung.
»Ruhig!«, murmelte Simon seinem knurrenden Hund zu. Wie er schon vermutet hatte, suchte die mysteriöse »große Katze«, die das Vieh der Nachbarhöfe bereits in Furcht und Schrecken versetzt hatte, jetzt auch sein Land heim. Zehn Minuten später hörte Simon ein Fauchen und blieb jäh stehen. Selbst seine menschliche Nase nahm einen moschusartigen, säuerlichen Gestank wahr. Das Tier schien keine vier Meter vor ihnen in den dichten, dornenbewehrten Schlehenbüschen zu lauern. Simonis Herz hämmerte vor Erregung. Es war nicht das erste Mal, dass er der Spur der großen Katze folgte. Aber bisher war er dabei auf dem Land der Nachbarn geblieben, und er war dem Tier noch nie so nahe gekommen. Jetzt lehnte er sich an einen Felsen und zwang sich zu warten.
Nach zehn Minuten hatte Simon kaum noch Gefühl in den Händen. Er schob sich das Gewehr unter den Arm und massierte sich die Finger, bis sie wieder zum Leben erwachten. Sam drückte sich an seine Beine, sodass Simon das ängstliche Zittern des Hundes spüren konnte.
Dann ertönte ein tiefes Knurren, und ein Adrenalinstoß fuhr Simon durch die Adern. Er zielte. Er hatte nicht übel Lust, das ganze Gebüsch mit Schüssen zu durchsieben. Aber wenn die Bestie erst einmal verwundet war, würde sie in die Hügel flüchten, und er würde ihrer Spur folgen müssen. Das konnte dauern. Also richtete er seine Taschenlampe auf das undurchdringliche Gewirr von Dornen und Nesseln, bis er zwei gelbe Augen glitzern sah und das drohende Knurren lauter wurde. Sam, der hinter ihm stand, jaulte auf.
»Sitz, Sam«, flüsterte Simon. Der Hund verteidigte die Herde mit seinem Leben, aber diese unbekannte Gefahr, die lautlos aus der Nacht auftauchte, machte ihm Angst. Für Simon verkörperte die Katze den unwillkommenen Zustrom fremder Menschen, der die geliebte englische Lebensart bedrohte. Mit dieser Bedrohung kann ich fertig werden, dachte er grimmig und spannte den Finger am Abzug noch weiter an.
Er wartete, und die strategische Untätigkeit schlug ihm auf die Stimmung. Alles in ihm drängte zum Angriff, aber er wusste, dass er nicht nachgeben durfte.
Der östliche Horizont färbte sich langsam austerngrau, aber bisher hatte noch kein Lichtstrahl den Wald durchdrungen. Schon bald würde die Katze vor dem Tageslicht fliehen und auf der steinigen Kuppe jenseits des Waldes ein gutes Ziel abgeben. Es war eine Belohnung auf das Leben der Bestie ausgesetzt, und die einheimischen Bauern waren in einen freundschaftlichen Wettstreit getreten; jeder wollte das Tier töten und das Preisgeld einstreichen. Sie alle hatten Lämmer und sogar halb erwachsene Schafe verloren, und in der friedlichen kleinen Gemeinde kursierten die wildesten Geschichten über die Kraft und die Herkunft der großen Katze. Aber bisher hatte niemand sie mit eigenen Augen gesehen. Manche vermuteten, dass es sich um einen aus dem Zoo von Bekesbourne entkommenen Puma handelte oder um einen Leoparden, den jemand sich als Jungtier gehalten und später ausgesetzt hatte. Sie alle hatten die Spuren des Tieres untersucht. Seine Pfoten mussten so groß sein wie Untertassen und hinterließen tiefe Abdrücke auf den schlammigen Pfaden. Sechzig Kilo, hatte einer seiner Nachbarn geschätzt. Simon hatte den Gedanken mit einem geringschätzigen Achselzucken abgetan, aber jetzt war er sich nicht mehr so sicher.
In einem Anfall unerwünschter Tollkühnheit stürzte sich sein Hund ins Gestrüpp und bellte mutig. Wildes Zischen und Jaulen erklang, und Simon machte einen Satz nach vorn. Sam wurde zerfleischt, aber bevor Simon ihm zu Hilfe eilen konnte, flog der Hund in hohem Bogen durch die Luft und heulte kurz auf, bevor er auf dem Boden aufschlug. Simon konnte nur noch einen flüchtigen Blick auf gelbe, glitzernde Augen werfen, als auch schon etwas Schwarzes und sehr Großes an ihm vorbeijagte und in die Hügel floh. Er verlor kostbare Sekunden, während er vor Staunen wie gelähmt dastand, bis er endlich drei Schüsse abgab und den leisen Aufprall der Kugeln auf dem laubübersäten Boden hörte. Dann wandte er seine Aufmerksamkeit Sam zu, der übel zugerichtet war und so aussah, als hätte er an seiner demütigenden Niederlage grausam zu leiden.
»Du dummer Hund.« Simon streichelte den zitternden Collie beruhigend, während er die Wunden untersuchte. Irgendwie fühlte er sich verantwortlich für das, was geschehen war. »Dummer Sam. Du hättest warten sollen. Jetzt komm. Steh auf. Du kannst doch laufen, oder? Du bist gerade noch mal davongekommen, mein Junge. Das wird dir hoffentlich eine Lehre sein.«
Als sie aus dem Wald kamen, beleuchteten die ersten nebligen, malvenfarbenen Sonnenstrahlen die Bäume, und die dunklen Schatten hatten sich bereits über Berge und Täler geflüchtet. Ein ungreifbarer Schimmer legte sich über die Hügel, der kühle Nordwind erwachte zum Leben, und hier und da zwischen den dahinjagenden Wolken zeigte sich noch der Mond. Simon machte sich auf den Heimweg und sah dabei immer wieder zu Sam hinüber, der zwar humpelte, ansonsten aber einigermaßen unversehrt zu sein schien. Der Hund war gut ausgebildet und hätte eigentlich seinen Anweisungen gehorchen müssen.
Obwohl er sich vorgenommen hatte, es nicht zu tun, konnte Simon der Versuchung nicht widerstehen, das bewaldete Flussufer auf Zeichen von Rauch abzusuchen. Aber das Land lag dunkel und verlassen da. Dann ließ sein Gedächtnis verräterisch das Bild von Bela vor ihm erstehen; ihre Augen leuchteten vor Bewunderung, ihre Haut war makellos, und das Haar und die silberne Burkha wehten schimmernd in der leichten Brise. Nicht schwer zu entschlüsseln, befand Simon. Enttäuscht trottete er weiter.
Vom Gipfel des nächsten Hügels aus konnte er bereits das Dorf sehen, Temple Minnis, das noch halb im Morgennebel lag. Simon blieb stehen und drehte sich um. Sam taumelte hinter ihm her. Er würde ihn tragen müssen. Aber vorher zog er sein Handy aus der Tasche und rief den Tierarzt James Evans an, bat ihn, etwas früher zu kommen, und wie immer stimmte James zu. Er war ein guter Freund.
Anschließend nahm Simon den Hund auf den Arm und entschied sich, eine Abkürzung über den Acker zu nehmen. Bald kam auch schon Redhill in Sicht, sein karges, steinernes Gutshaus. Johannes Shepherd, ein Händler aus dem Ort, hatte es über dem verwüsteten Ostflügel eines Klosters aus dem zwölften Jahrhundert errichtet. Das war im Jahr 1530 gewesen, nachdem die katholischen Klöster auf Befehl Heinrichs VIII. zerstört worden waren. Seither bebauten die Shepherds das umliegende Land und erwarben, wann immer sich die Möglichkeit bot, noch weiteren Ackerboden dazu. Vor der Südfront des Hauses wuchsen auf breiten Beeten Krokusse, Schneeglöckchen und knospende Narzissen. Nach Osten hin wechselten sich Getreidefelder mit brachliegendem Weideland ab, auf dem Simons preisgekrönte britische Milchschafe durch die hügelige Landschaft strichen.
Historisch gesehen waren die Shepherds Neulinge in diesem Teil Englands. Vor der letzten Eiszeit hatten steinzeitliche Clans hier gekämpft und gejagt, und ihre heldenhaften Knochen nährten noch heute die fruchtbare Erde. Ihre steinernen Speere, Messer und Grabstichel lagen in Simons Äckern. Schnee und Eis, die sich wieder des Landes bemächtigt hatten, waren schließlich ihr Schicksal gewesen.
Später hatten dann verwegene Volksstämme ihren Weg über die sumpfigen, großen Ebenen des Kontinents genommen, hatten hier gekämpft und sich schließlich in diesem quälend schönen Land niedergelassen, diesem Land mit seinem Nebel und seinem sanften Regen, seinem sommerlichen Zwielicht, seiner fruchtbaren, lange geschundenen Erde, seinen unverfälschten Wäldern und den reinen, schnell fließenden Flüssen. Ihre Frauen hatten Seite an Seite mit den Männern gekämpft, und durch die verwirrenden Nebel der Vorgeschichte schimmerten hier und da noch immer Erinnerungen an die sagenumwobenen Helden jener Zeit durch. Dann waren die Kelten gekommen und mit ihnen ihre Götter. Die Kelten waren nackt auf ihren Streitwagen in die Schlacht gezogen, die Haut geschmückt mit blauen Tätowierungen, mit im Wind wehendem Haar und hocherhobenen Langschweren. Und wann immer sie in die Schlacht zogen, war Morrigan, die grimmige Kriegsgöttin, an ihrer Seite gewesen.
Nur vor Flidais hatten sie sich gefürchtet, vor der verführerischen Jägerin, die sie in die Urwälder locken und ihnen die Körpersäfte aus dem Leib saugen konnte. Sie huldigten Cernunnos, dem gehörnten Gott der Tiere, aber den ersten Platz in ihrem Herzen hatte Epona, die Pferdegöttin, die im Damensitz ritt und all jene bestrafte, die ihren Pferden ein Leid antaten. Die Kelten liebten ihre Tiere, vor allem aber die Pferde. Und Simon wusste, dass diese Kelten noch immer gegenwärtig waren, tief verborgen in englischen Genen und dem Land, das noch immer erfüllt war von ihrer Magie.
Der Familiengeschichte zufolge lag unter dem alten Kloster die Ruine einer keltischen Kapelle, die Ana gewidmet war, der Göttin der Erde und der Fruchtbarkeit, der ältesten und wichtigsten aller keltischen Gottheiten. Als Junge hatte Simon sich gern eingebildet, dass er sie in den Nebelschwaden sehen konnte, die von der See her heraufwehten; vor seinem inneren Auge war ihr halb nackter Körper von Tätowierungen bedeckt gewesen, und das wilde rote Haar fiel ihr bis auf die Hüften.
Bald hatte Simon seine Herde erreicht und atmete voller Freude den Duft der dicken, feuchten Wolle ein. Kurze Zeit später stand er wieder auf seinem Hof. Es war noch nicht einmal sieben Uhr, aber seine neue Mitarbeiterin Sarah Jones hatte die Milchkammer bereits mit dem Wasserschlauch einer gründlichen Reinigung unterzogen. Mit besorgter Miene kam sie jetzt auf ihn zugelaufen und wischte sich die feuchten Hände an der Hose ab.
»Du lieber Himmel! Was ist passiert?« Sie blieb stehen und beugte sich vor, um den Collie zu streicheln, der in Simons Armen heftig zitterte.
»Es gibt sie wirklich … diese so genannte große Katze … Sie sieht aus wie ein Puma. Sam muss genäht werden. Ich fahre sofort zum Tierarzt. Kümmern Sie sich hier um alles. Ich werde nicht lange fort sein.«
»Haben Sie sie getötet?«
»Ich habe sie verfehlt.«
Sie blickte auf. »Mum möchte Sie sprechen … wenn möglich noch heute Abend … das heißt, wenn es Ihnen nichts ausmacht … Es gibt da ein Problem.«
Ihre Worte kamen stoßweise, während sie immer wieder niesen musste. Sarah litt an Asthma und Allergien und hatte deswegen vor kurzem einen guten Job in der Halbleiterfabrik am Ort gekündigt. Sie war eine kräftige junge Brünette mit dunklem Teint und einer Leidenschaft für Pferde, und sie hatte Muskeln wie ein Schmied. Sie lebte mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern im benachbarten Newtown, das direkt hinter den Hügeln lag. Simon mochte die junge Frau, und er vertraute ihr. Trotzdem gelang es ihm jetzt nicht, seine Verärgerung zu verbergen. Sarah bemerkte es und lief dunkelrot an.
»Sie kann nichts dafür. Irgendetwas stimmt da nicht. Wir haben überlegt, ob wir die Polizei verständigen sollen, aber was ist, wenn sie Jules mitnehmen?« Ihre sanften braunen Augen bewegten sich unruhig hin und her.
»Jules ist Ihr Bruder?«
Sarah nickte, den Tränen nahe.
»Er steckt in Schwierigkeiten, ja?«
»Das wissen wir nicht, wirklich nicht.«
»Machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden schon eine Lösung finden.« Simon war wütend, weil er glaubte, dass Sarahs Familie ihn um Geld bitten würde.
»Mum macht Schichtarbeit… also am besten so etwa um acht.«
Warum ich, um alles in der Welt? Und dann auch noch so spät. Simon kam sich ausgenutzt vor und wandte sich ab.
Kapitel 3
Um sieben Uhr abends wusste Simon, dass er zu seiner Verabredung nicht pünktlich sein würde. Auf der Rückfahrt vom Dorf dachte er über den höchst zufrieden stellenden Tag nach, der hinter ihm lag. Seine preisgekrönte schwarzbunte Lieblingskuh Candida hatte gekalbt… ein hübsches Bullenkalb mit milchigen Augen und langen schwarzen Wimpern –, das Wintergetreide gedieh, und die Eierproduktion war gestiegen, obwohl eines seiner Hühner verschwunden war. Das muss die Schuld meiner Tochter sein, befand er. Mit ihren siebzehn Jahren führte Ana einen leidenschaftlichen Kreuzzug für jedes lebende Geschöpf. Sie gehörte einem Dutzend verschiedener Bewegungen an und hatte ihr Zuhause in ein Schlachtfeld verwandelt, bis Simon nichts anderes übrig geblieben war, als sich von seinen teuren Legebatterien zu trennen und sie durch Ställe für frei laufende Hühner zu ersetzen. Was unfair ist, hatte Simon gedacht, als er endlich kapitulierte. Um sechs Uhr hatte Evans, der Tierarzt, angerufen und berichtet, dass er Sam abholen könne. Der Hund sehe aus wie eine Patchworkdecke. Aber er hatte hinzugefügt: »Ihm fehlt nichts, was Zeit und Antibiotika nicht heilen könnten.«
Simon war mit halsbrecherischem Tempo ins Dorf gerast und hatte die schmalen Straßen verflucht, auf denen Holzpflöcke als künstliche Verkehrshindernisse und einkaufsversessene Fußgänger das Vorankommen zusätzlich erschwerten. Er konnte sich noch an die Zeiten erinnern, als das Dorf nur aus einer Hand voll Steincottages um die Kirche herum bestanden hatte, sämtlichst verborgen hinter einem dichten Kastanienhain. Damals hatte das ganze Dorf von den umliegenden Bauernhöfen gelebt. Aber seit den Siebzigern lag das Dorf in Londons weitem Pendlergürtel. Die Cottages waren auf Vordermann gebracht und zu exorbitanten Preisen verkauft worden. Schon bald bauten die alten Einheimischen, die jetzt überwiegend in nichtlandwirtschaftlichen Bereichen tätig waren, Rhabarber und Bohnen an, fuhren ihre Kinder zu kleinen Reitturnieren, bezogen ihre Forellen von der neuen Forellenfarm und spielten im hiesigen Sportclub Golf und Tennis. Simon hatte seinen Wagen in einer Ladezone abgestellt und war in die Praxis geeilt, aber James hatte darauf bestanden, dass er ihm das morgendliche Jagdfiasko in allen Einzelheiten schilderte. Deshalb war er jetzt spät dran.
Mrs Jones war noch nicht erschienen, wie er feststellte, als er auf seinen Hof einbog. Sams Prellungen hatten sich verhärtet, und der Hund konnte sich kaum rühren. Simon trug ihn zu seinem Korb im Wintergarten. Mit ein wenig Glück würde es ihm noch gelingen, ein paar Bissen zu essen.
Leicht irritiert eilte er durch das Haus und schaltete die Lichter und den Gaskamin im Wohnzimmer ein. Der Raum war groß und stilvoll nach Lauras Geschmack eingerichtet, mit leuchtend bunten Sofas, stapelweise Kissen und drei abscheulichen modernen Gemälden an den Wänden. Die Küche erstrahlte im falschen Glanz von Kupfertöpfen und bemaltem Keramikgeschirr, lauter nutzlose Dinge, denn er konnte sich nicht daran erinnern, dass Laura je eine Mahlzeit dort zubereitet hatte. Mrs Watson kam täglich aus dem Dorf herüber, um zu putzen und zu kochen. Sonst wärmten sie sich nur vorgekochte Mahlzeiten auf. Laura, die von Beruf Innenarchitektin war, steckte voller Widersprüche, und die warme und liebevolle Ausstrahlung ihres Heims war nichts als Täuschung.
Am Telefon fand er eine handgeschriebene Notiz von Ana vor. Sie sei mit Freunden ins Kino gefahren. Simon hörte den Anrufbeantworter ab, die gewohnte Nachricht von seiner Frau: »Hallo, Darling, mir ist etwas dazwischengekommen. Ein Kunde besteht darauf, dass wir seinen Auftrag nach der Arbeit bei einem Drink besprechen. Tagsüber kann er es wegen anderer Termine nicht einrichten. Wir sehen uns dann nachher. Ich werde versuchen, nicht allzu spät zu kommen.«
Simon schluckte einen Seufzer herunter und riss sich zusammen. Laura hatte ihr Cottage im Dorf, das sie für geschäftliche Zwecke nutzte, neu eingerichtet, und in letzter Zeit lebte sie praktisch dort. Es war traurig, dass sie sich so auseinandergelebt hatten, und er fühlte sich sehr einsam. Vor Jahren hatte Laura ihm oft vorgeworfen, dass er nicht in der Lage sei, seine Gefühle zu zeigen, aber inzwischen machten sie praktisch nur noch Smalltalk. Simon, der sich bereits mit einem weiteren einsamen Abend abgefunden hatte, kehrte in den Wintergarten zurück, um Sam zu füttern.
Der Hund humpelte stark, untersuchte den Fressnapf und schlich dann wieder zurück zu seinem Korb. Simon strich ihm über den Kopf. »Besiegt von einer Katze, hm. Am besten, du schläfst eine Nacht darüber.«
Wieder in der Küche, gönnte Simon sich ein Glas Rotwein, durchstöberte den Kühlschrank, in dem er etwas geräucherten Schinken fand, und machte sich ein Sandwich. Während er aß, wanderten seine Gedanken immer wieder zu der bevorstehenden Begegnung. Er hatte das Gefühl, dass ein verstörendes Erlebnis auf ihn wartete. Häusliche Geständnisse waren sein wunder Punkt. Vielleicht war das der Grund, warum seine Ehe ins Straucheln geraten war. Sie hatten sich niemals »ausgesprochen«, wie die Amerikaner es so schön formulierten, eine Methode, die auf der anderen Seite des Atlantiks alles in Ordnung zu bringen schien, zu der man in diesem Haus jedoch nur selten Zuflucht nahm.
In diesem Moment fuhr im Hof ein Wagen vor, und Sam stieß ein schwaches Bellen aus. »Pst!« Simon nahm einen großen Bissen, legte das halb gegessene Sandwich in den Kühlschrank zurück, leerte sein Glas und eilte zur Haustür.
Mrs Jones war allein gekommen, und jetzt beugte sie sich über den Kofferraum, in dem sie nach irgendetwas zu suchen schien. Ihre langen, wohl geformten Beine zogen Simons Blick auf sich. Schließlich holte sie einen Mantel und eine Tasche hervor und strich sich mit einer affektierten Geste den hautengen Wollrock glatt. Sie war auf eine schlampige Weise sexy, aber in letzter Zeit fühlte Simon sich von allen Frauen angezogen, vielleicht weil seine Libido ihm schon seit einer Weile schwer zu schaffen machte. Nicht dass es eine Rolle gespielt hätte. Überdies stellte Simon fest, dass Mrs Jones blond war, und einen Moment lang fragte er sich, woher Sarah ihr dunkles Haar haben mochte.
»Mr Shepherd«, rief sie lächelnd, als sei er ein alter Freund. In diesem Augenblick wurde Simon klar, dass er Mrs Jones nicht mochte. Woran lag es, dass er sich immer im Bruchteil einer Sekunde ein Urteil über Menschen bildete? Er wusste, dass das nicht richtig war, und im Allgemeinen begegnete er solchen Leuten mit übertriebener Freundlichkeit, um sich selbst zu beweisen, dass er im Unrecht war. Leider stellte er dann unweigerlich fest, dass er mit seiner Einschätzung richtig gelegen hatte. Selbstgefällig, eingebildet und seicht, befand er und hasste sich gleichzeitig dafür. Simon drückte die Schultern durch. Während die Frau an ihm vorbei ins Wohnzimmer ging, Platz nahm und umständlich die Beine übereinander schlug, wünschte er, sie würde endlich zur Sache kommen.
»Es tut mir so Leid, dass ich Sie jetzt damit belästige. Ich kenne kaum jemanden hier …« Sie plapperte weiter, bis sie endlich auf ihr Problem zu sprechen kam. »Der Pfarrer behält ihn immer länger bei sich, verstehen Sie …«
Während sie sprach, überlief Simon eine Gänsehaut. Das passierte ihm immer, wenn ihm etwas peinlich war. In diesem Augenblick hätte er alles darum gegeben, irgendwo anders zu sein.
»Er kommt nach den Chorproben immer zu spät nach Hause, und manchmal geht Jules auch rüber, um dort aufräumen zu helfen. Zumindest sagt er das. Und plötzlich hat er ständig Geld. Er behauptet, er würde es in der Schule beim Kartenspielen gewinnen. Er ist erst zwölf. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wie soll jemand wie ich etwas gegen den Pfarrer ausrichten?«
Sie zuckte hilflos die Achseln. »Leute in Ihrer Position sind besser geeignet, ihn zur Rede zu stellen. Ihre Freunde würden sicher nicht wollen, dass die Medien auf die Sache aufmerksam werden. Ich möchte meinen Sohn nicht verlieren, aber es muss etwas geschehen. Ich habe Angst, zur Polizei zu gehen. Und was diese Typen vom Sozialamt betrifft…« Sie rümpfte hörbar die Nase. »Sarah meinte, Sie würden uns helfen.«
»Ach ja? Nun, vielleicht sollte ich mal mit Ihrem Sohn reden«, erwiderte er vorsichtig.
»Sie werden bei ihm nicht weit kommen. Sie müssten ins Pfarrhaus gehen und ihn rausholen.«
Er schnitt eine Grimasse und holte tief Luft. Wie konnte sie, eine Fremde, hierher kommen und versuchen, ihn zu einer solchen Peinlichkeit zu drängen?
»Das werde ich ganz sicher nicht tun«, sagte er mit mehr Nachdruck, als er beabsichtigt hatte. »Sie können nicht von mir erwarten, dass ich den Pfarrer eines solchen … hm … dass ich den Pfarrer einer solchen Sache bezichtige. Schließlich habe ich nur Ihr Wort darauf. Sie könnten sich irren, Mrs Jones.«
Sie stand auf und warf ihm einen vernichtenden Blick zu. »Dann werde ich zur Polizei gehen«, drohte sie. »Es muss aufhören … Sofort. Jules ist bei ihm, und er wird nicht vor neun Uhr nach Hause kommen, vielleicht sogar noch später. Also, was ist da los? Sagen Sie es mir.« Sie klang ordinär, und Simon errötete.
»Beruhigen Sie sich. Lassen Sie uns noch einmal darüber nachdenken. Sie sagen, Jules sei jetzt dort?«
»Er bleibt immer ziemlich lange dort, nachdem die anderen schon gegangen sind. Wenn ich Alan davon erzähle – das ist mein Ex, dann wird es Mord und Totschlag geben.«
»Vielleicht wäre er in diesem Fall besser geeignet …«
»Wir leben nicht mehr zusammen. Ich habe Angst vor dem, was er dem Pfarrer antun könnte … Ich meine, er und seine Freunde.«
Simon konnte sich den Lynchtrupp, der von Newton in ihr Dorf herüberkam, lebhaft vorstellen, und die Vorstellung brachte ihn auf die Beine.
»Na schön. Dann lassen Sie uns gehen.«
Simon raste in Richtung Temple Minnis, aber je näher sie dem Dorf kamen, desto mehr zögerte er. Warum hatte er dieser schrecklichen Frau geglaubt? Simon war schon seit einiger Zeit nicht mehr in der Kirche gewesen. Nicht mehr seit Anas Taufe, überlegte er, aber der neue Pfarrer kam gelegentlich zu einem Routinebesuch auf den Hof. Im Allgemeinen ließ er sich mit einem Glas Sherry, einer kleinen Spende und einigen Worten der Ermutigung abspeisen. Simon versuchte, sich daran zu erinnern, wie er aussah, aber er wusste nur, dass der Mann jung und blass war und eine große Brille trug, die ihm immer wieder über die Nase rutschte.
»Ich nehme an, Jules ist bereits zu Hause und fragt sich, wo Sie stecken.«
»Ha!« Sie hob geringschätzig den Kopf und warf ihm einen hochmütigen Blick zu. Aus den Augenwinkeln sah Simon, dass ihre Zähne nach innen geneigt waren. Sie sah einem Nagetier so verblüffend ähnlich, dass ihn ein Schaudern überlief, als er den Wagen vor dem Pfarrhaus parkte.
»Das ist sein Fahrrad, ja. Also ist er da drin, ja.«
Ihre Stimme knirschte unangenehm in Simons Ohren, und er stieg hastig aus dem Wagen.
»Sie warten hier.« Sein Tonfall ließ keinerlei Widerspruch zu.
Die Tür war unverschlossen. Groteske Schatten versperrten den Weg, aber er konnte in der Ferne ein schwaches, flackerndes Licht ausmachen. Er hörte ein leises Stöhnen und hätte um ein Haar in den Raum gerufen, ob jemand dort sei, entschied sich dann aber dagegen. Irgendetwas stank hier zum Himmel. Warum war es so dunkel und so still? Er tastete sich weiter vor und fragte sich, was um alles in der Welt er sagen sollte.
Nachdem er die Tür aufgedrückt hatte, blinzelte er und versuchte, sich einen Reim auf die Szene zu machen, die sich ihm im Kerzenlicht darbot. Der Junge kniete. Das war doch sicher in Ordnung. Der Pfarrer hatte den Blick in ekstatischer Verzückung an die Decke gerichtet. So weit, so gut. Aber es war keine Hostie, die der Junge im Mund hatte.
Für einen Moment war er gelähmt vor Übelkeit und Empörung. Dann verflüchtigte sich die Verwirrung, und er empfand unbändigen Zorn. »Oh Gott! Nein!«, explodierte Simon. »Oh Gott!«
Der Junge zuckte zusammen und fuhr herum, während der Pfarrer vor Schmerz aufschrie, sich krümmte, mit Tränen in den Augen und beiden Händen sein zerbissenes Glied umklammerte.
»Oh Gott«, kam das matte Echo von dem jungen Pfarrer. Dann huschten magere weiße Beine in Richtung Tür.
Während der Junge sich umdrehte, um zu flüchten, konnte Simon einen kurzen Blick auf fein gemeißelte Gesichtszüge werfen. Aber beim Anblick dieses Gesichts stockte ihm der Atem. Der Junge war schön und verdorben, und er lächelte verstohlen. Er sah zu ihm auf, wie eine Hure es hätte tun können, und Simon taumelte in seinem Entsetzen zurück und prallte gegen die Tür. Puck hätte so aussehen können oder ein zügelloser, bösartiger Engel. Er packte den Jungen am Ellbogen und schob ihn hinaus und über den von Lavendelbüschen gesäumten, gepflasterten Weg zu seiner Mutter.
»Warten Sie«, knurrte er.
»Was zum Teufel geht da drinnen vor?« Sie musterte ihn mit mitleidloser Neugier. Unerklärlicherweise stieg ein tiefes, durchdringendes Schuldgefühl in Simon auf.
»Fragen Sie ihn«, sagte er.
»Wir haben gebetet«, heulte der Junge.
Argwöhnisch blickte die Frau zwischen Simon und ihrem Sohn hin und her.
Simon lief zurück ins Haus, wo der Pfarrer leise weinend an seinem Schlafzimmerfenster stand, riss ihn am Arm herum und schleuderte ihn unbarmherzig gegen die Wand. Während der Mann sich den Priesterkragen vom Hals riss, keuchte Simon, so groß war die Anstrengung, sich zurückzuhalten. Plötzlich packte ihn die grauenhafte Furcht, dass er den Mann vielleicht töten könnte.
»Sie sind kein Pfarrer! Niemals wieder!« Atemlos vor unterdrücktem Zorn packte er den Telefonhörer und zerrte den Pfarrer zu dem Apparat hinüber. »Rufen Sie Ihren Vorgesetzten an«, murmelte er und rüttelte ihn. »Wer ist das?«
Mit hochrotem Gesicht schüttelte der Pfarrer nur den Kopf.
»Was ist Ihnen lieber, ein Lynchtrupp oder ein schneller Abgang? Erklären Sie die Angelegenheit dem Bischof und sehen Sie zu, dass Sie von hier verschwinden, bevor ich Sie umbringe.«
Der junge Mann wählte eine Nummer und murmelte unter Tränen ein paar Worte in den Hörer hinein, aber sie schienen nicht viel Sinn zu ergeben. Simon nahm ihm den Hörer ab und umriss mit knappen Worten, was geschehen war.
»Schaffen Sie uns diesen Bastard noch vor Morgengrauen vom Hals. Oder Sie übernehmen selbst die Verantwortung für die Konsequenzen. Ich kann für seine Sicherheit nicht mehr garantieren, sobald das Wort ›Kinderschändung‹ im Dorf erst die Runde gemacht hat.«
»Sagen Sie nichts«, flüsterte eine hinterhältige anonyme Stimme. »Überlassen Sie die Sache uns. Wir werden eine interne Untersuchung durchführen. Es ist nicht notwendig …« Simon ließ den Hörer fallen und stürzte hinaus, um mit tiefen Zügen die frische, saubere Abendluft einzuatmen.
»Lassen Sie uns losfahren!« Er hob das Fahrrad des Jungen in den Kofferraum und fuhr in grimmigem Schweigen zum Hof zurück. Mrs Jones stellte keine Fragen. Sie wiegte ihren Sohn in den Armen und weinte dabei leise. Simon half den beiden in ihren eigenen Wagen und war erleichtert, sie endlich davonfahren zu sehen.
»Was jetzt?«, überlegte er laut. Sollte er die Polizei verständigen? Oder einen Sozialarbeiter? David würde es wissen. Er fühlte sich über und über besudelt und machte sich auf den Weg zu seinem Freund.
Kapitel 4
»Wenn das keine Angelegenheit für die Polizei ist … Zum Teufel mit der schlechten Publicity!«
Als Vorsitzender der Immobiliengesellschaft, die buchstäblich das ganze Dorf verwaltete, sollte David Fergus von diesem Problem erfahren, hatte Simon beschlossen, aber jetzt war er sich da nicht mehr so sicher. Inzwischen war eine Stunde vergangen, und Simon hatte sich hinreichend gefangen. Er wirkte distanziert und verächtlich, er hatte bei der Beschreibung der Szene einen Anflug von Humor gezeigt, und es war ihm sogar gelungen, den Abgrund aus Ekel und blindem Zorn, in den er zu stürzen drohte, vor den anderen zu verbergen. Die Flasche Single Malt Whisky, die sie zusammen in Angriff genommen hatten, war dabei ebenso hilfreich gewesen wie das prasselnde Feuer und das eichenvertäfelte Arbeitszimmer mit seinen bequemen Sesseln aus schwarzem Leder.
David, der gewöhnliche Sterbliche um mehr als Haupteslänge überragte, verströmte genügend Zuversicht, um jeden Vorstand auf seine Seite zu ziehen. Nachdem sein Vater in den Achtzigern gestorben war, hatte David die Peerswürde erlangt, und die Rolle stand ihm ausgezeichnet.
»Es wäre Wahnsinn, das an die Öffentlichkeit dringen zu lassen«, wandte David ein. »Ich werde mich mit der Diözesanleitung in Verbindung setzen.«
»Das habe ich bereits getan.«
»Gut! Die Kirche kann diese Art von Publicity ebenso wenig gebrauchen wie wir. Es würde die Hausverkäufe erschweren und unsere Aktien in den Keller stürzen lassen.«
»Der Junge braucht eine Therapie. Und was ist mit seiner Mutter?«, hakte Simon nach. »Sie wird das Ganze früher oder später aus ihm herausquetschen. Außerdem …« Er brach ab, außerstande, die geeigneten Worte zu finden, die seine Verachtung für Davids eindimensionale Welt ausdrückten. Offenbar wurde diese Welt nur vom Aktienindex regiert.
David setzte sein Vorstandslächeln auf. »Überlass die Angelegenheit nur mir. Mum besänftigen wir mit Zuckerbrot und Peitsche, und einen Seelenklempner für den Jungen bezahlen wir auch. Wenn der Pfarrer nicht bis Tagesanbruch verschwunden ist, werden wir ihn hinauswerfen.«
»Unter welchem Vorwand?«
»Sagen wir doch, er sei wegen Überarbeitung zusammengebrochen.«
Simon lachte kurz und grimmig auf und fügte sich schließlich, wenn auch widerstrebend. »Das ist doch lächerlich. Seine ganze Gemeinde besteht aus nichts weiter als ein paar alten Damen.«
David zwinkerte ihm zu, während er an einer silbernen Zigarrenkiste herumfingerte. »Wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter.« Er zuckte die Achseln, kritzelte ein paar Worte auf einen Notizblock und warf ihn dann beiseite. Irgendjemand anders würde sich darum kümmern. Das war seine Art. Simon beneidete den Freund, der sich jetzt ausschließlich seiner Zigarre widmete, um die Fähigkeit, dergleichen Dinge einfach abzuschütteln.
»Hör mal, Simon, Lloyds hat mich praktisch an die Wand gedrängt, wie du sicher schon gehört hast, und ich versuche, die Verkäufe so schnell wie möglich unter Dach und Fach zu bringen. Sieh dir das mal an.« Er schob einen neuen Prospekt, ein wahres Kunstwerk, über den niedrigen Tisch.
Die Worte: »Dieser Zipfel des ausländischen Ackers wird für immer englisch bleiben« tanzten in scharlachroter Kursivschrift vor Simons Augen. Hinter der Aufschrift prangte ein mit Mohnblumen gesprenkeltes grünes Feld.
»Du kannst nicht…«, murmelte Simon. »Es ist absurd, oder schlimmer noch, es ist anstößig, und es ist schlechter Stil. Außerdem ist es nicht wahr. Ich meine, nimm nur diese abscheuliche Geschichte heute Abend. Das England, das wir kannten, existiert nicht mehr.« Er warf den Prospekt auf den Tisch.
»Unsinn. Wir hatten einen Traum, und wir haben daran festgehalten. Wir haben gewonnen.«
Aber wer hatte dafür bezahlt? Simon kämpfte die Erinnerung an Angelas blasses Gesicht nieder, daran, wie sie ausgesehen hatte, als er sie an die Oberfläche des dunklen, vereisten Sees gezogen hatte. Er erinnerte sich an das aufkeimende Entsetzen, während er alles getan hatte, um sie wiederzubeleben, und gescheitert war. Ein Traum! Mein Gott! Schock und Schmerz hatten eine Lungenentzündung nach sich gezogen, und am nächsten Morgen hatte man ihn ins Krankenhaus gebracht. Die Lungenentzündung war auskuriert, aber seine Schuldgefühle würden niemals Heilung finden. Es erstaunte ihn, dass David ihre früheren Taten noch immer als »Sieg« betrachten konnte. Wütend über Davids mangelnde Sensibilität, stand er auf und wollte gehen. »Überlass das den Werbetextern. Du zahlst ihnen schließlich genug.«
»Warte, Simon. Es ist da noch etwas passiert…« David schob ihm die Flasche zu. »Bedien dich. Du wirst es brauchen.«
»Mir reicht’s, vielen Dank.«
Die Hände in den Taschen vergraben, ging David auf und ab, bis er sich abrupt umdrehte. Er wippte auf den Füßen hin und her, und Simon kam zu dem Schluss, dass er sich im Laufe der Jahre nicht sehr verändert hatte. Er hatte vielleicht ein wenig zugenommen, aber sein Haar war noch immer blond und die Haut bronzebraun. Vielleicht wirkten die schönen grauen Augen eine Spur berechnender. Mit seinen sechsundvierzig Jahren trug er noch immer Tweedanzüge, graue Flanellhosen und verstiegene Westen über weißen Seidenhemden, gerade so, wie er es immer getan hatte, und die Art, wie er jetzt auf den Füßen wippte, erinnerte Simon an frühere heikle Begegnungen. David wusste nicht recht, womit er anfangen sollte.
»Verschwende deine Zeit nicht damit, wie die Katze um den heißen Brei zu schleichen. Du hast es nur mit mir zu tun. Mit Simon.«
»Okay. Tut mir Leid. Also gut. Deine Tochter und eine Bande von Rowdys haben heute Morgen vor meinem Haus der Jagdgesellschaft aufgelauert, die Jäger angepöbelt und mit Farbe besprüht. Unglücklicherweise hat mein Pferd den größten Teil abbekommen. Ich musste den Tierarzt kommen lassen. Ich habe ihm gesagt, er soll dir die Rechnung schicken.«
»Vielen Dank. Komisch, dass der Tierarzt mir nichts davon gesagt hat.« Irgendwo hinter Simons Augen brannte heißer Kummer, während er versuchte, sich den Schock nicht anmerken zu lassen.
»Ich habe Evans gebeten, es nicht zu tun, und natürlich habe ich auch die Polizei nicht verständigt. Was ich hätte tun sollen. Versuch um Himmels willen, Ana im Zaum zu halten. Ich hatte drei todsichere Käufer, und was glaubst du, ist passiert? Sie haben sich anders entschieden. Natürlich waren sie aalglatt und freundlich, und es tat ihnen alles sehr Leid. Sie sagten, sie hätten gehofft, die Londoner Probleme hinter sich zu lassen, und wollten sich nicht stattdessen unsere aufladen.«
»Es wird nicht wieder vorkommen. Natürlich werde ich die Arztrechnung bezahlen. Ich bedaure den Vorfall sehr. Mehr, als ich sagen kann. Wie viele junge Leute waren es?«
»Ungefähr acht, und Ana natürlich. Sie hatte anscheinend das Kommando. Ich hatte sie eingeladen, an der Jagd teilzunehmen. Deshalb wusste sie so genau über den Zeitplan Bescheid. Ich hatte ja keine Ahnung …« Mit finsterem Blick brach er ab.
»Und dein Pferd?« Simon wusste, dass die temperamentvolle Araberstute David viel bedeutete.
»Die Sache hat ihr nicht besonders gefallen. Wir mussten ihr die Flanke mit einem speziellen Lösungsmittel abschrubben und sie anschließend noch gründlich waschen. Das Zeug hat gebrannt, und sie hat nach dem Stallburschen getreten, der daraufhin für eine Woche krankgeschrieben worden ist. Sieh mal, Simon.« David legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Wir kennen uns schon sehr lange. Wir haben einander durch weit ernstere Schwierigkeiten geholfen. Nimm die Sache nicht so schwer. Sie ist erst sechzehn.«
»Siebzehn«, murmelte Simon.
»Schick sie in ein Internat.«
»Das kann ich nicht. Sie hat bereits das Abitur bestanden.« Mit Auszeichnung, wie er nicht hinzufügte, weil es ihm irgendwie nicht passend schien.
»Wie wäre es mit einem sozialen Jahr in der Dritten Welt? Dort könnte sie etwas Nützliches leisten, und die Erfahrung würde sie vielleicht zu Verstand bringen.«
»Einen Versuch wäre es wert.« David ließ ihn relativ ungeschoren davonkommen. Simon wusste, wie dringend er diese Verkäufe brauchte.
Auseinandersetzungen mit Ana waren immer eine quälende Angelegenheit, da sie auf jeden Tadel mit Verachtung reagierte und selbst kein Blatt vor den Mund nahm. Sie war durch und durch überzeugt, dass sie das Richtige tat, und er konnte sich nicht daran erinnern, dass sie bei solchen Streitereien jemals nachgegeben hätte. Nun, diesmal würde sie es tun müssen. Schweren Herzens verabschiedete er sich, wohl wissend, dass er aufbleiben und auf seine Tochter würde warten müssen, um ihr klar zu machen, wo ihre Grenzen lagen.
Kapitel 5
Es war ein langer Tag gewesen. Simon war müde, und sein Kopf fühlte sich dumpf an. Zu viel Scotch. Er nickte ein und wachte wieder auf, steif vor Kälte. Ob Ana und Laura in der Zwischenzeit zurückgekommen waren und ihn hatten schlafen lassen? Ein schneller Blick aus dem Fenster zeigte ihm, dass kein Wagen vor dem Haus stand, und es war fast Mitternacht. Wo also steckten die beiden? Katastrophenbilder blitzten in seinen Gedanken auf. Er wehrte sie ab und setzte sich an seinen Schreibtisch, wo er seine Sorgen und Ängste unterdrückte.
Seine Gedanken wanderten zu Bela, wie sie es so oft taten. Mittlerweile wusste er, wo sie wohnte. Er hatte sich die Autonummer des Wohnmobils eingeprägt und nicht mehr als zwei Telefonanrufe bei einer Bekannten in der Kreisverwaltung gebraucht, um den Namen und die Adresse der Besitzerin zu ermitteln, einer Mrs Bela Shah. Aus den Unterlagen ließ sich allerdings nicht schließen, ob sie verheiratet und welcher Nationalität sie war. Seit damals hatte er alles darangesetzt, die Erinnerung an eine Frau, die er nur ein einziges Mal und bei Mondlicht gesehen hatte, auszulöschen. Er versuchte es noch immer.
Es war nach Mitternacht, als Ana die Haustür öffnete und durch den Flur auf die Treppe zuschlich. Um mit zehn Zentimeter hohen Absätzen auf Zehenspitzen zu gehen, bedarf es der Körperbeherrschung einer Balletttänzerin, durchzuckte es ihn, während er beobachtete, wie seine Tochter das Gleichgewicht verlor. Sie klammerte sich am Treppengeländer fest und bückte sich, um sich die Schuhe von den Füßen zu zerren. Als sie sich wieder aufrichtete und sich die dichten, dunklen Locken aus dem Gesicht strich, enthüllte sie ihr zartes Profil, ein Erbe ihrer Mutter. Alles andere gehörte ihr allein: ein spitzes Kinn, ein ovales Gesicht mit dicken, dunklen Brauen und sanften braunen Augen, mit denen sie jetzt auf der Suche nach Licht nervös die Treppe hinaufspähte. Die Lampen brannten nicht, und Ana wirkte erleichtert.
Sie war siebzehn, sah aber in ihrem dürftigen Top, einer gebauschten Seidenhose und einer schwarzen, ebenfalls seidenen und mit Ziermünzen besetzten Jacke wie mindestens zweiundzwanzig aus. Die Jacke gehörte Laura, und Simon fragte sich, ob sie wusste, dass Ana sie sich ausgeliehen hatte. Selbst aus dieser Entfernung konnte er den Wein in ihrem Atem riechen.
»Du brauchst nicht so zu schleichen. Deine Mutter ist nicht zu Hause, und ich bin noch wach.«
Sie fuhr herum. »Ich bin nicht geschlichen«, schleuderte sie ihm entgegen. »Wo ist Mum?«
»Sie arbeitet noch.«
»Und warum bist du dann noch wach und hockst allein in der Dunkelheit herum?«
»Ich habe auf dich gewartet. Komm und setz dich zu mir. Danke, dass du eine Nachricht hinterlassen hast. Man bekommt im Kino heutzutage also auch Drinks serviert.«
»Sei nicht so abfällig. Das steht dir nicht. Wir sind nach dem Film noch in den Pub gegangen.«
»Du bist minderjährig und hättest da gar nicht sein dürfen. Und die Sperrstunde ist auch schon lange vorbei.«
»Hör auf, auf mir rumzuhacken, Dad. Ich bin müde.«
»Da bist du nicht die, Einzige«, schnaubte er. »Es wird langsam Zeit, dass du vernünftig wirst. Es mag zwar in Mode sein, das Gesetz zu brechen, aber es ist trotzdem falsch.« Er hatte kaum begonnen und befand sich bereits in der Defensive. Verdammt!
»Das tun doch alle.« Ana wechselte mühelos die Taktik. »Armer, alter Astronaut, der sich in Raum und Zeit verirrt hat. Du hinkst uns anderen fünfzig Jahre hinterher.« Sie küsste ihn auf die Stirn.
»Lass das, Ana. Setz dich zu mir. Wir müssen reden.« Er schob sie von sich.
»Ich bin müde, Dad«, jammerte sie und flüchtete sich in das Kind, das sie immer noch war.
»Pech. Du darfst in einem Pub noch keine Drinks bestellen …«
»Habe ich auch nicht. Ich habe sie nur getrunken.«
»Hör auf mit der Haarspalterei. Und du darfst dich auch nicht mit diesem Pöbel abgeben, mit dem du heute Morgen zusammen warst, du darfst meine Freunde nicht verärgern oder mich in Verlegenheit bringen, indem du dich zum Narren machst, und vor allem sollst du nicht grausam zu Tieren sein. Ausgerechnet du! Ich schäme mich für dich.«
Diese letzte Salve müsste sie eigentlich in ihre Schranken weisen, überlegte er.
Mit offenem Mund trat sie einen Schritt zurück; sie war sichtlich schockiert, erholte sich jedoch schnell.
»So spricht Farmer Giles auf dem Weg zum Schlachthof«, spottete sie wild, während ihr die Schamesröte ins Gesicht stieg. »Hör mal, Dad, mein Gewissen ist meine Sache, nicht wahr? Hetzjagden sind eine Schande für uns alle. Sie werfen ein schlechtes Bild auf unsere Gesellschaft, also werde ich dagegen protestieren, wann immer mir danach zumute ist, und du kannst mich nicht daran hindern.«
»Ach, kann ich nicht? Tu, was ich dir sage, oder du wirst dein beträchtliches Erbe verlieren.«
»Oh, bitte! Mehr fällt dir dazu nicht ein?« Sie bückte sich und schlüpfte wieder in ihre Schuhe, als gäben ihr die zusätzlichen zehn Zentimeter Halt.
»Warum tust du das, Ana? Du hast eine gute, christliche Erziehung genossen …«