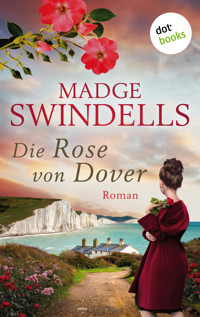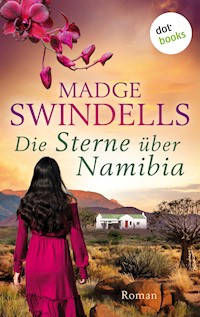5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Frau kämpft gegen dunkle Gegenspieler: der Spannungsroman »Zeit der Entscheidung« von Erfolgsautorin Madge Swindells als eBook bei dotbooks. Was wirst du tun, um dein Glück zu verteidigen? – Sie gilt als das eleganteste Raubtier der Londoner Finanzszene – bis ein Skandal droht, Ninas Karriere zu beenden. Auf der Flucht vor der Presse sieht sie nur einen Ausweg: Sie muss ein paar Monate in Südafrika untertauchen. Aber mit einem hat Nina nicht gerechnet: dass sie hier ihr Herz verlieren wird! Der Geschäftsmann Wolf ist attraktiv und auf geheimnisvolle Art undurchschaubar. Nina wird seine Frau, Mutter eines kleinen Sohnes … und zum ersten Mal in ihrem Leben glücklich! Bis zu dem Tag, an dem Wolf und der kleine Nicholas spurlos verschwinden – und Nina in das Fadenkreuz brutaler Verfolger gerät, die alles tun, um ihren Mann zu finden. Doch mit einem haben sie nicht gerechnet: Dass Nina immer noch kämpfen kann wie eine Löwin! Jetzt als eBook kaufen und genießen: der mitreißende Spannungsroman »Zeit der Entscheidung« von Madge Swindells für alle Fans der Bestsellerautorinnen Lisa Jackson und Karen Rose. Wer liest, hat mehr vom Leben! dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 593
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über dieses Buch:
Was wirst du tun, um dein Glück zu verteidigen? – Sie gilt als das eleganteste Raubtier der Londoner Finanzszene – bis ein Skandal droht, Ninas Karriere zu beenden. Auf der Flucht vor der Presse sieht sie nur einen Ausweg: Sie muss ein paar Monate in Südafrika untertauchen. Aber mit einem hat Nina nicht gerechnet: dass sie hier ihr Herz verlieren wird! Der Geschäftsmann Wolf ist attraktiv und auf geheimnisvolle Art undurchschaubar. Nina wird seine Frau, Mutter eines kleinen Sohnes … und zum ersten Mal in ihrem Leben glücklich! Bis zu dem Tag, an dem Wolf und der kleine Nicholas spurlos verschwinden – und Nina in das Fadenkreuz brutaler Verfolger gerät, die alles tun, um ihren Mann zu finden. Doch mit einem haben sie nicht gerechnet: Dass Nina immer noch kämpfen kann wie eine Löwin!
Über die Autorin:
Madge Swindells wuchs in England auf und zog für ihr Studium der Archäologie, Anthropologie und Wirtschaftswissenschaften nach Cape Town, Südafrika. Später gründete sie einen Verlag und brachte vier neue Zeitschriften heraus, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Bereits ihr erster Roman, »Ein Sommer in Afrika«, wurde ein internationaler Bestseller, dem viele weitere folgten.
Die Website der Autorin: www.madgeswindells.com
Bei dotbooks veröffentlichte Madge Swindells ihre großen Familien- und Schicksalsromane »Ein Sommer in Afrika«, »Die Sterne über Namibia«, »Eine Liebe auf Korsika«, »Die Rose von Dover«, »Liebe in Zeiten des Sturms«, »Das Erbe der Lady Godiva« und »Die Löwin von Johannesburg« sowie ihre Spannungsromane »Im Schatten der Angst«, »Gegen alle Widerstände« und »Der kalte Glanz des Bösen«.
***
eBook-Neuausgabe Juni 2020
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1998 unter dem Originaltitel »Sunstroke« bei Little, Brown and Company, London. Copyright © der englischen Originalausgabe 1998 by Madge Swindells
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2000 by Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach
Copyright © der Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung eines Bildmotives von shutterstock/mamita
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96655-268-4
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Zeit der Entscheidung« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Madge Swindells
Zeit der Entscheidung
Thriller
Aus dem Englischen von Wolfgang Neuhaus
dotbooks.
Prolog
Kapstadt, 30. Juni 1993
Mit ausdrucksloser, unbeteiligter Miene verkündet der Richter mein Urteil. »Nina von Schenk-Möller, ich habe bei meinem Urteilsspruch zu Ihren Gunsten berücksichtigt, dass Sie nicht vorbestraft und noch jung sind. Gegen Sie spricht allerdings die Schwere Ihrer Verbrechen. Hiermit werden Sie in zwei Fällen der Spionage gegen die Republik Südafrika und in vier Fällen des Betrugs für schuldig befunden. Ich verurteile Sie zu sechs Jahren Gefängnis.«
Bewaffnete Beamte führen mich von der Anklagebank fort und die Treppen zu den Zellenblocks hinunter. Laut scheppernd fällt die Gefängnistür hinter mir zu. Ich starre sie an, kann den Blick nicht davon losreißen. Die Anspannung in meinem Inneren ist wie ein stählerner Draht, der sich vom Hals bis zu den Fersen spannt und immer straffer angezogen wird. Ich kann es ertragen ‒ genauso, wie ich die Ungerechtigkeit und den Verrat ertragen konnte. Doch der Schmerz um meinen Jungen ist nicht auszuhalten.
Wo bist du, Nicky? Ich fühle, dass du noch lebst. Weinst du um mich? Hast du Angst? Lieber Gott, beschütze mein Kind, meinen süßen kleinen Sohn. Hilf mir, das alles durchzuhalten, bis ich wieder frei bin und meinen Jungen suchen kann. Hilf mir, dass ich nicht den Verstand verliere. Wenn ich das alles nur begreifen könnte! Warum, Herrgott?
ERSTER TEIL
Kapitel 1
Es gab eine Zeit voller Fröhlichkeit, als die Zukunft wie ein lockender Stern am Himmel meiner unbeschwerten Jugend strahlte und ich, die Novizin des Lebens, die Welt mit neuen Besen kehrte. Ich war von der beruhigenden Gewissheit erfüllt, dass ein allwissendes und gütiges Schicksal über mich wachte. Ich war sicher, dass die Bande zwischen meinen Eltern unzerreißbar seien. Ich war überzeugt davon, als Erwachsene ein erfülltes Leben zu finden. Ich glaubte fest daran, dass kluge Menschen die Geschicke der Welt leiteten. Und vor allem glaubte ich an die alles heilende Kraft der Liebe.
Ich wuchs in den nebligen Bergen von Torrindon im schottischen Hochland auf. Ich wusste, wo der Goldadler in den unzugänglichen Gipfelregionen des Liathach sein Nest baute. Oft beobachtete ich, wie der Adler über den See schwebte und im Wald verschwand, um dort auf Jagd zu gehen, und kurz darauf vernahm ich die schrillen Todesschreie eines Kaninchens oder eines Hasen, die abrupt verstummten. Manchmal, an Frühlingsabenden, hörte ich die zornigen Rufe des Adlers und wusste, dass er wieder töten musste, wollten er und seine Jungen nicht sterben.
Die Sommer waren die schönste Zeit des Jahres. Oft schlich ich mich aus dem Haus, um in den Nächten, in denen es nie völlig dunkel wurde, auf Streifzüge zu gehen. Ich sah Hirsche und Rehe und wilde Ziegen, die zum Seeufer herunterkamen, um dort zu grasen und zu trinken. Ich wurde braun gebrannt, kräftig und abgehärtet; ich hatte Kratzer am ganzen Körper, und mein dunkelrotes Haar wurde lang und widerspenstig und gebleicht von der Sonne.
Als Einzelkind, das noch dazu in einem abgeschiedenen Haus aufwuchs, wusste ich kaum etwas darüber, was üblicherweise die Jungen taten und was die Mädchen. Statt mit Puppen zu spielen, lernte ich, im Kanu auf reißenden Bergflüssen zu paddeln und an den stürmischsten Tagen mit Vaters kleiner Jacht auf dem See zu segeln. Ich bestieg sämtliche Gipfel in der Gegend und ging im eiskalten Wasser der Bergseen schwimmen. Ich konnte mit der Schleuder besser umgehen als jeder Junge, den ich kannte. Ich lernte, den Fährten der Wilderer zu folgen und ihre Fallen unschädlich zu machen. Ich lernte, Holz zu hacken und Bretter zu sägen. Doch eines lernte ich nie: Angst zu haben. Die Angst war etwas für Schwächlinge und Versager. Wir Ogilvies kannten keine Angst. Und so wurde ich stark und zäh und selbstbewusst ‒ und ein bisschen überheblich ‒ in meinem Hafen des Glücks, dem alten Herrenhaus meiner Eltern, das zwischen den Fichten am Ufer des Sees stand.
Die Winter waren eine Zeit der Ruhe und Beschaulichkeit, wenn das Kaminfeuer loderte und das Haus vom würzigen Duft brennender Fichten-, Eiben- und Wacholderzweige erfüllt war. Oft lag ich dann auf einem schwarzen Läufer aus Schaffell vor dem Kamin, las stundenlang und lernte neue Freunde kennen: David Copperfield, Tarn O’Shantner und Wandering Willie. Spätabends schwelte die Glut unter großen Torfstücken im Kamin; am frühen Morgen, bevor ich mich auf den Weg zur Schule machte, verbreitete sie immer noch wohlige Wärme. Im Winter war Mutter des Öfteren zu Hause, und manchmal schaute Vater herein, um die Ehrerbietung und Bewunderung zu genießen, die heimkehrende Krieger sich verdient haben.
Wir lebten ein abgeschiedenes Leben in Ogilvie Lodge. Der einzige Ort im weiteren Umkreis hieß Torrindon. Dort ging ich zur Schule. Meine Mutter liebte den Trubel und die Gesellschaft anderer Menschen und war deshalb oft tagelang fort, um dann mit einer großen Ladung Einkaufstaschen und Hutschachteln und in Seidenpapier gewickelten Geschenken nach Hause zu kommen, wobei ihre Augen unter ihrer modischen Frisur funkelten. Während sie mir dann ihre neuen Kleider, ihren neuen Schmuck und die nutzlosen Geschenke zeigte, die sie mir mitgebracht hatte, war das Haus von den Klängen schwungvoller Tanzmusik erfüllt, und Mutter pochte mit der Schuhspitze im Takt auf den Fußboden.
Sie war eine Träumerin, die ein Dutzend Leben gleichzeitig lebte. Als junges Mädchen saß ich manchmal mit ihr zusammen und lauschte gespannt, wenn sie sich Geschichten darüber ausdachte, was mit mir und ihr und Daddy hätte sein können, würden wir nicht so abgeschieden leben, und ich betrachtete ihr langes, rot schimmerndes Haar und ihre großen blauen Augen, die sehnsüchtig durchs Fenster auf die schneegekrönten Berggipfel blickten.
Warum hatte sie sich für Vater entschieden? Vielleicht, weil er beim britischen Geheimdienst arbeitete. Vielleicht, weil das Königshaus ihm für seine Verdienste um die Krone drei Orden verliehen hatte. Vater war ein besonderer Mann ‒ Sportler, Geheimdienstagent, Commander bei der Marine, der örtliche Friedensrichter, wenn er zu Hause war, und der beste Schütze im Distrikt. Er beherrschte mehrere Sprachen fließend und war in jeder Hinsicht Perfektionist. Aber er war auch ein harter Mann, der hohe Ansprüche an sich selbst und andere stellte. Doch bei aller Strenge hatte er viel Sinn für Humor, und unsere Familie wurde in Torrindon und der Umgegend geliebt und verehrt. Ich bewunderte meinen gutaussehenden Vater mit seinen fröhlichen braunen Augen und dem hellbraunen Haar.
Maria, unsere Haushälterin, liebte ich wie eine Mutter. Da meine Eltern so viel unterwegs waren, übernahmen Maria und Mac, ihr Mann, häufig die Rolle von Pflegeeltern. Sie waren freundlich und warmherzig. Die Küche war Marias Königreich ‒ ein großer Raum, der uns als Wohnzimmer diente, wenn meine Eltern nicht daheim waren. Mac war Hausmeister und Gärtner und Chauffeur in einer Person. Ich kannte ihn immer nur als Mac. Unter seiner liebevollen, aber sorglosen Anleitung baute ich ein Baumhaus, als ich zehn Jahre alt war, und schoss meinen ersten ‒ und letzten ‒ Vogel, um den ich tagelang weinte.
Als ich elf Jahre alt war, entdeckte ich einen Otter am Ufer des Torrindon Loch ‒ so hieß der See, an dem unser Haus stand. Das arme kleine Wesen saß in einer Falle und war halb tot vor Kälte und in tiefem Schock. Ich befreite das Bein des Otters aus der Falle; dann wickelte ich das Tierchen in meinen Pullover und nahm es mit nach Hause, wobei mir die Tränen über die Wangen liefen.
Maria kam aus dem Haus gerannt, als sie mich weinen hörte. »Nina! Was ist denn, mein Schatz?«
»Hol eine Schachtel! Mach schnell, bitte! Ich habe einen Otter gefunden … Er saß in einer Falle. Ruf Mac! Schnell, schnell, wir müssen ihn zum Tierarzt bringen! Vielleicht kann der ihm helfen. Das arme Tier hat schreckliche Schmerzen.«
Mac fuhr mit mir in die Stadt, wo die Wunde des Otters von unserem Tierarzt, Dr. MacIntyre, genäht und verbunden wurde. Er gab dem Otter eine Überlebenschance von fünfzig Prozent. Vier Tage lag er in einem Korb neben meinem Bett, knabberte lustlos Heringe und Forellenfilets und versteckte sich, wenn ich zur Schule ging. Nach zwei Monaten hatte er sich so prächtig erholt, dass er einen Platz in unserem Haus beanspruchte, nachdem er einen heftigen Streit mit unserer Deutschen Dogge ausgetragen hatte, die den Namen »Brigit« trug, nach einer keltischen Göttin. Meinen neuen Freund nannte ich »Otto den Tapferen«. An Winterabenden legte ich mich auf das Schaffell am Kamin und las Otto und der frierenden alten Brigit im schwachen Licht der Flammen meine Lieblingsgeschichten vor: Ivanhoe, Entführt und Der Wind in den Weiden.
Eines Tages ‒ ich war dreizehn Jahre alt ‒ verschwand Otto. Es war später Herbst. Ich suchte das gesamte Ufer des Sees nach ihm ab, kämpfte mich durch Dornengestrüpp und dichten Adlerfarn und stapfte durch morastige Senken voller faulender abgefallener Blätter. Ich sah die scheuen Eichhörnchen, die für die lange dunkle Jahreszeit Eicheln und Bucheckern sammelten, und ich beobachtete die wilden Ziegen in ihrem prächtigen glänzenden Winterfell. Schließlich entdeckte ich Ottos Leiche in einer der Senken. Ihm war beinahe der Kopf vom Rumpf getrennt worden, offenbar vom Hieb mit einem Spaten. Sofort hatte ich unseren Nachbarn in Verdacht, den Bauern John Gilmore.
Ich wickelte Otto in meinen Mantel, machte mich auf den Weg zu Gilmore, der am Kamin saß und Tee trank, und schleuderte ihm meine Anschuldigung entgegen.
»Sie haben Otto ermordet! Das melde ich dem Tierschutzverein! Sie sind ein grausamer, widerlicher Mann!«
Der Bauer und seine Frau reagierten bestürzt. »Aber diese Viecher sind Schädlinge, Mädel. Und ich wusste ja nicht, dass es dein Otto ist. Komm, wir werden ihn anständig beerdigen.«
Sie überredeten mich, ihnen Ottos sterbliche Überreste auszuhändigen, die sie dann in ihrem Rosengarten vergruben.
Später wurde mir klar, dass der Spaten des Bauern letztendlich ein Segen gewesen war. Denn wie hätte mein armer zahmer Otto in Freiheit überleben sollen?
Wenige Wochen später wurde mein Vater bei einem Autounfall zum Krüppel, und unsere heile Welt fiel auseinander.
***
Die nächsten Monate waren bitter. Vater wurde mürrisch und in sich gekehrt. Mutter nörgelte und weinte und unternahm wochenlange, weite Reisen. Wenn sie nicht da war, erfüllte Maria gänzlich die Mutterpflichten. »Was würde das arme Mädchen ohne uns anfangen?«, hörte ich sie einmal sagen. »Es ist eine Schande!«
Einen Monat später packten Maria und Mac ihre Habseligkeiten und erklärten mir, sie würden uns verlassen.
»Warum?«, fragte ich verwundert.
»Weil deine Eltern uns gekündigt haben, mein Kind.«
»Ich gehe mit euch, Maria.«
Sie lachte. »Du bist nicht unsere Tochter, Kleines. Wir haben eine neue Arbeitsstelle gefunden und können dich nicht mitnehmen, und wenn du es noch so gern möchtest.«
Ich schloss daraus, dass Maria und Mac mich nicht mitnehmen wollten. Offenbar war ihre Liebe zu mir gleichsam mit einmonatiger Kündigungsfrist gestorben. Voller Verzweiflung wandelte ich um den See herum und versuchte, mit dieser unerwarteten Zurückweisung fertig zu werden. Als ich Stunden später nach Hause kam, wollte ich Mutter zur Rede stellen. Zu meinem Erstaunen packte auch sie ihre Sachen. Als ich zu ihr aufs Zimmer kam, stand sie vor dem Spiegel, während ihr Koffer auf dem Bett lag. Ich trat neben Mutter, und wieder einmal fiel mir auf, dass ich fast schon so groß war wie sie. Doch Mutter war zierlich, ich dagegen war kräftig gebaut.
»Wir ziehen nach Bristol, Nina, und werden bei Onkel Theodore wohnen.« Mit ihren wunderschönen blauen Augen blickte sie mein Spiegelbild an. »Du wirst ihn sehr mögen, Nina, und wir werden ein glückliches Leben führen. In Bristol gibt es viele Geschäfte und viele schicke Sachen. Und du wirst eine Menge Freunde finden.«
»Ich hasse Einkäufen, und neue Sachen brauche ich nicht.«
»Aber sieh dir an, wie kurz dein Kleid geworden ist. Du liebe Güte, wie schnell du wächst, Nina! Wenn du größer bist als die Jungs, findest du nie einen Mann. Nun mach nicht so ein Gesicht. Sei ein braves Mädchen. Du siehst gar nicht hübsch aus, wenn du eine Schnute ziehst. Außerdem kann ich es nicht leiden, wenn du die beleidigte Leberwurst spielst.«
»Ich möchte zu Hause bleiben. Bei Dad.«
»Aber Schatz. Dein Vater und ich trennen uns. Du musst bei einem von uns bleiben, und dein Vater ist ein schwer kranker Mann. Wen hast du eigentlich lieber, Daddy oder mich?«
Wie sollte ich ihr die Wahrheit beibringen?
Einen Tag später, als die schreckliche Trennung kurz bevorstand, trug ich das Problem meinem Vater vor. »Schick mich nicht weg, Daddy. Ich kümmere mich um dich. Wir werden prima miteinander auskommen. Ganz bestimmt!«
Vater lehrte mich die harte Wirklichkeit des Lebens, als er mich mit wenigen kühlen Worten zwang, mich der neuen Welt zu stellen.
»Heutzutage sind Scheidungen etwas Alltägliches«, sagte er. »Deine Mutter und ich sind nicht die Ersten, und wir werden nicht die Letzten sein ‒ allenfalls in unserer Familie. Du musst darunter leiden, ich weiß. Aber vergiss nicht, du bist eine Ogilvie. Und hier draußen hast du sowieso ein zu einsames Leben geführt. Du bist besser beraten, bei deiner Mutter zu bleiben.«
»Und wann sehe ich dich?«, fragte ich voller Schmerz.
»Mich?« Er schien ehrlich verwundert. »Hör zu, Nina. Im Leben ist es selten so, wie man es sich wünscht. Will man durchkommen, muss man die Veränderungen hinnehmen und das Beste daraus machen. Streng dich in der Schule an und versuch, gut mit deinem Stiefvater auszukommen. Du bist bald erwachsen, und dann wirst du ein freier Mensch sein.«
»Aber ich liebe dich, Dad.« Ich streckte die Hände aus und legte sie ihm auf die Wangen, während ich gegen den Aufruhr in meinem Inneren kämpfte.
Ich weiß noch, wie Vater mich seltsam anschaute. »Bald bist du eine Frau«, sagte er nur. »Und Frauen vergessen die Liebe schnell.«
Wie kalt er war. In diesem Augenblick hasste ich ihn.
Ich bestand darauf, ein Internat zu besuchen. Hin und wieder bekam ich Vater zu sehen, doch er schien in seiner eigenen Hölle auf Erden gefangen und konnte nicht einmal die Hand zu einer zärtlichen Geste ausstrecken ‒ am allerwenigsten bei einer jungen Frau, die ihrer Mutter so sehr ähnelte wie ich. Meine Verzweiflung machte mich wild und unberechenbar. In der Schule wurde ich zur treibenden Kraft bei den verwegensten Streichen und Abenteuern, bis die Rektorin erschrak, wenn sie mich nur kommen sah.
Mein Vater widmete sich der Malerei und wurde mehr und mehr zu einem Einsiedler, der in drei Zimmern unseres großen alten Hauses lebte. Das Putzen, Kochen und Fahren übernahm ein Ehepaar aus der Gegend. Ich besuchte Vater einmal im Monat, doch unsere Treffen waren stets schmerzlich. Nie konnten wir die Mauern niederreißen, die zwischen uns standen; dennoch war ich jedes Mal traurig, wenn ich mich von ihm verabschieden musste.
Inzwischen wusste ich, dass auf der Welt nur die Sieger zählten. Welcher Gott die Erde erschaffen hatte ‒ er kannte keine Gnade mit den Schwachen oder Verkrüppelten oder welche Spezies man auch anführen möchte. Hatte Gott es nicht so eingerichtet, dass lebende Wesen einander fraßen? Dass sie lebten oder starben, je nachdem, wie stark und rücksichtslos, wie gerissen und intelligent sie waren? Töten oder getötet werden, fressen oder gefressen werden, siegen oder besiegt werden ‒ es war eine Welt, die ich begreifen konnte, eine Welt, in der die Logik regierte und in der Rührseligkeiten fehl am Platze waren. Es war eine Welt, in der ich zu den Siegern zählen konnte.
Deshalb suchte ich, so wie der Goldadler, in den höchsten Berggipfeln nach meinem eigenen Revier und fand es.
Kapitel 2
FINANCIAL TRIBUNELondon, 15. Dezember 1989
Das schrecklichste Raubtier im Dschungel der Anlageberatung und des Investment-Managements ist Nina Ogilvie, stellvertretende Direktorin der Abteilung für Vermögensverwaltung der Bertram’s Bank. Mit 28 Jahren hat Ogilvie die Kontrolle über das Kapital von nicht weniger als 500 Pensionsfonds, das sich auf insgesamt mehr als fünfzig Milliarden Pfund beläuft. Wer die Macht über die Pensionsfonds besitzt, der hat die wahre wirtschaftliche Macht in dieser Stadt. So mancher Topmanager musste bereits den Hut nehmen, wenn die Bilanzen des von ihm geführten Unternehmens nicht den Erwartungen Ogilvies entsprachen.
Geradezu beispielhaft ist ihr letzter Coup ‒ die Übernahme der landesweiten Sidor-Supermarktkette. Ogilvie hielt den bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden der Ladenkette, Sir Reginald Sidor für inkompetent, sodass sie ein Übernahmeangebot unterstützte, das Cedric Jedrow unterbreitet hatte. Kaum ließ Jedrow in der Öffentlichkeit durchsickern, Nina Ogilvies Rückendeckung zu besitzen, war die Übernahme der Ladenkette so gut wie unter Dach und Fach. Sir Reginald, von Jugend an darauf vorbereitet, das Geschäftsimperium seines Vaters zu leiten, fand sich über Nacht auf der Straße wieder…
»Verdammter Mist!«
Da stand noch viel mehr. Ich konnte es nicht fassen, dass die Presse einen solchen Blödsinn über mich schrieb. Kurz ließ ich den Blick über die Kommentare schweifen. Dann drückte ich auf die Taste der Gegensprechanlage, um mit meinem Chef Eli Bertram zu reden.
»Nina?« Elis Stimme. »Ich wollte Sie gerade zu mir bestellen …«
»Ich weiß auch, warum.«
»Kommen Sie, sobald Sie Zeit haben.« Seine Stimme klang gereizt.
»Ich bin schon unterwegs«, sagte ich.
Ich eilte in das Bad neben meinem Büro. Es war acht Uhr früh, und ich war gerade erst gekommen. Draußen fegte ein heftiger Südwestwind mit achtzig Sachen durch die Straßen Londons, und mein Haar stand mir vom Kopf ab, als hätte ich eine Hochspannungsleitung berührt. Seufzend betrachtete ich mich im Spiegel. Ich hatte alles, was ich verabscheute: Wirres dunkelrotes Haar, blasse Haut, grüne Augen. An diesem Tag sah ich sogar noch blasser aus als gewöhnlich, und in meinem Blick lag Furcht. Ich hatte das unbestimmte Gefühl, dass sehr schlechte Neuigkeiten auf mich warteten. Hatte es mit diesem Zeitungsbericht zu tun? »Ruhe bewahren, Nina«, sagte ich zu meinem Spiegelbild.
Als ich die Treppe ins Erdgeschoss hinuntereilte, dachte ich an Eli und meinen Job und an die überaus negative Publicity für mich und die Bank. Eli Bertram war ein Mann, den ich bewunderte, weil er sich nur von Logik und kühler Vernunft leiten ließ. Er war der einzige Überlebende einer jüdischen Bankiersfamilie. Als junger Mann war er vor den Nazis aus Hamburg quer durch Europa geflüchtet und schließlich nach Großbritannien gelangt, wo er in die Royal Air Force eintrat und bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs als Bordschütze Dienst tat. In den harten Nachkriegsjahren hatte er mit Erfolg die elterliche Bertram’s Bank neu gegründet, diesmal in London. In den späten sechziger Jahren bildete er seine Abteilung für Vermögensverwaltung und Anlageberatung, der ich angehörte.
Vor sieben Jahren hatte ich als unbedarfter Neuling bei Elis Bank angefangen, nachdem ich meinen Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft gemacht hatte. In dem Klima der kühlen Vernunft war ich rasch gediehen und hatte eine steile Karriere gemacht. Doch ich ließ mich nicht ausschließlich von Vernunft und Logik leiten, sondern stets auch von meiner Intuition ‒ und die sagte mir jetzt, dass mir gewaltiger Arger bevorstand.
Als ich Elis Büro betrat, brannten meine Wangen. Eli erhob sich schwungvoll. Trotz seiner dreiundsiebzig Jahre war er noch immer ein athletischer und gut aussehender Mann mit durchdringenden schwarzen Augen und dichtem weißem Haar.
»Tja, Nina, wir haben ein echtes Problem. Jetzt, wo die Medien auf Sie aufmerksam geworden sind, haben wir möglicherweise bald die ganze Pressemeute am Hals.« Elis Augen funkelten belustigt. »Man wird Bilder von Ihnen veröffentlichen wollen, zumal Sie äußerst fotogen sind. Man wird in Ihrem Privatleben herumschnüffeln. Würde ein Reporter Sie beobachten, wie Sie … sagen wir, mit Neville Wimpey zu Abend essen, würden die Aktien seines Unternehmens in Schwindel erregende Höhen steigen und dann doppelt so schnell in den Keller fallen. Ich weiß, dass Sie niemals Interviews geben, aber die Presseleute kennen Mittel und Wege, über jeden etwas herauszufinden. Der Artikel über Sir Reginald Sidor hat es ja bewiesen.« Er setzte sich wieder, verschränkte die Hände hinter dem Kopf und blickte mich fragend an. »Aber wir werden ihnen einen Strich durch die Rechnung machen, Nina. Ich nehme an, Sie sind sich im Klaren darüber, dass Sie sich mit Sidor einen gefährlichen Feind geschaffen haben?«
»Ja. Aber was das betrifft, muss er sich ans Ende der Warteschlange stellen.«
Eli bedachte mich mit einem knappen Lächeln, und ich fühlte mich ein bisschen besser.
»Das ändert aber nichts daran, dass Sir Reginald gestern im Unterhaus vor der Gefahr einer zunehmenden Macht der Anlageberater gewarnt hat. Er hat viel Zustimmung gefunden, und das könnte Probleme für uns bedeuten.«
»Verlierer jammern immer. Das haben Sie mich gelehrt, Eli.«
»Stimmt. Na ja … jedenfalls, ich habe da eine Idee. Kaffee, Nina?«
»Ja, gern.«
Eli drückte auf einen Knopf an der Gegensprechanlage und ließ uns von seiner Sekretärin Kaffee bringen. »Ich habe noch mehr schlechte Nachrichten«, fuhr er dann fort. »Aber die können wir gern ein andermal besprechen, wenn es Ihnen lieber ist.«
»Erzählen Sie’s mir jetzt. Dann haben wir es vom Tisch. Ich habe gelernt, ziemlich gut mit den Höhen und Tiefen meines Jobs fertig zu werden.«
»Die Sache betrifft Ralph Dorrington.«
Ich hatte das Gefühl, Eli hätte mir einen Eimer kaltes Wasser ins Gesicht geschüttet. Wusste er es? Wussten es alle? Affären zwischen Arbeitskollegen wurden gar nicht gern gesehen, aber Ralph und ich waren diskret gewesen. Unser beider Privatleben spielte sich weit entfernt von den neugierigen, sensationslüsternen Augen dieser Stadt ab. Ich erhob mich mit einer raschen, unwirschen Bewegung und blickte durch das Doppelglasfenster auf die kahlen Äste des Ahorns, die im Wind zitterten.
»Ralph ist nichts für Sie, Nina. Warum suchen die klügsten Frauen sich immer die größten Dummköpfe aus?« Eli versuchte höflich zu sein, aber er war einfach nur unverschämt.
»Warum suchen manche Männer sich Fleisch gewordene Blondinenwitze aus?«, erwiderte ich respektlos. Ich brauchte mich nicht umzudrehen; ich wusste auch so, dass ich einen Treffer gelandet hatte. Mit seiner dritten Ehe hatte Eli sämtliche Angestellten der Bank schockiert.
»Jetzt hören Sie mal gut zu, Nina. Sie haben mit achtundzwanzig Jahren schon sehr große Macht. Sie sind meine eigene Entdeckung ‒ eine Frau von seltener Auffassungsgabe. Und Sie haben eine untrügliche Nase für gute Geschäfte. Ich glaube, man kann es mir nachsehen, wenn ich väterliches Interesse an meinen besten Mitarbeitern zeige.«
»Reden wir jetzt über meinen Job? Zwischen geschäftlichen und privaten Dingen liegen Welten. Wenn Ralph mich vögelt, hat das nichts mit unserem Job zu tun.« Angesichts meiner Wortwahl wurde ich rot. »Und das mit dem väterlichen Interesse sollten Sie sich sparen, Eli. Das passt nicht zu Ihnen. Ich mag Sie lieber so, wie Sie sind. Und noch etwas. Da wir nun schon mal so offen miteinander reden … haben Sie einen Privatdetektiv beauftragt, Ralph und mir nachzuspionieren?«
»Ja«, sagte er mit einem herausfordernden Blick.
Eigentlich hatte ich mit nichts anderem gerechnet; dennoch brachte sein Geständnis mich auf die Palme. Ich hatte Eli immer bewundert.
»Ich glaube, mit Ihrer Spürnase hätten Sie sogar bei den Nazis Karriere machen können.« Es war eine mehr als dumme Bemerkung, und kaum hatte ich die Worte gesagt, fragte ich mich auch schon, wo ich einen neuen Job finden könnte, der so gut bezahlt wurde wie dieser.
Elis Augen waren mit einem Mal so kalt wie Gletschereis. Und seine Stimme klang nicht minder frostig.
»Geben Sie sich keine Mühe, Nina. Ich kenne Ihre Taktik. Schließlich habe ich sie Ihnen beigebracht. Den Gegner schockieren und dadurch unachtsam machen, dann eine Rauchbombe werfen und aus dem Nebel heraus scharf schießen.« Er blickte mich fest an. »Und jetzt halten Sie den Mund, und hören Sie mir gut zu. Für viele Leute, die bei uns ihr Geld investieren, steht die Existenz auf dem Spiel. Also muss ich wissen, ob ein Trottel wie Dorrington hier arbeitet, weil er gut im Bett ist oder weil er was auf dem Kasten hat. Nun, jetzt weiß ich ja Bescheid. Der Mann ist ein aufgeblasenes Arschloch, das sich als Banker verkleidet hat, und Sie haben ihn beschützt.«
Was sollte ich dazu sagen? Eli hatte ja Recht.
»Es kommt noch schlimmer. Der Kerl treibt es auch mit Ihrer Sekretärin.«
»Was?« Ich hatte alle Mühe, die Beherrschung zu wahren ‒ und das nicht nur wegen der niederschmetternden Neuigkeit über Ralph und meine Sekretärin. »Sie lassen Mitarbeiter ausspionieren! Erwarten Sie etwa, dass die sich das einfach gefallen lassen und treu zu Ihnen und der Bank stehen? Leben Sie wohl, Eli. Sie bekommen noch heute meine schriftliche Kündigung.« Ich ging zur Tür. »Nun warten Sie doch, Nina. Davonzulaufen ist keine Lösung.« Widerwillig blieb ich stehen.
»Setzen Sie sich. Hören Sie mich wenigstens zu Ende an. Ihr Einverständnis vorausgesetzt, werde ich Sie für ein paar Wochen nach Südafrika schicken. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Land sich der Weltwirtschaft öffnen muss. Niemand kann Veränderungen ewig lange aufhalten. Mein Agent in Südafrika, Bernie Fortune, hat ein sehr interessantes Geschäft angeleiert. Wie Sie wissen, haben sich eine Reihe amerikanischer und britischer Unternehmen aufgrund der wirtschaftlichen Sanktionen aus Südafrika zurückgezogen. Das haben sich einige dortige Investoren zunutze gemacht. Sie haben die Firmen für einen Spottpreis erworben. Auf diese Weise ist ein gewaltiges wirtschaftliches Potential entstanden. Aber die Südafrikaner können die Probleme nicht allein bewältigen. Sie brauchen ausländische Investoren und Finanzexperten. Bernie setzt alles daran, dass die Südafrikaner uns den Auftrag geben, beides zu beschaffen ‒ Geld und Fachwissen. Er ist überzeugt davon, dass wir bei der Sache ein Vermögen machen können. Fliegen Sie nach Südafrika, Nina. Sondieren Sie die Lage. Und halten Sie Augen und Ohren offen. Falls eine andere südafrikanische Regierung an die Macht kommt, müssen wir imstande sein, blitzschnell darauf zu reagieren. In diesem Land gibt es unermessliche Bodenschätze, die zum Teil noch gar nicht erschlossen sind. Südafrika braucht vor allem Geld, Geld und nochmals Geld. Wer dort als Erster den Fuß in der Tür hat, wird den Rahm abschöpfen.«
Wenn Eli sich mit einem neuen Projekt beschäftigte, konnte nichts und niemand ihn davon ablenken. Während ich den Kaffee trank, hörte ich ihm nur mit halbem Ohr zu, denn ein Teil von mir trauerte Ralph nach und hoffte gegen alle Wahrscheinlichkeit, dass Eli einmal falsch lag, aber das war nie der Fall. Und als er schließlich ein Bild schier unermesslicher Gewinnmöglichkeiten in Südafrika vor meinem inneren Auge entstehen ließ, hatte er meine ungeteilte Aufmerksamkeit.
»Wenn ich Sie so reden höre«, sagte ich, »komme ich mir wie Ali Baba vor. Jetzt brauche ich nur noch den Zauberspruch.«
»Den kenne ich nicht«, erwiderte er bescheiden. »Ich bin bloß Eli Bertram, und ich kann Ihnen nur den guten Rat geben, sich vor den vierzig Räubern in Acht zu nehmen.«
Mir wurde wieder einmal deutlich, was für ein vielschichtiger Mensch Eli war, was für ein autokratischer und dennoch fürsorglicher Chef. Er konnte ein unverbrüchlich treuer Freund sein ‒ oder ein unversöhnlicher Feind. Deshalb wurde er in der Stadt geliebt und gefürchtet. Doch ich würde ihm niemals verzeihen können, dass er mir hatte nachspionieren lassen. Du wirst zu einer anderen Bank wechseln, versprach ich mir. Du wirst kündigen, sobald du aus Südafrika zurück bist.
»Wenn Sie nach London zurückkehren, ist diese Sidor-Geschichte Schnee von gestern«, sagte Eli mit einem selbstzufriedenen Grinsen. »Und dann werden Sie auch Ralph Dorrington vergessen haben, und alles geht wieder seinen gewohnten Gang. Ein Monat in südlicher Sonne wird Ihnen gut tun.«
Kapitel 3
Ein »Abschiedsessen« hatte Ralph es genannt. Als der Ober mich an unseren Lieblingstisch führte, dachte ich über die möglichen Bedeutungen dieses Wortes nach. Was meinte Ralph mit »Abschied«? Meine bevorstehende Reise nach Südafrika? Du wirst es früh genug erfahren, sagte ich mir.
Ralph und ich hatten uns schon oft in diesem bescheidenen italienischen Restaurant in der Nähe des Bankhauses getroffen. Heute waren fast alle Tische besetzt. Ich bemerkte, wie mehrere Frauen verstohlen mein smaragdgrünes Chanel-Kleid beäugten. »Hallo Schatz. Ich hoffe, ich habe dich nicht warten lassen.« So weit, so gut.
Ralph erhob sich und setzte sein üblicherweise für Kunden reserviertes Lächeln auf. Dann verzog er das Gesicht zu einem gespielt mitfühlenden Ausdruck. Vermutlich würde er gleich seinem Bedauern Ausdruck verleihen, wie es in alten Zeiten bezahlte Trauerweiber bei der Beisetzung wildfremder Leute getan hatten. Es war nicht zu übersehen, dass er mir etwas vorspielte. Ich erkannte es daran, wie er den Kopf leicht zur Seite drehte und mich aus den Augenwinkeln musterte, und wie er mit beiden Händen die meine ergriff. Doch hinter dieser Fassade erkannte ich seine wilde Freude darüber, es mir heimzahlen zu können.
Was heimzahlen? Dass ich ihn als Liebhaber nicht in den Himmel gehoben hatte? Das männliche Ego ist ein zerbrechliches Ding; jeder Kerl braucht ständig eine gewisse Dosis an weiblicher Bewunderung. Wenn man einen Mann den ganzen Abend reden lässt, kommt irgendwann die Bemerkung, wie faszinierend man doch sei. Doch zeigt man den Kerlen auf irgendeine Weise die eigene Überlegenheit, fühlen sie sich auf den Schlips getreten. Jemand anderen zu bewundern, war ohnehin nie meine Stärke gewesen.
Also stimmt es, ging es mir durch den Kopf, als ich mich setzte. Also hat Eli Recht. Ralph hat es mit meiner Sekretärin getrieben. Ich verspürte einen Anflug von Schmerz, der aber rasch vom Zorn über meine eigene Dummheit verdrängt wurde. Während Ralph die Weinkarte studierte, las ich die Speisekarte und wartete.
Ralph hatte sich sein Studium finanziert, indem er als Gelegenheits-Dressman arbeitete. Er sah gut aus: das dunkelbraune Haar vom Wind leicht zerzaust, der offene, vertrauenerweckende Blick eines Gentleman, ein markantes Gesicht und ein gewinnendes Lächeln. Außerdem besaß er den Schwarzen Gürtel in Karate und hielt sich fit. In der Bank hatte sein selbstsicheres Auftreten die Kollegen dazu verleitet, an seine nicht vorhandenen beruflichen Fähigkeiten zu glauben. Er spielte die Rolle des Bankers perfekt, doch er vermasselte seinen Auftritt, weil er einfach nicht zugeben wollte, dass auch er sich irren konnte. Und er machte nie seine Hausaufgaben.
Der Weinkellner stand wartend am Tisch. Ralph bestellte mit großer Geste und wandte sich dann mir zu.
»Du siehst umwerfend aus, Nina.«
Ich nickte kühl. Ich wusste, dass ich etwas verloren hatte, was mir viel bedeutete: das Gefühl, fraulich und begehrenswert zu sein. Ralph hatte mir dieses Gefühl gegeben, und schon deshalb würde er mir fehlen. Der kommende Monat, den ich fern von London in Südafrika verbringen sollte, bot mir vielleicht die Gelegenheit, einmal sehr gründlich über mich nachzudenken.
»Hör mal, Ralph, ich habe schlechte Neuigkeiten für dich. Gestern Morgen hat Eli mir gesagt, dass er dich entlassen wird. Wegen des Flops mit der Sherborne-Versicherung und wegen des Schwindels mit dem Jachthafen auf den Bahamas. Eli meint, du hättest den Betrug durchschauen müssen. Ich habe ihn gebeten, dir noch zwei Monate zu geben, damit du selbst kündigen kannst. Er ist einverstanden. Er gibt dir die Chance, das Gesicht zu wahren und woanders einen neuen Anfang zu machen. Du könntest ja sagen, du hättest gekündigt, weil… nun ja, weil Diana für mich arbeitet.«
Langes Schweigen. Ich beschloss, den Mund zu halten und abzuwarten. Schließlich schmetterte Ralph die flache Hand auf die Tischplatte, dass Geschirr und Gläser klirrten.
»Du hast also herausgefunden, dass Diana und ich ein Verhältnis haben? Großer Gott! Jetzt wird mir alles klar. Dieses Miststück! Es gibt nichts Schlimmeres als wütende Weiber. Erzähl mir davon.«
»Nein, Ralph. Ich wollte dich gerade anrufen, als du mich angerufen hast.«
Ich wollte ihm nicht ins Gesicht sagen, dass ich ihn schon seit Wochen vor Eli beschützte. So tief konnte ich nicht sinken, oder doch?
»Ich beschütze dich schon seit Wochen vor Eli. Ich habe versucht, deine beiden geschäftlichen Flops zu vertuschen, aber er hat es herausgefunden.«
»Na ja, in Zukunft brauchst du mich ja nicht mehr zu … beschützen.«
Ich holte tief Luft. Wie schaffte der Kerl es bloß, seine selbstgerechte Art zu wahren und so zu tun, als wäre ich der Übeltäter? Diskussionen waren zwecklos, das wusste ich, denn Ralph glaubte immer, was er glauben wollte. Deshalb war er als Anlageberater eine Gefahrenquelle.
»Lass uns bestellen«, sagte er mürrisch.
»Salat Nigoise und ein Mineralwasser.«
»Das Übliche? Kühl und beherrscht wie immer, Nina, was? Selbst in einer Krise. Kein Wunder, dass sie dich die ›Eisige Jungfrau‹ nennen.«
Ach, wirklich? Und wer waren sie?
»Was für eine Krise?«
Ralph zuckte zusammen. »Du lieber Himmel, Nina, du weißt es noch nicht?«
»Was?«
»Diana und ich müssen heiraten«, sagte er. »Sie ist schwanger. Ich würde das eine Krise nennen. Du nicht?«
»Für dich, ja. Nicht für mich. Erst recht nicht für Diana. Sie ist dumm, fett und hässlich.«
Ich hatte zu laut gesprochen. Die Gäste an den Nebentischen schauten zu uns herüber, und ich wurde rot.
Jetzt wurde Ralph wütend. »Aber sie ist wenigstens eine Frau und kein Geldautomat! Und sie wird mir eine gute Ehefrau sein!« Er genoss seine Grausamkeit. »Diana wird mir nie vormachen wollen, dass sie cleverer ist als ich. Bei ihr muss ich mich auch nicht jede Nacht aufs Neue beweisen.«
In diesem Augenblick starben meine Empfindungen für Ralph an Wut und Scham. Für einen kurzen Moment trauerte ich seinem gut gebauten Körper nach. Mögen Männer keine erfolgreichen Frauen? Können sie es niemals ertragen geschlagen zu werden? Oder war Ralph eine Ausnahme?
»Diana wird mich als Mann zu schätzen wissen. Weißt du, Nina, du brauchst dir nicht die Schuld daran zu geben, dass es zwischen uns aus ist«, fügte er in gönnerhaftem Tonfall hinzu. »Ich wäre sowieso nicht bereit gewesen, den rücksichtslosesten weiblichen Finanzhai dieser Stadt zu heiraten.«
»Ich hätte dich auch nie danach gefragt. Du warst gut im Bett. Aber das ist auch schon alles.« Es war eine Lüge, aber er glaubte mir und wurde rot.
»Weißt du, Nina, du brauchst gar keinen Partner. Du hast nie einen gebraucht. Da liegt dein Problem. Wahrscheinlich hätte ich es dir schon früher sagen sollen. Hat Diana …?« Wieder erschien dieser gespielte, falsche Ausdruck auf seinem Gesicht. »Diana und ich …« Er verstummte.
Diana und ich sagte zwar alles, doch Ralph war offenbar entschlossen, mir in allen Einzelheiten zu schildern, was er an meiner Sekretärin so sehr liebte.
»Wenn ich ihr mal weh tun sollte, wird sie weinen, und dann werde ich mir wie der letzte Dreck Vorkommen und alles tun, um es wiedergutzumachen. Du hast immer gleich mit schweren Geschützen zurückgefeuert. Du bist der Typ, der eine Mücke mit einem Marschflugkörper abschießt. Du musst immer der Sieger sein.«
»Auf deine Ehe«, sagte ich ironisch und hob mein Glas, trank und bekam einen Schluckauf. Ausgerechnet jetzt. Ich nahm die Serviette und drückte sie mir auf den Mund, versuchte, meinen Zorn im Zaum zu halten.
In diesem Augenblick kam mir mit der Plötzlichkeit einer mystischen Offenbarung eine neue Einsicht. Ein Mann wie Ralph würde nie mit einer Frau leben können, die ihm überlegen war und in der Ehe das Sagen hatte. War er nur deshalb mit mir ins Bett gegangen, weil er wusste, dass er eine mächtige Beschützerin brauchte, um nicht von Eli vor die Tür gesetzt zu werden? Und wann hatte er die Zeit gefunden, mit Diana zu schlafen? Plötzlich musste ich an seinen prall gefüllten Terminkalender denken: montags und mittwochs Karate, dienstags und donnerstags Squash und Jogging an den Wochenenden. Doch Ralph bekam einen Schmerbauch. Das hätte mir angesichts dieser vielen sportlichen Aktivitäten zu denken geben müssen.
»Du wirst fett. Warum fällt mir das erst jetzt auf?«
»Deine überheblichen Gehässigkeiten kannst du dir sparen, Nina!« Wie oft hatte er mir solche Bemerkungen an den Kopf geworfen? Und weshalb hatte ich dem Mistkerl das immer wieder durchgehen lassen? Dieses »Abschiedsessen« war Zeitverschwendung. Es gab nichts mehr zu sagen. Ich erhob mich.
»Du bist ein Betrüger, Ralph. Du hast auch mich betrogen, aber was macht das schon. Ich wünschte nur, du würdest endlich aufhören, dich selbst zu betrügen. Offenbar glaubst du tatsächlich den Schwachsinn, den du dir selbst vormachst. Eli hat dich gefeuert, weil du zu viele Fehler gemacht hast. Als Anlageberater bist du eine Niete. Sieh den Tatsachen endlich ins Gesicht, und such dir einen anderen Job, Ralph. Lebwohl.«
Es wäre ein klasse Abgang gewesen, aber natürlich musste ich mich noch einmal umdrehen und ihm die Hand auf die Schulter legen, ich dumme Kuh. »Keine Feindschaft, Ralph. Trennen wir uns als Freunde. Danke für die schönen Stunden. Danke, dass du mir das Gefühl gegeben hast, eine Frau zu sein. Alles Gute.«
Seine Augen leuchteten auf, was ich für einen Ausdruck von Rührung hielt, ich dämliche Ziege. »Danke, Nina«, sagte er und umfasste mein Handgelenk. »Obwohl es eine Herkulesarbeit war, dir die Illusion zu verschaffen, eine Frau zu sein. Lange hätte ich das sowieso nicht mehr durchgehalten.«
Ich schüttete ihm seinen Wein ins Gesicht. Bastard!
Später sagte ich mir, dass es schlimmer hätte kommen können. Man stelle sich vor, die Szene hätte sich im Hilton abgespielt oder im Annabelle’s.
Kapitel 4
An einem regnerischen, stürmischen Dezemberabend machte ich mich auf die Reise nach Kapstadt. Als ich an Bord der Maschine ging, packte mich das seltsam erregende Gefühl, in neue, unbekannte Gefilde vorzustoßen, und ich war froh, England, die Presse und die Kälte eine Zeit lang hinter mir zu lassen.
Als ich Platz genommen hatte und den Gurt anlegte, dachte ich an das letzte Wochenende zurück. Es war katastrophal verlaufen. Ich war nach Edinburgh geflogen, um meine Mutter und John zu besuchen, ihren dritten Ehemann. Da ich nicht in Mutters Haus wohnen wollte, hatte ich mir im Mount Royal Hotel an der Princes Street ein Zimmer genommen und mich für neunzehn Uhr mit Mom und John im Hotelrestaurant verabredet. Ich hatte eine Illustrierte mitgenommen, denn meine Mutter kam niemals pünktlich. Doch nach einer Stunde Wartezeit fragte sogar ich mich, ob irgendetwas passiert war. In diesem Augenblick stieg mir der vertraute Duft von Chanel No. 5 in die Nase, und ich hörte das leise Säuseln von Nylon auf Nylon und das Klicken von Moms hohen Absätzen.
Mutter benutzte hemmungslos weibliche Hilfsmittel für gutes Aussehen: teure Kleider und Schuhe, Schmuck, Make-up, Chiffon-Halstücher. In ihrem taubenblauen Versace-Kostüm und der weißen Seidenbluse sah sie fantastisch aus. Immer noch drehten Köpfe sich nach ihr um, wenn sie vorüberschritt. Als junge Frau war sie umwerfend schön gewesen, doch Gott allein weiß, welche Mühen es sie kostete, sich ihre Schulmädchenfigur, ihren jugendlichen Teint und ihren straffen Hals zu bewahren und das Grau aus ihrem dunkelroten Haar fernzuhalten. Was bei Mutters Überlebensstrategie an Planung und Vorbereitung erforderlich war, hätte in meinem Job vermutlich zu einem millionenschweren Geschäftsabschluss gereicht. Aber daran war ja nichts Schlimmes; deshalb fragte ich mich, weshalb ich im Geist meine Krallen schärfte. Fünf Sekunden später wusste ich die Antwort.
»Du siehst schlecht aus, Schatz.« Mutter trat einen Schritt zurück, legte den Kopf schief, musterte mich und zog eine Schnute wie ein kleines Mädchen. »Und du bist zu dünn für deine Größe.«
»Findest du?«
Irgendetwas an Mutters geringer Körpergröße und ihrer ultrafemininen Einstellung hatte mir immer schon das Gefühl vermittelt, zu groß zu sein. Sie umarmte mich und küsste mich stilvoll auf beide Wangen, wobei ihr Haar meine Nasenlöcher kitzelte. Ich kämpfte so mühsam gegen das Niesen an, dass mir Tränen in die Augen traten. John hielt sich im Hintergrund. Er war ein großer, unbeholfener Mann mit rotem Gesicht, das jetzt noch die Spuren einer schlimmen Akne aufwies.
»Ich glaube, wir sollten sofort in den Speisesaal gehen.« Ich hakte mich bei Mutter ein. »Hier entlang.«
»Erzähle uns, was es Neues gibt«, sagte sie geziert. »Wann werdet ihr heiraten, du und Ralph? John und ich sterben vor Neugier. Wie geht es deinem Schatz überhaupt?«
»Wir haben uns getrennt. Mein Schatz hat meine Sekretärin gebumst. Eli hat den Dreckskerl gefeuert.«
Das reichte, um die Konversation zu beenden, bis wir an unserem Tisch waren.
»Ich habe immer schon gewusst, dass dieser Mann nicht der Richtige für dich ist«, murmelte Mutter tapfer, nachdem wir uns gesetzt hatten.
Ich war überrascht. Ließ sie mich tatsächlich ungeschoren davonkommen?
»Das Problem ist nur, dass du seine Chefin warst. Und wir sollten uns nichts vormachen ‒ manchmal kannst du sehr herrisch und schrecklich einschüchternd sein. Liegt an deinem klugen Kopf, fürchte ich. Eine Frau sollte nicht so viel Verstand besitzen wie du. Es war schwierig genug, mit deinem Vater zu leben, und der war ein Mann.«
Aber nicht Manns genug für dich, Mom. Erst recht nicht mehr nach seinem Unfall. Doch dieses Thema hatte ich meinen Eltern gegenüber nie zur Sprache gebracht.
»Schnee von gestern, Mutter. Ich möchte nicht darüber reden. Bestellen wir lieber den Wein, ja?«
John ließ ein dröhnendes Lachen vernehmen. »Ja, hör endlich auf, Rebecca. Wenn Nina einen Mann will, wird sie ganz sicher einen bekommen.« Seine fette rote Pranke legte sich auf meine Hand. »Sie sieht entzückender aus als je zuvor, ist dir das noch nicht aufgefallen? Nina kommt ganz auf dich. Sie ist nur eine frischere, jüngere Ausgabe von dir.«
Das musste gesessen haben, doch Mutter trug es mit Fassung. John war ein launischer, schwieriger und verwöhnter Mistkerl, der meine Mutter brauchte ‒ genauer gesagt, ihr Geld ‒, sie aber wegen ihres Alters hasste. Und jetzt bestrafte er sie, indem er mit mir flirtete. Natürlich würde Mutter sich später an ihm rächen. Ich kam mir wie ein Häufchen Elend vor, als ich dasaß und mich an meine Rolle als neutrale Dritte klammerte.
»Glaub mir, Nina, es ist nicht das Ende der Welt, wenn man auf die Dreißig zugeht. Du hast eine Enttäuschung hinter dir, aber dir wird schon noch der Richtige über den Weg laufen. Ich habe Frauen und Männer gekannt, die sogar schon über dreißig waren, als sie geheiratet haben.«
Kann die eigene Mutter dich nicht leiden? fragte ich mich nicht zum ersten Mal. Ich griff so impulsiv nach meinem Weinglas, dass es umkippte. »Oh, verdammt!« Weshalb nahm ich mir ihre Worte eigentlich so zu Herzen? »Wir leben in verschiedenen Welten, Mutter. Für mich zählen keine Ehemänner, für mich zählt nur Profit.«
»Bekommst du eigentlich noch deine Periode? Oder bringt dein Körper nur noch Bilanzen hervor?«
Das saß, aber der Schmerz über Johns Bemerkung stand Mutter noch deutlich ins Gesicht geschrieben, und ich wollte ihr nicht noch mehr wehtun, indem ich ihr eine passende Antwort gab. Also entschied ich mich für die bedingungslose Kapitulation und blieb stumm, während Mutter mir den ganzen Abend verbale Florettstiche verpasste. Schließlich, gegen zehn Uhr ‒ nachdem ich mir ihren endlosen Monolog über die passende Mode für einen Typ wie mich angehört hatte ‒, versetzte Mutter mir den tödlichen Stich.
»Du hast den ganzen Abend kein einziges Mal gelacht, Nina. Du hattest nie viel Sinn für Humor, aber dieser Job in der Stadt hat dich ja schrecklich abgestumpft. Gott sei Dank, dass du für ein paar Wochen aus dieser Mühle herauskommst.«
Sie schob den Stuhl zurück und stand auf.
Auch ich erhob mich und murmelte ein paar Abschiedsworte. Am nächsten Morgen flog ich nach Inverness, um Dad zu besuchen.
Vater saß vor seiner Staffelei, als ich sein Atelier betrat. Er schaute über die Schulter und musterte mich kurz von oben bis unten; dann wandte er sich wieder seinem Gemälde zu.
»Es war nicht nötig, sich auf den weiten Weg hierher zu machen«, sagte er mit seiner ausdruckslosen Stimme. »Aber es ist nett, dass du gekommen bist.«
Vater malte Tierbilder, hauptsächlich Vögel. Seine Gemälde waren fotorealistisch, könnte man sagen; aber die Tiere sahen so leblos aus wie die armen ausgestopften Viecher, die er als Modelle benutzte. Und wie traurig er selbst aussah! Sein schütteres graues Haar war wirr, und sein langes, knochiges Gesicht war hagerer als je zuvor. Seine wachen, aber wehmütigen Augen lagen tief in den Höhlen und erinnerten mich an die einer Eule. Man konnte sich schwer vorstellen, dass dieser Mann einst Commander Charles Ogilvie gewesen war, Träger des Kriegsverdienstordens, des Fliegerkreuzes und der Tapferkeitsmedaille, eine beinahe legendäre Gestalt im britischen Geheimdienst.
Außer seiner Haushälterin Angela Joyce und deren Ehemann Trevor, die in einem Cottage auf dem Anwesen wohnten, hatte Vater keinen Menschen. Er lebte allein und wurde immer introvertierter. Im Zimmer vermischten sich die Gerüche von Staub, abgestandener Luft, Ölfarben und Terpentin mit der Atmosphäre von Verzweiflung und Einsamkeit. Eine rasche Erkundung der Küche bestätigte meine Befürchtungen. Im Haus waren keine Lebensmittel.
War Dad das Bargeld ausgegangen? Anders konnte es nicht sein. Am Hungertuch nagte er nicht. Er war wohlhabend, hatte eine hübsche Summe geerbt und besaß Aktien. Außerdem gehörten ihm fünfhundert Hektar Farmland, das er zum Teil an Bauern aus der Gegend verpachtet hatte. Überdies besaß er Zuchtvieh und bezog eine stattliche Rente.
»Du hast nichts im Haus, Dad. Soll ich dir irgendwas besorgen?«
»Nein.«
»Wo ist denn Mrs. Joyce?«
»Hat die Grippe.«
»Du brauchst Lebensmittel. Ich besorge dir welche. Leihst du mir deinen Wagen?«
»Die Mühe kannst du dir sparen. Mrs. Joyce kommt morgen wieder. Und wenn ich in der Zwischenzeit irgendetwas brauche, kann ich Trevor Bescheid sagen. Er muss sich hier irgendwo herumtreiben.«
»Warum kommst du nicht nach London und wohnst bei mir, Dad?«
»Weil ich Ogilvie Lodge nicht aufgeben will.«
»Aber du würdest dich in London wohl fühlen. Ich habe eine wunderschöne Penthouse-Wohnung in Hampstead, mit Blick auf Heath. Man hat eine meilenweite, herrliche Aussicht. Und die Blumen sind wundervoll. Es ist, als würde man auf dem Land leben.« Er gab keine Antwort, also kochte ich uns Tee, und wir unterhielten uns eine Stunde über Belanglosigkeiten. Schließlich versuchte ich, Dad von meiner unseligen Affäre mit Ralph zu erzählen.
»Ich habe diesen Mann in der Bank kennen gelernt. Ralph war ein Kollege. Ein humorvoller, gutaussehender Bursche. Ich dachte, aus uns beiden könnte etwas werden. Aber er hat mich wegen meiner Sekretärin sitzen lassen. Deshalb bin ich froh, eine Zeit lang aus London wegzukommen. Eli hat ihn gefeuert, weil er in seinem Job nichts taugte, aber Ralph gab mir die Schuld. Ich werde ihn trotzdem vermissen.«
»Das solltest du nicht. Dieser Ralph hat dir einen großen Gefallen getan«, sagte Vater mit seiner leisen, präzisen Stimme.
Später, als Trevor im Wagen wartete, um mich zum Flughafen zu fahren, gab ich Dad einen Kuss auf die Wange. Ich hätte ihn liebend gern umarmt, aber er malte unverdrossen weiter, und ich hatte Angst, gegen den Pinsel zu stoßen und sein Bild zu vermasseln.
»Tja, dann …«
»Pass auf dich auf«, sagte er. Mehr nicht.
Ich stand in dem kleinen Waschraum des Flugzeugs, um mich vor der Landung ein bisschen frisch zu machen und mein Gesicht und die Frisur aufzupolieren, als eine Glocke schrillte. Bitte anschnallen, leuchtete ein Schild über dem winzigen Waschbecken auf. Sekunden später schwankte und bockte das Flugzeug, und mein Kosmetikzeug fiel prasselnd auf den Boden. Ich blickte in den Spiegel. Ein hageres Gesicht mit großen, müden Augen, verquollen und blutunterlaufen, starrte mich an.
Ich raffte meine Utensilien zusammen, verließ den Waschraum, quetschte mich an einer Stewardess vorbei und arbeitete mich schwankend zu meinem Sitz vor. Die Nacht war mir endlos lang erschienen, und ich hatte kein Auge zugetan. Ein lächelnder Steward schob einen kleinen Wagen über den Mittelgang und reichte den Fluggästen Orangensaft. Das anschließende Frühstück und der Kaffee hoben meine Stimmung, und kurz darauf kreisten wir über dem Tafelberg von Kapstadt und setzten zum Landeanflug an.
Kapitel 5
Eine Böe des berühmten Südwesters erwischte mich voll und hätte mich beinahe von der Gangway gefegt. Oh Mann! Ich drückte meine Handtasche an die Brust und kämpfte mich voran. Als ich durch die Passkontrolle war, schnappte ich mir einen Handwagen, nahm mein Gepäck vom Laufband und bewegte mich in Richtung Ausgang. Ich war erstaunt, wie rasch und problemlos alles ablief. Die Tür glitt auf, und ich eilte hindurch. »Hier, Nina! Hier!« Ein Mann kam auf mich zu und schüttelte mir die Hand. »Ich bin Bernard Fortune, Ihr Gastgeber. Und … nun ja, Ihr Freund, wenn Sie möchten. Sagen Sie Bernie zu mir. Kommen Sie, ich möchte Ihnen meine Frau Joy vorstellen. Tja, Nina, die Presse hat Wind davon bekommen, dass Sie heute hier eintreffen. Die Flughafenleitung hat uns einen Raum für eine Pressekonferenz zur Verfügung gestellt. Wenn Sie mir bitte folgen wollen.« Er packte meinen Handkarren.«
Die Presse? Verdammt.
»Guten Morgen, Mr. … Bernie«, sagte ich.
Das also war Elis hiesiger Agent. Ich musterte ihn unauffällig: gebräunte Haut, durchschnittlich groß, muskulös ‒ wahrscheinlich vom Gewichtestemmen im Fitnesscenter ‒, buschige Brauen, raubtierhafte, stechende Augen, behaarte Brust, Arme und Handrücken. Was er am Körper an Haaren zu viel hatte, hatte er auf dem Kopf zu wenig: Bernie besaß eine schimmernde Glatze. Er war ein Bursche, vor dem man sich in Acht nehmen musste, wie ich instinktiv spürte. Ein Mann, der jeden rücksichtslos in den Boden stampfte, der ihm in den Weg geriet.
»Tut mir leid, dass wir Ihnen wegen der Pressekonferenz nicht vorher Bescheid sagen konnten«, erklärte Bernie, »aber dass Sie hierher nach Kapstadt kommen, ist für uns von allergrößter Wichtigkeit. Das Licht am Ende des Tunnels sozusagen. Seit einem halben Jahrhundert sind wir Südafrikaner die Aussätzigen der Erde, und wir haben genug davon, das kann ich Ihnen sagen. Die verdammten Sanktionen machen der Wirtschaft des Landes schwer zu schaffen. Dabei ist Südafrika die reinste Goldgrube. Einige Leute haben das früh genug erkannt, Nina. Sie werden diese Männer bald kennen lernen. Ich hoffe, mit Ihrem Eintreffen wird sich hier einiges ändern. Genau das sollten Sie der Presse mitteilen, damit die westliche Welt endlich auf uns aufmerksam wird; denn was wir vor allem brauchen, sind Investoren.«
Ich konnte Bernies Redeschwall kaum folgen. In unserem Job plappert man nur dann so viel, wenn man seine Zuhörer aus dem Konzept bringen will. Was hatte Bernie mit mir vor? Und welcher Idiot ruft eine Pressekonferenz ein, bei der eine Frau Rede und Antwort stehen soll, die eine ganze Nacht in einem Flugzeug verbracht hat? Morgen wäre auch noch früh genug gewesen. »Weshalb diese Eile? Ich bin noch einen ganzen Monat hier, Bernie.«
Er wurde rot und grinste entwaffnend.
»Wir müssen die Suppe löffeln, solange sie heiß ist, Nina. Es steht zu viel auf dem Spiel.«
Bernies Frau Joy machte einen überängstlichen und angespannten Eindruck. Sie trug einen samtblauen Trainingsanzug, der zur Farbe ihrer Augen passte wie auch die Schleife in ihrem nach hinten gebundenen Haar. Sie besaß ein recht anziehendes Gesicht, war aber dünn genug, um als Magersüchtige durchzugehen, was zur Folge hatte, dass die Haut in faltigen Lappen unter ihrem Kinn hing, schlaffe Säcke unter ihren Augen bildete und ihren Hals wie den eines Truthahns erscheinen ließ. Kein Problem für einen guten Schönheitschirurgen, hätte meine Mutter gesagt.
Das Pressekorps, das mein Erscheinen in die »westliche Welt« verbreiten sollte, bestand aus zwei müde aussehenden Männern und drei jungen Frauen. Irgendjemand schob mich zwischen Bernie und Joy hinter einen Schreibtisch.
»Ich möchte Ihnen die Frau vorstellen, derentwegen Sie gekommen sind«, sagte Bernie mit honigsüßer Stimme. »Miss Nina Ogilvie. Wie ich Ihnen schon sagte, ist Nina die größte Senkrechtstarterin in der Londoner Finanzwelt.«
Ich warf Bernie einen düsteren Blick zu, doch er hielt die Augen auf die Pressevertreter gerichtet. »Nina hat zwar die ganze Nacht im Flugzeug verbracht, steht Ihnen aber gern zur Verfügung, weil sie besser als jeder andere weiß, welche Möglichkeiten sich in diesem Land und für dieses Land bieten.«
Die Fragen kamen anfangs zögernd, doch zehn Minuten später war immer noch kein Ende in Sicht. »Danke für Ihr Interesse. Guten Morgen«, sagte ich schließlich erschöpft, stand auf und ging zur Tür.
»Wie werden Sie damit fertig, als Frau in einer Männerwelt zu arbeiten?«, rief eine weibliche Stimme in meinem Rücken.
Ich drehte mich um, eine zynische Bemerkung auf der Zunge, die ich jedoch hinunterschluckte, als ich sah, wie jung und verletzlich die Reporterin aussah.
»Wie ich damit fertig werde? Indem ich versuche, die Männer mit ihren eigenen Waffen zu schlagen«, sagte ich. »Sie dürfen mich wörtlich zitieren.«
Ich lächelte und verließ das provisorische Konferenzzimmer.
Ich wurde in einen auf Hochglanz polierten Siebener-BMW gesetzt und einem riesigen Neger mit schräg stehenden Augen und einem kleinen Spitzbart vorgestellt. Er trug eine Chauffeuruniform, die ihm viel zu klein war.
»Das ist Cäsar, unser Fahrer. Er steht Ihnen zur Verfügung, wohin Sie auch wollen«, sagte Bernie, ohne den Schwarzen eines Blickes zu würdigen.
»Guten Morgen, Cäsar.« Ich streckte die Hand aus, und er bedachte mich mit einem erstaunten Lächeln.
Auf der Fahrt durch den morgendlichen Verkehr legte Bernie mir plötzlich seine heiße Hand aufs Knie. »Was für ein Mädel Sie sind!«, sagte er. »Das war eine prima Vorstellung vorhin. Der alte Eli kann sich glücklich schätzen, dass er Sie hat.«
Ich stieß Bernies Hand weg und hoffte, dass Joy seine plumpe Anmache nicht bemerkt hatte.
Einige Zeit später kamen wir an deprimierenden Slums vorbei. Meile um Meile primitiver, dreckstarrender Hütten, zwischen denen es von zerlumpten Schwarzen nur so wimmelte.
»Der neueste inoffizielle Vorort von Kapstadt«, sagte Bernie mit deutlicher Herablassung. »Auf dem Land besitzen diese Leute ein paar Kühe, ein Stückchen Ackerland, und vor allem leben sie in ihrer Heimat. Aber was tun sie? Sie strömen in die Städte, wo es keine Jobs für sie gibt. Was Sie da draußen sehen, ist das Ergebnis.«
Schweigen ist Gold, sagte ich mir, zumal ich eine Fremde war. Wir ließen die Slums hinter uns und gelangten in weitaus angenehmere Wohngegenden. Als wir in die Stadt einfuhren, kam es mir vor, als würde ich auf einem anderen Planeten landen: von Eichen gesäumte Prunkstraßen, exotische Architektur, hektargroße gepflegte Rasenflächen mit blühenden Sträuchern, Villen im spanischen, marokkanischen, altenglischen und frühholländischen Stil. Doch bei allen Unterschieden gab es hier eine Gemeinsamkeit: Reichtum.
»Das ist Constantia«, sagte Joy zu mir, und in ihrer Stimme lag Selbstgefälligkeit. »Hier wohnen wir. Sehen Sie die Villa da drüben? Da sind Lord und Lady Melcroix zu Hause. Und dahinten wohnt die Herzogin von …«
Und, und, und. Joy hatte eine Schwäche für Titel. Wenn man ihr Glauben schenken durfte, hatte sich hier die Hälfte der britischen Blaublüter einen Platz an der Sonne gesichert. Schließlich bogen wir in die Einfahrt zu einer riesigen spanischen hacienda ein. Der gepflegte Rasen hätte Wimbledon zur Ehre gereicht, und der Swimmingpool besaß olympiareife Ausmaße. Cäsar hielt mir die Wagentür auf.
»Cäsar, diese Dame hat einen Flug von sechstausend Meilen hinter sich. Kümmern Sie sich gut um sie.« Bernie schaute mich an und grinste. »Ich sehe Sie beim Abendessen, Nina. Joy wird Sie zum Einkaufen mitnehmen und sich um alles andere kümmern.« Er nickte seiner Frau kühl zu.
»Bernie«, sagte ich, »ich kann ja verstehen, dass Südafrika Probleme hat, zum zwanzigsten Jahrhundert aufzuschließen, aber ich glaube, Sie sollten sich endlich darüber klar werden, dass nicht die Frau eines Kollegen Sie besucht, sondern dass ich selbst der Kollege bin. Und ich bin nicht hier, um einzukaufen.«
»Nina … Nina … als Erstes werden Sie einige sehr mächtige Männer aus der südafrikanischen Finanzwelt auf gesellschaftlicher Ebene kennen lernen. Für heute Abend haben Joy und ich die wichtigsten Gentlemen zum Dinner eingeladen. Morgen früh fahren wir mit Ihnen in den Timbavati-Wildpark. Jeder einflussreiche Mann, den Sie kennen lernen müssen, wird dabei sein ‒ in einer entspannten und zwanglosen Atmosphäre, in der man sich Freunde schaffen kann.« Er bedachte mich wieder mit einem entwaffnenden Lächeln. »Also nutzen Sie den Tag, um sich auf alles vorzubereiten. Joy wird mit Ihnen einkaufen fahren, weil Sie verschiedene Sachen brauchen: Khaki-Shorts, eine strapazierfähige Bluse, einen Tropenhelm, ein Paar feste Stiefel. Andere Länder, andere Sitten. Besorgen Sie sich die Sachen. War mir ein Vergnügen.«
Er fuhr davon, und ich blickte ihm wutschäumend hinterher.
Kapitel 6
»Dinner um neunzehn Uhr«, hatte Bernie gesagt. Weil ich nicht wusste, wie man sich hierzulande zu solchen Anlässen kleidete, ging ich auf Nummer sicher und entschied mich für ein schwarzes Cocktailkleid. Die schwüle Hitze und die Dusche hatten mein lockiges Haar trotz aller Bemühungen in eine widerspenstige dunkelrote Krause verwandelt, und mein Gesicht war von dem langen Flug immer noch gerötet und leicht gedunsen. Schließlich band ich mir das Haar mit einer weißen Schleife aus Chiffon im Nacken zusammen und legte eine Perlenkette und Ohrringe an.
Bernie wartete bereits auf mich. »Kommen Sie«, sagte er und drängte mich entschlossen zu einer Tür, aus der Stimmen drangen. »Sie sind spät dran. Die Show muss beginnen.«
Ich musste lächeln, als ich Bernies Salon betrat. Das Dekor schrie mir förmlich entgegen, dass die Fortunes es geschafft hatten: holzvertäfelte Wände, Perserteppiche auf dem marmorgefliesten Fußboden, alte Gemälde in schweren vergoldeten Rahmen. Joy trug ein mitternachtsblaues Seidenkleid und war mit Schmuck behangen wie ein Christbaum. Sie eilte zwischen den Gästen umher und spielte mit bewundernswertem Geschick die Dame von Welt.
Ein rascher Blick in die Runde zeigte mir, dass die anwesenden Damen allesamt blendend aussahen. Keine von ihnen hatte die Mitte der Zwanzig überschritten. Zweifellos waren sie die zweiten oder dritten Ehefrauen ihrer Gatten, die älteren Semesters waren. Zwischen diesen jungen Frauen wirkte Joy wie Unkraut in einem Rosengarten, mochte sie sich auch noch so verbissen an die Illusion klammern, jung und attraktiv zu sein.
»Sehen Sie!« Stolz ließ Bernie den Blick über seine Gäste schweifen. Er senkte die Stimme. »Die meisten sind hässliche und skrupellose alte Böcke, aber sie sind gute Freude von mir. Millionenschwere Burschen. Seien Sie nett zu ihnen.«
Offenbar waren die weiblichen Gäste lediglich Staffage. Ein Ober in weißer Livree, komplett mit Handschuhen und Kummerbund, kam mit einem silbernen Tablett und bot uns Drinks an. Als ich ein Glas nahm, erkannte ich verdutzt, dass ich Cäsar vor mir hatte, den Fahrer, den ich zuletzt in Khaki-Shorts bei der Gartenarbeit gesehen hatte.
»Danke, Cäsar. Ein Mann für alle Gelegenheiten, stimmt’s, Bernie?«
Bernie errötete. »Sie sollten dieses Land erst besser kennen lernen, bevor Sie Kritik üben, Nina.«
Mit einem widerwilligen Nicken gab ich Bernie zu verstehen, dass er Recht hatte. Er nahm meinen Arm und führte mich durchs Zimmer zu einem der Gäste. »Ich möchte Ihnen Theo Hamilton vorstellen, Nina. Theo besitzt die Schürfrechte an mehreren Diamantenminen …«, plapperte Bernie fröhlich drauflos. »Hallo Theo. Das ist Nina Ogilvie, der neueste und einzige weibliche Senkrechtstarter in der Londoner Finanzwelt. Du solltest dich gut mit Nina stellen, alter Junge!«