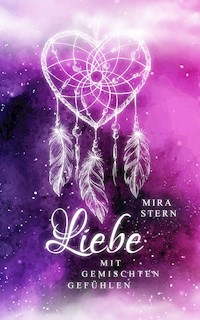9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine Bruderschaft im Schatten. Eine Frau im Licht. Und ein Strudel aus Ritualen und Intrigen.
Lucilla wird zu einer Fotoausstellung nach München eingeladen. Aber sie ahnt nicht, dass eine Geheimgesellschaft dahintersteckt. Sie hofft nur auf ein kleines Abenteuer. Doch das, was ihr bevorsteht, wird ihr Leben für immer verändern. Erst recht, als sie erkennt, wer sie ist …
München in der Gegenwart – so magisch, wie es keiner kennt. Ein Roman voller Spannung und Poesie. Tiefgründig und berührend.
»Geheimbund mit Dame« entführt in eine Welt voller Magie – eine Geschichte, die nicht nur unterhält, sondern verwandelt.
Kennst du die Magie des eigenen Bewusstseins? Wer bereit ist, hinter die Schleier der Realität zu blicken, wird eine Geschichte finden, die das Herz berührt und die Seele entfacht.
Manche Pfade öffnen sich nur für Mutige.GLAUBST DU AN BESTIMMUNG? Öffne dein Herz, "Geheimbund mit Dame" öffnet dir die Augen. Bist du bereit für eine andere Sicht der Dinge? Dann folge dem LICHT. Dieses Buch könnte der JOKER in deinem Leben sein.
Inspirierende Belletristik & Urban Fantasy.
Ein Roman für alle, die in eine andere Wirklichkeit eintauchen wollen und dabei eine poetische Sprache zu schätzen wissen. Komplexe, surreale Bilderwelten – für Träumer und Suchende.
Ein Roman, den man fühlen kann.
Unsichtbare Welten, Mystik und Magie, eine starke Frau, ein Männerorden. Selbstfindung, Initiation, magische Träume, Familiengeheimnis. Inspiration mit Lesegenuss. Ein erhellendes Abenteuer. Was will man mehr?
„Eine spannende und gut nachvollziehbare Handlung macht das Buch zu einem absoluten Lesevergnügen. Die Geschichte ist rund, mit mysteriösen und unerwarteten Wendungen … “ - YvetteH auf Lovelybooks
„Wer neugierig auf das Außergewöhnliche ist, sollte das Buch unbedingt lesen.“ - Heidelinde12 auf Lovelybooks
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mira Stern
Geheimbund mit Dame
Alles Vergängliche
Ist nur ein Gleichnis!
Das Unzulängliche,
Hier wird’s Ereignis;
Das Unbeschreibliche,
Hier ist’s getan;
Das Ewig-Weibliche
Zieht uns hinan!
(Chorus Mysticus – Goethe – Faust II)
Lucilla wird zu einer Fotoausstellung nach München eingeladen. Aber sie ahnt nicht, dass eine Geheimgesellschaft dahintersteckt. Sie hofft nur auf ein kleines Abenteuer. Doch das, was ihr bevorsteht, wird ihr Leben für immer verändern. Erst recht, als sie erkennt, wer sie ist …
München in der Gegenwart – so magisch, wie es keiner kennt. Ein Roman voller Spannung und Poesie. Tiefgründig und berührend.
Die Prophezeiung scheint sich zu erfüllen. Ausgerechnet eine Frau wird dem Männerorden all das bringen, wonach er sucht. Aber sie weckt auch Begehrlichkeiten. Und im Hintergrund lauern Zweifler. Sie gerät in einen Strudel aus Ritualen und Intrigen. Bald steht ihr Leben auf dem Spiel. Liebe allein kann sie nicht retten. Was bleibt ihr? Und wem sollte sie unbedingt vertrauen?
Mira Stern, Jahrgang 1972, studierte Germanistik/Kunstwissenschaft an der Universität Halle/Wittenberg. Nach ausgedehnten Reisen durch Europa und den Nahen Osten lebte sie einige Jahre in Griechenland. Inzwischen widmet sie sich alten Menschen und betreut ehrenamtlich das Projekt ›Altern im Einklang mit der Natur‹. In ihrer Lebensphilosophie bekennt sich Mira Stern zu dem Prinzip der ›Universellen Liebe‹.
Weitere Bücher von Mira Stern:
›Die eigenwillige Magie der Liebe‹
›Liebe mit gemischten Gefühlen‹
Siehe auch: https://mira-stern-buecher.jimdofree.com
Mira Stern
*
Geheimbund mit Dame
Roman
1
Ich umschlich das Gebäude wie eine pirschende Katze und hoffte, es würde mir sein Geheimnis preisgeben. Aber ohne zu offenbaren, dass ich das Rätsel zu entschlüsseln suchte. Ich war dreizehn Tage zu früh. Was hatte ich mir nur dabei gedacht? Wusste ich doch, dass ich zu diesem Haus keinen Tag früher Zugang bekäme. Ich starrte das Bauwerk an, als sollte wenigstens mein Geist seine Mauern durchdringen. Die Fassade beeindruckte mich, sie war keineswegs so abweisend wie die Auftraggeber, die mich hierher eingeladen hatten. Aber sie hielt meinem bohrenden Blick stand.
Keine Chance, man ließ mich so oder so nicht ein.
Gestern fischte ich, knapp sechshundert Kilometer entfernt von hier, einen Brief aus meinem Kasten. Darin erfuhr ich, an welcher Adresse die Ausstellung stattfinden würde. Bienenstraße Nummer 13 bis 17. Der Punkt war auf der beigelegten Karte mit neonblauem Marker eingekreist, etliche kleine Pfeilspitzen wiesen den Weg dorthin. Mein Geduldsfaden war bis zum Zerreißen gespannt. Es lag zwei Wochen zurück, dass ich die Fotos, die sie für ihre Ausstellung angefordert hatten, am anderen Ende der Stadt abgeliefert hatte. Doch im Brief stand unmissverständlich: Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen vor der Eröffnung der Hauptausstellung am 1. November kein Einlass in das Gebäude gewährt wird.
Was um alles in der Welt war in mich gefahren? Erst in dreizehn Tagen, so war es präzise festgelegt, sollten meine Bilder im Foyer der Ausstellung hängen. Ich war überzeugt, die Aufmerksamkeit würde sich eher auf den Kellner richten, der die Sektgläser vorbeibalanciert. Nicht auf meine Fotos.
Aber das geheimnisvolle Getue um all das herum reizte mich. Nicht nur das, es weckte meine Neugier! Weshalb ließ sich vorher nicht mehr darüber erfahren? Warum sollte ich zur Eröffnung im Abendkleid erscheinen? Kein Mensch würde mich kennen. Wer war der Mann im Frack, der mir erst im Treppenhaus begegnet war und der mich nachher so eigenartig beobachtet hatte?
Das war vor zwei Wochen gewesen, als ich die Einzelheiten mit der Sekretärin in dem Jugendstilhaus am anderen Ende der Stadt besprach.
Er stand weit hinter mir in der offen stehenden Tür und schien zu glauben, dass ich ihn nicht bemerken würde. Doch sein Blick bohrte sich in meinen Rücken. Die Aufmerksamkeit, die er mit sich führte, breitete sich von dort in alle Richtungen aus, als sei sie eine gallertartige Masse, die mich mit ihrer blauen Farbe einfärben wolle. Ja. Seine Aufmerksamkeit war blau.
Nie zuvor in meinem Leben hat mich ein geheimer Blick derart berührt. Ich wagte nicht, mich umzudrehen. Dabei hätte ich zu gern in seine Augen geschaut – nur – um herauszufinden, ob sie so blau wären wie die Bläue, die mich überzog. Doch ich rührte mich nicht. Blieb still auf dem Stuhl gegenüber der Sekretärin sitzen, deren raue, tiefe Stimme ihre resolute Körpersprache betonte.
Sie hatte mir eine Frage gestellt. Der reine Ton klang mir im Ohr und verriet, dass sie etwas zu hören erwartete. Ich blieb ihr die Antwort schuldig. Meine Aufmerksamkeit war dem Gespräch entwischt und schlich sich nur widerwillig zurück an diesen Platz. Ich nuschelte eine Entschuldigung für die kurzzeitige gedankliche Abwesenheit. Dabei landete ein Lächeln auf meinen Schulterblättern, ein sonnig-gelbes breites Lächeln, das aufwärts wanderte. Es umfasste meinen Hals, als griffe es mir neckend ins Genick. Dann löste sich das bisschen Gelb im Meer aus Blau spurlos auf.
Ein feiner Windhauch verkündete, dass der Mann in der offen stehenden Tür gegangen war. Ich war überzeugt, dass ich ihn an diesem Tag kein weiteres Mal zu Gesicht bekommen würde.
Denn Stunden zuvor, unten im Treppenhaus, war er zusammengezuckt, als ich sein Erscheinen registriert hatte. Nicht sein Körper zuckte, sondern ein unsichtbarer Fühler, der in meine Richtung ausgestreckt war. Ich spürte die Präsenz dieses Mannes, bevor mein Blick ihn streifte. Als ich mich zu ihm hindrehte, wandte er sein Gesicht schnell ab. Die Luft zwischen uns spannte sich. Es war ein deutlicher Hinweis, dass mein Blick ihm nicht behagte. Ich überließ ihm den Raum, den scheue Menschen um sich brauchen, wenn sie sich nach einer Tarnkappe sehnen. In dem Moment hielt ich ihn für schüchtern, doch ein wenig später war ich sicher, er hatte andere Gründe, nicht gesehen werden zu wollen. Ich bereute meine Höflichkeit.
Als er Stunden später in der Türöffnung des Büros erschien, erkannte ihn mein Gespür sofort wieder. Bei seinem Verschwinden war ich fest überzeugt, dass er wusste, wie er auf mich gewirkt hatte.
Zwischen ihm und mir bestand eine geheime Verbindung.
Ohne den Fotowettbewerb wäre ich ihm nie begegnet. Aber ich hätte auch nichts von dieser Ausstellung erfahren. Ich war einer Laune gefolgt und hatte ausgerechnet ein Foto aus meiner Kapitell-Sammlung hingeschickt. Ein Bild in Postergröße. Ein Motiv, das ich in der Krypta der Basilika ›San Nicola‹ in Bari fotografiert hatte.
Schon drei Tage später forderten sie mich per Brief – mit Poststempel Berlin – auf, weitere Bilder von diesen Kapitellen zu übersenden, erstmal nur kleine Kopien davon. Ich schickte sie hin, allesamt.
Ich hatte an jenem Tag in Süd-Italien so lange fotografiert, bis der Akku des Apparats schlappgemacht hatte. Jedes Kapitell, Bild für Bild, von allen Seiten.
Das lag Jahre zurück. Nun schien jemand einen Narren an diesen herangezoomten Details gefressen zu haben. Ließ sich denn meine Interpretation der Motive in den Fotos erkennen?
Der nächste Brief kam aus München. Mir schien, er hatte nicht mehr so direkt etwas mit dem Fotowettbewerb zu tun. Ich wurde gebeten, mich zu einem Vorgespräch einzufinden, sollte aber niemandem davon erzählen.
Wir haben Sie in eine Angelegenheit eingeweiht, die ausschließlich Sie etwas angeht. Bewahren Sie absolutes Stillschweigen darüber.
Ich hatte bis dahin nicht unbedingt den Eindruck, dass ich eingeweiht worden war, und schüttelte den Kopf.
Die Fahrt- und Hotelkosten werden übernommen, ebenfalls Spesen aller Art.
Die komplette Kostenübernahme erschien mir durchaus verlockend.
Bitte bringen Sie die Originale der Fotos mit, keine Bearbeitungen.
Vorsichtshalber überprüfte ich nochmal, ob ich die Bilder für mich gesichert hatte.
Am nächsten Tag schnappte ich die sorgfältig verpackten Bilder und reiste für zwei Tage nach München. Ich hoffte auf ein kleines Abenteuer. Doch wo Erwartungen lauern, ist die Enttäuschung nicht weit.
Die meiste Zeit verbrachte ich in Räumen, in denen man mich warten ließ. Mich beschlich das unbehagliche Gefühl, beobachtet zu werden. Ich zwang mich zur Ruhe. Wobei dieser Zustand eher einer vorgetäuschten Gelassenheit entsprach.
Unterzogen sie mich einem Test? Oder prüften sie meine Geduld? Aber wozu? Meine Gedanken hielten mich beschäftigt. Doch die vielen ungelösten Rätsel machten mich zunehmend nervös. Meine Finger sprangen wie kleine Kobolde mal hierhin, mal dorthin. Ich rieb mir derart häufig die Nase, dass mein Make-up keine Chance hatte, das zu überstehen.
Als mein Blick dabei war, meinen zappelnden Fingern hinterherzuhüpfen, erschien eine freundliche, hagere Dame mit grauem kurzem Haar. Sie geleitete mich unter tausend Entschuldigungen für meine Unannehmlichkeiten in einen nächsten Raum. Ich bekam ungefragt Tee serviert. Dazu gab es Ingwerplätzchen, deren Herbheit vortrefflich zu meiner Stimmung passte.
Als ich zum dritten Mal in einen menschenleeren Raum geleitet wurde, saß mir mein Sarkasmus schon auf der Zunge, doch ich presste die Lippen aufeinander, um ihn zurückzuhalten. Etwas in mir war der Ansicht, mein Kommentar wäre in diesem Rahmen fehl am Platz.
Ich hatte bis dahin drei Stunden damit verbracht, geduldig auf jemanden zu warten, dessen Name mir nicht genannt worden war. Ein Herr, ein besonderer offenbar. Er wurde mir gegenüber nur als ›Der Zuständige‹ erwähnt. Ich hatte mich redlich darum bemüht, der Dame einige zusätzliche Informationen zu entlocken, doch vergeblich. Sie hielt sich, im Gegensatz zu dem, auf den ich wartete, nicht für zuständig. Und das, obwohl sie sich nicht allzu deutlich von einem Mann unterschied, sowohl vom Gang her als auch vom Körperbau. Meine Gereiztheit nahm unfaire und verletzende Formen an – zum Glück nur im Stillen.
Nach dem Tee geleitete sie mich in eine Bibliothek. Ich vermutete, dass ich mir so die Zeit etwas vertreiben sollte. Sie bot mir aber nicht etwa an, mich den Büchern hinter den Glastüren nähern zu dürfen. Ihren Augen entnahm ich ein Flackern, das auf das Gegenteil schließen ließ. Also betrachtete ich die Buchrücken nur brav durch die geschlossenen Türen. Es waren alte Bücher, die wie Kostbarkeiten wirkten, zumeist in Ledereinbänden oder mit golddurchwirktem Stoff bezogen. Ich hätte nicht gewagt, sie ohne solche weißen Stoffhandschuhe zu berühren, die Archivare in Museen tragen.
Zum Glück litt ich nicht mehr unter dem Nichtstun. Womöglich besänftigten mich die Plätzchen in meinem Bauch; ich hatte mir einige davon – und gewiss mehr als schicklich war – genehmigt. Meine Gedanken spannen in satter Trägheit ihre Netze und trugen Bilder darin, die mich hinreichend unterhielten. Außerdem stand ein Baum vor dem Fenster, der schon über hundert Jahre alt zu sein schien. Mein Blick ließ sich dazu verleiten – an meiner statt – auf seinen knorrigen Ästen entlang zu krabbeln. Ich hatte nicht bemerkt, wie ich mich auf das dunkle hochpolierte Holzfensterbrett gesetzt hatte. Das Fenster war hoch wie eine Tür und wurde, je länger ich hinausschaute, wie zu einer Pforte in eine andere Welt. Der Baum flüsterte mir etwas zu, ich konnte es nicht durch das geschlossene Fenster hören, aber ich spürte es, ich sah es. Seine wulstigen Lippen bewegten sich, seine Äste schwangen sanft wie die Arme eines Shivas auf und ab.
Ich nickte ein.
Inmitten der Bibliothek standen Eichenbänke. Sie waren in Form einer Bienenwabe aufgestellt. Die Bücherwände ringsherum wichen immer weiter zurück, um mehr Raum für diese hölzerne Sitzgruppe zu schaffen. Ich blinzelte, um trotz der Bewegung im Raum erkennen zu können, was statisch war. Auf den Bänken saßen Männer in schwarzen Anzügen. Sie waren auffällig schick gekleidet, wenn auch ein wenig altmodisch. Die Rüschen an den Ärmeln der weißen Hemden schauten unter dem schwarzen Jackett hervor.
Ich hörte Tuscheln. Die schon angegrauten Herren diskutierten hin und her. Ihr Gemurmel wurde so laut, dass es mich wie ein Strudel umschwirrte und schließlich einsog. Ich fand mich in der Mitte der Bänke wieder, stand in diesem begrenzten Raum im Innern der Bienenwabe.
»Sie ist es.«
»Es entspricht der Prophezeiung. Ihr Erscheinen wurde für dieses Jahr angekündigt. Und der November steht schon vor der Tür, viel Zeit bleibt uns nicht mehr, das Jahr ist fast um.«
»Was soll das Besondere an ihr sein? Sie sieht aus wie eine gewöhnliche junge Frau.«
»Wir leben im einundzwanzigsten Jahrhundert. Was hast du erwartet, wie sie erscheint?«
»Es heißt doch, sie kommt aus der Mitte und vollbringt den Wandel. Mitte könnte ebenso für Masse stehen.«
»Wir werden es herausfinden.«
»Es heißt aber fernerhin, sie müsse voller Unschuld sein … aus der lichtlosen Nische heraustreten, erwachen und das Alte überstrahlen.«
»Ihr Lächeln ist nicht unschuldig … ihr Lächeln … verrät, dass sie uns hören kann.«
»Sie schläft doch!«
»Ich glaube, sie träumt. Aber – sie – ach herrje, sie lächelt verräterisch.«
»Wenn sie uns wirklich nur träumen würde, könnte sie uns nicht …«
Ein Strudel katapultierte mich aus der Wabenmitte zurück auf den Fenstersims. Ich erwachte.
Natürlich fanden sich keine Bänke in der Bibliothek, auch wenn ich unverwandt auf die Stelle, an der sie gestanden hatten, starrte und ihre Existenz noch zu erspüren glaubte.
Ich bedauerte, dass ich keine Uhr am Arm trug. Inmitten der Bücher herrschte Zeitlosigkeit. Unwillkürlich suchte ich meine Handtasche, um die Uhrzeit auf dem Smartphone zu erfahren. Doch ich hatte sie im Tee- und Gebäck-Servierraum liegen lassen. Das gefiel mir überhaupt nicht. Ich war nicht dafür bekannt, mich jemals von meiner Handtasche zu trennen. Sollte ich zurückgehen und nach der Tasche suchen?
Die Tür ging auf. Eine unüblich große, aber auffallend reizvolle Frau in einem blauen, enganliegenden Kostüm lächelte mir entgegen. Ihr kastanienbraunes Haar wallte über die linke Schulter. »Es tut mir leid, es ist Ihnen heute nicht möglich, einem der zuständigen Herren zu begegnen. Aber ich darf Sie trösten, Ihre Bilder werden im Haupthaus ausgestellt. Ich nehme an, dass Sie damit einverstanden sind. Es wird alles zu Ihrer Zufriedenheit arrangiert. Es ist uns eine große Ehre. Wir werden Ihre Werke mit größtmöglicher Sorgfalt behandeln. Folgen Sie mir bitte, ich habe den Vertrag vorbereitet, Sie brauchen ihn nur noch zu unterschreiben. Die Eröffnung ist am 1. November, das sagte ich doch schon, nicht wahr?«
Sie redete wie ein Wasserfall und gab mir keine Gelegenheit, jemals auf etwas zu antworten. Offenbar bestand für sie keinerlei Zweifel, dass ich dieses Angebot annehmen würde. Dabei wusste ich weder, um was für eine Ausstellung es sich handeln sollte, noch, von welchem Haupthaus die Rede war.
Obwohl die hinreißende Dame den Eindruck erweckte, sie ginge davon aus, ich wüsste, worum es sich drehte, wurde ich doch das Gefühl nicht los, absichtlich am Antworten gehindert zu werden. Ich war bereits verplant, ohne Widerrede. Das juckte mich gehörig. Ich liebte es nicht unbedingt, meine Entscheidungsfreiheit zu verlieren.
»Folgen Sie mir ins Büro!« Das blaue Kostümchen schwebte vor mir her und die Person, die es trug, streute Wörter aus wie Blumen. Sie fielen vor mir zu Boden und ich stapfte darüber hinweg. Beinahe achtlos. Unversehens bemerkte ich die weiße Handtasche, die sie wie aus dem Nichts griff. Ich hätte schwören können, sie wäre ihr angereicht worden, doch wir waren die Einzigen in diesem Gang. Es war meine Handtasche. Aber sie reichte sie nicht zu mir weiter.
Ich nahm mir fest vor, niemals wieder in meinem Leben so auf jemanden einzuquasseln. Ich fühlte mich ertappt. Denn ich konnte nicht ausschließen, womöglich selbst schon mal diese Rolle innegehabt zu haben. Jetzt hielt ich es für eine Lektion, um Schweigen zu lernen. Wohltuendes Schweigen.
Die Dame im blauen Kostüm war sich ihrer Sache sicher wie eine Chefsekretärin. Kaum im Büro angelangt, forderte sie mich auf, mich zu setzen. Sie thronte gleich darauf hinter dem Schreibtisch in einem übergroßen Sessel, während ich ihr gegenüber sowohl etwas niedriger, als auch mit dem Rücken zur Tür saß.
Die Frau wirkte durch ihre raue Stimme womöglich barscher, als sie war. Sie verhielt sich korrekt. Doch ich mochte sie nicht. Ich schrumpfte in ihrer Gegenwart zu einem winzigen grauen Häuflein zusammen. Wie ein Patient, der mit eingezogenem Kopf jedwede Diagnose seines Arztes entgegennimmt, ohne zu wagen, sie zu hinterfragen. Ich ärgerte mich über mich selbst. Doch zu mehr – als zu einem imaginären Ballen der Fäuste – reichte es nicht. Im Stillen verpasste ich dieser mit allen Wassern gewaschenen Dame die Bezeichnung ›Dampfwalze‹. Sie hatte mein Selbstbewusstsein niedergewalzt und schien als Nächstes all meine Kontrollfunktionen im Visier zu haben. Ich dachte: So, wie sie den Laden schmeißt, weiß sie garantiert weit mehr, als sie preisgibt.
Ich unterschrieb den Vertrag unbesehen. Ihre erdrückende Präsenz brachte mich dazu. Mühelos.
Im nächsten Augenblick schob sich dieses blaue Etwas über meinen Rücken und zog alle Aufmerksamkeit auf sich. Bis sich das sonnig-gelbe Lächeln im Blau auflöste, verpasste ich gewiss einige Sätze der dominanten Dame. Aber die Frage, mit der sie mich zurückgerufen hatte, ließ sie unbeantwortet im Raum stehen, ohne sie zu wiederholen. Stattdessen walzte sie weiter.
»Ich schicke Ihnen ein Gesprächsprotokoll von heute zu. In vierzehn Tagen werden wir Ihnen mitteilen, an welchem Ort Sie sich einzufinden haben.«
Mein Trotz regte sich; ihr ›Einzufinden-haben‹ gefiel mir nicht. Und wenn ich nicht erscheine? Dann können Sie mich mal! Meine Fotos habt ihr doch, was wollt ihr von mir?! Doch ich schwieg brav. Sie erklärte mir derweil, dass ich nicht vor der Eröffnung im November an meine Bilder herankäme. Es wäre ja auch gar nicht nötig, sie seien perfekt. Sie überreichte mir einen Scheck, dessen Betrag mich fürchten ließ, dass ich meine Bilder nicht nur verliehen, sondern verkauft hätte. Meinen irritierten Blick fing sie mit der Frage auf, ob sie mir das Geld lieber auf ein Bankkonto überweisen solle. Ich nickte und schüttelte fast gleichzeitig den Kopf, zuckte mit den Schultern und überließ die Deutung meiner Gesten der Sekretärin, die daraufhin den Scheck zurücknahm, meine Bankdaten abfragte und notierte. Mein Trotz war nach diesem Vorgang still. Ich würde mich einfinden, so viel stand fest. Bevor ich das Büro verließ, schob sie mir meine Handtasche zu. Ich hätte gerne nachgeprüft, ob deren Inhalt vollständig war, traute mich aber nicht, mein Misstrauen zur Schau zu stellen. Ihr Blick registrierte, dass ich mit mir rang, bevor ich die Tasche unbesehen umhing.
Unten vor dem Haus stand ein schwarzes, kantiges Auto. Der Chauffeur sprang herbei und riss die Tür auf, als er mich erblickte. Ich zog die Augenbrauen hoch und wendete den Kopf, um mich zu vergewissern, dass er allen Ernstes mich meinte.
»Ich habe Anweisung, Sie zu Ihrem Hotel zu fahren. Und ich stehe Ihnen zu Diensten, bis Sie morgen abreisen.«
»Morgen, ja.« In Anbetracht dessen, dass ich dieses Detail gegenüber der Sekretärin erst bei der Verabschiedung preisgegeben hatte, war er erstaunlich gut informiert.
Ich stieg hinten ein. Er schloss die Tür. Ich kam mir vor wie im falschen Film. Doch darauf kam es nun auch schon nicht mehr an.
»Wünschen Sie noch etwas oder soll ich Sie direkt zum Hotel fahren?«
»Ich bin müde, ich brauche dringend ein wenig Schlaf. Es war alles so verwirrend.« Ich kämpfte mit meinem Gähnen, das ich unbedingt unterdrücken wollte. Die Idee, an diesem Tag noch ein kleines Abenteuer zu erleben, hatte sich längst eingerollt wie eine schlummernde Katze.
Gestern, sechshundert Kilometer entfernt, erhielt ich in dem Brief die Adresse des Haupthauses. Aber nicht nur das. Man wies mich außerdem darauf hin, ich würde vertragsbrüchig, wenn außer mir noch jemand von dieser Ausstellung erführe. Und das bedeutete im Einzelnen, die Sache würde für mich platzen und ich müsste die volle Summe erstatten, die mir überwiesen worden war. Es hieß: Darüber hinaus hätte es noch weitreichendere Konsequenzen, die wir im Einzelnen nicht aufzählen wollen, da wir darauf vertrauen, dass Sie die Vertragsauflagen erfüllen.
Ich nahm das zum Anlass, den Vertrag nochmal in aller Ruhe durchzulesen. Auch das beigelegte Gesprächsprotokoll. Darin war das Abendkleid erwähnt, das ich am Tag der Eröffnung tragen sollte. Von der Geheimniskrämerei mal abgesehen fand ich an all dem nichts Schlechtes. Auch wenn ich versucht war, die Doppeldeutigkeiten im Sprachgebrauch nicht für zufällig zu halten. Aber ich war ja selber ein Meister der Geheimnisse. Was also sollte mich daran stören, wenn ich auf eine mir vertraute Eigenheit bei anderen stieß? Ich beschloss, das für vertrauenerweckend zu halten. Soweit man Empfindungen beschließen kann.
Bienenstraße 13 bis 17. Das Haus besitzt nur einen Eingang, richtiger gesagt wäre wohl Portal. Die Treppenstufen werden nach unten hin immer breiter und erinnern in ihrer schlichten Eleganz an eine Schlosstreppe.
Ich suchte nach einer Antwort auf die Frage, warum ich so viele Tage zu früh hergekommen war. Die Idee, die letzten Oktobertage für ein kleines Abenteuer in München zu nutzen, war sicher nicht der wahre Grund. Oder doch?
Ich starrte das Gebäude an, das mich in seiner unauffälligen Schönheit faszinierte. Zu wenige Verzierungen, um ausgeprägter Jugendstil zu sein, zu elegant, um schlicht zu sein. Wenn die Hausnummer einen Sinn hätte, müssten die Wände im Innern aufgebrochen und ein zusammenhängendes Geschoss über fünf Häuser hinweg geschaffen worden sein. Praktisch für eine Ausstellung. Auf zwei Etagen ergeben sich gewisse Möglichkeiten, so viele Räume zu nutzen. Es schien mir ein elitärer Verein zu sein.
Mir schoss der Gedanke durch den Kopf, dass ich die nächsten Tage dafür verwenden musste, ein Abendkleid aufzutreiben: Die extrem großzügig bemessene Überweisung würde davon allenfalls etwas angeknabbert. München bietet gewiss ein breites Angebot, um – wenn schon, denn schon – ordentlich aufgeputzt zu erscheinen.
Mir fehlte allerdings jegliche Übung darin.
Ich konnte mich nicht mehr vom Anblick dieses Gebäudes trennen. Dabei hätte ich längst ein Hotel aufsuchen müssen. Völlig unvernünftig war ich abgereist, ohne zu planen, wo ich schlafen würde. Die ganze Geschichte veränderte mich, ich handelte unvorhersehbar und anders als für mich typisch. Das hätte mich misstrauisch machen sollen, doch stattdessen reizte es mich nur noch mehr. Es geschah etwas. Und es kitzelte an meiner Neugier.
Am Rande der gegenüberliegenden Straßenseite fiel mein Blick auf eine schmiedeeiserne Bank. Sie wäre gewiss ziemlich kalt, dachte ich, aber meine Füße nahmen mir die Entscheidung ab und trugen mich geradewegs zu ihr.
Ich setzte mich und lehnte mich an. Das Metall der Bank war keineswegs kalt. Es fühlte sich an, als hätte eben noch jemand darauf gesessen. Ich schüttelte den Kopf. Meine Prognosen schienen sich hier nie zu bewahrheiten.
Ein älterer Herr, der wie aus dem Boden geschossen vor mir stand, sprach mich an: »Suchen Sie etwas oder jemanden? Vielleicht kann ich Ihnen behilflich sein?«
Ich zuckte zusammen.
Er lächelte und trat einen Schritt zurück. Dabei verbeugte er sich ein klein wenig.
»Nein, danke, sehr liebenswürdig. Ich wollte einfach nur hier sitzen. Es ist ein faszinierend schönes Haus … das da drüben … finden Sie nicht auch?«
»Was genau meinen Sie?«
Ich malte Girlanden in den Himmel, als ob ich seine Aufmerksamkeit dirigieren wollte, und kommentierte dazu: »Ich finde es unbeschreiblich schön. Es zieht meinen Blick an, ich kann mich seiner Wirkung nicht entziehen, und dabei ist es doch an und für sich recht schlicht. Die Schlichtheit erscheint aber in Perfektion. Die Linien passen zusammen. Die Fensterhöhen sind meisterhaft aufeinander abgestimmt. Der Erker ist so exzellent integriert. Und die wenigen Zierelemente schweben wie Schutzengel vor den empfindlichen Eckpunkten.« Ich geriet ins Schwärmen und erkannte immer mehr, warum mich diese Fassade faszinierte.
Meine Worte waren mir etwas peinlich. Ich fürchtete schon, ein wenig versponnen zu wirken. Aber der ältere Herr erweckte nicht den Anschein, sich über mich zu amüsieren. Im Gegenteil.
»Die meisten Menschen übersehen das. Aber Sie … Sie interessieren sich wohl für Bauwerke?«
»Eigentlich nicht so direkt. Aber manchmal scheint sich eines gegen meine Unachtsamkeit durchzusetzen«.
Er lächelte nachsichtig, als wüsste er genau, was ich damit meinte, und murmelte nur: »So, so.«
»Kennen Sie diese … hm … Adresse?«, wagte ich zu fragen.
»Die Nummer 13-17 meinen Sie?« Er hatte einen spöttischen Ton in der Stimme.
»Wissen Sie etwas über … also ich wüsste gerne … nun ja, also, passiert da manchmal was? Sie sind doch von hier und kennen das Haus.«
»Manchmal ist es reizvoll, etwas nicht zu wissen. Eine Ahnung, die unbeweisbar in der Luft schwebt, entspringt doch reinster Magie, finden Sie nicht auch?«
Sein ›Finden-Sie-nicht-auch‹ schien mich nachzuäffen. Doch sein Spott war von neckischer Liebenswürdigkeit. Sein Alter hatte zwar seine Statur gebeugt. Seine Höflichkeit hingegen war von unbeugsamer Natur. Er stand seitlich neben der Bank und hielt sich an der Rückenlehne fest. Seine Hand war etwas zittrig und so wild zerknittert, dass sie einem Hundertjährigen hätte angehören können. Meine Höflichkeit war offenbar schon in jungen Jahren auf der Strecke geblieben. Schuldbewusst nahm ich meine Reisetasche von der Sitzfläche und bot ihm wenigstens jetzt schnell an, sich zu setzen. Ich rückte ein Stück beiseite. Genau genommen bis ans Ende der Bank. Er lächelte und schien zu überlegen. Dann setzte er sich ans andere Ende. Zwischen uns war noch Platz für eine weitere Person. Ich schwieg.
Dieses Nebeneinandersitzen brachte eine Peinlichkeit mit sich, die dem vertraulichen Gespräch von vorher den Boden entzog. Ich faltete meine Hände ineinander, legte sie in den Schoß und räusperte mich. Die angestrengte Suche nach geeigneten Höflichkeitsfloskeln grub abwechselnd eine Falte in meine Nasenwurzel oder zauberte ein Miniatur-Waschbrett auf meine Stirn. Das spürte ich. Mehr nicht. Das Schweigen wurde drückend. Ich rieb mir die Nase und hüstelte. Meine Haare krabbelten im Gesicht, ich strich sie immer wieder nach hinten. Sie rutschten kurz darauf nach vorn.
Erst als mein Blick vorsichtig und anfangs nur äußerst flüchtig den alten Herrn neben mir streifte, beruhigte ich mich. Er hatte die Augen geschlossen und genoss die Abendsonne auf seinem Gesicht. Er nahm sich die Zeit für seine Ruhe. Ich atmete sie ein und vergaß, wieder wegzuschauen. Seine bronzefarbene Haut war wettergegerbt. Er wirkte wie ein alter Weiser in viel zu schicken Klamotten. Je länger ich ihn betrachtete, desto ruhiger wurde ich. Winzige Sonnensternchen tanzten über seinen Augenlidern. Die Augenbrauen waren schmal und ausdrucksstark; wäre er jünger gewesen, hätte ich vermutet, dass er sie in Form zupft. Seine Lippen waren voll und sinnlich. Ich dachte: Er muss mal ein begehrenswert gutaussehender Mann gewesen sein.
Seine Lider zuckten, seine Mundwinkel hoben sich. Ich schaute schnell weg und war mir sicher, er hatte gemerkt, dass ich ihn so unverhohlen musterte. Er räusperte sich. Ich sah flüchtig zu ihm hin. Sein Lächeln überstrahlte sein Gesicht bis in den letzten Winkel.
»Sie interessieren sich nicht nur für Fassaden von alten Bauwerken, hm?« Er lachte ungebremst los und öffnete die Augen. Ich rieb mir die Nase, doch mein Lachen drängte nach draußen. Ich konnte es nicht halten, fing es aber schnell wieder ein.
Bevor die nächste peinliche Stille Einzug halten konnte, fragte er mich: »Was haben Sie denn heute noch vor?«
»Gut, dass Sie mich daran erinnern! Ich muss mir noch ein Hotel suchen!«
»Richtig, Sie sind ja nicht von hier. Aber was …« Er unterbrach sich.
»Was wollten Sie wissen?«
»Ist mir wieder entfallen …«, nuschelte er.
Wir wussten beide, dass das nicht stimmte, aber ich fragte nicht weiter nach.
Er holte tief Luft und betrachtete mich. »Kennen Sie die Bienenwabe?« Er schaute mir direkt in die Augen. Ich schluckte. Denn ich sah die Herren auf den Eichenbänken vor mir.
»Ich meinte das Hotel.« Er lächelte vieldeutig. »Sie haben doch noch keines, nicht wahr?«
»Ach so, das Hotel ›Bienenwabe‹. Nein. Das kenne ich nicht. Ist das empfehlenswert?« Meine Erleichterung sorgte für eine lautere Stimme als nötig.
Seine Mundwinkel zuckten fast unmerklich, folgten dann aber der Bemühung, ernst zu bleiben. »Ich hab noch nie in dieser Stadt im Hotel geschlafen, ich wohne ja hier. Aber ich kenne es sehr gut. Es wird Ihnen schon gefallen.«
»Ist das weit von hier?«
»Nein, mehr oder weniger direkt in der Nebenstraße. Günstig gelegen, um immer mal wieder einen Blick auf dieses Gebäude hier zu werfen. Das müsste Ihnen doch gefallen?«
Ich fühlte mich erwischt. Aber auch erkannt. Er hatte eine so herzige Art, ich war richtig froh, ihm begegnet zu sein.
»Also gut, man soll ja Tipps von erfahrenen Menschen nicht von sich weisen. Ich werde versuchen, dort unterzukommen. Wohnen Sie auch hier in der Nähe?« Ich kicherte entschuldigend und konnte von Glück sagen, dass er schon so alt war. Sonst wäre das unter Anbaggern gelaufen.
»Ja, ganz in der Nähe. Kann gut sein, dass wir uns mal wieder über den Weg laufen. Schließlich bin ich der Pförtner und einem Pförtner entgeht nichts und niemand.« Er schmunzelte.
»Es schadet nie, einen Verbündeten an seiner Seite zu haben, wenn man in fremden Gefilden unterwegs ist.« Ich war überrascht über das, was ich da von mir gegeben hatte. Er anscheinend auch, denn er legte den Kopf schief und bohrte seinen Blick tief in meine Gedankenwelt hinein. Ich war mir nicht sicher, ob er das fand, was er suchte. Die Falten, die wie kleine Wellen über seine Stirn zogen, sahen eher nicht danach aus.
Ich setzte schnell hinterher: »Ich mag Sie irgendwie. Aber vielleicht liegt das nur an dieser Straße hier. Weil … Ihr Gesicht reflektiert das Gebäude, das mich heute so gebannt hat. Aber kein Wunder. Wir sitzen ja direkt gegenüber. Da ist das normal, wenn sich die Nebenfarben widerspiegeln. In der Fotografie ist der Effekt nur allzu gut bekannt.«
»Interessante Betrachtungsweise.«
Ich hatte mir früher immer einen Großvater gewünscht. Seit meiner Kindheit glaubte ich, dass mir so ein verständnisvoller Opa all meine Wünsche erfüllen könnte. Vielleicht kam es daher, dass ich einen Narren an diesem alten Mann gefressen hatte. Ich fühlte mich ihm verbunden, als wären wir miteinander verwandt. Reinstes Wunschdenken.
Ich erhob mich fast zeitgleich mit ihm. Keiner von uns hatte angekündigt, gehen zu wollen. Wir standen uns gegenüber und lächelten still in uns hinein.
»Wo sagten Sie, sei das Hotel?«, fragte ich, obwohl ich das sicher auch Google hätte fragen können. Womöglich suchte ich einen Vorwand, mich noch nicht verabschieden zu müssen.
Er zeigte mit der Hand in die Richtung. »Am Ende der Straße geht rechts ein kleiner Fußweg ab. Genau da, wo der alte Baum steht, sehen Sie den?«
»Ja, der ist nicht zu übersehen. Ein Prachtstück von einem Baum!«
»Nicht wahr? Sie folgen dem kleinen Pfad bis an sein Ende. Er schlängelt sich zwischen diversen Häusern hindurch. Merken Sie sich das Muster, das Sie im Boden erkennen. Der Weg, der für Sie der richtige ist, wird immer dieses Muster haben. Einerlei, ob Sie glauben, er würde seine Richtung wahllos ändern. Folgen Sie Ihrem Muster! Dann kommen Sie auch an.«
»Das hört sich an wie im Märchen. Rotkäppchen soll nicht vom Wege abkommen. Was würde denn passieren, wenn ich nicht meinem Muster folge?«
»Folgen Sie ihm einfach. Glauben Sie mir, es ist das Beste! … Und … Denken Sie an den Ariadne-Faden.«
Für gewöhnlich machten mir solche Spinnereien Spaß, doch diesmal überzog mich eine Gänsehaut. Eine nicht fassbare Ahnung breitete sich in meinem Genick aus und ich forschte nach: »Sie sind sich absolut sicher, dass es ein richtiges Hotel ist, das ich dort finde? Also mit Rezeption und vielen Zimmern?«
»Ja, absolut sicher. Aber es ist kaum jemandem bekannt. Dort ist gewiss etwas für Sie frei!«
Er wusste, wie er mich beruhigen konnte. Die Sonne war eben dabei, unterzugehen. Und die Aussicht, in einer fremden Stadt nicht zu wissen, wo man die Nacht verbringt, war nicht gerade verlockend.
Ich war mit dem Mittagszug angereist. Es wäre ausreichend Zeit gewesen, eine geeignete Unterkunft zu finden. Selbst am anderen Ende der Stadt. Doch anstatt einen Gedanken an die Hotelsuche zu verschwenden, hatte ich mich unter tausenden Vorwänden unverkennbar der geheimnisumwobenen Adresse genähert. Das war schwieriger als gedacht. Zuerst stieg ich an der falschen Haltestelle aus. Dann erfand ich vermeintlich schlaue Abkürzungen und landete vor einem Zaun. Und als ich in unmittelbarer Nähe war, lief ich etliche Male daran vorbei. Und das, obwohl ich eine übersichtliche Karte dabei hatte, die sie mir extra mitgeschickt hatten. Schließlich kehrte ich um. Erst, als ich dem eingezeichneten Weg vom markierten Ausgangspunkt an folgte, gelangte ich an mein Ziel – voller Erleichterung. Aber gänzlich, ohne an ein Nachtlager zu denken.
Ich lächelte über mich selbst. Solche Vorgehensweise hätte ich mir niemals zugetraut. Ich war bis dahin stets auf Sicherheit bedacht und bei aller Liebe zu spontanen Anwandlungen doch ein recht planender Mensch.
Der alte Mann neben mir stolperte und rief sich so in mein Gedächtnis. Ich griff spontan nach seinem Arm, um ihm Halt zu bieten. Die ersten paar Meter hatten wir zusammen zurückgelegt. Doch plötzlich blieb er stehen.
»Gehen Sie nur. Sie wollen ja mal ankommen. Ich bin zu langsam. Sonst würde ich Sie noch bis zur Platane begleiten.«
Mein Blick suchte den Baum. Von der Stelle aus konnte ich nicht erkennen, dass es eine Platane war. Sie beherrschte das Ende der Straße. Ein Sackgassenschild warnte an der nächsten kleinen Kreuzung, dass dieser Baum das Ende der Straße markierte.
»Also dann, ich hoffe, wir sehen uns mal wieder! Ich versuche derweil mein Glück in der Bienenwabe.« Bei der Erwähnung des letzten Wortes beschlich mich ein mulmiges Gefühl. Ich erinnerte mich abermals an meinen Traum mit den Herren in der Bibliothek. Unterhalb meiner Schulterblätter drängte ein Druck aus meinem Inneren nach draußen. Nur einen winzigen Augenblick. Ich zog den Kopf ein und fühlte mich auf den ersten Schritten ohne Begleitung ziemlich allein. Aber es gelang mir, mich nicht noch einmal umzuschauen.
Die Platane war göttlich! Sie beherrschte den gesamten Bereich am Ende der Straße. Um ihren Stamm herum waren Bänke angebracht worden, ohne jedoch die Rinde des Baumes zu beschädigen. Die Sitzgelegenheiten trugen sich selbst. Und sie ließen genügend Platz, falls der Baum sich weiter ausdehnen wollte. Wäre die Sonne nicht schon untergegangen, hätte mich nichts bremsen können, mich auf einer der Bänke niederzulassen. So umschlich ich dieses Arrangement im Dämmerlicht wie eine Katze den heißen Brei. Der Anblick kam mir bekannt vor. Sechs Bänke. Im Kreis um den Baum herum. Doch es war kein Kreis, die Bänke bildeten gerade Seiten.
›Bienenwabe‹ erklang ein Echo in meinem Kopf und erinnerte mich daran, das Hotel aufzusuchen. Doch es erinnerte mich noch an so Einiges mehr.
Der empfohlene Pfad war schmal und mit Basalt-Steinen belegt. Die Steine hatten eine gleichmäßige hexagonale Form, die durch bläuliche Steine, die Muster bildeten, betont wurde. Die Muster irritierten das Auge beim Laufen. Ich starrte sie an, als wollte ich sie festhalten. Doch sie entzogen sich dem Erkennen. Ich hätte stehenbleiben müssen, um sie sorgfältig zu betrachten, doch es schien, als bestimmten sie das Tempo meiner Schritte. Der Pfad würde zwischen Häusern hindurchführen, hatte der Alte gesagt. Doch ich sah nichts und niemanden jenseits der dichten Hecken. Mein Blick fixierte dieses seltsame Muster, das mich führte. Ich folgte ihm, wie ein ruderloses Boot, das von irgendwoher an Land gezogen wird.
2
Unterdessen war es dunkel geworden. Am Rande des Pfades steckten winzige Lämpchen im Boden, die dem Basaltgestein ein Schimmern entlockten. Der zarte Lichtschein nahm schrittweise zu und wurde auf ein Mal so hell, dass mir nicht mehr entgehen konnte, dass ich direkt auf ein Gebäude zusteuerte. ›Die Bienenwabe‹ stand auf einem Schild oberhalb der Tür. Links und rechts davon verströmten gusseiserne Lampen ein angenehm orangefarbenes Licht. Es sollte mich doch sehr wundern, wenn ich dieses Hotel über Google gefunden hätte, schoss es mir durch den Kopf. Und ich beschloss, es später zu überprüfen, vorausgesetzt, es ermöglichte seinen Gästen den Zugang zum Internet. Ich spielte mit dem Gedanken, ich sei durch eine Zeitmaschine gerutscht. Ein Funkloch wäre da sicher noch die kleinste Form einer Überraschung.
Die alte schwere Holztür öffnete sich vor mir. Die Teppiche an den Wänden fingen zuerst meine Aufmerksamkeit ein. Unglaublich, dass man so feine Muster weben kann, staunte ich. Sogar Vögel und Schmetterlinge waren darin zu finden. Auf dem Boden hingegen fand sich keinerlei Teppich. Er war mit Fliesen gestaltet oder besser gesagt mit einem Kunstwerk aus feinsten Steinchen. Es hätte römische Fußbodenmosaike vor Neid erblassen lassen.
Ich traute mich keinen Schritt weiter. Zwar ging ich auf weichen Gummisohlen, die der Schönheit nichts hätte anhaben können, aber ich wollte diese Feinheiten nicht mit Füßen treten. Was sollte ich tun? In Strümpfen weiter? Sähe wohl doch ein wenig seltsam aus. Ich suchte die holzgetäfelte Rezeption nach Hinweisen ab und muss gestehen, dass ich froh war, dort niemanden sitzen zu sehen. Da kam mir eine Idee. Ich trat immer nur auf die großen einfarbigen Bereiche, ohne die Fugen zu den funkelnden Mosaikeinfügungen zu berühren. Das verlangte mir zwar ein wenig Geschicklichkeit ab, doch weil es mich daran erinnerte, wie man auf Feldsteinen einen Fluss überquert, machte es durchaus Spaß.
An der Rezeption angelangt, drückte ich auf die beschriftete Klingel, die dazu aufforderte, betätigt zu werden. Seitlich hinter dem kleinen Tresen öffnete sich die Tür und ein Herr älteren Semesters mit gelb gestreifter Weste erschien. Er verbeugte sich vor mir und begrüßte mich, als hätte er seit Jahrzehnten aufgegeben, auf Gäste zu hoffen. Mir kam es etwas zu überschwänglich vor. Vielleicht auch nur diensteifrig, keine Ahnung.
»Ich hätte gerne ein Zimmer.« Meine Augen suchten in seinen nach einer Bestätigung. Doch er nickte nur und nahm einen Schlüssel vom Brett.
»Benötigen Sie meinen Ausweis?«
»Aber nein, Madam, Sie sind hier herzlich willkommen.«
»Ich werde voraussichtlich etwas länger hierbleiben. Könnte ich da nicht einen kleinen Rabatt bekommen? Was wird mich das Zimmer kosten bei, sagen wir, etwa vierzehn Tagen?«
»Machen Sie sich darüber keine Gedanken, wer bei uns unterkommt, dessen Rechnung ist beglichen. Alles inklusive.« Er lächelte, als wäre das, was er gesagt hatte, das Selbstverständlichste der Welt.
Mir stand der Mund offen. Als ich es bemerkte und ihn etwas zu schnell zuklappte, schlugen meine Zähne hart aufeinander. Ich hüstelte.
Er schob mir den Schlüssel zu und fragte: »Welche Zahl wünschen Sie?«
»Äh, welche Zahl? Was meinen Sie?«
»Welche Zahl ist Ihre Zahl? Welche Zimmernummer wünschen Sie?«
»Ich … ich dachte, das würden Sie mir verraten! Zu welchem Zimmer gehört denn dieser Schlüssel?«
»Zum Blauen. Ich brauche trotzdem Ihre Zahl. Sie wird an der Tür benötigt.«
»Ah! Ich verstehe. Was soll ich sagen, ich weiß keine Zahl.«
»Wer hat Sie berufen? Welche Nummer trägt Ihr Auftrag? Die Zahl wird Ihnen doch rechtzeitig per Post zugeschickt.«
»Ich fürchte, hier liegt ein Missverständnis vor. Sie verwechseln mich gewiss. Ich glaube nämlich nicht, dass für mich schon ein Zimmer bezahlt ist. Geben Sie mir einfach ein anderes und sagen Sie mir den Preis.«
»Entschuldigen Sie, ich war unaufmerksam. Sie sind zum ersten Mal hier.«
»Ja, allerdings.«
»Sagen Sie mir die Zahl, die Ihnen jetzt in den Sinn kommt, dann weiß ich mehr.«
»13-17.« Ich wollte ihn verschaukeln und war mir sicher, ich wüsste schon, was ich darauf zu hören bekäme. Doch er verbeugte sich vor mir und nuschelte ein »Hab ich mir doch gleich gedacht« in den Bart.
Er öffnete eine Tisch-Klappe im Tresen und bat mich hindurchzutreten. Er deutete auf die Tür, aus der er nach meinem Klingeln eingetreten war. Sie verbarg einen Fahrstuhl.
»Kommen Sie, gnädige Frau. Es geht nach oben.« Er streckte die Hand auf galante Art aus und dirigierte mich in den Aufzug, er selbst folgte in gebührendem Abstand und drückte auf die Drei.
»Hat jede Etage ein blaues Zimmer?«, fragte ich.
»Ja.«
Aha, so ist das. Er konnte nichts falsch machen mit der Farbzuweisung. Während er mich zum Zimmer begleitete, rätselte ich darüber, wieso er mir den Schlüssel schon gegeben hatte, bevor er die Nummer erfragte.
Vor der einzigen blauen Tür in diesem Flur blieb er stehen: »Schließen Sie bitte auf, der Schlüssel speichert einmalig Ihre persönlichen Muster. Sie werden ihn danach nicht mehr benötigen.« Er gab eine Zahlenkombination oberhalb des Schließzylinders ein und trat beiseite. Ich brauchte eine Weile, bis ich mit dem klobig geratenen Messingding zurechtkam; der Schlüssel wollte sich partout nicht im Schloss drehen lassen. Dann endlich sprang die Tür auf.
Der geduldige Herr trat wieder näher, zog den Schlüssel ab und verstaute ihn in seiner Westentasche.
»Wie öffne ich, wenn ich ohne Schlüssel rein möchte?«
»Sie berühren den Knauf. Der erkennt Sie ab sofort.«
»Darf ich Sie fragen, warum Sie mir das blaue Zimmer zugewiesen haben?«
Er schaute mich verwundert an. »Sie gehören doch eindeutig zur blauen Fraktion, das sieht man doch.«
»Wer sieht das?«
»Die Mitglieder.«
»Ich würde Ihnen gerne noch ein paar Fragen stellen, aber hier stehen wir so zwischen Tür und Angel …«
Ich hoffte, er würde mir einen anderen Platz für eine Unterhaltung anbieten, doch er trat einen Schritt zurück und wandte sich stattdessen zum Gehen.
»Sie wollen gewiss zur Ruhe kommen. Alles Weitere findet sich.« Und weg war er.
Das Zimmer strahlte Ruhe aus. Weiß und Blau dominierten. Doch die Möbel waren aus hellem Holz und nahmen dem Blau an den Wänden die Kühle. Die Decke war Dunkelblau, abgesetzt mit einer breiten weißen Bordüre aus Holz. Unsichtbare Lampen strahlten oberhalb der verdeckten Gardinenstangen an die Decke. Es war blendfreies Licht, das ich nach Belieben per Fernbedienung hoch- und runterregulieren konnte. Die Taster links und rechts vom Bett brachten eine ins Kopfende des Bettgestells integrierte Fläche zum Leuchten. Auch dieses Licht blendete nicht. Alles war auf Harmonie bedacht. Die Vorhänge fielen seidig herab und schimmerten zartglänzend. Sie hatten den gleichen Farbton wie die hellblauen Wände. Das Bettzeug glänzte ebenfalls in Hellblau. Es gefiel mir. Und das, obwohl ich bisher geglaubt hatte, dass Grün meine Lieblingsfarbe sei. Frühlingshaftes helles Grün. Hier lernte ich einen neuen Aspekt von mir kennen. Die blaue Umgebung entspannte mich zwar ebenso wie Grün, doch sie förderte dabei eine spezielle Fähigkeit zur Konzentration. Ich ließ mich nicht frühlingshaft umgarnt einsinken, sondern erhob mich in luftige, himmlische Höhen. Es war eine andere Art und Weise, mich zu entspannen. Mir gefiel es in diesem Zimmer immer besser. Es versprach etwas – etwas, wonach ich mich insgeheim sehnte. Jedoch – ich hätte es nicht benennen können.
Ich ging den Empfindungen nach und legte mich quer auf mein Bett. Das Bettzeug duftete nach Meer und nach Wind – und dieser Duft trug mich unweigerlich in das Reich der Träume.
Als ich erwachte, war Mitternacht längst vorüber. Ich konnte mich an keinen meiner Träume erinnern, obwohl ich einen Hauch der fremden Welt noch in meiner Nähe erspürte. Beinahe ließen sich die verblichenen Bilder wiedererkennen, doch nur beinahe. Ich betätigte den Lichttaster neben dem Kopfende. Das leuchtende Kopfteil des Bettes brachte mich erneut zum Staunen. Doch ich musste mal und mir fiel ein, dass ich die Ausstattung meines Zimmers noch nicht in allen Bereichen überprüft hatte. Das war ein unmissverständlicher Hinweis, dass ich tagsüber zu wenig getrunken hatte.
Der Anblick des Bades ließ mich für einen Moment vergessen, warum ich dorthin gewollt hatte. Vor mir ein Waschtisch aus weißem Marmor mit Armaturen in edlem Design. Darüber ein mit Lämpchen besetzter Spiegel, der die gesamte Wand für sich einnahm. Der Fußboden ebenfalls aus hellem Marmor mit diagonaler dunkelgrauer Zeichnung. Er mutete wie ein Katzenfell an. Eine großzügig bemessene Duschkabine aus Glas neben einer Eckbadewanne, in deren Seitenwände Düsen für den Whirlpool integriert waren. Und das alles war schon bezahlt. Für mich? – Das konnte doch nicht stimmen. Ich traute mich kaum, inmitten dieser Ausstattung meinem eigentlichen Bedürfnis nachzukommen. Es blieb mir aber nichts anderes übrig.
Die Spülung funktionierte vollautomatisch.
Die Umgebung erhob mich zu etwas, das weit über meinen Ansprüchen lag. Ich streichelte über den marmornen Waschtisch, betrachtete mich im Spiegel und strich mir eine Haarsträhne aus der Stirn. Kaum, dass ich das Luxusbad verließ, kramte ich mein Smartphone aus der Tasche und schaltete den Datenempfang ein. Tagsüber hatte ich ihn abgestellt, um Akkukapazität zu sparen. Erstaunlicherweise bekam ich Internetzugang. Ich fragte Google nach ›Bienenwabe‹. Und ich bekam allerhand über Bienen erklärt. Ich präzisierte auf ›Hotel Bienenwabe München‹.
Meinten Sie vielleicht: Bienenvolk auf dem Dach?
»Alles klar.« Ich schüttelte den Kopf und kicherte.
Dem Brief, in dem mir die Adresse geschickt worden war, hatte eine ausfaltbare Karte beigelegen, in der die Bienenstraße markiert war. Speziell die Position der Nr. 13-17. Die Karte war übersichtlich, und so hatte ich sie hilfreich gefunden und genutzt, ohne die Bienenstraße auf andere Weise zu suchen. Nun wollte ich sie von Google finden lassen. Doch nach der Eingabe ›Bienen…‹ fiel mir das Telefon aus der Hand und landete unsanft auf dem harten Boden. Ich bückte mich entsetzt, befürchtete schon das Schlimmste, doch streichelte dann entschuldigend über das heil gebliebene Display. Unbeabsichtigt schaltete ich es dabei wieder aus. Auch egal. Ich legte es beiseite.
Auf dem kleinen Tisch neben dem Ohrensessel fand ich eine Menükarte. Rund-um-die-Uhr-Service stand darauf. Eine Seite für Speisen, eine Seite für Getränke. Ich hätte mir gerne einiges davon zu Gemüte geführt, doch ich fand es unanständig, zu dieser späten Stunde noch ein aufwändiges Menü zu verlangen. Ein Omelett auf Brokkoli schien mir etwas mit geringerem Aufwand zu sein. Daneben stand ein Code, den man über die Tastatur des Haustelefons eingeben sollte. Okay. Das machte ich. Zehn Minuten später klopfte es an der Tür. Als ich öffnete, war da niemand, nur ein Wagen, auf dem ein abgedeckter Teller stand. Daneben ein Brotkörbchen. An der Seite des Gefährts waren Flaschenhalter befestigt. Darin steckten Mineralwässer verschiedener Sorten.
Ich verputzte das Essen und bunkerte die Wasserflaschen für später. Den Wagen schob ich wieder vor die Tür. Meine Müdigkeit nahm den Rest der Nacht für sich in Anspruch. Ich schlief wie ein Bär.
Morgens kitzelte mich die Sonne wach. Ich hatte ausgesprochen gut geschlafen. Nun war ich auf den Tag gespannt. Ich angelte mir mein Smartphone und suchte nach Geschäften, die Abendkleider versprachen. ›Lindwurmstraße‹ hörte sich drollig an. Sollte ich es da versuchen? Ich ging die genauen Standorte durch und kreierte daraus einen Tagesplan für mich. Sieben Geschäfte zog ich in die engere Auswahl. Ich freute mich auf den Tag.
Mir schwebte ein karmesinrotes Kleid vor. Doch mich beschlich das Gefühl, dass ich mich lieber im blauen Farbspektrum bewegen sollte.
Nach dem Frühstück auf meinem Zimmer genehmigte ich mir eine kleine Stadtrundfahrt durch München. Der Taxifahrer amüsierte sich über meine eigenwillige Auswahl der Highlights.
Die Abendkleider waren wahrhaft berauschend. Anfangs machte es mir unheimlich Spaß, mein Aussehen wie eine Rolle zu wechseln. Doch bald besiegte ein mulmiges Gefühl die Freude, weil ich dabei war, ein Schauspieler in einem Stück zu werden, dessen Vorlage ich nicht kannte. Just in diesem Augenblick brachte die Verkäuferin ein türkisfarben schillerndes, schmal geschnittenes Kleid, das mit glänzendem Lila durchsetzt war. Je nachdem wie man es drehte, war es ebenfalls möglich, es für lilafarben und Türkis durchsetzt zu halten. Die Frage, ob das in seiner Kombination als eine Art von Blau durchgehen würde, verblasste schneller, als ich darüber nachdenken konnte.
Meine Entscheidung war gefallen, bevor ich das Kleid anprobiert hatte. Es passte aber zum Glück wie angegossen. Der tiefe spitze Ausschnitt war mit einem Tüllstreifen bedeckt, der dafür sorgte, dass das Nichtsichtbare umso verlockender erschien. Wie ein Schleier an einem Damenhut, durch den man das Gesicht ahnt und doch nicht erkennt.
Die Verkäuferin war sprachlos. Sie staunte mich an und gab dann ein Stoßgebet von sich. Die Zeit dehnte sich. Ich drehte und wendete mich vor dem Spiegel und konnte selber nicht glauben, was ich da sah. Ich war nicht mehr dieselbe. Ich fühlte mich wie eine bisher unscheinbare Rose, die jetzt veredelt, in Zukunft berauschend duften würde. Ich strich mit beiden Händen über meine Wangen und spürte, dass die neue Rolle mit mir verwuchs.
Blieb nur noch die Frage, welche Rolle das sein würde.
Die Verkäuferin fand ihre Sprache wieder. »Das Kleid ist erst diese Woche reingekommen und ich wollte es schon zurückschicken. Ich dachte, diese beiden Farben würden jede Frau erschlagen. Doch Sie … Sie … das hätte ich nie gedacht. Sie glauben gar nicht wie Sie damit ausschauen. Einfach göttlich!«
Ja, das fand ich auch. Treffend formuliert. Besser hätte ich es nicht sagen können.
»Darauf müssen wir anstoßen! Warten Sie, wir haben ja immer einen Sekt kalt, aber heute … das ist doch ein richtiger Anlass!«
Es war mir ganz lieb, dass sie verschwand. Der Gedanke, das Kleid wieder ausziehen zu müssen, behagte mir überhaupt nicht. Ich wollte es anbehalten, wenigstens noch ein Weilchen.
Es klirrte im Nebenraum. Dann hörte ich den Sektkorken aus der Flasche floppen. Ein Grund zum Feiern. Allerdings versuchte ich im nächsten Augenblick, nach dem Preisschild zu angeln. Vergeblich. Was ich für das Schild gehalten hatte, war nur ein schillerndes Bändchen. Die Verkäuferin erschien mit einem Tablett, auf dem die Flasche und zwei Sektgläser standen. Sie balancierte es auf das kleine, runde Tischchen, das vermutlich zu diesem Zweck gedacht war, und rief voller Verzückung: »Bezaubernd! Das schaut einfach bezaubernd aus!« Nun ja, das war ihr Job.
»Ich fühle mich auch ohne Sekt schon ganz wohl in dieser Hülle«, gab ich zu.
Wir stießen an und nippten wohlerzogen am ersten Glas. Der Rest aus der Flasche verschwand dann etwas unkultivierter. Sie schenkte nach, wir kicherten. Ich sorgte mich allerdings um das Kleid.
Nach dem dritten Glas Sekt beschlossen wir einvernehmlich, dass es besser sei, das gute Stück bis zu seinem gedachten Auftritt zu schonen. Die Verkäuferin zweifelte nicht eine Sekunde daran, dass ich das Kleid mitnehmen würde.
Ich sah wehmütig zu, wie es hübsch zusammengelegt in der großen, silbern bedruckten Schachtel verschwand. Die Frage, die im Raum schwebte, stellte ich nicht. Ich zahlte den königlichen Preis, ohne ein Wort darüber zu verlieren. Die Verkäuferin hatte guten Grund, sich und mich gleichermaßen zu beglückwünschen. Doch dieses unbeschreibliche Etwas war jeden Preis wert.
Und das passierte ausgerechnet einer wie mir! Mich gab es fast ausschließlich in der Ausführung mit Hose. Plötzlich war ich stolze Besitzerin eines Abendkleides. Ich wünschte von ganzem Herzen, es möge mehr als einen Anlass geben, es zu tragen.
Ich nahm ein Taxi, das mich wie gewünscht an der Platane absetzte. Doch es nahm einen anderen Weg, als ich vermutet hatte; an der Bienenstraße 13-17 führte er nicht vorbei. Das Taxi bog aus einer der nachfolgenden Seitensträßchen ein. Ein Schleichweg vielleicht. Taxifahrer kennen für gewöhnlich den kürzesten Weg.
Ich trug meine Trophäe vor mir her und konnte an der breiten Pappschachtel vorbei kaum auf den Pfad hinabsehen. Das brachte mich ins Stolpern. Ich klemmte sie mir zu guter Letzt doch noch unter den Arm. Und schon bewahrheitete sich, was der Alte gesagt hatte. Der Pfad verlief in eine unerwartete Richtung. Ich folgte stoisch dem Muster – jedoch – mich beschlich dabei Angst. Der Anblick des Hotels entlockte mir einen Ausruf der Erleichterung.
Im Innern der ›Bienenwabe‹ angekommen, sprang ich von Fliesenfläche zu Fliesenfläche. Ich hatte morgens beim Verlassen des Hotels das kürzeste Springmuster herausgefunden. Jetzt ging das schon recht flott. Die Rezeption war wie bisher immer unbesetzt. Der Fahrstuhl surrte und brachte mich nach oben.
Ich beschloss, mir als Nächstes ein göttliches Menü servieren zu lassen. Zur Feier des Tages. Der Traum von einem Abendkleid gehörte jetzt mir. Und dabei war ich alles andere als eine Prinzessin. Doch prinzessinnenhaft hatte das Kleid gar nicht gewirkt. Es war … Ich suchte nach der richtigen Beschreibung. In mir echoten die Worte der Verkäuferin ›Einfach göttlich!‹
Ich tippte verschiedene Codes ins Haustelefon. Hunger hatte ich. Seltsamerweise verflüchtigte sich mein Appetit. Das Essen würde den schon wieder wecken, dachte ich, und wartete geduldig auf das Klopfen an der Tür. Das Menü weckte alle meine Sinne, nicht nur den bloßen Appetit. Dennoch wurde ich danach sehr müde. Den Rest des Tages verschlief ich. Und ich träumte lebhaft dabei.
Ich sah mich auf einer Bank in einem Museum sitzen, vor mir ein überdimensioniertes Gemälde eines Portals. Neben mir auf der Bank ließ sich in gebührendem Abstand ein Herr in einem Frack nieder. Beinahe geräuschlos. Mein Kopf vermochte nicht, sich nach ihm umzudrehen. Nur mein Auge schielte mal für einen Moment so weit wie möglich nach rechts. Ich wusste, wer das war, der da neben mir saß. Auch ohne sein Gesicht zu sehen, das ich ohnehin noch nicht kannte. Die Bläue auf meinem Rücken begann wieder zu kriechen. Ich schwieg – er schwieg. Meine Aufmerksamkeit richtete sich auf eine blaue Berührung an meinem Oberarm. Sie fühlte sich an wie eine streichelnde Hand, die in tröstlicher Art Vertrauen vermittelt. Und Vertrautheit. Ich entspannte mich völlig und begann dabei zu strahlen wie ein Stern. In meiner Brust entstand ein Licht, das jener Liebe entsprang, die ich nur selten in meinem Leben empfunden hatte. Ich dehnte mich aus und löste mich auf.
Leider erwachte ich an dieser Stelle. Punkt Mitternacht. Und ich fühlte mich recht ausgeschlafen, was äußerst unpraktisch war um diese Zeit. Ich überlegte: Die Zeiten, in denen ich mich nachts allein auf die Straße getraut habe, sind längst vorbei.
Trotzdem überfiel mich das blödsinnige Verlangen, ausgerechnet in diesem Moment zur Nummer 13-17 zu schlendern. Nur mal so, gänzlich absichtslos – und keineswegs voller Erwartungen. Ich kicherte über meine beschwichtigenden Gedanken, die den Selbstbetrug nicht verbergen konnten.
Die Schachtel mit dem Kleid stand auf dem Stuhl neben dem Kleiderschrank. Ich hatte nicht gewagt, noch einmal hineinzusehen, als ob sich das Unbeschreibliche, das darin schlummerte, beim Öffnen des Kartons verflüchtigen könnte. Auch jetzt hielt mich etwas davon ab, und zwar der Gedanke, dass ich dazu die passenden Schuhe bräuchte.
Doch zunächst zog es mich in die Bienenstraße.
Zu meiner größten Überraschung entdeckte ich den alten Mann vom Vortag auf der Bank unterhalb der Platane. Das Licht der Straßenlaterne, das sich durch das Blätterdach hindurchmogelte, sorgte für Schattenspiele auf dem Gesicht des Alten. Ein hübscher Trick der Natur, dachte ich. Seine Falten waren wie weggezaubert. Ich hätte ihn beinahe nicht erkannt. Doch seine Körpersprache verriet ihn. Er knotete an einem Fischernetz herum und reparierte offenbar schadhafte Stellen. An seinen Händen erkannte ich ihn wieder. Ich ging langsam auf ihn zu. Er sah zu mir auf und lächelte.
»So, so. Zu so später Stunde noch unterwegs.« Er fragte es nicht, er stellte es fest.
Ich konnte seinem Ton nicht entnehmen, was er davon hielt, und erwiderte: »Schön, Sie wiederzusehen! Sie, hier um diese Zeit – damit hätte ich am Allerwenigsten gerechnet!« Auch ich vermied es, Fragen zu stellen.
Er legte sein Netz beiseite und bot mir mit einer Geste an, mich zu setzen. Ich traute mich, rückte aber doch an das äußerste Ende der Bank. So konnte ich mich seitlich zu ihm wenden und das peinliche Gefühl vermeiden, wie in einem Wartesaal zu sitzen.
»Ich sagte doch, dass ich der Nachtwächter bin und dass wir uns wiedersehen würden.« Es klang beiläufig – was es aber nicht war.
»Sie sagten aber, Sie seien der Pförtner!«, korrigierte ich ihn und schmunzelte. Ich hatte es so oder so nicht geglaubt.
»Nachtwächter, Pförtner, einerlei … was macht das schon für einen Unterschied.«
Für mich war das nicht dasselbe, aber das spielte im Augenblick keine Rolle.
»Ich konnte nicht mehr schlafen«, gestand ich ihm. »Also – ich war am Nachmittag eingeschlafen und hab unglaubliches Zeug geträumt. Um Mitternacht bin ich aufgewacht und war wacher als an manchem Morgen, an dem ich mir gewünscht hätte, so wach zu sein.« Warum erzähle ich ihm das, fragte ich mich.
»Ich hoffe, Sie hatten gute Träume.«
»Eigentümlich reale, ja. Aber nur einer ist mir noch in Erinnerung. Vielleicht wollte ich meinen aufregenden Tag verarbeiten. Ich hab mir gestern ein Kleid gekauft. Ein Abendkleid.«
»Etwas Besonderes für einen besonderen Anlass, nehme ich an.«
»Ganz genau. Mögen Sie Märchen?«
»Ja. Wieso?«
»Weil es wie im Märchen zuging. Das Kleid hat mich verzaubert, kaum dass ich es an hatte. Sogar schon vor dem Probieren. Es hat mich für einen Augenblick verwandelt.«
»In was hat es Sie denn verwandelt?«
Ein zarter Wind strich durch die Blätter und ließ die Schatten auf seinem Gesicht tanzen. Ich suchte nach Worten – es hat mich in etwas Göttliches verwandelt – doch das traute ich mich nicht zu sagen.
»In etwas Unbeschreibliches«, erwiderte ich stattdessen. Der Wind nahm die Schatten aus seinem Gesicht und ließ sie über seiner Brust tanzen.
»So, so.«
Ich hatte die bisherigen »So, so« für eine harmlose Eigenheit des alten Mannes gehalten, diesmal aber schwante mir, dass er damit bestätigte, dass er mehr wusste, als er sagte. Er musterte mich mit amüsiertem Blick, der gut auch meinem Gedanken gelten konnte.
»Sie wissen, was es mit der Nummer 13-17 auf sich hat, da bin ich mir fast sicher.« Ich hatte nur danach fragen wollen, doch behauptete es stattdessen. Ein bisschen forsch, wie ich fand, aber Zielstrebigkeit führt ja meist schneller ans Ziel. »Ich bin dorthin eingeladen … demnächst. Ich wüsste gerne, was mich dort erwartet.«
»Und? Sie mögen keine Überraschungen?«
»Doch, schon, eigentlich, aber …« Ich räusperte mich. Ich durfte nichts verraten. Mit dem Daumen strich ich mir über die Lippen. Ich suchte nach einer Möglichkeit, es zu umschreiben: »Die Umstände sind doch äußerst außergewöhnlich. Sie haben mich verändert, beeinflussen meine Entscheidungen. Das kenne ich nicht von mir.«
»Ich nehme mal an, Sie mögen Märchen, sonst hätten Sie mich nicht danach gefragt. Können Sie denn dem Seltsamen nicht etwas Märchenhaftes abgewinnen?«
»Doch. Schon. Aber …«
»Was?«
»Ich weiß auch nicht.«
»Sie glauben, Sie fürchten sich?«
Komische Formulierung. Ich glaube das nicht nur, ich hab sogar … Der Gedanke unterbrach sich selbst.
»Vielleicht, ein bisschen, also über drei Ecken. Es ist so ein Unbehagen, mehr wie eine Ahnung.«
»Dann steht Ihnen ein Wandel bevor. Das löst immer Unbehagen aus.«
Die Aussage des Alten kam der eines Kartenlegers gleich. Aber es beruhigte mich, in seiner Nähe zu sein. Außerdem wollte ich ihn dazu verleiten, seine imaginäre Kristallkugel hervorzuholen. Zu gerne hätte ich einen Blick hinein geworfen. Doch er hielt sich bedeckt und griff wie zur Bestärkung dessen nach seinem Fischernetz.
»Ich wusste gar nicht, dass man als Pförtner auch fischen geht«, gab ich etwas kokett von mir.
»Die einen stricken, die anderen spinnen, die nächsten weben … ich flicke Netze.«
Mir war endgültig klar, dass er mehr meinte, als er sagte.
»Gehen Sie ruhig wieder schlafen. Sie werden jetzt müde genug sein. Wir sehen uns wieder.«
Es wäre unhöflich gewesen, daraufhin nicht zu gehen. Also verabschiedete ich mich und kehrte zum Hotel zurück, ohne der 13-17 einen wenigstens rein äußerlichen Besuch abgestattet zu haben. Ich fühlte einen Blick in meinem Rücken, als ich den kleinen Pfad betrat.
Mein Zimmer empfing mich wie ein langjähriger Freund, der einen fraglos in die Arme schließt. Es vermittelte mir Geborgenheit, ohne etwas von mir zu verlangen. Ich vertraute mich ihm an und schlief schneller ein, als ich es für möglich gehalten hätte.
3
Der nächste Tag führte mich in einen antiquarischen Buchladen. Der Verkäufer ließ mich in Ruhe durch den Laden schlendern. Er beobachtete mich nur wie ein aufmerksamer Kellner, der bemerkt, wenn das Glas leer ist, sich ansonsten aber nicht aufdrängt. Ich hatte keine Ahnung, wonach ich suchte, und ließ meine Blicke schweifen, mal hierhin mal dorthin. Sie blieben an einem Ledereinband hängen. Ich zog vorsichtig das Buch aus dem Regal und betrachtete seinen Titel. Der Geheimbund und seine Aspekte. Darunter ein dunkelrotes Herz, das von Licht umstrahlt wurde. Um das Herz herum stand – mehrfach aufgereiht wie eine Buchstabenkette – Ritter des Lichts. Das Buch war schwer, seine Blätter waren vergilbt. Ich schlug die ersten Seiten auf. Über drei Seiten hinweg waren die Kapitel aufgelistet, auf der dritten hieß eines: Die Prophezeiung. Ich zuckte zusammen. Schon wieder erinnerte mich etwas an den Traum in der Bibliothek. Es war Zeit, der Sache auf den Grund zu gehen. Ich schlug das Buch zu und wendete es, um auf der Rückseite nach dem Preis zu suchen. Da war keiner. Ich lief eilig zum Verkäufer, der mich nun doch etwas misstrauisch beäugte, und fragte ihn danach. Er zog mir das Buch aus der Hand und schaute mich dann über seinen Brillenrand hinweg an. Sehr gründlich. »Dieses Buch ist unbezahlbar.« Hoffte er allen Ernstes, mich damit vom Kauf abhalten zu können? Es weckte mein Interesse nur noch mehr.
»Bitte nennen Sie mir den Preis, ich werde den schon bezahlen können!«
»Glaube ich gern. Aber das Buch ist unverkäuflich. Es hätte niemals hier draußen im Regal stehen dürfen.«
»Hier draußen? Sie haben also auch noch ein drinnen?«
»Das tut nichts zur Sache!« Er ließ das Buch langsam aber sicher unter dem Ladentisch verschwinden. Keine Chance. Dieser Mann ließ sich nicht überzeugen.
»Dürfte ich dann wenigstens noch einen Blick hineinwerfen? Hier, innerhalb Ihrer Buchhandlung. Bitte.«
»Es tut mir leid. Das ist nicht möglich. Es war nicht für … äh …« Er blickte mich noch einmal über den Brillenrand hinweg an. »Nicht … für Sie … bestimmt.«