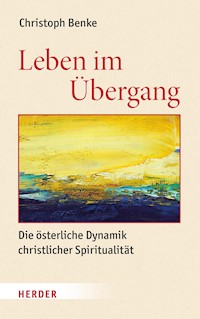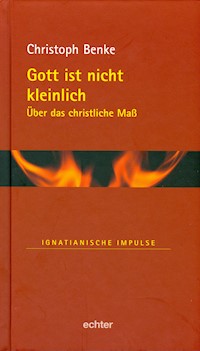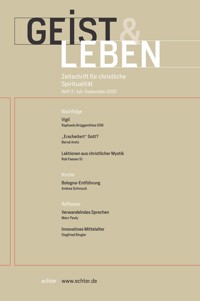
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Echter
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
GuL 98 (2025), Heft 3 Juli-September 2025 n. 516 Notiz Christoph Benke Wenn der Boden schwankt [223-224] Nachfolge Raphaela Brüggenthies OSB Vigil [226-230] Michael Höffner Sakrament des gegenwärtigen Augenblicks. "Caussades" Alltagsmystik in theologischer Relecture II [231-238] Ulrich Hörwick Auf der Spur des homo religiosus. Zur spirituellen Verortung von Bergexerzitien [239-247] Bernd Aretz "Erscheitert" Gott? Kenosis und Kunst bei Klaus Hemmerle [248-256] Rob Faesen SJ Lektionen aus christlicher Mystik [257-265] Nachfolge | Kirche Andrea Schmuck Die Bologna-Entführung. Ein Krimi über Vertrauen als dialogische Ressource [266-272] Daniel Tibi OSB Kanonische Weisheit. Von der Spiritualität des Kirchenrechts [273-281] Nachfolge | Junge Theologie Wolfgang Sigler OSB Der Exodus als Streitgeschichte [282-287] Reflexion Christoph J. Amor "Alles ist durch das Wort geworden". Zugänge zur Lehre von der Schöpfungsmittlerschaft [288-296] Marc Pauly Verwandelndes Sprechen. Sprache als geistlicher Weg bei Eugen Rosenstock-Huessy [297-306] Siegfried Ringler Innovatives Mittelalter [307-315] Philippe Lécrivain SJ Geschichte und Theologie treiben mit Michel de Certeau (1925-1986) [316-322] Lektüre Buchbesprechungen [324-330]
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Heft 3 | Juli–September 2025
Jahrgang 98 | Nr. 516
Notiz
Wenn der Boden schwankt
Christoph Benke
Nachfolge
Vigil
Raphaela Brüggenthies OSB
Sakrament des gegenwärtigen Augenblicks. „Caussades“ Alltagsmystik in theologischer Relecture II
Michael Höffner
Auf der Spur des homo religiosus. Zur spirituellen Verortung von Bergexerzitien
Ulrich Hörwick
„Erscheitert“ Gott? Kenosis und Kunst bei Klaus Hemmerle
Bernd Aretz
Lektionen aus christlicher Mystik
Rob Faesen SJ
Nachfolge | Kirche
Die Bologna-Entführung. Ein Krimi über Vertrauen als dialogische Ressource
Andrea Schmuck
Kanonische Weisheit. Von der Spiritualität des Kirchenrechts
Daniel Tibi OSB
Nachfolge | Junge Theologie
Der Exodus als Streitgeschichte
Wolfgang Sigler OSB
Reflexion
„Alles ist durch das Wort geworden“. Zugänge zur Lehre von der Schöpfungsmittlerschaft
Christoph J. Amor
Verwandelndes Sprechen. Sprache als geistlicher Weg bei Eugen Rosenstock-Huessy
Marc Pauly
Innovatives Mittelalter
Siegfried Ringler
Geschichte und Theologie treiben mit Michel de Certeau (1925-1986)
Philippe Lécrivain SJ
Lektüre
Buchbesprechungen
Impressum
GEIST & LEBEN – Zeitschrift für christliche Spiritualität. Begründet 1926 als Zeitschrift für Aszese und Mystik
Erscheinungsweise: vierteljährlich
ISSN 0016–5921
Herausgeber:
Zentraleuropäische Provinz der Jesuiten
Redaktion:
Christoph Benke (Chefredakteur)
Dieter Fugger (Redaktionsassistenz)
Redaktionsbeirat:
Margareta Gruber OSF / Vallendar
Stefan Kiechle SJ / Frankfurt
Bernhard Körner / Graz
Edith Kürpick FMJ / Köln
Ralph Kunz / Zürich
Jörg Nies SJ / Stockholm
Andrea Riedl / Regensburg
Klaus Vechtel SJ / Frankfurt
Redaktionsanschrift:
Pramergasse 9, A–1090 Wien
Tel. +43–(0)664–88680583
Artikelangebote an die Redaktion sind willkommen. Informationen zur Abfassung von Beiträgen unter www.echter.de/geist-und-leben/. Alles Übrige, inkl. Bestellungen, geht an den Verlag. Nachdruck nur mit besonderer Erlaubnis.
Werden Texte zugesandt, die bereits andernorts, insbesondere im Internet, veröffentlicht wurden, ist dies unaufgefordert mitzuteilen. Redaktionelle Kürzungen und Änderungen vorbehalten. Der Inhalt der Beiträge stimmt nicht in jedem Fall mit der Meinung der Schriftleitung überein. Für Abonnent(inn)en steht GuL im Online-Archiv als elektronische Ressource kostenfrei zur Verfügung. Nichtabonnent(inn)en können im Online-Archiv auf die letzten drei Jahrgänge kostenfrei zugreifen. Registrierung auf www.geist-und-leben.de/.
Verlag: Echter Verlag GmbH,
Dominikanerplatz 8, D–97070 Würzburg
Tel. +49 –(0)931–660 68–0, Fax +49– (0)931–660 68–23
[email protected], www.echter.de
Visuelle Konzeption: Atelier Renate Stockreiter
E-Book-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim, www.brocom.de
Bezugspreis: Einzelheft € 13,50
Jahresabonnement € 45,00
Studierendenabonnement € 30,00
jeweils zzgl. Versandkosten
Vertrieb: Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder direkt beim Verlag. Abonnementskündigungen sind nur zum Ende des jeweiligen Jahrgangs möglich.
Auslieferung: Brockhaus Kommissionsgeschäft GmbH, Kreidlerstraße 9, D–70806 Kornwestheim
Auslieferung für die Schweiz: AVA Verlagsauslieferung AG, Centralweg 16, CH–8910 Affoltern am Alibs
eISBN: 9783429067977
NNachfolge
R
L
N
Raphaela Brüggenthies OSB | Rüdesheim am Rhein
geb. 1980, Dipl.-Theol., Dr. phil., Ordensschwester der Benediktinerinnenabtei St. Hildegard, Rüdesheim
Vigil
Das Chorgestühl ist über hundert Jahre alt. Die Gebrauchsspuren machen es wertvoll. Das Holz ist durchbetet, es atmet Klage und Dank, es ist eingespielt wie eine alte Geige. Der Verlauf der Maserung ist wellenförmig, eine topographische Karte mit Höhenlinien für den spirituellen Aufstieg. Durchkreuzt wird diese natürliche Bewegung nur durch aufwendige Schnitzereien.
Gut hundert Personen hätten hier Platz, so viele Stallen und auch Zellen gibt es, doch nur noch knapp dreißig Ordensschwestern leben an diesem Ort, zurückgezogen, im beständigen Rhythmus von Gebet und Arbeit. Das große Klostergebäude, in dem die immer weniger werdenden Schwestern bis zu ihrem Tod einander aushalten und verzeihen, wächst ihnen über den Kopf. Etwa fünfzehn können noch zu den Gebetszeiten kommen. Noch. An jeder Ecke nimmt man dieses kleine, gnadenlose Wort in den Mund. Es zählt an und rechnet ab. Was ist das für ein Leben, wenn man bloß in den Kategorien von „noch“ und „nicht mehr“ über sich spricht? Als gäbe es keine Zukunft, und als wäre die Gegenwart schon längst vergangen. Meine Seele klebt am Boden!
Das Ordensleben in Westeuropa geht zurück wie die Gletscher der Alpen. Langsames Sterben eines Jahrtausende alten Biotops. Eine religiöse Landschaft schmilzt wie Eiscreme in der Sonne. Die Folgen dieser Krise sind nicht abzusehen, aber niemand klebt sich deshalb auf die Straße. Man inventarisiert und katalogisiert, um zu sichern, was längst im Verschwinden ist. Das Leben wird museal und gleicht einer Violine ohne Resonanzkörper.
Schweig doch nicht!
Es ist Mittwochabend und es wird die Vigil, die nächtliche Gebetswache, gesungen. Es ist kurz nach halb acht und es fallen letzte Sonnenstrahlen durch die hohen Opalglasfenster in die fast menschenleere Kirche. Gefiltertes Licht aus der Höhe. Früher seien die Nonnen und Mönche zu den Vigilien noch in der Nacht aufgestanden. Früher. Heute gehe das nicht mehr. Geblieben sind die Texte: 150 Psalmen, die Woche für Woche, Tag für Tag wiederholt werden. Stete Wiederkehr des Gleichen. Ganz ohne Publikum. Einer höre zu.
Wie ein Neugeborenes wiegen die Schwestern die Psalmworte hin und her, hin und her, und kommen mir dabei selbst wie wiegende Ähren vor, hin und her, in endlos verschwendeter Zeit. Der Wiegegesang wirkt auf mich beruhigend wie heiße Milch mit Honig, verschwebend im Lärm meiner inneren Welt.
Doch heute Abend erklingt Geschrei, Scheiben klirren und Feuer bricht aus. Tobende Feinde kommen zu Wort, die sagen: Wir wollen sie ausrotten als Volk; an den Namen Israel soll niemand mehr denken. Die Worte wiegen beständig hin und her, hin und her, völlig unaufgeregt. Wie hat man diese Psalmen wohl am Abend des 9. November 1938 (auch ein Mittwoch) einander zugerufen, gedeutet, an sich herangelassen, gemeinsam gen Himmel geschaukelt? Ich kann es nicht begreifen. Wie haben Christen diese Texte gelesen, sie an den Gott der Juden gerichtet, ihm in den Ohren gelegen in ihren sonnendurchfluteten Nachtgebeten mit diesem ausgeliehenen Weh: Warum, warum, wie lange noch?
Plötzlich durchfährt es mich. Es ist Mittwoch, wenige Tage nach dem 7. Oktober 2023, und mein Wiegen und Gewiegt-Werden bricht abrupt ab. Der fremde Psalm stellt mich zur Rede, er erwartet eine Antwort von mir, hier und jetzt, sonst bräuchte ich ihn nicht zu erinnern, zu beten. Ich singe weiter und bleibe stumm. Auch der Bundestag stellte heute Morgen dem Terror eine Schweigeminute entgegen. Stummes Gedenken bei Sonnenschein. Im Schatten des Reichstags wiegt ein Kornfeld. O Gott, bleib nicht still!
Damit das kommende Geschlecht davon erfahre
Die Wände rings um das Chorgestühl waren früher ausgemalt. Ganz ohne Worte schiffte die Arche Noah durch die Heilsgeschichte bis unter das Kreuz – und wieder zurück. Theologische Programmatik in Fresken: Flut ruft der Flut zu beim Tosen deiner Wasser. Selbst ungläubiges Schauen wurde erhoben in die Wohnungen dieses himmlischen Jerusalems. Civitas Dei. Für jeden sei Platz in diesem friedlichen Gottesstaat, heißt es.
Ende der 1960er Jahre hatten die Schwestern sich sattgesehen an den einzigartigen Malereien, den mutigen Frauen, die rings um den Altar standen: Eva, Sarah, Rebecca, Esther, Ruth, Judith, Abigail, Jaël und Sulamith. Man übertünchte sie, tünchte, tünchte und übertünchte. Wisch und weg. Was für ein unsolidarisches Geschlecht! Auch die Vätergeneration tünchte, die Nachkriegsgeneration tünchte, die nachkonziliare Generation tünchte. Übertünchtes Bewusstsein, übertünchte Begierde, übertünchtes Begehren. Weiße Tünche wie unschuldige Milch. Heute schaut man auf Wände, die der Dreck der Jahre schwarz gefärbt hat. Hier und da blättert Putz ab und legt Fragmente frei – das übertünchte Haar Sulamiths und Ruths goldene Garben.
Eine Restaurierung wäre möglich, geht aber in die Millionen. Der erste Eimer Farbe kostete damals nur knapp 30 DM. Was bleibt im Gedächtnis von diesen billigen Zeiten des Tünchens und Übertünchens – hier und überall? Tünche über Tünche. Wasche mich, dann werde ich weißer als Schnee. Wer bezahlt dafür? Es gibt immer jemanden, der nicht bezahlt hat und einfach die Schulden vererbt, von Generation zu Generation.
Säume nicht!
Ich bin eine von ihnen. Eine von diesen plus/minus Fünfzehn. Die letzte Generation. Seit fast zwanzig Jahren komme ich mehrmals täglich in dieses Chorgestühl. Zum Beten, meistens aber nur zum Schweigen und Schauen ins Leere. Jede hat hier ihren festen Platz, aber seit einiger Zeit suche ich immer häufiger nach meinem. Ich finde ihn nicht mehr. Auch nach zwei Jahrzehnten Klosterleben gehöre ich noch immer zu den Jüngsten. Forever Young. Das ist mehr Fluch als Segen und Stoff für Romane. Manchmal stehle ich mich heimlich davon, schlüpfe in endlose Sommer und suche den Trost der Schönheit. Man kann in einem Leben in Gemeinschaft sehr einsam sein. Heillos verloren unter vertrauten Fremden. Dornengemeinschaft. Der Schmerz relativiert sich, wenn man sich selbst verlieren kann – oder besser: anheimgeben ohne Zögern.
Das Chorgestühl ist noch nicht alt, es ist im Vergleich noch relativ jung, aber es ist alt genug, dass man nichts mehr daran verändern darf. Es muss so bleiben, wie es ist. Hundert Plätze für Fünfzehn. 6,7 Plätze pro Person, Tendenz steigend.
Wir hängten unsere Harfen an die Weiden in jenem Land
Ich fahre mit dem Zug am Rhein entlang und lese Heines „Rabbi von Bacherach“. Ich bin die Einzige im Abteil, die ein Buch liest. Vor meinem Fenster spielt sich ab, was ich lese – Rhein in Flammen der anderen Art: das perfide Ineinander von Judenvernichtung und Kirchenerrichtung. Verdunkelung des Geistes. Seit mit Kain und Abel das Töten begann, hört es nicht mehr auf. Die Verfolger regenerieren sich ununterbrochen.
Die Sonne blendet mich, und an der nächsten Haltestelle mischt sich auch noch ein AfD-Plakat in die Handlung ein. „Heimat bewahren“, so der Slogan, der sich ausgerechnet über eine Panoramaaufnahme von Oberwesel zieht. Deutschnationale Rheinromantik steht wieder in Blüte. Hinter dem Plakat, auf der anderen Rheinseite, kann man das Original sehen. Eine kleine Gruppe deutscher Touristen zückt, da wir noch stehen, schnell das Handy und macht Fotos von der idyllischen Heimat, von der gotischen Ruine und ihren langen spitzbogigen Fenstern, und weiß doch nichts von ihrem Ursprung und dem vergossenen Blut.
Ich halte mich an Heine fest und rolle das gelbe Reclam-Bändchen in meinen Händen hin und her, als wollte ich eine Flüstertüte basteln. Ich könnte schreien, aber ich wechsele bloß meinen Platz. Ich setze mich demonstrativ gegen die Fahrtrichtung, und als der Zug sich wieder in Bewegung setzt, sehe ich, wie das Wahlplakat immer kleiner und kleiner wird und bald ganz verschwunden ist. „Rechtskurven sind gefährlich, weil man da leicht in den Gegenverkehr gerät“, brüllt ein Junge im Stimmbruch durch den Zug. Gefährlich für wen?, denke ich. Er und seine Kameraden lernen für den Führerschein. Hitler hatte keinen.
Sammle meine Tränen in einem Krug
Mit dem Platzwechsel sitzt mir nun eine Frau gegenüber, die mich erst kritisch mustert und dann sanftmütig anlächelt. Sie trägt eine altmodische Strickjacke, die ihr viel zu klein ist, vermutlich ein Erbstück. Irgendwann beginnt sie zu weinen, und ich reiche ihr ein Taschentuch. Ich erlebe das immer wieder, dass mein Ordenskleid solche Dammbrüche auslöst und fremde Menschen zum Weinen bringt. Mir reicht das Wasser schon bis an die Kehle. Ich schreibe diese Szene meinem Ordenskleid zu, und nicht mir, die in ihm steckt, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Tränen und Bekenntnisse provoziere, die mich gar nichts angehen.
Mein schwarzes Kleid mit dem kleinen weißen Kragen ähnelt dem Trikot eines Schiedsrichters. Vielleicht ist es das: Man denkt, ich sei unparteiisch, irgendwie neutral in jeder Hinsicht. So, wie ich ja auch keine Frau bin, jedenfalls keine richtige. Als Ordensschwester ist man ein interessantes Neutrum. Unisex. Ein Schiedsrichter darf nicht mitspielen, aber ohne ihn kein Spiel.
Das, was ich trage, weckt Erinnerungen, während ich, die es trägt, austauschbar bin. Sie werfen das Los um mein Gewand. Wer bin ich ohne dieses Kleid? Und was ist dieses Kleid ohne mich? Wer würde beim Anblick eines herrenlosen Kleides anfangen zu weinen?
In Nächten ohne Schlaf träume ich oft von Wanderungen durch hellgrüne Wälder. Es drängt mich vorwärts, aber mit jedem Schritt, den ich tue, werde ich kleiner, während meine Kleidung wächst und wächst. Statt ins Bodenlose zu fallen, verstricke ich mich in tausenderlei Fasern, werde eingewickelt wie in einen Kokon, verschwinde in fädiger Finsternis ohne Aussicht, aufzuwachen. Die Nacht leuchtet wie der Tag.
Zu groß gewordene Kleider gehen vom Saum her kaputt und fransen aus. Ich bin noch nicht alt genug, dass sich nichts mehr verändern darf. Ich will nicht bloß vom Saum her verschleißen, sondern ganz. Warmer Waldboden erdet. Ich werde aufbrechen.
Wie ein gestilltes Kind bei seiner Mutter
Vielleicht weint die Frau auch über etwas anderes. Vielleicht weint sie über den Soldaten, der neben mir sitzt und schläft. Nur seine Augenlider flackern und finden keine Ruhe. Was mag sich hinter ihnen abspielen? Was mag vor ihnen geschehen sein? Als er aufwacht, holt er einen Milchshake aus seinem Rucksack und durchsticht mit einem Strohhalm gefühllos die Verschlussfolie, sodass ein großer Schwall Milch über seine trockenen Hände läuft und sie tränkt. Was mag er schon alles auf diese Weise durchstoßen haben?, denke ich. Milch löscht die Erinnerung, habe ich irgendwo einmal gelesen, aber dieser Soldat ist viel zu jung, um vergessen zu müssen. Er könnte der Sohn der Frau sein – natürlich, nur eine Mutter weint. Ich gebe dem Soldaten ein Taschentuch für sein verschüttetes Gedächtnis. Seine Mutter fragt mich, wie ich heiße. Er ruft sie alle mit Namen.
Als ich am Abend zur Vigil gehe und wieder meinen Platz suche, sitzen die Frau und der Soldat bereits im Chorgestühl und nicken mir zu, als wären sie schon immer dagewesen. Ich schaue auf die getünchten Wände.
Das Chorgestühl wird man erhalten, schon allein aus kunsthistorischen Gründen.
N
Michael Höffner | Münster
geb. 1971, Dr. theol. habil., Professor für Theologie der Spiritualität an der PTH Münster und am CTS Berlin
Sakrament des gegenwärtigen Augenblicks
„Caussades“ Alltagsmystik in theologischer Relecture II*
Hingabe als „Mobilität der Seele“
Der kleine, in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstandene Traité Abandon à la Providence divine ermutigt die Lesenden, sprachlich durchaus provokant, den gegenwärtigen Augenblick jeweils als Sakrament zu empfangen. Das geschieht in der Haltung der Hingabe. Hingabe umschreibt eine Lebenshaltung, die dem gegebenen, konkreten Augenblick nicht mit Reserve oder sogar Widerstand entgegentritt, sondern zunächst mit einer behutsamen Anheimgabe. Der Mystikforscher Alois Haas hat im Blick auf Johannes Taulers „Arbeit der Nacht“ die Relevanz solcher Offenheit betont: „Es müssen sich die seelischen und psychosomatisch gegebenen Verspannungen verhärten, wo solche Gelassenheit keine Chance hat.“1 Dieser Gedanke lässt sich auch auf „Caussade“ ausweiten. Um diese Mobilisierung oder Mobilität geht es zentral in der dritten Gestalt der Hingabe, bei der sich an den Formulierungen ablesen lässt, dass für sie das Herzblut des Autors/der Autorin fließt. Ausdrücklich ist von einer „mobilité d’âme au souffle de la grâce“ (126) die Rede, also einer Beweglichkeit, Flexibilität oder Formbarkeit der Seele für das Atmen der Gnade. Abandon, Hingabe, steht für eine Haltung, die zunächst in innerer Flexibilität und Empfänglichkeit entgegennimmt, was geschieht, mit dem Vorschussvertrauen, dass es sich um eine Gegenwartsgestalt des Heiligen handelt. Abandon ist das vom Vertrauen in Gottes wohlwollend-wirkender Präsenz getragene Wagnis, sich dem gegenwärtigen Moment zu öffnen, sich einzulassen auf das Dunkel des gelebten Augenblicks.2 Als dessen Kehrseite bedeutet Hingabe, einen selbstmächtig-kontrollierenden Zugriff zu lassen (laisser faire Dieu!) – was ein Moment bejahter und angenommener Ungesichertheit einschließt. Nicht von ungefähr charakterisiert „Caussade“ abandon als aventure, als Abenteuer. Es geht um einen Lebensstil, der sich mitten in allem Tun und Lassen gelöst einer vorgängigen und begleitenden Gnade anvertraut, sich im Dunkel des gelebten Augenblicks von Christus, dem Beispiel der Hingabe, mitziehen lässt und der aventure einer Inspiration durch den Gottesgeist überantwortet.
Der Begriff der Hingabe ist historisch gewiss nicht unbelastet, besonders für Frauen, von denen häufig eine Hingabe bis zur Selbstaufgabe erwartet wurde. Allerdings hat der Philosoph Martin Scherer3 den Begriff jüngst auf erfrischende Weise entstaubt und rehabilitiert. In Hingabe stecke auch der Flow, das Gelöstwerden aus einer Überkontrolle; jemand lässt sich bereitwillig davontragen von etwas bzw. jemand Anziehendem. Hingabe birgt damit eine unübersehbar erotische Komponente4 – was sich im Traité auch darin zeigt, dass sie verknüpft ist mit der Brautmystik des alttestamentlichen Hohenliedes.
Die ignatianische Blickweitung
Vor diesem Hintergrund ermutigt „Caussade“ in immer neuen Anläufen, sich mit dem gegenwärtigen Augenblick zufrieden zu geben (53, 121, 134, 155, 157, 158) und ihn als Sakrament zu betrachten, als „Ort“, wo Gott Begegnung feiern will. Auch wenn Madame Guyon5 und andere bereits in diese Richtung denken und ihr Rat zur Treue gegenüber dem gegenwärtigen Moment nichts Außergewöhnliches ist6, ist die Begriffsprägung originell und die Gedankenführung „Caussades“, was die Breite der thematischen Entfaltung und die begriffliche Zuspitzung angeht, doch einzigartig. Hier hat ignatianische Spiritualität entscheidende Spuren hinterlassen, näherhin die Maxime, Gott zu suchen und zu finden in allen Dingen.7 Ignatius hat damit ein religiöses Ideal entworfen, „dessen Fruchtbarkeit […] weit über die Gesellschaft Jesu hinausstrahlt.“8„Caussade“ schließt sich dieser „ignatianischen Blickweitung“ an, die sich löst von einem sektoriellen Verständnis von Spiritualität, sie auf alle Sphären des Lebens ausdehnt und so zu einer organischen Sicht des Menschen und der Welt wird. Josef Stierli fasst die dieser Maxime zugrunde gelegte theologische Option in vier Punkten zusammen: Alle Dinge werden als Gaben Gottes und seiner Liebe gesehen (1); in diesen Gaben ist der Geber gegenwärtig (2), und zwar als tätiger Gott wirkend (3), so dass alle Dinge in ihrem immerwährenden Ausgang von Gott wahrgenommen werden wollen (4).9 Auf diese Weise werden alle religiössäkularen Dualismen aufgelöst. Schöpfer und Geschöpf stehen in keinem Konkurrenzverhältnis. Spirituelle Erfahrung ist nicht darauf beschränkt, dass ein bestimmter, religiös bedeutsamer Gegenstand neben anderen, religiös irrelevanten Gegenständen ausgemacht und entdeckt wird10, sondern auch Inhalte profaner Erfahrung können eine spirituelle Tiefendimension aufweisen. Ignatius präsentiert so eine Mystik gläubiger Weltzuwendung: In allem Bedingten kann das Unbedingte miterfahren werden. Indem unser Klassiker – zweifellos provokant11 – die überlieferte Sichtweise aufbricht und vom „Sakrament des gegenwärtigen Augenblicks“ spricht, schließt er sich an diese ignatianische Mystik und ihre theologischen Begründungen an. Weil alles in Gott betrachtet und sogar liebkost (166) werden soll, zeigt sich die Gottesbeziehung und Gottesliebe als inklusiv. Damit scheint ein Schritt unternommen hin zu einer Überwindung des Stockwerkdenkens von Natur und Gnade. Zugleich wagt „Caussade“ beherzt einen Schritt heraus aus einer einseitigen Innenorientierung der Spiritualität hin auf die „äußere“ Wirklichkeit. Während ein Thomas von Kempen noch raten konnte: „Lerne, was äußerlich ist, verschmähen, und gib Dich Deinem Innern hin“12, weitet „Caussade“ demgegenüber markant den Blick und würde formulieren: ‚Lerne Dich auch Deiner Außenwelt, Deiner Situation hinzugeben bzw. dem Gott, der Dir darin begegnen möchte – und nicht nur im Rückzug in Deine Innerlichkeit.’
Die zugrundeliegende Vorsehungslehre …
Diese Rede vom Sakrament des gegenwärtigen Augenblicks ist theologisch unterfangen von der Vorsehungslehre. Es geht um Hingabe an die Vorsehung, wie schon der Titel verrät. „Caussade“ bleibt, was die Vorsehung betrifft, ganz in der Spur des Thomas von Aquin und der Schultheologie. Thomas begreift Vorsehung als „im Geiste Gottes bestehenden Plan der Hinordnung der Dinge auf ihr Ziel“, das im ewigen Heil bzw. im ewigen Leben und damit im Glück des Menschen besteht.13 Darin plane Gott alles unmittelbar (immediate)14, bis hinein in kleinste Dinge, beziehe allerdings aus Güte bei der executio, der Ausführung des Plans, geschöpfliche Ursachen mit ein und gebe ihnen Anteil an der dignitas causalitatis15, so dass sie als providentiae participes16 für sich selbst und andere vorsehen als können. Aber auch inmitten dieser Inklusion menschlicher Freiheit erreiche der Wille Gottes souverän und unfehlbar sein Ziel und könne nicht vereitelt werden.17 Insofern ist für Thomas „jedes konkrete Schicksal umfangen von Gottes Vorsehung.“18
Diese Spur nimmt „Caussades“ Schrift auf. So heißt es, Gott lasse unfehlbar (!) beim Menschen ankommen, was für ihn das Beste ist.19