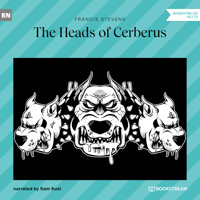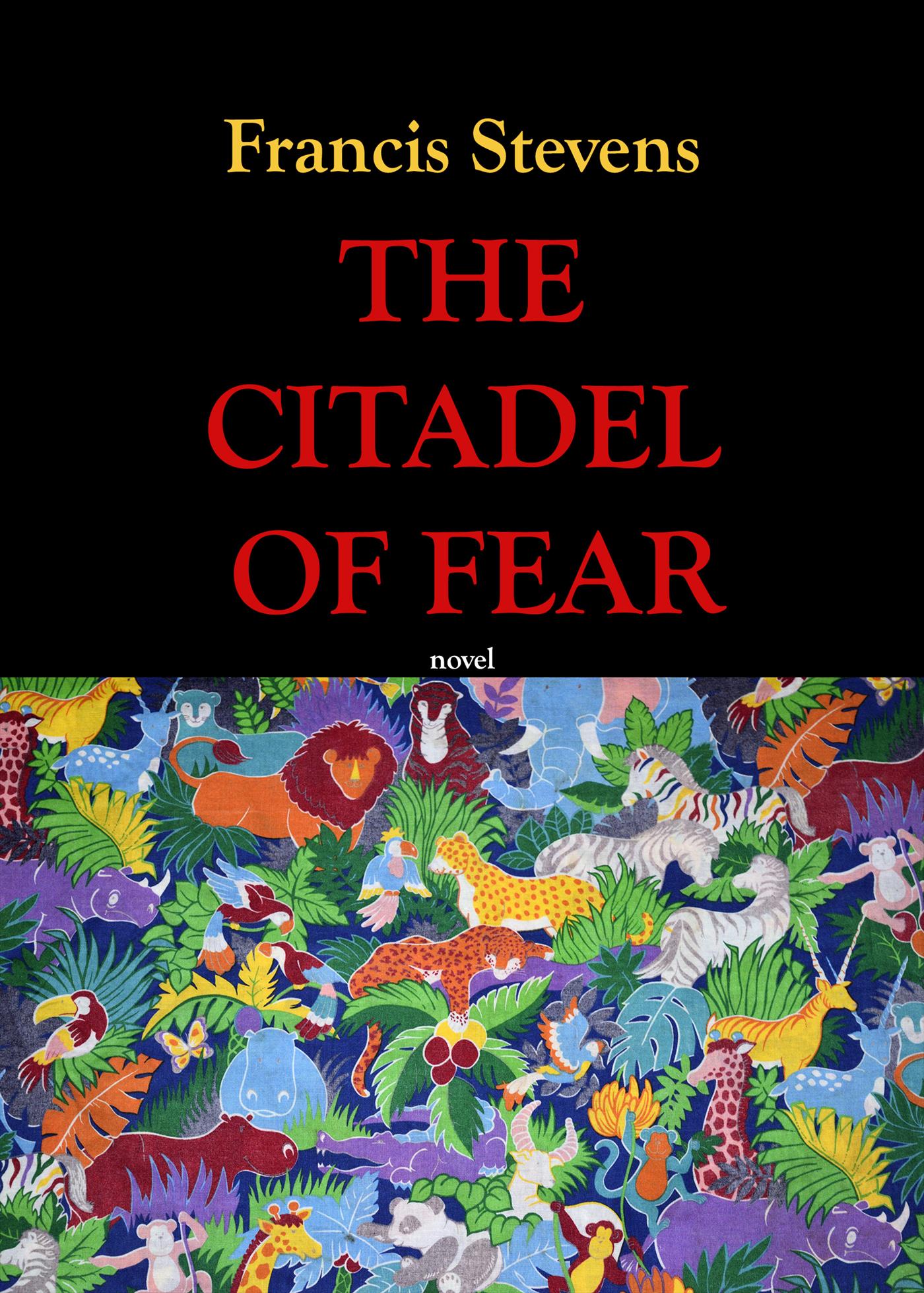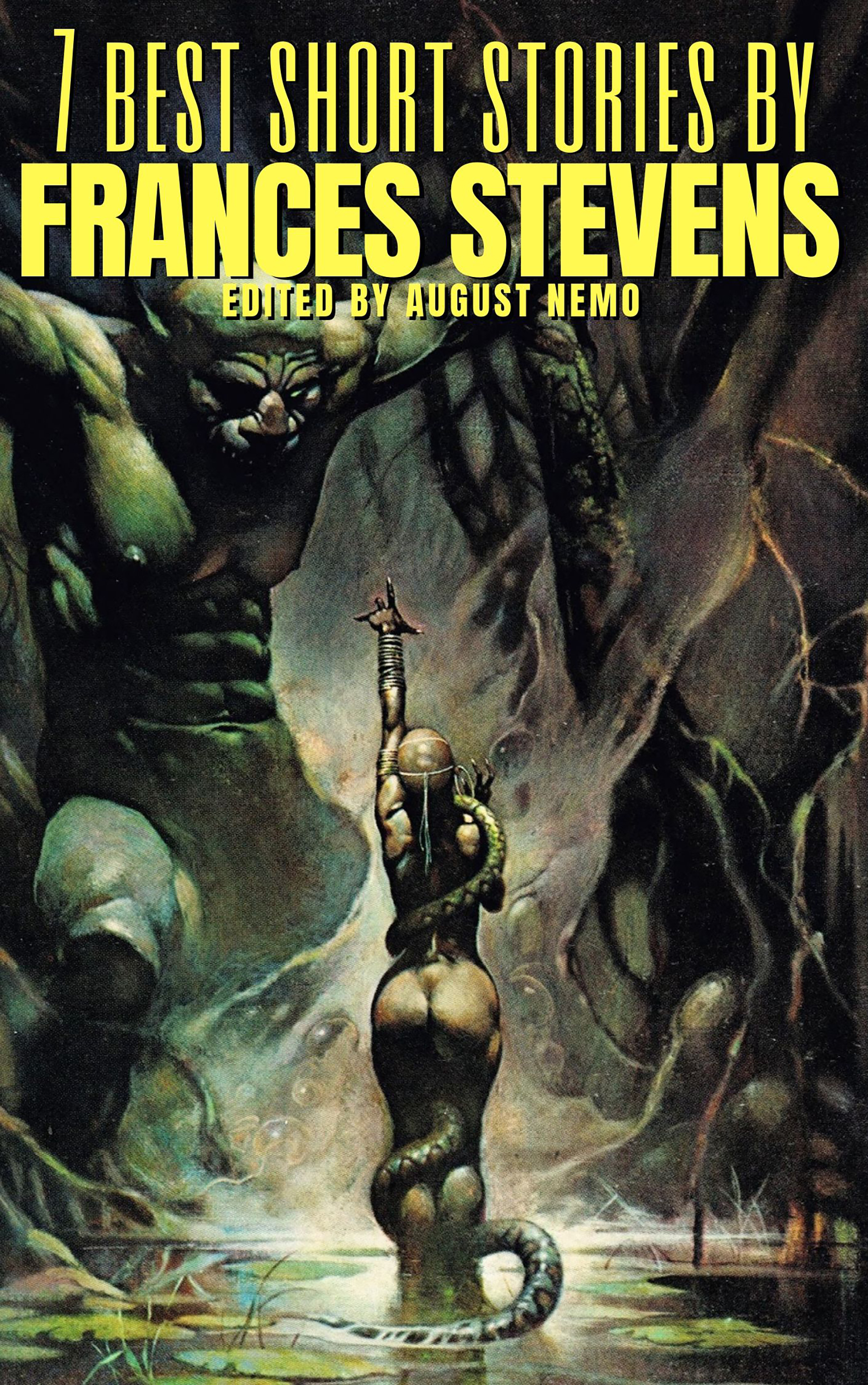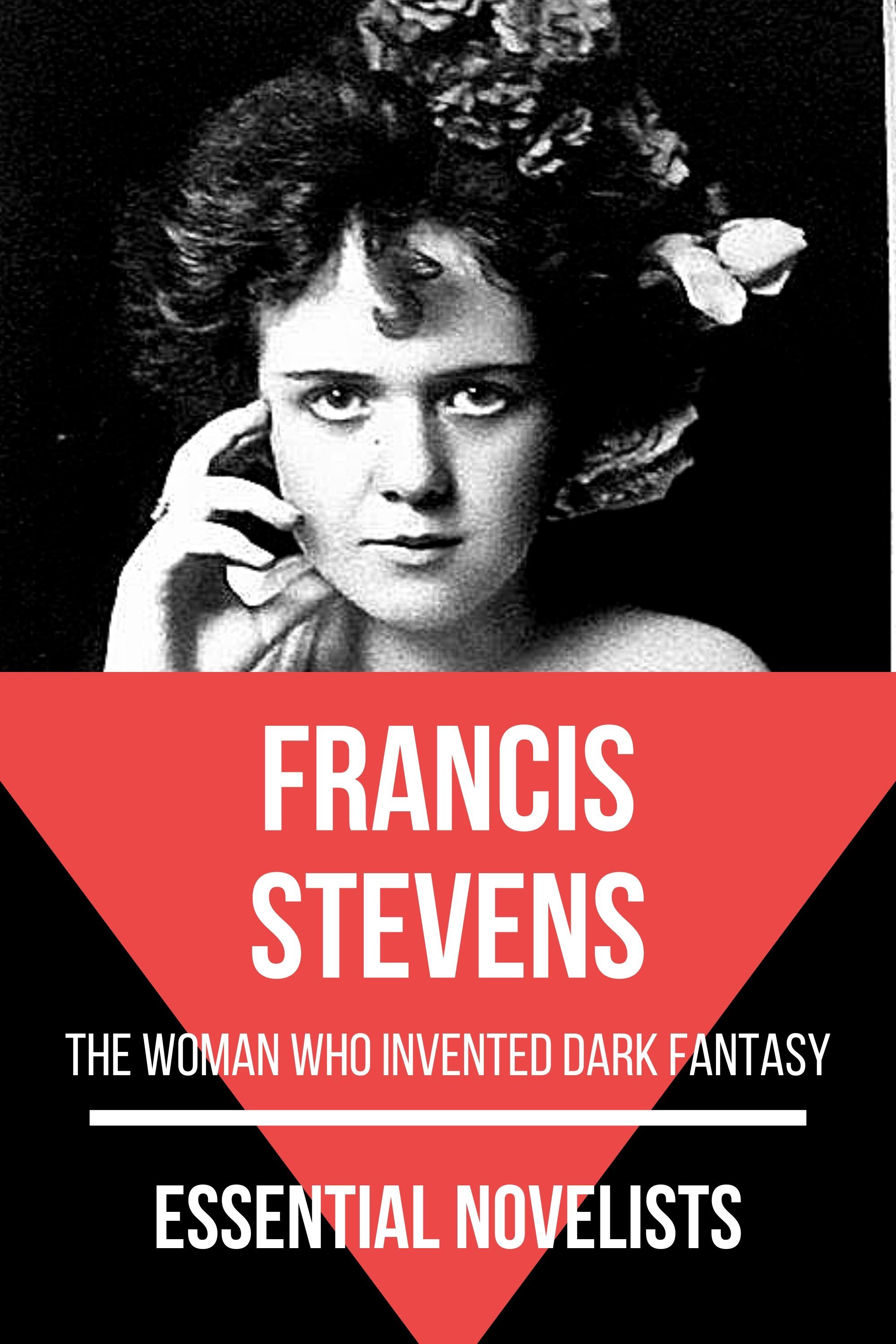Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Romane: Der Ruf des Totenbeschwörers (Klaus Frank) Dämonentöter (Steve Salomo) Das Rätselhafte Artefakt (Francis Stevens) Sandy Rendall wälzte sich unruhig in ihrem Bett hin und her. Sie stöhnte. Es war ein ängstliches, furchtsames Stöhnen. Sie sah sich durch einen Wald rennen. Es war hell, und doch war es nicht Tag. Es war eine eigenartige Dämmerung, die aber nicht zwischen Tag und Nacht lag. Ein Zustand, den es in der realen Welt nicht gab. Sie fühlte sich verfolgt, sie wusste, dass er hinter ihr her war. Sie lief keuchend, mit klopfendem Herzen. Sie hatte Angst. Furchtbare Angst. Aber sie wünschte sich auch, dass er sie einholen würde. Sie sehnte sich danach, in seinen starken Armen zu liegen. Sie wünschte sich, seine warmen, zärtlichen Lippen auf den ihren zu spüren, seine verlangenden Berührungen auf ihrem Körper. Plötzlich schreckte das sechzehnjährige Mädchen zusammen! Vor ihr tauchte er auf, aus einem dichten, schimmernden Nebel. Eine hoch gewachsene Gestalt, gekleidet in einen langen, nachtschwarzen Umhang.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus , Francis Stevens, Klaus Frank
Geister Fantasy Dreierband 1008
Inhaltsverzeichnis
Geister Fantasy Dreierband 1008
Copyright
Der Ruf des Totenbeschwörers: Phenomena 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Dämonentöter
Das rätselhafte Artefakt
Geister Fantasy Dreierband 1008
Francis Stevens, Klaus Frank, Steve Salomo
Dieser Band enthält folgende Romane:
Der Ruf des Totenbeschwörers (Klaus Frank)
Dämonentöter (Steve Salomo)
Das Rätselhafte Artefakt (Francis Stevens)
Sandy Rendall wälzte sich unruhig in ihrem Bett hin und her. Sie stöhnte. Es war ein ängstliches, furchtsames Stöhnen. Sie sah sich durch einen Wald rennen. Es war hell, und doch war es nicht Tag. Es war eine eigenartige Dämmerung, die aber nicht zwischen Tag und Nacht lag. Ein Zustand, den es in der realen Welt nicht gab. Sie fühlte sich verfolgt, sie wusste, dass er hinter ihr her war. Sie lief keuchend, mit klopfendem Herzen. Sie hatte Angst. Furchtbare Angst. Aber sie wünschte sich auch, dass er sie einholen würde. Sie sehnte sich danach, in seinen starken Armen zu liegen. Sie wünschte sich, seine warmen, zärtlichen Lippen auf den ihren zu spüren, seine verlangenden Berührungen auf ihrem Körper.
Plötzlich schreckte das sechzehnjährige Mädchen zusammen!
Vor ihr tauchte er auf, aus einem dichten, schimmernden Nebel. Eine hoch gewachsene Gestalt, gekleidet in einen langen, nachtschwarzen Umhang.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
COVER WERNER ÖCKL
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags geht es hier
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
Der Ruf des Totenbeschwörers: Phenomena 1
von Klaus Frank
Der Umfang dieses Buchs entspricht 126 Taschenbuchseiten.
Aus dem Innendienst des Verfassungsschutzes in eine neue Aufgabe bei einer bislang unbekannten Organisation, der IPA, auch Phenomena genannt. Ben Fuller weiß noch nicht, ob er richtig gehandelt hat, doch gleich sein erster Fall verlangt ihm alles ab. Jemand hat den Geist eines Massenmörders beschworen, und dieser Geist mordet in Gestalt lebender Menschen weiter.
1
Eva Kaulmann erwachte von einer Sekunde zur anderen aus ihrem tiefen Schlaf. Wie weggewischt war der belanglose Traum – Gärten, in der Sonne blitzende Seen, Kindergelächter –, der durch ihren Kopf gezogen war. Sie riss die Augen auf und blickte verstört in die Dunkelheit, welche sie umgab. Einen beängstigenden Augenblick lang fühlte sie sich vollkommen desorientiert und wusste nicht, wo sie war. Vielleicht doch noch im Traum gefangen, der ihr nun seine dunkle Seite präsentierte, wo es kein Gelächter mehr gab? Sie blickte umher, doch sie sah lediglich vage konturlose Schemen. Es waren die ihr ansonsten verhassten Schnarchgeräusche ihres Mannes Georg, die Eva halfen, Ordnung in ihre verwirrten Sinne zu bekommen. Ganz klar, jetzt wusste sie es wieder: Sie befand sich in ihrem eigenen Bett; ihre linke Hand war in das Laken verkrallt, als wäre es das Übel des Schreckens, den sie empfand.
Sie atmete auf, aber das Gefühl der Erleichterung verpuffte sofort wieder. Mit ihrem Kopf schien etwas nicht zu stimmen; es fühlte sich an, als sei er von rostigem Draht umfasst, dessen Schlingen immer enger gezogen wurden. Genau in der Mitte ihres pochenden Hirns hockte ein schlimmer Schmerz, der ihren Körper fühllos für alle anderen Reize zu machen schien.
Manchmal litt sie unter Migräne, aber das hier war eine gänzlich andere Erfahrung.
Und plötzlich hörte Eva Kaulmann die Stimme. Sie saß in ihrem Kopf, stellte sie fest; vermutlich war sie bereits die ganze Zeit dort gewesen, nur hatte sie das in dem Wust ihrer schmerzhaften Empfindungen nicht erkannt. Nicht nur Worte, sondern nun auch Bilder, die sich hinzugesellten. Bilder aus der Hölle, so schien es ihr. Sie sah Blut und Leiber, die es voller Ergebenheit verspritzten. Sie sah offene Münder, die gellende Schreie ausstießen, sah zerschlitzte Körper und tote Augen. Nichts als Verderbnis, Tod und Zorn.
Eva Kaulmann atmete heftig. Sie blickte hinüber zu Georg, der von alldem nichts mitbekam. Sie wollte ihn wecken, als ihr noch etwas klar wurde. In ihrer rechten Hand, die unter der Bettdecke verborgen war, befand sich ein Gegenstand. Zaudernd lupfte sie die Bettdecke an und wagte einen scheuen Blick. Ein Schluchzen drang aus ihrer Kehle, als sie vage das Messer erkannte, das sie fest umpackt hielt. Wie kam es dorthin? Diese Frage war genauso unerlässlich wie jene nach der bösartigen Stimme in ihrem Schädel. Beides hing miteinander zusammen.
Und als hätte die Stimme nur darauf gewartet, dass Eva das Messer entdeckte, wurde sie lauter und drängender. Sie spürte, wie ihr eigener Wille in die Ecke gedrängt wurde, als sei er ein Kaninchen im Käfig voller Schlangen. Jetzt war nur noch Raum für diese brutal klingende, leicht näselnde Stimme, die ihr nun Befehle erteilte, welche nicht zu missverstehen waren.
Töte!, sagte sie. Immer wieder: Töte!
Eva blickte auf das Messer, dessen Klinge unheilvoll und unglaublich scharf wirkte; das erkannte sie selbst in der Dunkelheit.
Der Horror, den sie empfand, überstieg die Grenze des Erträglichen. Ihre rechte Hand zitterte leicht, die Klinge des Messers darin vibrierte, und Eva fügte sich unbeabsichtigt eine kleine Schnittwunde am Oberschenkel zu. Sie sah das Blut nicht, aber ihre verstörenden Gedanken reagierten sofort darauf und brüllten und tobten in ihrem Schädel, der zu platzen drohte. Eva schloss die Augen, aus denen Tränen rannen, und schüttelte den Kopf. Sie glaubte, den Verstand zu verlieren. Ein leises Wimmern entfuhr ihr.
Neben ihr regte sich Georg und fuhr stöhnend in die Höhe. »Was ist denn?«, fragte er mit verschlafener Stimme. »Hattest du einen Alptraum?« Er streckte seine Hand aus und berührte die Schulter von Eva, die erschrocken zusammenzuckte, als sei ihr Mann der Feind, den es zu fürchten galt.
»Ich …«, stieß sie aus, doch mehr als ein Krächzen wollte ihr nicht gelingen. Ihr Gesicht war tränenüberströmt, ihre Lippen bebten. Sie räusperte sich und setzte nochmals an. »Er sagt, ich muss dich töten.«
2
Einige Sekunden lang herrschte Schweigen im behaglich-dunklen Schlafzimmer der Kaulmanns. Von fern hörten sie zwei Kirchen, die beinah gleichzeitig die volle Stunde schlugen. Mechanisch zählte Georg Kaulmann die Glockentöne mit, während er mit verwirrter Miene zu seiner Frau hinüberblickte. Es war drei Uhr morgens; eine Zeit, in der er sich lieber mit schöneren Träumen beschäftigen wollte.
Was hatte Eva da gesagt? Das war doch verrückt. Nichts deutete daraufhin, dass sie sich einen Scherz erlaubt hatte, der auch allzu geschmacklos gewesen wäre. Somit konnte der Grund nur sein, dass sie immer noch in einem Alptraum gefangen war, der nicht weichen wollte. Es konnte nicht anders sein; ein Traum, aus dem es kein Entrinnen gab. Er lachte unsicher auf; es klang wie ein ersticktes Husten.
»He, Mädchen«, sagte er betont sanft und berührte sie erneut an der Schulter. »Komm zu dir. Du träumst ja noch.« Seine Worte klangen in seinen Ohren wie dummes Zeug; er musste zugeben, dass diese Situation ihn maßlos überforderte. Konnten Menschen von einer Sekunde zur anderen den Verstand verlieren?, überlegte er plötzlich.
»Da ist diese Stimme in meinem Kopf«, sagte sie mit bebender Stimme. Sie schüttelte den Kopf und schaute ihn angstvoll an. »Diese Stimme … sie sagt es mir, Georg. Sie befiehlt es mir. Was soll ich denn dagegen tun? Sag es mir!« Sie rückte näher. Ihre Stimme wurde lauter: »Sag es mir! Ich kann ihn nicht aufhalten. Er sagt …« Mit einer Wucht, die Zähne zermalmen konnte, schnappte ihr Mund plötzlich mitten im Satz zu, und sie stieß ein gequältes, irr klingendes Stöhnen aus. Dann hob sie ihre Hand, und in der Dunkelheit wurde die unheilvolle Silhouette des Messers sichtbar.
Bevor Georg Kaulmann seine Frau fragen konnte, wie sie mitten in der Nacht an dieses grauenhafte Messer gelangt war, fuhr sie herum und stieß mit dem Messer zu. Georg Kaulmann hatte sich in seinem Leben einige schlimme Verletzungen zugezogen, unter anderem einen schweren Motorradunfall, aber all diese Erinnerungen verblassten angesichts der Schmerzwelle, die nun in ihm aufbrandete. Echter Schmerz fühlte sich kalt an, bemerkte Georg, er war kalt wie der Tod. Das Messer war bis zum Griff seitlich in seinen Hals eingedrungen; er spürte, wie die beidseitig geschliffene Klinge Fleisch und Sehnen zerschlitzte und Blut aus der Wunde schoss. Überall schien Blut zu sein; es besudelte das Bett, den Boden, die Wand hinter ihm. Es war in seinem Hals und seinem Mund, und er bekam keine Luft mehr.
Er stieß ein blubberndes Krächzen aus. Beinah schlimmer als der Tod, der immer näher heranpirschte, war für ihn die Ungewissheit, von wem Eva da gesprochen hatte. Die Zeit, das zu erfahren, würde ihm kaum mehr bleiben, das wusste er. Das Bett, auf dem er lag, war zu einem Meer aus Blut geronnen.
Wieder blitzte das Messer auf, er sah es schemenhaft von oben nach unten fahren, und er bäumte sich auf, als es in seine Bauchhöhle fuhr, dann schlitzte Eva, seine liebe, treue Eva, ihn bis zum Hals auf. Etwas Heißes fiel auf seine Hand, aber er war zu schwach, sie zu heben, um zu sehen, worum es sich handelte. Die Kälte, die er spürte, war nun allumfassend.
Er hörte jemanden schreien, aber der Schrei kam aus weiter Ferne, aus einem anderen Land, wie es schien, und erreichte ihn kaum.
Meine ungute Frau, dachte er, sie ist doch verrückt geworden.
Er rutschte seitlich vom Bett und stieß gegen den kleinen Nachttisch, der laut polternd umstürzte.
Das jedoch hörte Georg Kaulmann bereits nicht mehr. Die Finger seiner rechten Hand, die noch auf dem besudelten Bett lag, streckten sich wie zu einem Gruß, den er seiner Frau oder dem Haus widmete.
Eva Kaulmann lag quer auf dem blutüberströmten Bett und blickte auf den Leichnam ihres Mannes. Sie schluchzte und schrie. Sie nahm seine erschlaffte Hand und hielt und drückte sie. Sie hatte ihren Mann umgebracht, ihr rechter Arm hatte sich ihrem Willen widersetzt und immer wieder zugestochen, bis er sich nicht mehr regte. Sie hatte keine Chance, sich gegen den Einfluss der unheimlichen Stimme zur Wehr zu setzen, die immer wieder Worte der Aufstachlung ausgespien hatte. Wie war so etwas nur möglich? Eva Kaulmann bebte vor Panik und Entsetzen.
Nach einigen Sekunden stand sie langsam auf und ließ die erkaltende Hand der Leiche los, auch dies war auf den fremden Einfluss zurückzuführen. Die Stimme sorgte dafür, dass sie tapsig wie eine Schlafwandlerin das Schlafzimmer verließ. Unter ihren nackten Füßen schmatzte das Blut. Auf dem dunklen Flur wandte sie ihren Kopf hin zu einer geschlossenen Tür im ersten Stock des Einfamilienhauses, wo ein kleines Licht brannte, und setzte sich in Bewegung.
Nicht noch einmal!, dachte sie voller Panik. Nicht noch einmal!
Doch ohne zu zögern steuerte sie weiter auf diesen Raum zu, hinter dessen Tür sie ihren achtjährigen Sohn Clemens wähnte.
Die Stimme feuerte sie an, auch ihn zu töten.
3
Clemens stand in seinem hellblauen Schlafanzug hinter der Tür seines Zimmers und spähte durch das Schlüsselloch. Eine geraume Weile herrschte unten bereits Stille, doch er war nicht sicher, ob er dies für ein gutes Zeichen halten sollte. Er konnte die schrecklichen Laute von vorhin nicht einordnen; beinah war es ihm vorgekommen, als wäre noch jemand bei seinen Eltern gewesen, aber das war sicher vollkommen abwegig.
Plötzlich hörte er leise Schritte auf der Treppe, und Clemens presste wieder ein Auge vor das Schlüsselloch, und er sah seine Mutter im Schein der Lampe, die nachts immer brannte. Ein leiser Schrei entfuhr ihm. Ihr kurzes Nachthemd war mit Blut getränkt, genau wie auch ihre Füße, und ihr Gesicht war eine verzerrte Grimasse, aus der groß und weiß und alptraumhaft ihre Augen hervorstachen. War das dort wirklich seine Mutter oder jemand Fremdes, der ihr Aussehen angenommen hatte und nun zu ihm wollte? Ein Instinkt sagte ihm, dass er fort musste.
Ohne sich umzuschauen, ging er rückwärts zum Fenster. Als er es im Rücken spürte, drehte er sich um und öffnete es. Die Scharniere quietschten leise, das taten sie bereits seit Monaten; sein Vater hatte sich schon so oft vorgenommen, sie zu ölen, doch immer war etwas geschehen, das wichtiger war. Für einen Sprung war es zu hoch, wenngleich Clemens oft mit offenen Augen davon geträumt hatte, es doch unversehrt schaffen zu können. Aber es gab einen anderen Weg, der gefahrloser zu bewältigen war. Bis fast an das Fenster wuchs der dicke Ast eines mächtigen Baums heran, den Clemens bereits oft als aufregende Alternative benutzt hatte, die Wohnung zu verlassen. Mehrmals hatten seine Eltern ihn deswegen gescholten, aber alle Versprechungen, es nie wieder zu tun, waren kurze Zeit darauf gebrochen.
Mit traumwandlerischer Sicherheit stieg Clemens auf das schmale Sims und hielt sich am oberen Rand des Fensterrahmens fest, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Es bedurfte nur eines großen Ausfallschrittes, um auf den Ast zu steigen. Genau das war jedoch stets der kritische Punkt, denn sobald er das tat, musste Clemens seine Hände vom Fensterrahmen lösen und allein auf seine Standsicherheit vertrauen. Ein wenig höher streckte sich ihm ein anderer, etwas dünnerer Ast entgegen, den er nur zu packen brauchte, um wieder sicheren Halt zu bekommen.
Gerade als er dort stand, wurde die Tür seines Zimmers aufgerissen, und seine Mutter stieß einen irren Schrei aus, der Clemens Finger beinah vom Ast gelöst hätte. Er warf einen Blick in das Zimmer hinein und erwiderte den Schrei. Wie eine Furie stürzte seine Mutter zum Fenster, das Messer drohend über ihrem Kopf schwingend. Er sah die Tränen der Verzweiflung in ihrem Gesicht, was er als Widerspruch zu ihrem mörderischen Zorn empfand.
Was hab ich denn getan?, dachte er verzweifelt. Was hat sie so böse gemacht?
Beinah war sie schon heran, um ihn zu packen, da löste Clemens sich aus der Starre, die ihn für einen Moment bewegungsunfähig gemacht hatte. Er wusste aus Erfahrung, dass der Rest ein Kinderspiel war, ein sanfter Abstieg von Geäst zum tieferen Geäst, das er ähnlich wie eine Treppe nutzen konnte. Lediglich die letzten anderthalb Meter musste er springend überwinden.
Die Klinge fauchte nah an seinem Gesicht vorbei. Seine Mutter fiel beinah aus dem Fenster, so weit lehnte sie sich hinaus. Noch einmal fuhr das Messer auf ihn zu, und einen beängstigenden Augenblick lang befand Clemens sich mit beiden Füßen in der Luft, als er dem Hieb auswich. Wild strampelnd suchte er nach dem Ast, um wieder Tritt zu fassen.
Seine Mutter schrie und stieß heisere, beinah kläffende Keuchlaute aus. Ihre weit aufgerissenen Augen waren leuchtende Scheiben des Irrsinns. Sie schien ihn gar nicht mehr zu erkennen. Schreiend und geifernd stieß sie das Messer nach ihm. Dann wuchtete sie sich aus dem Fenster hinaus und packte mit wilder Entschlossenheit einen Ast, der unter dem Ansturm zu brechen drohte.
Clemens beeilte sich, hinunter zur kleinen Grasfläche zu klettern, die ihr Haus von der Straße trennte.
Als er unten angelangt war, erblickte er das Gesicht seiner Mutter im Geäst des Baumes. Er sah ihre Tränen, die nicht zu der vor Wut verzerrten Grimasse passten. Wie ein Miniaturregenschauer fielen die Tränen zu ihm hinunter. Er streckte die Hand aus, und ein warmer Tropfen landete wie eine Segnung auf seiner Handfläche.
Erneut stieß Eva Kaulmann einen grunzenden Schrei aus, und der zauberische Augenblick zerfiel zu Staub.
Mit Schreck erkannte er, dass sie die Hälfte des Abstiegs bereits hinter sich gebracht hatte.
Eilig wandte Clemens sich um und rannte davon. Seine nackten Füße klatschten in schnellem Wirbel auf das raue Pflaster. In seinen Ohren klang es wie eine rasende Serie von Ohrfeigen. Ohne hinter sich zu blicken, überquerte er die nächtlich-ruhige Straße. Weiter vorn befand sich eine kleine Parkanlage. Seine Hoffnung war, sich dort hinter einem Busch zu verkriechen. Was er dann tun sollte, wusste er beim besten Willen nicht, und diese Aussichtslosigkeit trieb ihm während des Laufens die Tränen in die Augen. Ihm wurde plötzlich klar, dass sein behütetes Leben plötzlich vorüber war; was immer jetzt noch folgen würde, war eine gänzlich andere Existenz.
Eva Kaulmann folgte ihrem Sohn im Abstand von einigen Metern. Sie war schneller als er, erkannte sie; die wütende Stimme in ihrem Kopf stachelte sie zur Höchstleistung an, sie drohte und schmeichelte, um dem schmerzenden Körper der Frau noch mehr Kraft zu entlocken. Der panische Rest ihres eigenen Ichs war rettungslos unterlegen und konnte dem Treiben nur noch folgen, ohne ihm Einhalt zu gebieten.
Sie überquerte ebenfalls die Straße, doch plötzlich wurde sie von einem hellen Lichtkreis eingefangen. Sie hörte Reifen ohrenbetäubend laut quietschen. Erschrocken wandte Eva Kaulmann den Kopf und sah einen weißen Lieferwagen vor sich aufragen, der eine nächtliche Fracht transportierte.
Zu spät!, dachte sie, und diese Erkenntnis wurde von ihrem eigenen Bewusstsein erfreut aufgenommen, bedeutete es doch, dass Clemens, ihr Sohn, ungeschoren davonkam.
Sie vernahm einen hellen Schrei aus dem Innern des Lieferwagens und sah das bleiche Gesicht des Fahrers, der einen Moment zu spät reagiert hatte, vielleicht wegen einer Ablenkung oder aus Übermüdung. Dann war das brüllende Ungetüm heran. Eva Kaulmann sah den Kühlergrill, welcher aus der Nähe der Zahnreihe eines Hais ähnelte; dann wurde die Besessene davongewirbelt wie Laub in einer Sturmnacht. Die Frau überschlug sich mehrere Male und rutschte über den rauen Asphalt.
Blut lief ihr aus Mund und Ohren; am Rücken, im Gesicht und an den Beinen, die in einem unmöglichen Winkel vom Körper abstanden, hatte sie verheerende Schürfwunden. Wie ein Mahnmal hielt sie das Messer mit der Spitze nach oben zum Nachthimmel.
Stolpernd verließ der Fahrer seinen Lieferwagen und trat langsam heran. Ein Schock benebelte all seine Sinne, so war er für eine Weile nicht in der Lage, nach Hilfe zu rufen oder zu sehen, ob er für das Opfer noch etwas tun konnte. Er stand einfach reglos da und wurde Zeuge, dass etwas Ähnliches wie eine zitternde kleine Wolke aus dem Mund der Frau entwich. Sie stieg in die kühle Nachtluft empor und zerfaserte nach wenigen Momenten wie Zigarettenrauch.
4
»Nun, was halten Sie davon?«, fragte mich der Mann, der sich mir als Jules Vernon vorgestellt hatte; ein Name, den ich mir sicher gut würde merken können, wenn ich nur an den Schriftsteller Verne dachte. Sein Schädel war vollkommen blank rasiert, in seinem Gesicht wucherte ein schwarzer, leicht geschwungener Schnurrbart, wodurch der Mann, der recht groß war, wie ein skrupelloser Finsterling wirkte. Aber ich spürte, dass er ein durchaus zuvorkommender Zeitgenosse war, dessen tiefsinniger Charme hinter einer Wand aus Kaltschnäuzigkeit verborgen lag; das war eine Kombination, die so manch einen Gesprächspartner zunächst einmal brüskieren musste. Dass der erste Eindruck keineswegs stimmte, verrieten am ehesten seine blauen Augen, die belustigt zu funkeln begannen, wenn etwas ihn erfreute.
Ich blickte auf die Kopie der Akte, die vor mir lag. Vernon hatte mehrere Passagen daraus zitiert, und ich musste zugeben, dass sie äußerst umfangreich war. Es gab kaum ein Jahr aus meinem Leben, das unerwähnt geblieben war. Auch Daten aus meiner Kindheit fanden sich dort, inklusive dem Tod meiner Eltern.
Ganz vorn befand sich ein Foto von mir, und ich rätselte, wann es aufgenommen worden war, doch ich vermochte diese Frage nicht zu beantworten. Der Fotohintergrund gab keinen Aufschluss über den Ort, an dem ich mich befunden hatte; mit einiger Sicherheit waren wesentliche Details mit einem Bildbearbeitungsprogramm entfernt worden. Ich konnte lediglich sagen, dass es neueren Datums war, wenngleich ich fand, dass ich auf dem Foto älter als die zweiunddreißig Jahre aussah, die ich kürzlich geworden war. Vielleicht lag das am Ausdruck meiner Augen, die ein wenig zu niedergeschlagen blickten. Wenn ich nur gewusst hätte, was ich in dieser Sekunde empfunden und gedacht hatte. Es musste ein Sommertag gewesen sein, denn ich trug ein kurzärmliges Hemd, und mein blondes Haar war von der Sonne heller geworden, als es sonst der Fall gewesen wäre.
Ich löste mich von der Begegnung mit mir selbst und hob den Blick. »Ihr Angebot ist verlockend«, antwortete ich endlich, aber so zaudernd, dass meine Aussage ins Gegenteil verkehrt wurde, »aber ich kann kaum glauben, dass der Verfassungsschutz mich so ohne Weiteres gehen lassen will. Man könnte fast annehmen, denen liegt nicht viel an mir.«
Vernon lächelte und breitete seine Arme in einer genauso umfassenden wie nichtssagenden Geste aus. »Wären Sie etwa enttäuscht deswegen? Immerhin hat man Sie in den Innendienst versetzt, und ich vermute, dort wären Sie noch lange geblieben. Aber wir wissen, Sie sind jemand, der an die Front gehört, immerhin haben Sie dort Ihre größten Erfolge aufzuweisen. Jede Menge Ermittlungen, an denen Sie beteiligt waren, waren ein großer Erfolg.«
Ich zuckte mit den Schultern, ohne seine Worte zu kommentieren. Gedankenverloren blickte ich auf ein großes Bild, das hinter Vernon an der Wand hing und eine blühende Landschaft zeigte; der Optimismus, der in jedem Farbklecks steckte, wirkte maßlos überzogen. Wenn Gott so etwas einmal im Sinn gehabt hatte, dann musste er die Lust an der Umsetzung verloren haben. Das Bild diente als Fensterersatz, denn dieses Büro, in dem ich mich nun seit mehr als einer halben Stunde befand, lag im Untergeschoss. Über mir erstreckte sich der gläserne Koloss des Europäischen Parlaments, das gleichermaßen einschüchternd wie beeindruckend auf mich wirkte.
Vor wenigen Stunden war ich mit der Maschine aus Düsseldorf in Straßburg gelandet, und nach einer etwas langatmigen Anmeldeprozedur war ich von einer hübschen und ein wenig geschwätzigen Frau durch diverse Flure hinunter zum Untergeschoss in dieses Büro begleitet worden.
Dass mein Chef mich in den Innendienst versetzt hatte, war immer noch ein Schock für mich, auch wenn ich es vermied, meinen Unmut zum Thema zu machen. Es war, wie so oft, wenn es um den Verfassungsschutz ging, eine politische Entscheidung von ziemlich weit oben gewesen. Man zog mich aus dem Verkehr und hoffte, dass Ruhe einkehren würde. Skandale wurden, wenn sie von Agenten verursacht wurden, am liebsten unter den Teppich gekehrt – meist zusammen mit den betroffenen Agenten.
»Sie haben einen Mann daran gehindert, eine Frau zu vergewaltigen.« Vernon warf einen Blick in die Akte und blätterte erst einige Seiten vor, dann wieder zurück, aber ich nahm an, er kannte diese Passage beinah auswendig, und seine vorgebliche Suche nach den richtigen Zeilen diente nur einer simplen Effekthascherei »Ein Rechtsradikaler, Stefan Schulmann, mehrfach vorbestraft, für seine Brutalität bekannt. Die Frau, die ihn nicht kannte, ging ihm am helllichten Tag in die Falle, und er verschleppte sie in seine Wohnung und fiel über sie her. Da Sie ihn in einer anderen Sache observierten, war es kein Wunder, dass Sie schnell zur Stelle waren. Sie rissen ihn von der Frau fort und machten ihn kampfunfähig.« Vernon grinste mich an, in seinen Augen funkelte es vor Vergnügen. »Andere Stimmen fanden schärfere Worte für das, was Sie mit ihm anstellten, darunter befanden sich auch die Anwälte Schulmanns, was Ihr Pech war.«
Ich nickte mit verkniffenem Gesichtsausdruck, während ich mich fragte, warum der Mann so ausführlich auf diesem Thema herumritt; schließlich kannte ich alle Details. Machte es ihm Freude?
»Schulmann erlitt unter anderem einen Kieferbruch, einen Jochbeinbruch, er verlor eine Menge Zähne und noch mehr Blut, außerdem trug er Quetschungen davon, und er hat auf seinem rechten Auge bis heute nur noch eine stark eingeschränkte Sehfähigkeit. Von Kleinigkeiten wie einer ausgerenkten Schulter oder seiner gebrochenen Nase müssen wir erst gar nicht reden. Seine Anwälte haben Ihrem Laden die Hölle heiß gemacht, und Sie können von Glück sagen, dass es keine ernsteren Konsequenzen für Sie gab. Jemand hielt seine schützende Hand über Sie.«
»So, tat das jemand?«, warf ich giftig ein. »Hören Sie, ich sage nicht, dass es richtig war, was ich gemacht habe, aber Schulmann ist ein Schwein, er hätte keine Skrupel gehabt, die Frau über Tage hinweg zu vergewaltigen. Ich vermute, am Ende hätte er sie umgebracht oder Schlimmeres.« Ich zwang mich zur Ruhe. Auf gar keinen Fall wollte ich die Fassung verlieren, was manchmal vorkam, wenn ich an diese Angelegenheit dachte.
»Schlimmeres? Was könnte denn schlimmer sein als der Tod?«
»Als ob Sie das nicht wüssten. Er hätte durchaus geplant haben können, die Frau als Dauergast zu behalten, damit er und seine Jungs regelmäßig Spaß haben konnten. Einige rechtsradikale Gruppierungen haben außerdem recht gute Kontakte in den Osten, somit wäre nicht auszuschließen gewesen, dass die Frau als Prostituierte in Polen oder Tschechien enden sollte. Von dort wäre sie niemals wieder aufgetaucht. Sie wäre einfach von der Landkarte verschwunden.« Ich blickte Vernon an und spürte, dass allein die Erinnerung mein Blut in Wallung brachte. Zwar hatte ich vorhin eingeräumt, dass ich einen Fehler begangen haben mochte, aber ich sah das im Grunde völlig anders. Aber ich hatte gelernt, dass es klug war, wenn man die Wahrheit nicht unverblümt aussprach. Wenn Politik ins Spiel kam, war die Wahrheit selten gut. »Das wäre schlimmer als der Tod, meinen Sie nicht auch?«
»Nichts ist schlimmer als der Tod.« Nicht Vernon sagte diese Worte, sondern ein Mann, der ein wenig versetzt hinter ihm saß und bislang schweigsam und scheinbar ohne großes Interesse das Gespräch verfolgt hatte. Seinen Namen immerhin kannte ich bereits: Albert Armstrong.
Stocksteif saß er auf seinem Stuhl und fixierte mich mit finsteren, verschlossenen Blicken. Seine näselnde Stimme hallte unangenehm in meinen Ohren nach. Ich wusste nicht viel über den Mann, nur das, was Vernon mir zu Beginn unseres Gesprächs verraten hatte: Armstrong entstammte einem alten, äußerst vornehmen Londoner Familiengeschlecht und hatte, so zumindest kam es bei mir an, nie einen Handschlag getan, sondern war allein durch die Erbfolge zu einem immensen Vermögen gekommen. Er fungierte als Berater dieser seltsamen Organisation, die mich verpflichten wollte.
Ohne auf Armstrongs provozierende Bemerkung einzugehen wandte ich mich an Vernon: »Da Sie ja alles über mich wissen, scheinen Sie ja wirklich an mir interessiert zu sein. Aber worin genau bestünde denn meine Aufgabe?«
»Wunderbar, Herr Fuller. Sehr direkt, das gefällt mir.« Vernon lachte dröhnend, Armstrong hingegen verzog griesgrämig seine Miene. »Wie ich bereits sagte, handelt es sich um eine recht neue Einheit, die den geschmeidigen Namen Institute of paranormal Activities trägt.«
»Macht sich gut auf einer Visitenkarte.«
»Die Kurzform ist IPA. Aber uns gefällt am besten der Begriff Phenomena, das ist ja nun wirklich ein visitenkartentauglicher Name, finden Sie nicht? Phenomena wurde von der Europäischen Union erschaffen und hat die Aufgabe, paranormalen Auffälligkeiten nachzugehen. Die Sinnhaftigkeit wurde in diesem Hause mehrere Male kontrovers erörtert, aber aus meiner Sicht war es gut, dass man sich zur Gründung entschloss. Zumindest steckt mehr dahinter als sinnlose Verschwendung von Steuergeldern.«
»Paranormale Auffälligkeiten?«, stammelte ich. »Was meinen Sie damit? Vorkommnisse ähnlich wie bei Akte X?«
Vernon verzog voller Missmut das Gesicht. »Akte X ist nun sicher nicht unser Vorbild. Wir hoffen, unsere Aufgaben dezenter zu lösen. Dazu bedarf es selbstredend einer gewissen Qualität beim Mitarbeiterstamm.« Er deutete mit einem Zeigefinger auf mich. »Und da kommen nun wieder Sie ins Spiel.«
»Aber was könnte denn eine solche Auffälligkeit sein?«, erkundigte ich mich. »Mir ist noch niemals eine begegnet.« Kaum hatte ich dies gesagt, wusste ich bereits, dass ich mir selbst eine Falle gestellt hatte.
Erneut deutete Vernon mit seinem Zeigefinger auf mich, diesmal in triumphierender Manier, und selbst Armstrong zog zumindest seine Augenbrauen interessiert in die Höhe. »Wirklich nicht? Wir wissen, dass Ihre Mutter durch einen tragischen, unverschuldeten Autounfall ums Leben kam, Ihr Vater hingegen verschwand ungefähr vier Jahre später auf mysteriöse Weise. Es gibt nur einen Zeugen für die damaligen Geschehnisse – Sie! Sie waren damals erst acht Jahre alt, nicht wahr? Später erzählten Sie den ermittelnden Beamten von einem gleißend hellen Licht, das sich über Ihren Vater gestülpt hatte, während dieser abends in den Garten getreten war, um eine Zigarette zu rauchen. Sie standen an der offenen Terrassentür und beobachteten die Szene. Sie sagten, innerhalb dieses Lichtkegels hätte sich noch eine weitere Person befunden, die deutlich größer und massiger gewesen sei als Ihr Vater.
Laut Ihrer Aussage habe Ihr Vater sich gewehrt und laut um Hilfe geschrien. Dafür gibt es in der Nachbarschaft allerdings keine Zeugen. Auch dieses grelle Licht will niemand beobachtet haben, obwohl es so hell war, dass Sie Ihre Augen schließen mussten. Als es erlosch, war Ihr Vater verschwunden, die unheimliche Person, die Sie gesehen haben, natürlich ebenfalls, und es gab überhaupt keine verdächtigen Spuren an dieser Stelle. Noch nicht einmal die Zigarette, die Ihr Vater rauchte, war auffindbar.
Natürlich hat Ihnen niemand geglaubt. In den alten Akten fand ich den Vermerk über eine Zeugenaussage, die von einer Nachbarin gemacht wurde. Dort hieß es, Sie hätten immer eine verblüffend blühende Fantasie besessen. Generell, so wurde gesagt, unterstellte man Ihnen Tagträumerei. Das war natürlich Grund genug, Ihrer Aussage keinerlei Beachtung zu schenken. Ihr Vater war somit eine verschwundene Person, wie es immer wieder vorkommt. Vielleicht hatte er eine andere Frau kennengelernt, oder die Trauer um den Tod Ihrer Mutter steckte noch so tief in ihm, sodass er einfach nicht anders konnte, als zu verschwinden und Sie allein zurückzulassen.«
»Das hätte er nie getan!«, fuhr ich auf. Ich blickte Vernon voller Wut an. Hitzeschauer zuckten in meinen Schläfen.
»Ich will mir kein Urteil anmaßen«, beschwichtigte Vernon mich mit milder Stimme. »Aber glauben Sie nicht, dass Sie damals Zeuge einer paranormalen Auffälligkeit geworden sein könnten? Vielleicht liegt die Sache auch anders, wer kann das heute schon noch sagen? Aber hat es Sie nie interessiert, was mit Ihrem Vater geschehen sein könnte? Vielleicht lebt er noch – irgendwo. Vielleicht wartet er darauf, dass Sie ihn finden. Wenn er noch lebt und sein eigenartiges Verschwinden nicht freiwillig geschah, dann bin ich mir sicher, dass er Sie nie vergessen hat.«
Meine Augen brannten vor Zorn und Verzweiflung, obwohl ich mir den Befehl gab, vor diesen Männern keine Emotionen zu zeigen. Krampfhaft dachte ich an angenehmere Dinge, um den alptraumhaften Schrecken meiner Kindheitszeit zu verdrängen. Es gelang mir, aber dennoch war mein Gesicht scheinbar verräterisch wie ein offenes Buch.
»Herr Fuller«, sagte Vernon, »Benjamin …«
»Ben!«, unterbrach ich ihn. »Wenn schon, dann nennen Sie mich Ben. Ich hasse es, Benjamin genannt zu werden.« Ich zuckte mit den Schultern, als ich mich den Blicken der beiden Männer ausgesetzt fühlte. »Eine Angewohnheit von mir, meinetwegen nennen Sie es Marotte.«
»In Ordnung, also Ben. Es gibt diese unerklärlichen Dinge, die niemand nur mit rationalem Denken erklären kann. Es gab sie schon immer, und wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass sie sich häufen, und zwar in einer Weise, die besorgniserregend ist; daher wurde das IPA, oder Phenomena, geschaffen. Unsere Organisation ist klein, aber äußerst effektiv, wir haben ein Team aus Wissenschaftlern, die rund um die Uhr damit beschäftigt sind, den Geheimnissen der auftauchenden Phänomene auf den Grund zu gehen, und wir haben Agenten, die an vorderster Front auf die Jagd gehen, leider bislang nur innerhalb der Grenzen der EU. Das sollen auch Sie tun, Ben, dafür sind Sie nun hier. Wir haben mit Ihren Vorgesetzten in Düsseldorf gesprochen, wo die Landesbehörde des Verfassungsschutzes beheimatet ist. Sie hatten keine Einwände, Sie gehen zu lassen. Sie sagten, dass Sie ein sehr guter Mann für heikle Situationen sind, aber durch die Geschehnisse sind Sie für Ihren Arbeitgeber verbrannt. Sie müssen verstehen, Ben, dass Sie wahrscheinlich nie wieder dem Innendienst entkommen könnten. Das kann nicht Ihr Ziel sein.«
Ich dachte über diese Worte nach. Auf der einen Seite war ich enttäuscht, dass meine Vorgesetzten so wenig darum bemüht waren, mich zu halten, andererseits hegte ich selber die Befürchtung, dass der verhasste Innendienst das Ende meiner beruflichen Karriere war. Musste ich nun also nicht Vernons Angebot annehmen und ehrenwertes Mitglied von Phenomena werden?
Bevor ich jedoch den Mund aufmachen konnte, kam mir Vernon schon zuvor. »Wir haben sogar bereits den ersten Auftrag für Sie.« Grinsend schob er mir eine dünne Akte hin.
5
Andreas Schütte saß unruhig auf der alten, abgewetzten Couch, deren Bezug eine Farbe hatte, die Schütte nicht näher bestimmen konnte; es war ein helles, von dunkleren Stockflecken durchzogenes Grau mit einem Hauch von Rosa, das ihn an eine Lage aus altem Rindfleisch erinnerte. Noch schlimmer war, dass das Möbelstück auch einen ähnlichen Geruch verströmte, aber mit dieser Wahrnehmung schien nur er gesegnet zu sein. Nervös trommelte sein rechtes Bein unentwegt einen gleichmäßigen Rhythmus auf den Parkettboden.
»Könntest du wohl damit aufhören?«, fauchte ihn Cendric Baltic an, der neben ihm saß. Er überragte Schütte selbst im Sitzen deutlich. Seit einigen Tagen trug Baltic seinen Schädel beinah kahl rasiert; eine solche Radikalrasur hätte Schütte seinem Freund nicht empfohlen, denn dadurch kam die kantige Form seines Kopfes umso stärker zur Geltung, was abschreckend wirkte. Zweifellos war auch Baltic nervös, seine Augen wanderten unentwegt durch den karg eingerichteten Raum, und er musste sich ständig räuspern.
Lediglich der Dritte im Bunde, Zoltan Nenth, war die Ruhe selbst. Ein schwaches Lächeln lag auf seinem Gesicht, und seine dunklen Augen funkelten.
»Ich versteh euch nicht«, sagte er, »das war doch alles so abgesprochen. Ihr wart einverstanden und habt mich unterstützt. Ich hab immer mit offenen Karten gespielt.«
»Aber dass der Irre nachts loszieht und Leute umbringt, war nicht abgesprochen«, sagte Schütte in jämmerlichem Ton. »Sechs Tote innerhalb von nicht einmal zwei Wochen. Wenn rauskommt, dass wir damit zu tun haben, dann sind wir fällig, Mann. Wir kommen nie wieder raus aus dem Bau. Ist dir das eigentlich klar?«
»Aber es wird nicht rauskommen. Nicht, wenn ihr den Mund haltet und die Nerven bewahrt. Im Grunde haben wir nicht das Geringste damit zu tun. Was immer auch geschieht, mit uns kann das niemand in Verbindung bringen. Kapiert endlich, dass Lutz Bürger auf unserer Seite ist. Besser gesagt, seine Seele, die wir beschworen haben; um nichts anderes geht es ja. Ich hab euch erzählt, er konnte zu Lebzeiten sein Werk nicht vollbringen, da er zu früh starb. Nun aber, nachdem es uns gelungen ist, ihn in unsere Welt zu zitieren, ist sein Geist mehr denn je in der Lage, die Taten von einst zu wiederholen. Dass er auf eigene Faust loszieht, ist nicht in meinem Sinne, das könnt ihr mir glauben, aber das ließ sich wohl nicht vermeiden. Soll er es tun, was kümmert es uns? Wir haben nicht das Geringste damit zu tun, und das wird auch so bleiben. Dennoch wird er uns wichtige Dienste leisten. Denkt doch daran, was wir besprochen haben: Er wird alles tun, was wir von ihm verlangen. Wir sind bald reich, glaubt mir. Und niemand wird uns was anhängen können.« Er lachte, und um seine schwarzen Augen herum platzte ein Gitternetz aus Fältchen auf. »Versteht ihr, was das bedeutet? Denkt doch mal drüber nach. Wir werden bald in Geld schwimmen, weil der Geist es uns beschaffen wird. Wir müssen nur die Hände aufhalten, wenn er es abliefert. Das war doch genau das, was wir wollten. Oder etwa nicht?«
Cendric Baltic sah urplötzlich froher drein, als hätte er durch die Worte seines Freundes eine neue Ladung Zuversicht injiziert bekommen, die er dringend nötig hatte. Das Gesicht Schüttes jedoch blieb skeptisch; wenn Zweifel eine Krankheit war, dann gab es für ihn keine Rettung mehr. Zoltan Nenth beobachtete seine Freunde und wusste in dieser Sekunde, dass er auf seinen Kumpan nicht mehr zählen konnte. Nicht der Totengeist Lutz Bürgers, sondern Schütte war die Gefahr für seinen Plan, die es zu beseitigen galt. Doch das ließ Nenth sich nicht anmerken.
»Aber die Morde«, wandte Schütte ein, »der kann doch nicht wahllos Leute zur Strecke bringen.« Er blickte Baltic an, dann Nenth, doch er stieß stets bloß auf eine Wand aus Ablehnung, und er schüttelte den Kopf, als könne er auf diese Weise seine Frustration loswerden.
Er deutete auf die Tageszeitung, die auf dem zerkratzten Holztisch lag; in großen Lettern zog der Kölner Express Parallelen zu einer Mordserie, die Köln vor vielen Jahren in Angst und Schrecken versetzt hatte. Das Vermächtnis des Rippers von Köln! So lautete die Schlagzeile der heutigen Ausgabe.
Der Ripper von Köln, dahinter verbarg sich Lutz Bürger, der in den fünfziger Jahren in der Stadt Jagd auf seine Opfer gemacht hatte. Innerhalb von drei Jahren brachte er mindestens ein Dutzend Menschen auf brutale Weise um.
Ähnlich wie Jack the Ripper war auch Bürger, mit einem Messer bewaffnet, durch die Nacht geschlichen und hatte seine Opfer gesucht und aufgeschlitzt, und zwar mit einer so immensen Brachialgewalt, dass ihm die Eingeweide der Toten förmlich um die Ohren geflogen sein mussten, wie damals ein Kommissar zur Presse gesagt hatte. Es gab lediglich zwei gravierende Unterschiede zum Londoner Mörder: Bürger konzentrierte sich nicht auf Huren, sondern zerschlitzte Männer und Frauen jeder Gesellschaftsschicht, und er konnte schließlich gestellt werden. Durch eine Unvorsichtigkeit war er einigen Polizisten aufgefallen, die Patrouille gingen. Es gelang ihnen, Bürger in einen finsteren Hinterhof zu treiben, wo sie ihn schließlich erschossen, als er über eine Mauer flüchten wollte. Nachdem man seine Identität herausfand, wurde klar, dass Bürger zeit seines Lebens ein vollkommen unbescholtener Mann gewesen war, ein sonntäglicher Kirchgänger, ein Bankangestellter, der zuvorkommend allen Kunden gegenüber war, ein Mitglied eines Wandervereins, der oft die Eifel erkundete.
»Die Morde gehen uns nichts an!«, entgegnete Nenth scharf. »Und wir können auch nichts dagegen tun. Es sei denn, du legst es darauf an, sein Feind zu sein. Aber bitte, Andreas, so dumm wirst du hoffentlich nicht sein.«
Schütte schwieg, während langsam der Sinn dieser Worte in sein Hirn sickerte. Die Drohung war letztlich unverhohlen, das war ihm plötzlich klar, und verzweifelt fragte er sich zum wiederholten Mal, worauf er sich da eingelassen hatte. Er verfluchte den Tag, an dem Zoltan ihn und Cendric Baltic in seinen verrückten Plan eingeweiht hatte; dass er eine Möglichkeit gefunden hatte, den Geist des verstorbenen Massenmörders zu beschwören. Mit seiner Hilfe wäre es ein Leichtes, so erzählte Nenth ihnen in seiner typisch gönnerhaften Art, alles im Leben zu erreichen. Sie würden an Geld kommen und unliebsame Kontrahenten aus der Welt schaffen. Der Geist würde ihnen jeden denkbaren Weg ebnen. Nichts davon hielt Schütte für bare Münze, sondern für eine Spinnerei seines Freundes.
Schütte erklärte sich bereit, dieser Beschwörung beizuwohnen. Das tat er, weil er Langeweile empfand, was ein Synonym für sein ganzes Leben war. Angst war ein anderer Grund für seine Zustimmung, denn er wusste aus schmerzhafter Erfahrung, dass Nenth nicht lange fackelte, wenn es darum ging, seine Ideen durchzusetzen. Baltic trug eine unübersehbare Narbe an der Stirn, die Nenths Unbeherrschtheit bezeugte. Wenn es sein musste, schlug Nenth zu. Diese Tatsache hatte ihm schon oft Scherereien eingebracht, aber aus diesen Lektionen hatte er nie etwas gelernt.
Die Beschwörung war, so glaubte Andreas Schütte, vollkommen ereignislos verlaufen: Kein Geist erschien, keine Stimme sprach mit Grabesstimme aus dem Jenseits zu ihnen, kein Hauch von Schwefel lag in der Luft; somit war Schütte damals einigermaßen beruhigt nach Hause gegangen. Doch zwei Tage später geschah der erste rätselhafte Mord, bald darauf der nächste, das letzte Vergehen lag nun zwei Tage zurück – eine Frau hatte ihren Mann auf bestialische Weise niedergemetzelt und war schließlich von einem Transporter überfahren worden. Warum das geschah, blieb ein einziges Rätsel: Die Mörder, allesamt bislang unbescholtene Bürger, die niemals zuvor bei ihren Mitmenschen den Eindruck erweckt hatten, dass sie solcherart Pläne schmiedeten, begingen gleich nach der Untat Selbstmord, indem sie sich in einem Akt scheinbarer Reue die Kehlen durchschnitten. Doch eine Tatwaffe wurde nie gefunden; kein Messer in der Nähe der Leichen. Und auch Eva Kaulmann, die überfahren wurde und schwer verletzt im Krankenhaus lag, trug keine Waffe bei sich. Die Polizei stand angesichts dieser gespenstischen Umstände vor einem schier unlösbaren Rätsel.
Nur drei Menschen hätten etwas zur Auflösung beitragen können. Schütte schaute unglücklich drein, weil ihm langsam dämmerte, dass diese Rolle ihm zufiel.
6
Mit einem gewissen Unbehagen beäugte meine Lebensgefährtin Stephanie Winkler die auf dem Wohnzimmertisch liegende Waffe, die ich aus Frankreich mitgebracht hatte. Es handelte sich um eine Walther PPQ Classic, eine Pistole mit Neun-Millimeter-Kaliber. Die Ausrüstung war, im Vergleich zum Verfassungsschutz, sehr spärlich, aber die Erklärung Vernons dröhnte noch in meinen Ohren, und ich gab sie gleich an Stephanie weiter.
»Im Moment ist noch keineswegs klar, ob die ganze Organisation eine lange Lebensdauer haben wird. Es gibt offenkundig eine Menge Widersacher, die sagen, das Projekt dient nur dazu, Geld zum Fenster hinauszuwerfen.«
»Was bei der EU doch eigentlich nie passiert«, unterbrach Stephanie mich mit zynischem Unterton.
Ich zuckte mit den Achseln. »Man will Erfolge sehen; erst dann, so sagte Vernon, sei mit einer Budget-Erhöhung und entsprechend besserer Ausrüstung zu rechnen. Wenngleich mir nicht ganz klar ist, welche Ausrüstung vonnöten sein wird, um Geister zur Strecke zu bringen.«
»Ein Eichenpfahl vielleicht? Oder Weihwasser?«
»Sehr lustig.«
In die Funktionsweise der Waffe war ich in den beiden vergangenen Tagen eingewiesen worden. In dem Zusammenhang erfuhr ich, dass es sich bei der 9mm-Munition um eine Spezialanfertigung handelte, in deren Innern eine chemische Substanz war, die nach einem Treffer augenblicklich aus dem Projektil austrat. Dadurch wurde das getroffene Objekt, sofern es sich um eine paranormale Auffälligkeit handelte, augenblicklich unschädlich gemacht. Es lag auf der Hand, dass dieser Erklärung keine praktische Übung am lebenden Objekt folgte, daher blieb mir keine andere Wahl, als den Ausführungen Glauben zu schenken.
Außerdem hatte ich einige Kollegen kennengelernt, die, ebenso wie ich, an vorderster Front operieren sollten. Auch in der wissenschaftlichen Sektion des IPA war ich gewesen, wo man mich einem gründlichen Gesundheitscheck unterzog. Besonders in Erinnerung geblieben war mir der Leiter Leonhard Kilmister, einem deutsch-britischen Professor, der, wie man mir sagte, ein ausgezeichneter Naturwissenschaftler sowie ein Experte für viele Mythologien war.
»Ein netter Kerl«, schloss ich meinen kurzen Bericht. »Man nennt ihn intern wohl nur Lemmy.«
»Warum das?«
Mit ein wenig herablassendem Tonfall erklärte ich Stephanie, dass der Sänger und Bassist der Gruppe Motörhead ebenfalls Kilmister hieß. »Interessant ist jedoch, dass Leonhard ausschließlich klassische Musik hört.«
»Na, da könntest du doch seinen Horizont erweitern, wenn sich mal eine Gelegenheit ergibt.«
»Er wäre erfreut.«
»Du hast zwar nicht besonders viel an Ausrüstung erhalten, aber aus meiner Sicht wirkt die Waffe so, als könnte man mit ihr ohne weiteres ein Mammut zur Strecke bringen.«
Ich entgegnete grinsend: »Es ist ja nicht auszuschließen, dass mir welche begegnen werden. Dann sollte ich gewappnet sein.«
Wie saßen in unserer gemeinsamen Wohnung in Düsseldorf. Durch das große Fenster sah ich in einiger Entfernung den Rhein, der sich seinen unermüdlichen Weg bahnte. In einem ausführlichen Gespräch hatte ich meiner Lebensgefährtin, mit der ich seit beinah zehn Jahren zusammen war, über meinen Aufenthalt in Straßburg berichtet. Sie reagierte ähnlich wie ich mit ziemlicher Verwirrung auf die Ausführungen. Es waren Neuigkeiten, die sie nicht so einfach akzeptieren konnte, und ich gestand ihr die Zeit zu, die sie benötigte, um zu einem Urteil zu kommen. Letztlich war es natürlich meine Entscheidung, aber es war mir lieber, wenn Stephanie diese mit gutem Gewissen unterstützen konnte.
Ich sah ihrem Gesicht an, dass im Moment Skepsis und Zweifel überwogen. Ihre dunklen Augen ruhten noch eine ganze Weile auf der Pistole, dann schwenkte ihr Blick zu mir hinüber, und ich sah sie unsicher lächeln, als hätte ich einen schmutzigen Witz erzählt. Gedankenverloren strich sie eine Strähne ihres dunklen Haars aus der Stirn; eine Geste, die mir schon seit vielen Jahren vertraut war. Ich lächelte unwillkürlich, als ich sie beobachtete.
»Was hast du?«, fragte sie mich.
Ich winkte ab. »Nichts.«
»Sag schon.«
Da ich Stephanies Hartnäckigkeit nur allzu gut kannte, gab ich klein bei. »Es ist nur so, dass man deine Unsicherheit so deutlich erkennen kann, als würde sie mit Leuchtschrift auf deiner Stirn stehen. Diesen Gedanken fand ich lustig.« Das entsprach nicht ganz der Wahrheit, aber sie schluckte sie.
»Wundert dich das? Es ist eine weitreichende Änderung, die sich da ergeben kann. Unser Leben würde sich dadurch ändern, und ich weiß nicht, ob mir dieser Gedanke gefällt.« Sie ergriff meine Hand und hielt sie fest umschlossen. »Und du willst dich wirklich darauf einlassen?«
Über diese Frage hatte ich den gesamten Heimflug nachgedacht. Am Ende war ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich mich in dieses Abenteuer stürzen wollte. Vernon wirkte einfach zu seriös, als dass ich seine Ausführungen als simple Spinnerei abtun konnte. Darüber hinaus hatte der Franzose eine Saite in mir zum Klingen gebracht, als er über meinen Vater gesprochen hatte. Ich entsann mich, dass ich mir als kleiner Junge geschworen hatte, die Wahrheit über sein Verschwinden herauszufinden, um es all denen zu zeigen, die meinen Worten nicht geglaubt und sie als Phantastereien eines Kindes abgetan hatten. Im Laufe der Jahre war diese Saite rostig geworden; umso größer war meine Verblüffung, dass dieses Gefühl nun mit unverminderter Vehemenz wieder in mir saß und meinen Herzschlag beschleunigte.
Zudem wollte ich um jeden Preis dem Innendienst entfliehen; ich hatte mehr und mehr das Gefühl, dass dieser Job zu einer immer größeren Last für mich wurde, die mich schließlich wie ein Grabstein erdrücken würde. Ich war Stephanie unendlich dankbar dafür, dass sie tapfer meine Degradierung erduldet hatte, obwohl ich ganz sicher sehr oft ein unausstehliches Scheusal gewesen sein musste. Aber sie hatte die Geduld mit mir nicht verloren und wurde nicht müde, mir einzubläuen, dass es irgendwann auch mal wieder aufwärts ging. Ihretwegen hatte ich den Mut nicht verloren.
»Ja«, antwortete ich mit einiger Verzögerung auf Stephanies Frage. »Ich denke, dass es die richtige Entscheidung ist. Und außerdem …«
Sie hob gleichermaßen interessiert und gewarnt die Augenbrauen. »Ja?«
»Ich habe sogar bereits meinen ersten Fall«, fuhr ich fort und reichte ihr die Akte.
»Sie verlieren keine Zeit«, murmelte Stephanie und überflog den Text.
Ich wusste, dass die Informationen ziemlich spärlich waren und kaum mehr als einen ersten Eindruck vermittelten.
»Ich habe bereits davon gelesen«, informierte sie mich. »Grässliche Geschichte. Unheimlich.«
»Absolut«, stimmte ich zu. »Unbescholtene Bürger mutieren zu Mördern und richten sich nach ihren Untaten selbst.«
»Wer ist schon unbescholten?«
»Du weißt, was ich meine. Sie haben vielleicht Steuern hinterzogen oder falsch geparkt, aber das macht sie noch lange nicht zu Bestien.«
»Natürlich nicht. Und wie willst du nun vorgehen?«
»Ich werde morgen nach Köln fahren und mich mit dem leitenden Ermittler austauschen, der über mein Kommen bereits informiert ist.« Ich warf einen Blick in die Akte. »Kriminalhauptkommissar Crenz.«
»Ein Düsseldorfer, der in Köln für Ordnung sorgen soll«, murmelte Stephanie. »Das sind ja die besten Aussichten.«
»Ich sehe das mit der Rivalität nicht so ernst.«
»Sehr fortschrittlich.«
7
Thomas Eichinger bewegte sich so leise wie möglich im Schlafzimmer, dennoch nahm seine Frau etwas wahr und schrak aus ihrem traumlosen Schlaf.
»Was machst du denn da, Thomas?«, fragte sie. Sie registrierte, dass er angekleidet war. »Willst du doch einmal fort?«
Mit einem angedeuteten Lächeln sagte er: »Ich gehe kurz runter in den Laden. Es wird nicht lange dauern.«
»Jetzt noch? Es ist spät. Hat das nicht Zeit bis Morgen?« Marianne Eichinger war so müde, dass sie die Antwort nicht in Zweifel zog. Bei genauerem Hinschauen hätte sie möglicherweise in den Augen ihres Mannes die Verzweiflung erkannt, die in ihm brodelte. Nichts von dem, was er im Moment tat, entsprang seinem eigenen Willen: Es gab keinen Anlass, in den unter der Wohnung liegenden Juwelierladen zu gehen, schon gar nicht zu dieser nachtschlafenden Zeit. Etwas befahl es ihm, eine erst vage, jedoch mehr und mehr drängende Stimme in seinem Kopf, die Eichinger erst aus dem Schlaf, dann aus dem warmen Bett getrieben hatte. Obwohl panische Angst in ihm aufloderte, sprach er mit vollkommen ruhiger und gelassener Stimme zu seiner Frau und belog sie. Beinah war sie schon wieder in tiefem Schlummer gefallen; so fiel ihr auch nicht auf, dass ihr Mann in Straßenschuhe schlüpfte, was für einen kurzen Besuch im Ladengeschäft nicht nötig gewesen wäre.
»Es dauert nicht lang«, wiederholte er, während er die Schlüssel suchte. »Schlaf weiter.«
Leise schloss er die Tür des Schlafzimmers hinter sich und verließ die Wohnung, um den Laden aufzusuchen. Hastig und verängstigt ging sein Atem, und er zitterte am ganzen Körper; wie ein Kind vor seinem strengen Vater. Dennoch unterlief ihm kein Fehler. Zunächst schaltete er die Alarmanlage aus, Licht machte er keines, die Stimme, die in ihm hockte und bohrende Befehle gab, untersagte es ihm. Er brauchte auch kein Licht, um sich zu orientieren. Nach und nach holte er verschiedene Wertgegenstände aus den Vitrinen und stopfte sie achtlos in einen Stoffbeutel. Er beschränkte sich meist auf Uhren, die am Schwarzmarkt am einfachsten zu verkaufen waren. Auch Goldschmuck nahm er mit. Damit ließ sich guter Profit erzielen.
Er konnte nicht sagen, für wen er diesen Diebstahl beging. Er stand vor einem völligen Rätsel, was in diesen Minuten mit ihm geschah. Es war geradezu so, als sei er ein fremdbestimmtes Wesen, das unhörbaren Befehlen folgte. Aber wer sprach zu ihm? Die Stimme kannte er nicht; sie klang zynisch und böse, als wüsste der Mann mehr über Eichingers weiteres Schicksal.
Nachdem die Tasche gut gefüllt war, verließ er leise das Geschäft und schloss die Tür hinter sich. Er stieg in seinen BMW, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite stand, und fuhr davon.
Ungefähr eine halbe Stunde später hielt er in einer ihm gänzlich unbekannten Gegend, in die er wie in Trance gefunden hatte. Selbst den Stadtteil, in dem er sich nun befand, konnte er nicht benennen. War er überhaupt noch innerhalb der Kölner Stadtgrenze? Eichinger wusste es nicht.
Auf der linken Straßenseite befand sich ein großes Waldgebiet, das sich ihm in der Dunkelheit drohend entgegenreckte, rechts standen Häuser auf weitläufigen Grundstücken. In den meisten Gebäuden brannte kein Licht, was Eichinger aufgrund der nächtlichen Zeit nicht überraschte. Er stieg aus und folgte der Straße zu Fuß. Ein kalter Wind kam ihm entgegen, und er schlang sich fröstelnd die zu dünne Jacke um den Leib. Niemand kam ihm entgegen, er hörte kein Auto; die Gegend war eine einsame Einöde, die sicher auch am Tage nicht reizvoll gewesen wäre. In regelmäßigen Abständen passierte er Straßenlaternen, die ein kümmerliches Licht auf den Asphalt warfen. Sobald Eichinger sie hinter sich gelassen hatten, überfiel ihn sein eigener monströser Schatten.
Es wirkte beinah so, als wären einige der Häuser, an denen er hastig vorüber schritt, überhaupt nicht mehr bewohnt. Die Rasenflächen vor den Gebäuden sahen verwahrlost aus, in den Garageneinfahrten standen keine Fahrzeuge; nichts erinnerte an menschliche Anwesenheit.
Doch dann sah er ein Haus, in dem Licht brannte, und Eichinger wusste, dass dort sein Ziel lag. Er musste mit seiner Nervosität kämpfen, immer wieder beschwichtigte er sich mit leisen, hastig ausgestoßenen Worten, denen er selbst kaum Glauben schenkte. Er hatte immer noch keine Erklärung gefunden für das, was ihm hier widerfuhr, aber er hoffte, dass es glimpflich für ihn ausging. Auf die Uhren und den Schmuck, die er in der Tasche bei sich trug, verzichtete er gern, auch wenn er das Fehlen der Wertgegenstände kaum glaubhaft würde erklären können. Niemand, am wenigsten seine Frau Marianne, die Teilhaberin des Geschäfts war, würde ihm abnehmen, dass er auf den Befehl einer Stimme, die er in seinem Kopf hörte, zum Dieb geworden war. Das grenzt an Wahnsinn, dachte er.
Mit vor Kälte und Angst verzerrtem Gesicht betrat er den schmalen Weg aus Steinplatten, die im ungepflegten Vorgarten des erhellten Hauses lagen. Überall wucherte Unkraut, und der Rasen war kniehoch in die Höhe geschossen. Im Hintergrund sah er das rostige Gestell einer Kinderschaukel. Wer immer hier lebte, legte nicht im Mindesten Wert auf Ordentlichkeit; gerade dies war für Eichinger jedoch von höchster Wichtigkeit. Wer es nicht schafft, sein Leben in Ordnung zu halten, pflegte er stets zu sagen, der hat sein Leben auch in anderen Bereichen nicht im Griff.
Bevor er den Klingelknopf betätigen konnte, wurde die Tür geöffnet, und ein Mann, dessen Gesicht im Dunkel nicht zu erkennen war, zog ihn hastig ins Haus. Im gleichen Moment wurde ihm der Beutel aus der Hand genommen. Dann wurde er in den Nachbarraum geleitet. Das alles ging ohne Worte ab. Eichinger war viel zu eingeschüchtert, um etwas zu sagen. In dem nächsten Raum warteten bereits zwei weitere Männer auf ihn, die ihm nicht besonders vertrauenerweckend erschienen. Mit einigem Erstaunen nahm er zur Kenntnis, dass ihre Gesichter nicht verdeckt waren. Dabei mussten sie doch wissen, dass Eichinger sie beschreiben konnte. Dann erst wurde ihm bewusst, dass seinem Gedankengang eine bedrohliche Konsequenz folgte.
»Ich danke Ihnen, Herr Eichinger«, sagte der Mann, der die Tür geöffnet hatte, mit freundlicher, jedoch auch unverkennbar zynischer Stimme. Nun sah Eichinger auch sein Gesicht; finstere Augen, in denen kein Leben zu schimmern schien, ein Drei-Tage-Bart, halblanges, nachtschwarzes Haar, das aussah, als sei es feucht.
»Was bedeutet das?«, fragte Eichinger mit einer Stimme, die ihm merkwürdig fremd vorkam; sie verriet, wie groß die Furcht war, die er verspürte. Unentschlossen sah er sich um, auf der Suche nach einem Fluchtweg, aber die drei Männer versperrten ihm wie zufällig jede Möglichkeit. Der Gedanke, sich mit Gewalt einen Weg nach draußen zu bahnen, kam ihm gar nicht erst; selbst gegen nur einen Gegner hätte er keine ernsthafte Chance gehabt, und bei dreien waren seine Erfolgsaussichten überhaupt nicht vorhanden. Wenn ihm überhaupt etwas half, dann waren es Diplomatie und Verständnis.
Der Mann, der ihn ins Haus gelassen hatte, grinste und hob die Tasche triumphierend in die Höhe, dann verstreute er ihren Inhalt über den zerkratzten Holztisch. Die Uhren und der Goldschmuck blitzten und blinkten im Licht. »Nicht schlecht für den Anfang, oder?«
Seine beiden Freunde kamen zögernd näher, sodass die Idee an Flucht erneut in Eichinger aufflammte. Noch nicht, mahnte er sich selbst zur Ruhe. Lass sie erst dem Reiz erliegen. Er selbst kannte dieses Gefühl nur zu gut. Er fühlte sich auch oft wie gebannt von der Schönheit, die er in seinem Geschäft vorfand. Selbstverständlich nur bei wertvollem Schmuck und nicht, wenn es sich, wie in diesem Fall, um kaum mehr als Tand handelte. Aber den Banausen genügte das scheinbar.
»Wie hast du ihn dazu gebracht, das zu tun, Zoltan?«, fragte Schütte.
»Ich hab nicht das Geringste damit zu tun«, erklärte Nenth. »Ihr habt daran gezweifelt, aber nun seht ihr den Beweis, dass Bürger genau das erledigt, was ich will. Alles andere spielt da keine Rolle. Kapiert ihr jetzt endlich, welche Zukunft vor uns liegt?« Er blickte von Schütte zu Baltic und fand Anzeichen von Zustimmung.
Baltic rührte verträumt in der Flut aus Schmuck, die sich über den Tisch ergossen hatte. »Und was geschieht nun mit ihm?«, wollte er schließlich wissen. »Der wird uns doch verraten, meinst du nicht? Es sei denn …« Er stieß ein heiseres Grunzen aus, das Ähnlichkeit mit einem Lachen hatte, und fuhr sich mit der Handkante über die Kehle.
»Das können wir doch nicht tun!«, rief Andreas Schütte, bevor Nenth den Mund aufmachen konnte. »Wir können den doch nicht umbringen!«
Eichinger hörte zu und verschluckte sich beinah vor Angst. Er ballte seine Hände zu Fäusten und öffnete sie wieder.
»Jetzt reg dich wieder ab!«, verlangte Nenth mit schneidender Stimme. »Wir werden unserem Freund nichts tun, nicht einmal ein Härchen werden wir ihm krümmen. Das wird auch gar nicht nötig sein.« Er wandte sich an den Juwelier, der ihn mit blassem Gesicht anstarrte; seine weit aufgerissenen Augen wirkten wie Kohlestücke. »Sie werden uns doch nicht verraten, oder?«
Entschieden schüttelte Thomas Eichinger den Kopf. Die Worte des Mannes entfachten neuen Mut, wo zuvor nur Resignation und Angst gewesen waren. Er konnte es kaum glauben – kam er wirklich so einfach davon? Nahm man es ihm ab, wenn er in aller Nachdrücklichkeit seine Verschwiegenheit beschwören würde? Wenn es nach ihm ginge, wäre das tatsächlich die Wahrheit, aber er kannte seine Frau Marianne gut genug, um wissen, dass sie ein solches Verbrechen nicht akzeptieren konnte. Es musste ihm gelingen, die Sache ihr gegenüber zu vertuschen, vielleicht durch ein Feuer, das er legen könnte, um alle Spuren verschwinden zu lassen. Gedanken schossen ihm wie Granatsplitter durch den Kopf. Irgendetwas würde ihm schon einfallen. Wenn er nur heute Nacht mit dem Leben davonkäme.
»Natürlich werde ich schweigen«, sagte er endlich. Er wandte den Blick von diesem Nenth ab, dessen Augen zu finster aussahen, als dass er diese Konfrontation länger als ein paar Sekunden aushielt. Stattdessen wandte er sich beinah flehend an Andreas Schütte, der einen durchaus vernünftigen Eindruck machte. Leider stellte Eichinger jedoch in dieser Sekunde fest, dass der Mann einen nicht minder verstörten Eindruck machte. Offensichtlich hatte er in dieser Gruppe nicht sehr viel zu sagen. »Ich schwöre, dass ich niemandem etwas sagen werde.«
Zufrieden klatschte Zoltan Nenth in die Hände. »Dann ist ja alles in Ordnung.« Er kam heran und legte Thomas Eichinger eine Hand auf die Schulter. »Ich hab nie an Ihrer Unterstützung gezweifelt. Also ist Ihre Aufgabe hiermit erledigt. Sie können heim zu Ihrer Frau, die doch sicher bereits auf Sie wartet, was?«
Mehr oder weniger stolpernd erreichte der Juwelier die Haustür und riss sie auf. Bevor sie hinter ihm ins Schloss fiel, hörte er Nenth, der zu seinen Kumpanen sagte: »Ich sagte doch, ich rühr ihn nicht an.«
8
Draußen ging Thomas Eichinger eilig die einsame Straße hinab. Ein Beobachter hätte ihm bescheinigt, dass er in diesen Sekunden einen irren Eindruck machte, denn er grinste und stieß Laute aus, die an Worte erinnerten, und gleichzeitig rannen Tränen an seinen Wangen hinab, doch bewusst nahm er weder das eine noch das andere wahr.
Er blickte immer wieder um sich, auf der Hut vor Verfolgern, die möglicherweise seine Rettung doch noch verhindern wollten, aber die Straße blieb, was sie schon bereits zuvor gewesen war: ein einsames Pflaster.
Er konnte bereits seinen BMW am Straßenrand stehen sehen und beeilte sich daraufhin noch mehr, als er plötzlich die Straßenseite wechselte, ohne dass dies seine Absicht war. Dort war nichts, was ihn dazu hätte verleiten können, noch nicht einmal ein Gehweg. Als Eichinger die Richtung wieder korrigieren wollte, bemerkte er zu seinem Entsetzen, dass dies nicht möglich war. Seine Beine bewegten sich wie ferngesteuert auf den Wald zu, erreichten seinen Rand, dann stapften sie durch das Dickicht. Bald hörte man nur noch das Unterholz knacken. Mit beinah unverändertem Tempo bahnte Eichinger sich seinen Weg, der äußerst beschwerlich und einigermaßen schmerzhaft war, denn ständig schnellten Zweige in sein Gesicht, und dornige Ranken zerrten an seinen Hosenbeinen und rissen Löcher in den Stoff und ins Fleisch.
Nächtliche Tiere wurden auf ihn aufmerksam und flüchteten weiter ins Dickicht; der Juwelier fühlte sich von tausenden Augen angestarrt.
»Verdammt!«, keuchte er und versucht eine erneute Kursänderung, aber seine Beine blieben stur und gingen immer weiter in den Wald hinein. Er schlug mit seinen Fäusten auf sie ein und schmeichelte und drohte ihnen, doch es änderte sich nichts.
»Was, zum Teufel, mach ich hier?«, fragte er sich immer wieder. Dann schrie er um Hilfe, vielleicht bestand die Möglichkeit, dass jemand ihn hörte. Er brüllte, bis er heiser war, doch nur Tiere antworteten ihm. Es war ihm ein Rätsel, was mit ihm geschah.
Verzweifelt wischte er sich übers Gesicht, das feucht war von Schweiß, Tränen und dem Blut. Einmal knickte er um, als er in eine Kuhle trat. Ungelenk wie ein nasser Sack fiel er auf den Teppich aus Laub und hielt sich den Knöchel, doch was immer in ihm war, das ihn vom Weg abgebracht hatte, es duldete nicht, dass er sich auch nur einen Moment lang Ruhe gönnte. Unerbittlich war da dieser unhörbare Befehl, dass er weiter musste. Thomas Eichinger schluchzte, sein Gesicht war vor Schmerzen verzerrt, als er sich langsam wieder auf die Beine quälte, die ihm nicht zu gehören schienen.
Obgleich in seinem linken Knöchel nun ein harscher Schmerz wütete, humpelte er weiterhin in unvermindertem Tempo durch den Wald; jede Begegnung seines Fußes mit dem Erdboden entlockte Eichinger ein Stöhnen.
Weiter, drohte die Stimme in seinem Kopf, nur immer weiter! Klang sie nicht gar ein wenig belustigt, als sei ihr Eichingers Qual eine wahre Freude?
»Verdammter Bastard!«, fluchte der Juwelier. »Du verdammte Bestie! Lass mich endlich frei!« Nichts geschah, nur das Tempo, das die Stimme ihm abverlangte, wurde noch mehr forciert.
Sein Marsch dauerte nur einige Minuten, die Eichinger jedoch wie Stunden vorkamen, schließlich gelangte er an eine Lichtung, und ein Tümpel lag vor ihm. Im schwachen Licht des Mondes, das die Lichtung erhellte, sah er die Schicht aus Algen, die wie ein Teppich auf der Oberfläche ruhte und das Wasser vollkommen erstarren ließ. Einige Frösche quakten, ungerührt von den Ängsten, die der einsame Mann ausstand.
Er fühlte, dass er nun am Ziel angelangt war. Schwer atmend stand er am Ufer des kleinen Tümpels, den verletzten Fuß ein wenig angewinkelt, damit er nicht so stark belastet wurde. Er hätte im Moment kaum etwas lieber getan als sich einige Minuten lang auszuruhen. Eichinger war mit seinen Kräften vollkommen am Ende. Mehr noch als der hastige Marsch erschöpfte ihn die unaussprechliche Angst; sie schien jegliche Kraft aus seinen Gliedern herauszerren.
Ohne sein Zutun spannten sich die Muskeln in seinen vor Erschöpfung zitternden Beinen an, und schon ging seine unfreiwillige Wanderung weiter, diesmal aber nur für wenige Sekunden. In der vom Mondlicht aufgeweichten Finsternis erkannte er einige Klumpen am schlammigen Ufer liegen. Als er heran war und sich vornüber beugte, sah Eichinger, dass es Steine waren. Er klaubte mit beiden Händen einige von ihnen auf, von denen die meisten in etwa die Größe einer Kleinkindfaust hatten, und stopfte sie sich in die Jacken- und Hosentaschen.
Ein Laut, so spinnwebfein wie ein verlorenes Echo, drang aus Eichingers Mund. Nun wusste er Bescheid. Die Steine hatten ihm die Antwort verraten; sie dienten dazu, dass er am Grund des einsamen Tümpels blieb und nie wieder auftauchte.
»Nein!«, flehte er zu niemandem. »Ich will nicht sterben!«
Die Stimme in seinem Kopf schwieg, als lohne es sich nicht mehr, etwas auf das Gestammel eines Todgeweihten zu geben.
»Bitte!«, greinte er. »Meine Frau! Ich hab doch niemandem was getan! Ich werd auch nichts verraten, ganz sicher nicht.«
Er drehte sich verloren um seine eigene Achse. Nur die Frösche antworteten ihm; ihr Quaken klang so gelangweilt, als wollten sie ihm bedeuten, dass Sterben in diesem Wald zur Tagesordnung gehörte.
Die mit Steinen prall gefüllten Taschen seiner Jacke drohten zu reißen, als Thomas Eichinger einen ungelenken Schritt zum Wasser machte. Mit dem nächsten Schritt zerteilte er die Algenschicht. Die Kälte des Wassers drohte ihm den Atem zu rauben, doch er hielt nicht inne, die Stimme ließ Zögern nicht zu.
Der Grund des stillen Tümpels, der den Mann zu schlucken drohte, fiel steil ab. Bereits nach wenigen Metern stand ihm das Wasser bis zur Brust. Verwesungsgeruch drang ihm in die Nase, als hocke unter der Oberfläche eine ganze Armee verfaulter Opfer der unheimlichen Stimme, die Eichinger ungerührt in den Tod schickte. Der Schlick am Grund zerrte an seinen Füßen und saugte den Mann förmlich auf.
Still und resigniert weinte Thomas Eichinger, aller Hoffnung beraubt. Dann machte er den nächsten Schritt, und Wasser füllte seinen Mund.