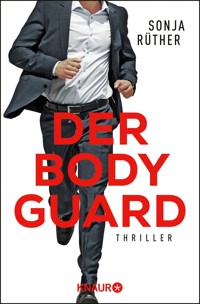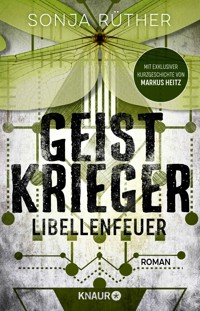
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Geistkrieger
- Sprache: Deutsch
Fantastischer Thrill in einem alternativen Amerika: Der Kontinent wurde nie erobert, doch die Nation der Powtankaner könnte von innen heraus zerstört werden … »Geistkrieger: Libellenfeuer« ist die Fortsetzung des Fantasy-Thrillers »Geistkrieger: Feuertaufe« von Sonja Rüther. Der Druck lastet schwer auf der Sondereinheit der Geistkrieger um den eingewanderten Schotten Finnley: Im Fall des »Gabensammlers« tappen sie im Dunkeln. Mit äußerster Brutalität reißt der Unbekannte denen, die gesegnet sind, ihre besondere Gabe aus dem Bewusstsein, um sie selbst zu nutzen und auf diese Weise immer mächtiger zu werden. Doch die Nation der Powtankaner wird noch von einem weiteren Übel bedroht: Immer mehr Menschen benehmen sich äußerst merkwürdig, das Ganze scheint sich wie eine Seuche auszubreiten. Ausgerechnet jetzt geraten die Geistkrieger in den Fokus widerstreitender politischer Interessen … Mit ihrer Thriller-Reihe »Geistkrieger« hat Sonja Rüther ein erfrischend anderes Fantasy-Setting geschaffen, das mit seiner alternativen Geschichte Amerikas und dem actionreichen Plot einfach süchtig macht. Auch der 2. Teil der Fantasy-Thriller-Reihe enthält eine exklusive Kurzgeschichte von Markus Heitz. Entdecken Sie als Einstieg in das Geistkrieger-Universum auch die exklusive und kostenlose Kurzgeschichte »Geistkrieger: Neue Wege«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 596
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Sonja Rüther
Geistkrieger
LIBELLENFEUERRoman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein geheimnisvoller Mörder, eine politische Intrige – und ein alternatives Amerika
Der Druck lastet schwer auf der Sondereinheit der Geistkrieger um den eingewanderten Schotten Finnley. Veränderung liegt in der Luft. Während der national gefeierten Wikingertage regen sich Mächte in Powtanka, die die Grenzen der Nationen lockern und das Land in ein neues Zeitalter führen wollen. Überschattet werden die Feierlichkeiten von einer Seuche, die sich rasant im ganzen Land ausbreitet. Als dann allerorts Menschen mit besonderen Gaben auftauchen, überschlagen sich die Ereignisse. Für die Sondereinheit der Geistkrieger steht bald mehr auf dem Spiel als ihr Ruf.
Der zweite Teil der Fantasy-Thriller-Reihe mit einer exklusiven Kurzgeschichte von Markus Heitz.
Aus dem Geistkrieger-Universum ist bisher erschienen:
Feuertaufe (Band 1)
Libellenfeuer (Band 2)
Neue Wege. Die Vorgeschichte zu Geistkrieger.
Inhaltsübersicht
Widmung
Glossar
Was zuvor geschah
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Novelle
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Danksagung
Quellennachweis
Für Keely und Norina
Glossar
Até Uzuye: Ehrenvolle Anrede, großer Vater
Ina Uzuye: Ehrenvolle Anrede, große Mutter
Powtankane: Einwohner Powtankas
Powtankanin: Einwohnerin Powtankas
Tunkan wiscasa: Steinmann
Wasicun: Mysteriöser Mensch, Ausdruck für Ausländer
Wicapi: Stern
Wakan Tanka: Der große Geist
Waktanas: Vom großen Geist erweckte Menschen, die über Gaben verfügen
Seelenspiegel: Ein Talisman, der Schaman*innen vor der Astralwelt schützt
Astralwelt: Die Ebene, auf der Auren, Totems und energetische Vorkommnisse von Menschen mit der astralen Sicht wahrgenommen werden können
Geistkrieger: Sondereinheit der Polizei für die Ermittlungen bei spirituellem Missbrauch
Powtanka: Name des Landes (USA)
Kanaston: Hauptstadt von Powtanka, Ostküste
Tamaya Wicapi: Stern der Mitte, der Hauptsitz des Nationalrates
Thure Ragnason: Leiter der Sondereinheit
Deidra Onheira: Stellvertretende Teamleiterin
Tate: Besitzt eine Assoziationsgabe
Chenoa Yakesha: Schamanin, schwanger mit einem von Fenrir gesegneten Kind
Finnley Whittle: Schotte, mit dem nordischen Totem Fenrir verbunden und dadurch ein Hüter, Vater von Chenoas Kind, verlobt mit Taima. Fällt durch seine vielen Tätowierungen auf, die ihn besonders im Gesicht mit Kabeln und Platinen wie eine Maschine aussehen lassen.
Akhlut Anernerk: Chief des Präsidiums, wird Der Wolf genannt
Taima Inyanke: Verlobte von Finnley, Wissenschaftlerin
Tatoke Inyanke: Vater von Taima, Oberhaupt des einflussreichen Inyanke-Clans
Oti Win: Mutter von Taima, führt den Clan mit ihrem Mann an
Hanpi Napé: Medizinmann bei der Polizei, ähnliches Aufgabengebiet wie ein Pathologe
Ehawee: Enge Freundin von Tate
Was zuvor geschah
Für seine große Liebe Taima ist Finnley aus Schottland nach Powtanka gezogen. Ein Land, in dem er durch seine Tätowierungen und seine Andersartigkeit ständig aneckt. Er bewirbt sich bei der Polizei für den Streifendienst und wird bei der Sondereinheit Geistkrieger eingestellt, die bei spirituellem Missbrauch zum Einsatz kommt. Ohne Einarbeitungszeit begleitet Finnley das Team zu Tatorten grausamer Totemmorde. Die Opfer wurden von unsichtbaren Kräften vor Zeugen zerfetzt. Die Geistkrieger geraten unter enormen Druck, und ausgerechnet der unerfahrene Schotte, den alle Tunkan wiscasa (Steinmann) nennen, wird für seine Kolleginnen und Kollegen zum Lebensretter. Es kommt heraus, dass der Schotte von Fenrir, einem nordischen Totem, erwählt wurde, die Reinigung und Zusammenführung aber noch nicht vollzogen wurden, weswegen Finnley bei Fenrirs Präsenz unter massiven Blackouts leidet. Widerwillig stimmt er dem Ritual zu und verlangt, dass Chenoa, die Schamanin der Geistkrieger, es durchführt, weil ihm gesagt wurde, das Totem würde die durchführende Schamanin spirituell beschenken. Was ihm verschwiegen wurde, sind die Risiken, die mit dem Ritual verbunden sind. Die Zusammenführung gelingt, aber das Geschenk, das Fenrir Chenoa macht, verkompliziert alles: Die Zeremonie endet leidenschaftlich, und die Schamanin empfängt ein vom Totem gesegnetes Kind.
Für Finnley sollte der Stand als vollwertiger Hüter eine Aufwertung sein, aber durch Chenoas Schwangerschaft gehen die Clanfehden erst richtig los. Und was das Ganze noch komplizierter macht: Sein Herz kann zwischen den beiden Frauen nicht mehr unterscheiden, er liebt beide und braucht sie in seiner Nähe.
Ihm bleibt allerdings keine Zeit, das Geschehen zu verarbeiten. Das Team kommt zusammen, und Tate offenbart, dass der Totemmörder bei ihm eine Gabe aktiviert hat, die er ihm aus dem Kopf reißen will. Tate kann Körper anderer übernehmen, wofür er nur deren Namen wissen und in der unmittelbaren Nähe sein muss. Ein Anschlag auf ihn sollte verhindern, dass der Totemmörder es an sich reißen kann, aber Tate überlebt.
Mit Finnley als vollwertigen Hüter im Team sind sie zuversichtlich, Tate vor weiteren Angriffen schützen zu können, doch sie geraten in einen Hinterhalt, bei dem er von den anderen isoliert wird. Tate sieht die Zerstörung der Gabe als einzigen Ausweg und richtet seine Dienstwaffe gegen sich selbst. Der Unbekannte vereitelt den Suizid und bekommt, was er so sehr begehrt. Die Totemmorde enden, aber der Schuldige, der fortan Gabensammler genannt wird, ist weiterhin auf freiem Fuß und nun eine weitaus größere Bedrohung als zuvor.
Kapitel 1
Die Libelle flog seit vielen Meilen unaufhaltsam von der Westküste durch das weitläufige Land Richtung Osten. In ihrem kleinen Körper lebte etwas anderes, das sich als blinder Passagier durch den festen Panzer gefressen hatte und Pheromone freisetzte, die zu dieser rastlosen Reise drängten. Im Innern war er sicher, egal, ob Vogel oder Fledermaus dem Trägertier ein Ende bereiteten, der Passagier würde nur in einen anderen Körper wechseln.
Aber die tapfere Libelle wurde nicht gefressen. Die glitzernden Flügel bekamen kleine Risse, während der Leib in der Sonne auszutrocknen begann. In diesem Landstrich wurde es niemals richtig kalt, und doch hätte das Insekt jetzt in einem ruhigen Versteck nahe einem Gewässer Winterruhe halten und auf das Ende seiner Lebenszeit warten sollen. Genau dort, wo die vorige Wirtin die Libelle auf die Hand genommen hatte, um sie vom Boden auf ein Schilfblatt zu setzen. Eine bessere Wahl hatte der blinde Passagier zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gehabt, weil er seinem Instinkt folgend seinen Stamm ausbreiten und dafür von Lebewesen zu Lebewesen wandern musste. Doch dieses Insekt war schwach und nach den vielen Meilen seines Flugs verbraucht. Im schlimmsten Fall fiel es vor dem Ziel einfach zu Boden und würde, für Fressfeinde uninteressant, liegen bleiben. Zumindest das musste vermieden werden. Der Passagier regte sich und schob sich durch die festen, kaum nennenswerten Eingeweide. Der Flug wurde holprig, die Flügelschläge setzten einige Male aus und ließen den dünnen Körper abwärts trudeln, bevor sich die Libelle wieder fing und weiterstrebte.
Instinkte einfacher Wesen ließen sich leicht beeinflussen, selbst von einem Bakterium, das eigenen Instinkten folgte. Vor allem die Menschen vergrößerten das Netzwerk seines Stamms, wann immer sie einander küssten, sich die Hände reichten oder Türklinken benutzten. Reisende trugen die Zellen durch das ganze Land und setzten somit fort, was die Meisterzelle begonnen hatte. Es war nur eine Frage der Zeit, bis ganz Powtanka mit diesen mikroskopisch kleinen Lebensformen abgedeckt sein würde. Je größer die Anzahl, desto besser konnte das Bakterium seine Abkömmlinge erreichen, ihnen Impulse senden, um das eigene Fortbestehen zu sichern und zu stärken. Genau dafür flog die Libelle über karges Ödland Richtung Ostküste.
Seit Stunden war der Kontakt zum Stamm abgerissen, weil sich die Neuinfektionen nicht mehr in erreichbarer Nähe befanden und die spirituelle Macht durch den winzigen Wirt sehr begrenzt war. Das Bakterium empfand keine Angst, es kannte nur Leben und Überleben, auf nichts anderes war es programmiert. Der Tag, an dem es den geeigneten Wirt für den dauerhaften Verbleib fände, wäre auch der Tag, an dem es sich vollkommen auf die eigene Zellteilung konzentrieren konnte, ohne nur kleine Ableger auszusenden. Es musste ein Gehirn mit besonderen Fähigkeiten sein, das die Ausmaße des Netzwerks erfassen könnte. Die Libelle flog immer tiefer. Die Flügelschläge erfolgten unregelmäßig und schwach, ein Absturz war unumgänglich, wenn dem Bakterium nichts Rettendes einfiel. Also veränderte es das Flugverhalten der Libelle. Was das Insekt bislang vermieden hatte, wurde nun von dem Passagier provoziert: Die Libelle machte auf sich aufmerksam.
Der schmale, glänzende Körper flog im Vorwärtsstreben auf und ab, während die Komplexaugen vom Bakterium zersetzt wurden, damit das Insekt nicht mehr auf Fressfeinde reagieren konnte. Durch die neuen Anstrengungen des Blindfluges verlor es abermals an Höhe. Das Bakterium verstoffwechselte die Proteine des Hirns, um sich für das, was kommen würde, zu stärken. Ganz aufs Überleben gepolt, blieb es wachsam und bereit für einen neuen Wirt.
Unvermittelt endete die Reise mit einem harten Aufprall. Das schlauchartige Herz versuchte, weiterhin die Hämolymphe durch den Körper zu pumpen, die durch die Nervenknoten ausgelösten Zuckungen täuschten über den Tod des Insekts hinweg, dessen Kopf nur noch eine leere Hülle war. Dem Bakterium blieben nur wenige Minuten, um einen neuen Wirt zu finden, weil es in einem toten Organismus nicht leben konnte. Sekunde um Sekunde verstrich, während es vergebens Impulse aussendete. Sein Stamm war außer Reichweite, und es kam auch kein Tier, das die Libelle fressen würde. Der Untergrund war das tote Holz einer Veranda, über die Sandkörner wehten. Nicht mal eine Pflanze, in die sich das Bakterium retten konnte.
Eilige Schritte trampelten über die Dielen, begeisterte Kinderstimmen und eine kleine Hand, die den leblosen Libellenkörper aufhob. Das Bakterium nutzte diese Gelegenheit, brach durch die Komplexaugen und heftete sich an die warmen Finger. Das Mädchen musste sich nur noch über die Augen reiben, einen Finger in den Mund stecken oder in der Nase bohren, dann wäre das Bakterium sicher.
Lauernd klebte es auf der Haut, während die Libelle in einem Glas landete. Das Mädchen ging ins Bad, drehte den Wasserhahn auf, wobei sich das Bakterium an der Drehvorrichtung halten konnte. Es war das Gehirn, das überleben musste, denn ohne die eigene Vermehrung würde der Rest seines Stamms unbrauchbar in den Körpern der Menschen wuchern und schlussendlich absterben. Das Mädchen drehte das Wasser wieder ab, und das Bakterium erhaschte einen Finger.
Dann lief das Kind durch das Haus in den ersten Stock, bückte sich und hob einen Schnuller auf. Er war noch warm, konnte also noch nicht lange auf dem Boden liegen. Nebenan schrie ein Säugling.
Kapitel 2
Der Winter bringt sogar den westlichen Gefilden kühle Temperaturen, die in der Nacht teils unter zehn Grad fallen. Aber das wird den anstehenden Wikingertagen keinen Abbruch tun. Das traditionelle Schmücken der Häuser wird ab Samstag die Stadt in ein Spektakel verwandeln, das den nordischen Besuchern des Jahres 860 alle Ehre machen wird.
Yurokta Aktuell wird in der kommenden Woche über die Feierlichkeiten ganz Powtankas berichten. Gerüchten zufolge wird in Kanaston eine japanische Delegation erwartet, die vom Chief der Nation persönlich zu den Wikingertagen eingeladen wurde. Kritiker bemängeln das fehlende Fingerspitzengefühl, in der Woche Fremde ins Land zu holen, in der Powtanka die erfolgreiche Abwehr sämtlicher Invasoren feiert. Wir dürfen auf die Rede des Chiefs gespannt sein. Die wichtigsten Veranstaltungstermine befinden sich auf Seite 12.
Noch war Tate allein im Büro. Es war der erste offizielle Arbeitstag nach seiner Genesung, was ihm schon beim Betreten des Polizeigebäudes neugierige Blicke eingebracht hatte. Der Streifschuss am Kopf war gut verheilt, aber nun zog sich eine lange Narbe von der linken Schläfe bis hinters Ohr, die durch ihr frisches Rosarot auffiel. Mit der Zeit würde das Gewebe heller und unauffälliger werden, aber da an dieser Stelle keine Haare mehr wuchsen, bliebe die Narbe immer sichtbar.
Fünf Monate waren eine lange Zeit. Erst sollte er in Ruhe genesen, dann wurde er für sein Verschweigen der Gabe mit einer Suspendierung bestraft und in dieser Zeit mehrfach spirituell auf den Kopf gestellt. Niemand wollte so recht glauben, dass er die Fähigkeit, andere Körper zu übernehmen, verloren hatte. Obwohl unterschiedliche Schamaninnen und Schamanen keine Hinweise mehr finden konnten, beendete der Wolf die Suspendierung erst jetzt. Tate wusste, dass Anernerk ihn nur spüren ließ, was es bedeutete, dem Chief derartige Informationen vorzuenthalten. Aber die Fehler der Vergangenheit musste ihm niemand mehr unter die Nase reiben. Die Erinnerungen quälten ihn. Wenn er die Waffe nur ein paar Sekunden früher gegen sich selbst gerichtet hätte, wäre er erfolgreich gewesen. Dann wäre der Angreifer leer ausgegangen, und Tate hätte zumindest verhindert, dass ein Wahnsinniger Personen wie Hemden wechseln konnte. Ich bin ihm direkt in die Falle gelaufen.
Wieder drehten sich seine Gedanken im Kreis, in diesem Büro sogar noch stärker, weil er gar nicht mehr hier sein sollte. Er hatte damals sein Team in Gefahr gebracht, ohne auch nur irgendeinen Nutzen daraus zu ziehen. Beim besten Willen konnte er sich nicht an das Gesicht des Angreifers erinnern, der ihm die Gabe aus dem Kopf geschält hatte. Jede Spur endete in einer Sackgasse. Der Mann war gefährlich, weil er Menschen das sehen lassen konnte, was sie glauben sollten. Tates Laune wurde zunehmend schlechter. Es fühlte sich falsch an, noch zu leben – als gehörte er gar nicht mehr in diese Welt. Verdammt, ich hätte diese verfluchte Gabe mit ins Grab nehmen müssen.
Wer auch immer dahintersteckte, er musste nur noch den Namen seiner Zielperson wissen und konnte in deren Nähe binnen eines Wimpernschlags den Körper übernehmen. Wenn niemand astral hinsah, würde es keiner bemerken. Was für eine unfassbare und gefährliche Macht. Die Skrupellosigkeit des gegnerischen Vorgehens verhieß absolut nichts Gutes. Dieser Kerl war nicht davor zurückgeschreckt, willkürlich Menschen zu töten, um an sein Ziel zu kommen. Die Bilder, die Tate als Visionen gezeigt worden waren, hatten von einem Krieg erzählt, der Powtanka vernichten würde. Tate wusste nicht, wie viel er davon glauben sollte, aber er musste vom Schlimmsten ausgehen. In den fünf Monaten, die er offiziell nicht arbeitsfähig gewesen war, hatte er trotzdem mit Deidra und Thure über den Fakten gebrütet, um den Kerl nicht davonkommen zu lassen. Doch erfolglos. Keine Zeugenaussage, Beweismittel oder Fingerabdrücke brachten sie weiter. Der Mann war ein Geist, oder besser: ein tiefer Schatten, der sich langsam über Powtanka ausbreitete.
Die einzige brauchbare Erkenntnis war, dass die Gaben in den Köpfen mancher existierten und jederzeit aktiviert werden konnten. Etwas, das nur dem großen Geist vorbehalten sein sollte, um die Symbiose von Mensch und Natur zu schützen.
»Wie schafft es der Kerl, sie zu aktivieren?«, sagte er leise vor sich hin. »Wie kann er anschließend in Köpfe hineingreifen und sie rausreißen?« Jeden Tag horchte Tate in sich hinein, ob seine Fähigkeit, in andere Körper zu wandern, tatsächlich verschwunden blieb. Für ihn war es besser, wenn sie sich nie wieder zeigte, weil der Nationalrat ihn damit nicht frei herumlaufen lassen würde. Das Letzte, was er derzeit ertragen konnte, war, im Fokus der Ältesten zu stehen.
Sein Blick fiel auf die graue Geierfeder der Schuld, die an einem Lederband vom Dolch im Türrahmen baumelte. Anernerk hatte deutlich gemacht, dass er von diesem Team erwartete, die Fehler wiedergutzumachen und den Schuldigen hinter Gitter zu bringen. Aber wie fing man einen Schatten?
Seine Kolleginnen und Kollegen hatten viel Arbeit mit den zahlreichen Vernehmungen der Studierenden, die bei dem Überfall dabei gewesen waren, und deren Angehörigen gehabt. Aber da war nichts, nicht mal ein winziges Indiz, das sich irgendwo hineingeschlichen hatte und einen Hoffnungsschimmer weckte. Tate rieb sich übers Gesicht und sah sich im Büro um. Er musste auf andere Gedanken kommen, bevor in seinem Kopf alles von vorn begann.
Finnleys Schreibtisch sah inzwischen benutzt aus. Aufnahmegeräte standen dort auf Ladestationen, ein Computer und diverse Notizzettel rundeten das Bild ab. Offenbar war der Schotte endgültig im Team angekommen.
»Unser Hüter«, sagte Tate und erinnerte sich an die rasanten Geschehnisse, die aus dem unerwünschten Fremden ein angesehenes Teammitglied gemacht hatten.
»War die Sehnsucht so groß?« Deidra kam durch die Tür, ließ die Lichtadern etwas heller leuchten und hängte die Jacke über ihren Stuhl. »Schön, dass du wieder da bist und wir uns nicht mehr heimlich bei dir treffen müssen. Hat sich schon wie eine anrüchige Teamaffäre angefühlt.«
Tate grinste schief. »Anernerk hatte ein Einsehen mit mir, dass es keinen Unterschied macht, ob ich arbeite oder ihr mich anders auf dem Laufenden haltet. Dieser Mann weiß einfach alles. Haben wir schon was Neues?«
Deidra setzte sich an ihren Schreibtisch, schaltete den Computer ein und faltete die Hände auf der Tischplatte. Trotz ihrer dunklen Haut bemerkte er tiefe Schatten unter ihren Augen. Offensichtlich ging es ihr auch nicht besser als ihm. Sie sah mitgenommen aus, und er war nicht hier gewesen, um einen Teil der Last mitzutragen – was sein schlechtes Gewissen nur noch mehr belastete.
»Es macht mich nervös, dass alles ruhig geblieben ist«, sagte sie und wirkte resigniert. »Wir haben uns durch so viele Nachrichten gewühlt. Nichts. Absolut nichts ist zu finden. Wenn er deine Gabe einsetzt, muss er sehr geschickt vorgehen.«
»Früher oder später wird er sich zeigen, und dann holen wir ihn uns, das verspreche ich dir«, versicherte er bemüht zuversichtlich. Tatsächlich wollte ihm keine Strategie einfallen, mit der sie sich vor der Gabe schützen konnten. Er hatte sie selbst benutzt, als er es noch gekonnt hatte. Es war so leicht gewesen: nur den Namen denken und im Kopf die leuchtende Kugel erscheinen lassen. Dieser Kerl war auch ohne die Seelenwanderung viel zu mächtig gewesen, jetzt konnte er sich überall befinden und Grenzenloses mit seinen Fähigkeiten anstellen. Wenn Tate wenigstens die Motivation gekannt hätte. Er fürchtete sich nicht vor den Gierigen, sondern vor jenen Soziopathen, die Chaos und Leid anstrebten.
»Was, wenn er die ganze Zeit aktiv ist und wir es nicht sehen?« Deidra langte zum Kopf und zog den strengen Zopf fester. »Ich muss immer an die Vision denken, die diese junge Frau dir gezeigt hat. Ob nun beeinflusst oder nicht, sie hat die Gabe besessen, dich das sehen zu lassen – was, wenn das unsere Zukunft ist?«
Diese Befürchtung hatte sie schon öfter ausgesprochen, und wie immer wusste Tate nicht, was er sagen sollte. Diese Vision war das Einzige, womit sie noch arbeiten konnten. Abstrakte Bilder, die eine grauenhafte Zerstörung skizzierten, die in Powtanka undenkbar war. Das Volk beschützte die Natur und tat alles für das Gleichgewicht. Tate hatte Fremde gesehen. Asiaten und Europäer. Große Maschinen, die sich durch die Erde gruben, und blutige Aufstände. Was würde der Kerl alles anstellen, um das zu erreichen? Tate musste sich räuspern, um die Stimme freizubekommen. »Was hältst du von der Entscheidung, ausgerechnet zu den Wikingertagen japanische Besucher einzuladen?«
So wie sie die Zähne aufeinanderbiss, war sie dieses Novum gedanklich auch schon mehrfach durchgegangen. »Kehkehwa Pinu’u hat in seiner Ansprache von der Symbolik dieser Geste gesprochen. Dass die Wikinger uns Wissen und Fortschritt schenkten und es nun an der Zeit sei, im Sinne des globalen Umweltschutzes etwas zurückzugeben. Japan sei bereit, sich diesem Vorhaben anzuschließen, aber ich habe trotzdem ein komisches Gefühl dabei.«
Tate hatte die Rede vom Chief der Nation ebenfalls gesehen. Er hatte über Klimawandel und die Erhaltung der Artenvielfalt gesprochen. Japan sei Powtanka gar nicht so unähnlich in seinem Umgang mit Naturgeistern, dem Lebensraum und Fremden.
»Du wärest keine von uns, wenn du nicht so empfinden würdest«, sagte er. Die Unruhe wuchs in seiner Brust, kam seit fünf Monaten ständig in Wellen, die ihn wie einen Schiffbrüchigen zwischen Erinnerungen, Theorien und Befürchtungen vorwärtstrieben. Wo käme er an, wenn er sich weiter an den Fakten festhielt, damit er nicht unterging? »Bevor die anderen kommen: Gibt es irgendwas Neues, das ich wissen muss?«
Deidra zuckte mit einer Schulter. »Du meinst, ob das Gerangel um den Hüter und sein Kind schon auf den Höhepunkt zugeht?«
Er nickte.
»Das wird kein gutes Ende nehmen. Ich glaube, Finnley versteht immer noch nicht, um was für einen Machtgewinn es für die Clans geht. Noch steht der Plan, dass Chenoa das Kind an ihn und seine Verlobte übergibt. Du wirst sehen, wie sehr die beiden versuchen, die Gefühle füreinander zu unterdrücken. Ich wette, der spirituelle Bund wird irgendwann über den weltlichen siegen, dann wird es sicher richtig hässlich.«
Tate nickte wieder. Die Clans interessierten sich nicht für Gefühle, ihnen ging es um Politik, wofür sie über Naturgesetze gern hinwegsahen, solange es Wakan Tanka nicht erzürnte. »Hast du mit ihm darüber geredet?«
Ein Seufzen verneinte, bevor sie die Antwort aussprach. »Vielleicht kommst du an ihn ran, bei mir macht er sofort dicht. Er hat sich auf seine Aufgabe konzentriert und tapfer alle alten Geistkriegerakten durchgelesen, um mehr über unsere Arbeit zu lernen. Nach seinem schwierigen Einstieg scheint er nun angekommen zu sein.«
Ihre recht nüchterne Ausführung ließ erahnen, dass sie sich Sorgen machte, die sie lieber für sich behielt, aber die musste sie auch nicht aussprechen. Beide Clans würden kurz vor der Niederkunft den Druck erhöhen, um das gesegnete Kind für sich zu beanspruchen. Was bedeutete, dass die schwierige Zeit erst noch vor ihnen lag. »Denkst du, er weiß, was er will?«
Deidra stieß genervt die Luft aus. »Ich glaube nicht mal, dass er überhaupt wahrhaben will, dass er sich entscheiden muss.«
Tate musste an das Gespräch denken, das er mit Finnley damals auf dem Weg zur gemeldeten Harpyie geführt hatte. Darüber, dass man loslassen müsse, um eine Bindung zu stärken. Und dass die Menschen in Powtanka jederzeit frei seien, ihrem Herzen zu folgen. Der Schotte musste ihn für einen Lügner halten, weil für Finnley offenbar ständig andere Regeln galten. »Ich hoffe nur, dass er sich von alldem nicht ablenken lässt. Er würde doch merken, wenn er dem Gabensammler gegenübersteht, oder? Fenrir würde die Gefahr wittern.« Seine Frage kam ihm naiv und hilflos vor.
»Nur wenn eine unmittelbare Gefahr besteht. Finnley sagt, dass Fenrir kein Hund sei, der jeden, dessen Nase uns nicht gefällt, auf Befehl abschnuppern würde. Ganz ehrlich, ein Spürhund wäre mir gerade lieber.«
Auch wenn Tate ihr zustimmte, war es doch beruhigend, einen vollwertigen Hüter im Team zu haben. Wenn sich das Fenrirgesicht zeigte und Finnley in den Beschützermodus wechselte, war er ein mächtiger Krieger. Es war albern, jemandem wie ihm überhaupt Vorschriften machen zu wollen. »So oder so, wir finden den Kerl und bringen ihn zur Strecke. Niemand nimmt mir was weg und kommt ungestraft damit durch«, setzte er nach.
Deidra zuckte nur mit den Schultern, Tate konnte sich vorstellen, was sie dazu sagen wollte, aber sie war niemand, der jammerte oder die Moral untergrub. Stattdessen blieb sie sachlich. »Wir bleiben vorerst bei unserer Routine«, sagte sie und presste einen Finger auf den Scanner, damit sie auf das Computersystem zugreifen konnte. »Wir haben unsere Aufmerksamkeit auf das landesweite Tagesgeschehen ausgeweitet, aber sollte er bei den Räten mitmischen, fällt sein Wirken bislang nicht auf.«
Die Tür wurde geöffnet, und Chenoa und Finnley kamen herein. Sie wirkten vertraut miteinander, auch wenn sie mit Abstand den Raum betraten. Es hieß, das Totem würde durch die Vereinigung ebenfalls etwas wie Liebe – nur wesentlich spiritueller – empfinden, was immer stärker als weltliche Empfindungen sei. Durch die Zusammenführung könne sich der Hüter jedoch nicht davon abgrenzen, weswegen es nur eine logische Entscheidung gab: Finnley und Chenoa mussten zusammenbleiben und gemeinsam das Kind großziehen. Tunkan wiscasa – unser Steinmann. Den Spitznamen würde der Schotte behalten, ob er wollte oder nicht.
»Ah, ihr kommt gemeinsam zur Arbeit?«, fragte Tate und grinste die beiden an.
Augenblicklich versteinerten ihre Mienen, und sie grüßten ihn verhalten.
»Schon gut, geht mich nichts an. Tut mir leid, das war nicht die Begrüßung, die ich eigentlich äußern wollte«, entschuldigte sich Tate und schaltete ebenfalls seinen Computer ein.
»Wie geht es dir?«, lenkte Chenoa das Thema auf ihn.
Seit sie ihn aus dem Krankenhaus geholt hatten und er den Strapazen Tribut zollen musste, indem er wochenlang zu schwach für die Arbeit gewesen war, blieb vieles ungesagt. Er musste etwas unternehmen, sich rächen und den Wahnsinnigen stoppen, um wieder zu seinem gewohnten Gleichmut zurückzufinden. »Noch immer gedemütigt, mein Stolz wurde angeschossen, und ich habe große Lust, dem Kerl in die Fresse zu schlagen.« Ja, das würde helfen. Es ärgerte ihn, dass er sich an kein vernünftiges Detail erinnern konnte, obwohl er sonst niemals etwas vergaß. »Aber rein physisch bin ich wieder obenauf.«
»Schön, dass du wieder da bist«, sagte Chenoa und setzte sich auf ihren Platz.
»Ich bin auch froh«, erwiderte Tate und betrachtete die Benutzeroberfläche seines Computers, die sich seit seinem letzten Einloggen vor über fünf Monaten nicht verändert hatte. Der Hintergrund zeigte ein Foto von einem roten Haus an einem mit leichtem Nebel verhangenen See. »Wie ich hörte, ist hier nicht viel passiert.«
»Nicht viel?«, übernahm Finnley. »Absolut gar nichts. Wir sind kleineren Meldungen nachgegangen, die aber allesamt uninteressant waren.«
So ruhig also. Wenigstens musste Tate kein schlechtes Gewissen haben, weil sie ohne ihn in Schwierigkeiten geraten waren.
»Und mit euch beiden ist alles gut?« Er musste einfach nachfragen.
»Auf jeden Fall«, sagte Chenoa. »Wir haben alles geklärt, jetzt muss das Kind nur noch auf die Welt kommen.«
Finnley presste die Lippen aufeinander und senkte den Blick. Ganz offensichtlich war er anderer Meinung, aber das behielt er für sich.
»Ihr wisst schon, dass die meisten Hüter mit ihren Schamaninnen zusammenbleiben, oder?« Tate kannte nicht einen Bericht über derartige Verbindungen, der etwas anderes verriet. Und wenn er es wusste, dann wussten es Taimas und Chenoas Familien auch. Es war also nur eine Frage der Zeit, wann Tatoke Inyanke auf den Bund der Ehe bestehen würde, um den Hüter im Clan zu sichern.
Chenoa hatte jedenfalls nie besser ausgesehen. Als umgäbe sie eine ganz besondere Aura. Ihr Bauch war inzwischen deutlich vorgewölbt und würde in den kommenden Wochen stetig wachsen.
Seine Frage wurde einfach ignoriert, als wären beide inzwischen sehr geübt darin, keine Reaktionen auf dieses Thema zu zeigen.
»Die Frauenwelt wird froh sein, dass du wieder fit bist«, scherzte Chenoa ungewohnt unkritisch, als habe er die Frage nie gestellt. Sie strich mit den Fingern über die Schnitzereien, die sie der Tischplatte offensichtlich neu hinzugefügt hatte.
Tate war die Lust nach Abenteuern vorerst vergangen, aber das kaschierte er mit einem Grinsen.
Finnley setzte sich an seinen Tisch und kontrollierte die Geräte. Morgendliche Routine eines eingespielten Teams.
»In Yurokta wurden vermehrt leichte Auraveränderungen registriert. Ansonsten symptomlos, nur leicht erhöhte Blutwerte, die auf Infektionen hinweisen«, fasste Deidra zusammen, was sie in den Neuigkeiten lesen konnte. »Wahrscheinlich erste Anzeichen der Grippewelle.«
Tate klickte das Board mit der aktuellen Landespresse an und fing ebenfalls an zu lesen. Sie suchten nach ungewöhnlichen Vorkommnissen oder Ungereimtheiten, die auf spirituellen Missbrauch hindeuten konnten. Auch wenn der Fall noch nicht abgeschlossen war, musste das Tagesgeschäft weitergehen.
»Was so alles in der Zeitung steht«, kommentierte Finnley. »Hier, in Schoschno hat ein Säugling mit vier Monaten laufen gelernt und versucht seitdem, ständig abzuhauen. Als gäbe es keine wichtigeren Meldungen.«
»Warte.« Bevor er die Meldung wegklicken konnte, ging Chenoa zu ihm und sah ihm über die Schulter. Tate fiel auf, dass sie dabei den Kontakt zu ihrem Kollegen suchte. Leichte Berührungen am Arm, mal eine Hand auf dem Rücken – und Finnley lehnte sich zurück, um die Nähe zu erwidern.
»Jemand soll sich den Kleinen mal ansehen«, sagte Chenoa. »Schoschno befindet sich eher im Landesinnern, da werden wir wohl jemanden aus der nächstgelegenen Großstadt schicken müssen.«
»Ist das dein Ernst?« Deidra schüttelte den Kopf. »Schoschno liegt verdammt abgelegen. Die werden da drüben nicht begeistert sein, wenn sie wegen so was den weiten Weg auf sich nehmen sollen.«
Chenoas rechte Hand wanderte zum Bauch und strich über die Wölbung. »Vier Monate alte Kinder laufen nicht, das ist ungewöhnlich. Und vielleicht sollte man einfach mal schauen, wo der Kleine hinwill, wenn er ständig auszureißen versucht?«
»Da spricht wohl die werdende Mutter?«, sagte Deidra, was Tate in Bezug auf Chenoa gedankenlos fand. Sie musste sehr abgelenkt sein, damit sie das nicht selbst bemerkte. Während sie sprach, sah sie nicht mal vom Display auf. »Du wirst sehen, dass kein Kind wie das andere ist. Manche werden eben sehr früh mobil.«
Chenoa richtete sich auf und unterbrach den Kontakt zu Finnley. »Ich werde niemals die Mutter von diesem Kind sein. Also behalte derartige Kommentare zukünftig für dich.«
Tate hörte Deidras Entschuldigung nicht zu, sondern beobachtete Finnley, dem dieser Wortwechsel nicht behagte. Wie er es sich gedacht hatte, schien der Schotte eine andere Meinung zu Chenoas Mutterschaft zu haben. Er rieb sich über den Nacken und vermied jeden Blickkontakt. Da werde ich wohl dringend mit dir reden müssen. Ihm tat der Steinmann in gewisser Weise leid. Trotz all der Tätowierungen, die Finnley wie eine halbe Maschine aussehen ließen, steckten viele Gefühle in ihm. Ein seltsamer Kontrast, der ihn noch sympathischer machte.
»Wie wäre es mit einem Kaffee?«, warf er in die Runde. »Tunkan, hilfst du mir tragen?«
Dankbar stand Finnley auf und wartete, dass sie losgingen.
»Und falls ihr meine Meinung braucht«, sagte er an die Frauen gewandt. »Bislang lag Chenoa mit ihrer Intuition immer richtig, also sollten wir jemanden hinschicken.«
Ohne auf eine Antwort zu warten, verließ er den Raum und legte Finnley im Flur freundschaftlich eine Hand auf die Schulter. »Wenn du über all das mal offen reden willst, sag Bescheid. Ich kann mir vorstellen, dass die Situation nicht gerade leicht für dich ist.«
Finnley grinste, sodass sein versilberter Eckzahn zum Vorschein kam und im bläulichen Schein der Lichtadern glänzte. »Ich bin echt froh, dass du wieder da bist. Taimas Familie macht mich echt fertig mit ihren Versuchen, mich auf die Zeremonie vorzubereiten. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht.« Sie gingen den Flur zur kleinen Küche entlang. »Ist es wirklich notwendig, all diese Phrasen auswendig zu lernen? Ich komme mir eher vor, als hätte man mir die Hauptrolle eines Theaterstücks aufgezwungen, als dass ich die Frau heirate, die ich liebe.«
Tate schwante das Schlimmste. »Ich hoffe, du nimmst das ernst und lernst fleißig.«
Finnley blieb stehen und drehte sich zu Tate, der ebenfalls stehen blieb. »Seit ich in dieses Land gekommen bin, warte ich darauf, von Taimas Clan den Segen für diese Hochzeit zu bekommen. Natürlich nehme ich es ernst.«
Im Eingangsbereich sah er Ehawee, die in Zivilkleidung am Tresen stand und mit ihren Kollegen sprach. Finnley folgte seinem Blick und legte nun ihm eine Hand auf die Schulter. »Warum kümmerst du dich nicht als Erstes um deine Angelegenheiten?«
Er ging weiter, während Tate die Richtung wechselte und Ehawee begrüßte.
Ihre Haut wirkte durchscheinend, was ihre fragile Erscheinung verstärkte, aber als sie ihn ansah, erblickte er die vertraute Lebendigkeit in ihren Augen. Vielleicht wirkte es auch nur so auf ihn, weil er nicht vergessen konnte, wie krank sie nach dem Totemangriff gewesen war. Sie gingen ein paar Schritte vom Tresen weg, obwohl sie dennoch nicht offen aussprachen, was sie eigentlich sagen wollten. »Es ist schön, dich wieder auf den Beinen zu sehen.«
»Das kann ich auch von dir sagen«, erwiderte sie.
»Wie geht es dir?«
Betroffen senkte sie den Blick und rieb sich über die Oberarme. »Die vielen Tiere fehlen mir, aber eine Katze ist geblieben.« Sie sah sich um und zeigte dann auf eine orange getigerte Katze, die am Eingang schnupperte.
Tate musste lachen. »Ich durfte ihre Gesellschaft auch ein paar Tage genießen. Solange sie nicht auf dich aufpassen soll, ist alles gut.«
Mit einer zögerlichen Bewegung nahm er ihre Hand, was sich nach allem gut anfühlte, und drückte ihre Finger leicht. »Du bist stark«, sagte er ermutigend. »Geh kleine Schritte. Ich kann mir vorstellen, dass die Erwartungen an dich wieder sehr groß sind, aber tu nicht mehr, als gut für dich ist.«
Sie sah sehr traurig aus, als sie lächelte und nickte. »Manchmal denke ich, es wäre besser gewesen, ich hätte nicht überlebt.«
Allein für diese Aussage wäre er gern zu ihrem Clan gefahren, um sie ein für alle Mal dort rauszuholen, aber nichts dergleichen stand ihm zu. Von ihr wurde erwartet, dass sie funktionierte, sich um ihren gelähmten Mann und die Kinder kümmerte und den Clan unterstützte.
»Lass uns demnächst essen gehen, und dann reden wir über alles, ja?«
Sie sah an ihm vorbei, zog ihre Hand zurück und nickte jemandem zu. Über die Schulter entdeckte er Finnley, der mit vier Bechern beladen war. »Ich habe von eurem Hüter gehört«, sagte sie abgelenkt. »Er soll gut auf euch alle aufpassen.«
Tate fasste sich an die Narbe am Kopf. »Ich bin froh, dass er da ist.«
Sie sah ihm in die Augen, und Tate hätte sie am liebsten in den Arm genommen, weil sie so erschöpft wirkte.
»Ich bin froh, dass du alles überstanden hast.« Langsam ging sie rückwärts zum Tresen zurück.
»Schreib mir, wann es bei dir passt«, sagte er gerade so laut, dass sie es noch hören konnte, und nahm ihr Schweigen als Bestätigung.
Die Wunden würden heilen, bei jedem. Ehawee litt bereits viel länger als er. Tate wandte sich um, nahm seinem Kollegen zwei Becher ab und folgte ihm. Ich werde dich finden und für das bezahlen lassen, was du ihr angetan hast. Das war kein leeres Versprechen, Tate war überzeugt, nur überlebt zu haben, weil jemand den Kerl stoppen musste. Es war Wakan Tankas Wille, und Tate hatte nichts mehr zu verlieren.
Kapitel 3
Schoschno
Taborri parkte vor der alten Holzfarm, die schon einige Ausbesserungen an der Fassade aufwies. Nur wenige wagten es, Häuser dort zu bauen, wo sie sich nicht gut mit der Natur in Einklang bringen ließen. Den Unterlagen nach waren es Powtankaner, aber ohne Clan waren sie kaum angesehener als Wasicun. Direkte Nachbarn gab es nicht, sie schienen von dem zu leben, was sie hier anbauten. Gerade mal Strom und fließend Wasser, ansonsten fehlte fast alles, was für Taborri selbstverständlich war. Diese Menschen lebten, wie die Vorfahren es vor einem halben Jahrhundert tun mussten – als habe die Moderne diesen Landstrich übergangen. Die Eltern waren am Vortag drei Stunden gefahren, um ihr Kind untersuchen zu lassen, das mit seinen vier Monaten bereits zu laufen begann und seitdem fortan auf jede Tür zustrebte, um das Haus zu verlassen.
Taborri sah zur Sonne, die in ihrem Zenit stand. Die Strahlen waren an diesem Ort selbst im Februar unangenehm stechend. Es kostete sicherlich unendliche Mühe, die angebauten Pflanzen vor dem Vertrocknen zu bewahren. Es war ihr unbegreiflich, wie man dieses Leben bevorzugen konnte. Schon der Gedanke, seine Kinder selbst unterrichten zu müssen, klang nervtötend und zermürbend. Jedes Mal, wenn sie dran war, sich im Clan um die Jüngsten zu kümmern, war sie froh, die Kinder hinterher wieder abgeben zu können. Diese Eltern konnten nicht mal einen Teil der Aufgaben auf andere übertragen. Sie machten alles allein, jeden Tag, und waren permanent mit denselben Menschen zusammen – Jahr für Jahr.
Sie ging zur Tür und klopfte an.
Im Haus war alles still.
»Familie Miakoda?«
Sie zog ihre schwarze Uniform zurecht und umrundete das Haus auf der überdachten Veranda. »Mein Name ist Taborri Anchahruu von der Polizei, ich würde gern mit Ihnen reden.« Dass sie eine Schamanin von den Geistkriegern war, ging diese Leute nichts an.
In dieser Jahreszeit war es nicht zu erwarten, dass die Familie auf dem Feld arbeitete. Sie wechselte die Sicht, um die Gegend auf der astralen Ebene zu betrachten. Das Land zeigte eine ganz eigene Energie, bescheidenes Leben in trockener Erde, das durch die Dürre eine schwächere Auraabstrahlung hatte als andere Gebiete. Mäuse, Insekten und Spinnen bewegten sich zwischen den wenigen Pflanzen.
»Was ist das?«, flüsterte sie und verließ die Veranda.
In einiger Entfernung lag eine größere, schwache Aura auf dem Boden. Es waren vielleicht zweihundert Schritte bis dahin. Um nicht zu stolpern, wechselte sie wieder die Sicht und ging etwas schneller.
»Hier stimmt definitiv etwas nicht.« Es war mehr als ein Gefühl. Als wäre die Natur an diesem Ort verstimmt oder in gewisser Weise besudelt.
Sie nahm ihr Mobiltelefon zur Hand und schickte eine Meldung an ihre Dienststelle mit der Bitte um Verstärkung.
Je näher sie kam, desto deutlicher erkannte sie einen kleinen, nackten Körper, der von der unerbittlichen Sonne ganz verbrannt war.
»Bei Wakan Tanka!« Sie lief schneller und zog ihr Jackett aus.
Der Säugling atmete schwer und starrte mit weit geöffneten Augen in die Ferne. Auf der knallroten Haut zeichneten sich dicke Brandblasen ab. Behutsam nahm sie ihn mit dem Jackett auf und trug ihn zum Haus zurück. Sie bezweifelte, dass ein Medizinmann noch viel für den Jungen tun konnte. Seine Aura war ganz schwach und flimmerte grünlich.
Wieder nahm sie das Telefon zur Hand und forderte zusätzlich ein medizinisches Team an. Beim Haus ging sie zum Hintereingang und drückte die Klinke runter. Die Tür war nicht verschlossen und führte direkt in die Küche.
Taborri wollte etwas sagen, während sie eintrat, aber als sie die Familie regungslos am Küchentisch sitzen sah, hätte sie vor Schreck beinahe den Jungen fallen gelassen. Vater, Mutter, Bruder und Schwester saßen am Tisch – einzig ihre Köpfe drehten sich langsam in ihre Richtung.
Die trockenen Lippen sprangen an mehreren Stellen auf, als sie gleichzeitig ein freudloses Lächeln zeigten. In der Mitte des Tisches stand ein Glas mit einer toten Libelle.
Taborri wich einige Schritte zurück und sah auf das Baby in ihrem Arm. Es sah sie ebenfalls an, verzog die verbrannten Züge zu einem Ausdruck der Freude, dann nieste es so plötzlich, dass die Haut an den Wangen platzte und zähes Blut hervorquoll. Entsetzt rieb sie sich mit einem Hemdsärmel übers Gesicht und wechselte erneut auf die astrale Sicht. In der Aura des Jungen bewegte sich etwas wie kleine, leuchtende Ameisen, die sich besonders im Kopf tummelten.
Sie sah das Blut, das auf ihr Jackett gespritzt war, in dem ebenfalls kleine Aurenherde immer kleiner wurden, bis sie erloschen. Vorsichtig legte sie den Jungen auf der Veranda in den Schatten und wählte eine Nummer auf ihrem Telefon. Es dauerte keine zwei Freizeichen, bis das Gespräch entgegengenommen wurde. »Du wolltest, dass ich mir das Kind ansehe«, sagte sie ohne Begrüßung. »Du hast recht, hier stimmt definitiv etwas nicht.«
Im Haus kratzten die Stuhlbeine über die Dielen. Taborri sah sich zu der Familie um, die sich langsam auf das Baby zubewegte. »Irgendwas ist in diesen Menschen, ich habe Aurenherde gesehen, die besonders …«
Der Vater stieg über den kleinen Körper hinweg und kam auf die Schamanin zu. Taborri griff nach ihrer Waffe und richtete sie auf den Mann. »Bleiben Sie sofort stehen.«
»Was ist da los?«, hörte sie Deidras Stimme aus dem Hörer.
Auch wenn er stehen blieb, wirkte er nicht minder bedrohlich. Sie hoffte inständig, dass die Verstärkung mit dem Hubschrauber käme. Seine Hände waren zu Fäusten geballt und das Kinn zur Brust gezogen. Der Mann starrte sie regelrecht an, was sich übergriffig und einengend anfühlte.
»Ich weiß nicht«, antwortete Taborri. »Der Vater des Jungen …« Mitten im Satz brach sie ab und ließ die Waffe sinken. Zeitgleich ging ein Ruck durch den Mann. Er blinzelte, als wäre er aus einem Tagtraum erwacht, rieb sich über den Nacken und sah sich verwirrt um.
»Taborri? Was ist da los?«, hörte sie die Stimme aus dem Telefon dringen.
»Ich muss weiter«, sagte Taborri und sah sich zur sandigen Ebene um. »Es ist alles gut.«
Sie ging los. Setzte zielstrebig einen Fuß vor den anderen, beendete das Gespräch, senkte die Hand mit dem Telefon und ließ es im Gehen einfach fallen, ebenso die Waffe. Das Gespräch war nicht mehr wichtig. Nichts war mehr von Bedeutung, sie folgte nur noch ihrem Instinkt, der ihr sagte, sie müsse nach Osten gehen. Vorbei an den vertrocknenden Pflanzen, der Stelle, wo der Junge gelegen hatte, und dann immer weiter.
Deidra legte auf und kaute nachdenklich auf ihrer Unterlippe. Es wäre ihr lieber gewesen, Chenoa hätte sich geirrt, weil nun das ungute Gefühl vorherrschte, ihre Kollegin in größere Gefahr gebracht zu haben als gedacht.
»Was ist?« Chenoa legte ihr Messer weg und wischte ein paar Späne von der Tischplatte.
»Das war Taborri«, sagte sie und ging im Geiste nochmals durch, was sie gehört hatte.
»Das habe ich verstanden, aber was hat sie gesagt?«
»Es war ganz merkwürdig. Anfänglich klang sie alarmiert, sie schien sogar die Waffe auf jemanden gerichtet zu haben, aber dann sagte sie, es sei alles gut, und hat das Gespräch beendet.«
»Ruf sie noch mal an«, verlangte Chenoa. »Lass mich mit ihr sprechen, ich will wissen, was sie gesehen hat.«
»Sie sagte, sie habe Aurenherde gesehen – kannst du damit etwas anfangen?« Nachdenklich wählte sie die Nummer. »Meinte sie Parasiten?«
»Möglich.« Chenoa machte eine drängende Handbewegung. In ganz Powtanka gab es zwanzig Geistkrieger-Einheiten, die einander ständig Bericht erstatteten, sodass sie längst keine Fremden mehr waren. Es galt immer noch, von den Erfahrungen gegenseitig zu profitieren, was auch über große Distanz zu einem freundschaftlichen Verhältnis beitrug. »Taborri hätte nicht allein dort hinfahren dürfen«, sagte Chenoa.
Das Freizeichen ertönte.
»Du hast recht. Ihr Teamleiter hat diese Meldung sicher ebenfalls nicht so bedeutsam eingestuft.« Deidra musste an ihr eigenes Team denken. Es war schon schwer genug, auf die eigenen Leute aufzupassen.
Tate und Finnley waren unterwegs. Thure hatte sie zu sich gerufen, und nun waren sie bereits seit einer Stunde in seinem Büro. Wahrscheinlich gab Thure ihnen genaue Anweisungen für Tates Wiedereingliederung, wobei Finnley dazu abgestellt wurde, ihn zu unterstützen. Anernerk behielt das Team im Auge, sie durften sich keine Fehler erlauben. Nicht nur, weil die Feder der Schuld am Türrahmen hing, sondern weil sich die Geistkrieger immer noch in der Bewährungsphase befanden. Ihr Versagen wurde zum Anlass genommen, alte Diskussionen neu zu befeuern, weil nach Meinung einiger spirituelle Vorkommnisse wieder in die Verantwortung der Räte überstellt werden sollten. »Sie geht nicht ran.«
»Dann ruf ihren Vorgesetzten an.«
Deidra warf Chenoa einen bösen Blick zu. »Sagst du mir jetzt ernsthaft, was ich tun soll?«
Die junge Powtankanin seufzte. »Entschuldige, ich neige in letzter Zeit zu Ungeduld.«
Deidra sah auf ihren Babybauch. »Wenn das die nächsten Monate hier funktionieren soll, werden wir uns alle etwas zusammenreißen müssen.«
Sie legte auf und drehte sich zu ihrer Kollegin.
»Hast du dir mal Gedanken gemacht, was passiert, wenn der Fötus größer wird und du in Gefahr gerätst? Als wir angegriffen wurden, konntest du die Verbindung zu Fenrir in deinem Bauch schon spüren. Wie wird es jetzt sein, da das Kind gewachsen ist?«
»Das weiß ich nicht«, gab Chenoa genervt zu. »Ich werde von allen Seiten unter Druck gesetzt, Dinge gefragt, die ich nicht beantworten kann, als müsste ich Expertin für gesegnete Kinder sein, aber das bin ich nicht. Kann ich wenigstens hier meine Ruhe haben?«
Eine Bitte, die Deidra bis zu einem gewissen Grad gut verstehen konnte. Gefühlsangelegenheiten waren nicht ihr Steckenpferd, aber sie musste das Risiko abschätzen, und dafür brauchte sie mehr Informationen.
»Sobald ich weiß, wie es sich auf unser Team auswirkt, werde ich es nicht mehr erwähnen.«
»Was meinst du damit?« Chenoa verschränkte die Arme vor der Brust und wirkte angriffslustig. »Denkst du, ich werde zu einer Behinderung?«
Seufzend suchte Deidra nach der Telefonnummer vom Präsidium in Yurokta. »Du nicht, aber die Umstände vielleicht schon. Und wenn du sachlich darüber nachdenkst, wirst du es genauso sehen.«
Emotionaler als gewollt stimmte Chenoa ihr zu. »Aber suspendiere mich nicht. Ich würde es nicht ertragen, zu Hause rumzusitzen. Die Arbeit ist alles, was ich habe.« Sie rieb sich über die Arme, als wäre ihr kalt. »Und auch alles, was mir bleiben wird!«
Zumindest das konnte Deidra bestens verstehen. »Wir lassen dich nicht allein«, versprach sie und wählte die Nummer. Als Vorgesetzte lebte sie für ihr Team, aber sie konnte nicht ihre Freundin sein. Wenn die Schwangerschaft zum Problem wurde, würde sie handeln müssen.
Sie mussten auf den Rückruf von der Westküste warten. Alles, was Deidra in Erfahrung bringen konnte, war, dass Taborri sich nicht bei der Familie befunden hatte, als die Verstärkung eingetroffen war, aber das reichte Chenoa nicht. In den gut zwei Stunden, die sie warteten, gingen sie systematisch die offene Akte durch, was sie seit fünf Monaten gefühlt jeden Tag machten, ohne auch nur eine neue Idee dabei herauszuziehen. Egal, was sonst noch passierte, der Mörder, der den größten spirituellen Missbrauch in der Geschichte Powtankas zu verantworten hatte, würde immer oberste Priorität besitzen, aber er zeigte sich nicht mehr. Das war alles so unbefriedigend und zermürbend. Was nützten die Fähigkeiten dieses Teams, wenn sie keine davon einsetzen konnten und nur zum Warten verurteilt waren?
Endlich rief der Kollege von der Westküste zurück. Das Gespräch dauerte nicht lange, und Deidras finstere Miene ließ nichts Gutes vermuten.
»Wenn wir irgendwas tun können … ja, verstanden … ist gut. Natürlich …« Als sie schließlich auflegte, wirkte Deidra ungewohnt entmutigt. »Taborri wurde eine gute Meile von der Farm entfernt tot aufgefunden. Der ersten Untersuchung nach starb sie an einer Hirnblutung. Einige Ergebnisse wurden verfälscht, weil Tiere ihr Blut vom Gesicht und von der Uniform geleckt haben. Woher das Blut stammte, wird noch untersucht«, fasste Deidra zusammen. »Die Ärzte gehen von einem Aneurysma aus, vielleicht erklärt es auch, warum sie sich vor ihrem Tod plötzlich so merkwürdig verhalten hat.«
Chenoa stand auf und musste sich ein paar Schritte im Raum bewegen. »Das soll Zufall gewesen sein?«, fragte sie fassungslos. »Was, wenn diese Aurenherde das verursacht haben? Wenn wir schuld an ihrem Tod sind, weil wir sie dort hingeschickt haben?«
»Selbst wenn, sie ist in Ausübung ihrer Pflicht gestorben. Taborri ist eine von uns gewesen. Wir alle leben mit dem Risiko. Die Sache wird nun gründlich untersucht, wir haben richtig gehandelt.«
Natürlich hatte Deidra recht, aber Chenoa fiel es schwer, sachlich mit dem Tod einer Kollegin umzugehen. Sie sah von Tate zu Finnley. »Seht ihr das auch so? Haben wir unseren Job getan und können jetzt einfach weitermachen?«
»Warum ist sie so weit vom Haus weg gewesen?«, fragte Tate.
»Das ist dem Kollegen auch ein Rätsel.« Deidra entsperrte ihren Computer und rief die Mails ab. »Sie schicken uns die Infos, wenn sie mehr wissen.«
»Wenn sie in die gleiche Richtung wie der Säugling gegangen ist, glaube ich nicht an einen natürlichen Tod.« Am liebsten wäre Chenoa in den nächsten Flieger gestiegen, um die Untersuchungen selbst durchzuführen.
»Die zuständigen Schamanen haben keine Auffälligkeiten bei ihr entdecken können. Keine Aurenherde, keine Spur. Auch bei der Familie nicht, die waren nur dehydriert. Die Aussagen der Familienmitglieder sind zudem nicht sehr nützlich. Als die Tochter gefragt wurde, ob ihr etwas Seltsames aufgefallen sei, hat sie den Beamten eine Libelle gezeigt. Mal ehrlich, wenn ein Insekt das Spannendste ist, was dort passiert, wären wirklich wichtige Dinge sofort aufgefallen, meinst du nicht?«
Deidra klickte eine Datei an und schien das Thema vorerst beenden zu wollen, aber Chenoa konnte das nicht. Zuständigkeit hin oder her, da sie Taborri dort hingeschickt hatten, waren sie in diese Sache involviert. »Was für eine Libelle?«
Deidra sah genervt zu ihr. »Muss das sein?« Sie nahm die Finger von der Tastatur und legte sie ruhig auf die Tischkante. Gleich würde wieder die Vorgesetzte aus ihr sprechen, wie so oft in den letzten Monaten, wenn sie glaubte, Chenoa würde Vorkommnisse überbewerten.
»Sag mir nur, ob die Libelle tot war und schon länger in der Gegend rumgelegen hat, bevor das Mädchen sie fand.«
Seufzend legte Deidra ihre Finger wieder auf die Tastatur und rief übers Netzwerk die Akte auf. »Vielleicht steht hier schon was. Wir werden das weiter mitverfolgen, aber solange wir nicht um Hilfe gebeten werden, befindet sich dieser Fall nicht in unserer Zuständigkeit, verstanden?«
Chenoa ging zu ihr. Während sich Deidra durch die wenigen Notizen klickte, sah Chenoa zu Finnley. Ihr Blick wanderte über die Tätowierungen in seinem Gesicht. Kabel, Platinen, Zahlencodes. Die Zahlenfolgen an seiner Schläfe standen für seine Verlobte, die sein Leben zum Besseren verändert hatte. In solchen Momenten wünschte sie sich, es befände sich noch freie Haut an der Stelle für neue Zahlen, die ihr ebenfalls einen Platz in seinem Leben gäben.
Als er ihren Blick bemerkte, sah sie schnell wieder auf das Display. Zwischen den Fotos vom Säugling, der Umgebung, Taborris Leiche und Aufnahmen von Fundstellen befand sich auch eine einzelne Aufnahme einer Libelle im Glas.
»Die sieht sehr mitgenommen aus«, sagte Chenoa, griff an Deidra vorbei und vergrößerte die Aufnahme. Die Flügel waren rissig, und die großen Augen wirkten irgendwie zerfressen. »Winterlibellen kommen eher in Osteuropa und Asien vor. Diese Imago sollte trotzdem nicht im Februar durch die Gegend fliegen.«
»Imago?«, warf Finnley ein.
»So werden die erwachsenen Insekten genannt. Winterlibellen können fast ein Jahr alt werden. Sie halten sich in der Nähe von Gewässern auf.« Mit einem Finger deutete sie auf den Computer. »In dieser Gegend gibt es weit und breit keine passenden Lebensräume für diese Insekten.«
Sie bemerkte, dass Deidra und Tate einander einen vielsagenden Blick zuwarfen. Finnley sah das auch. Er stand auf, kam zu ihr und betrachtete das Foto. »Wird ja wohl nicht schaden, diesen Imago zu untersuchen, oder?« Während er das sagte, legte er Chenoa eine Hand auf den Rücken, und es war wie ein dringend benötigter Energiestoß. Sie fühlte sich augenblicklich besser.
»Fein.« Deidra zog ihren Zopf fester und ließ die Schultern kreisen. »Ich schreibe eine entsprechende Notiz, aber dann lassen wir das Westküsten-Team in Ruhe seinen Job machen, und wir kümmern uns wieder um das, was hier passiert.«
Es fühlte sich trotzdem nicht richtig an. Als hätten sie etwas losgetreten, mit dem sich nun andere herumschlagen mussten. Aber Deidra hatte recht: Es war nicht mehr ihre Sache.
Dieses Warten darauf, dass etwas passierte, war zermürbend und zwiespältig. Einerseits war es gut, wenn alles ruhig blieb, andererseits wünschte sie sich, es würde etwas passieren, das der Schockstarre ein Ende setzte. Denn genau das war es: eine Schockstarre.
Jeder wurde von anderen Bildern des verhängnisvollen Angriffs verfolgt, aber niemand sprach es aus. Am schlimmsten war für sie, Finnley nahe zu sein, ohne ihm zu nahe kommen zu dürfen. An manchen Tagen tat es körperlich weh, diese tiefe Liebe nicht auszuleben. Sie sehnte sich danach, ihn zu spüren, weil sie sich an jede Sekunde des Rituals erinnern konnte. Als sie sich im Astralraum Finnley und Fenrir geöffnet hatte, war ein Band geknüpft worden, das an Intensität und Stärke niemals zu überbieten wäre, und die Entscheidung für dieses Leben lag nur einen Kuss entfernt.
Mit diesen Gedanken löste sie sich von seiner Hand und ging etwas auf Abstand. Sie hatte ihm ein Versprechen gegeben, an das sie sich halten musste.
Sie brauchten dringend Erfolge. Chenoa verrannte sich in jede kleine Meldung, die irgendwie Richtung spirituellen Missbrauch interpretiert werden konnte, Deidra sprach die Vorwürfe nicht aus, die sie sich selbst machte. Finnley kämpfte damit, das Richtige zu tun, während zwei Clans ihm diktieren wollten, wie das auszusehen habe. Und Tate – er war nicht mehr er selbst. Der Mann, der sonst jedes Detail bemerkte und alle Informationen bei Bedarf abrufen konnte, wirkte in sich gekehrt und abwesend. Das Trauma setzte ihm Scheuklappen auf. Es waren keine fünf Monate vergangen, sie erlebten einen mit Tagen bezifferten Stillstand, aber innerlich waren sie alle noch im Haus des verrückten Professors Broud und versuchten, die Vergangenheit zu verändern.
»Alles in Ordnung?«, flüsterte Finnley ihr zu, was ihr einen wohligen Schauer über den Rücken jagte.
»Nein«, erwiderte sie ehrlich und trat erneut einen Schritt von ihm weg. »Deidra hat recht, das ist nicht unser Fall.«
Ihre Gedanken blieben bei Taborri, während sie sich zurück an den Schreibtisch setzte, das Pad aus der Schublade holte und mit der Arbeit begann.
»In meiner Heimat wurde mal ein Exorzismus an dem Sohn des Pfarrers vorgenommen. Das Geschrei soll unmenschlich gewesen sein«, erzählte Finnley unvermittelt und kehrte ebenfalls an seinen Platz zurück. »Ich wette, einen vier Monate alten Jungen, der weglaufen will, hätten sie demselben Zirkus unterzogen, um den Dämon aus seiner Seele zu vertreiben.«
»Wahrscheinlich ist die Prozedur unmenschlich gewesen, und der Kleine hat deswegen so geschrien«, urteilte Chenoa. »Soweit ich weiß, gibt es nichts Übersinnliches in Schottland. Menschen steigern sich gern in so was rein, aber Dämonen, Götter oder den Teufel gibt es nicht. Nur das Leben und seine unterschiedlichen Energien oder Kräfte.« Sie konnte eine gewisse Geringschätzung nicht aus ihrem Ton heraushalten.
»Und was ist mit mir? Fenrir hat mich in meiner Heimat gefunden, war das nichts Übersinnliches?«
Als Chenoa ihn ansah, entspannte ein Lächeln ihre Züge. Ja, ihn gab es. Er war so real wie das Kind in ihrem Bauch oder die Liebe in ihrem Herzen. »Du bist die Ausnahme von der Regel, aber du hast ja gesehen, wie deine Landsleute damit umgegangen sind.« Es tat ihr leid, ihn daran zu erinnern, aber die Reaktionen der Menschen machten den Unterschied. »So zieht es sich durch die Geschichte der meisten Länder. Wer Gaben zeigte, wurde weggesperrt und auf unterschiedliche Arten getötet. Hexenverbrennung, Exorzismus, Lynchjustiz … eure historischen Aufzeichnungen sind voll davon, wie die großen Geister eurer Länder zum Schweigen gebracht wurden.«
Mit einem Nicken stimmte er ihr zu. »Ich verstehe, was du meinst. Denkst du, in Schottland wird der große Geist wieder an Stärke gewinnen, wenn Raubbau und Verschmutzung beendet werden? In den Legenden gibt es einige Wesen, die ich zu gern mal in echt sehen würde.«
Irgendwie war es charmant, dass Finnley bei Naturgeistern und Gaben wahrscheinlich an Kobolde und Feen dachte. »Vielleicht«, räumte sie ein. »Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Bringt ja auch nichts, weil sich die Schotten sicher niemals so sehr ändern werden, wie es für einen Wandel notwendig wäre.«
»Wenn alle so denken, sicher nicht«, sagte er etwas schroff. »Aber wie’s aussieht, begreift zumindest der Chief der Nation langsam, dass es zwar mehrere Kontinente gibt, aber nur eine Erde. Es wird wohl Zeit, dass sich alle mehr Gedanken machen.«
Aus Deidras Richtung kam ein genervtes Aufstöhnen. »Großartig, jetzt kommen wir langsam bei der Weltpolitik an. Jetzt noch den Tisch voller Essen, und das Familienfest ist eröffnet.«
Aber Chenoa ließ sich durch den Sarkasmus nicht von einer Erwiderung abbringen. »Die Schotten haben wie so viele andere Völker Mutter Natur grob und fahrlässig behandelt. Wenn der große Geist je besondere Kinder in deinem Land aktivieren konnte, dann sind die Gaben nicht stark genug gewesen, ein Umdenken zu provozieren. In Powtanka fließt die Energie, dieser Kontinent lebt. Frag deine Verlobte, wie sie sich in deinem Land gefühlt hat. Erwartest du ernsthaft, dass wir das wieder in Ordnung bringen, was deine Leute über Generationen zerstört haben?«
Sie bemerkte, wie er bei Taimas Erwähnung den Blick senkte. Die Reue ließ nicht lange auf sich warten, obwohl etwas in ihr diesen Streit wollte.
»Taima sagte beinahe täglich, dass sich Schottland für sie wie eine kalte Hand im Nacken anfühlt.« Er verlagerte das Gewicht und lehnte sich mit vor der Brust verschränkten Armen zurück, ohne es in einen Streit ausarten zu lassen. »Wahrscheinlich hast du recht. Ich denk nur immer, dass Fenrir mich gar nicht hätte finden können, wenn es die Astralwelt bei uns nicht gäbe.«
»Es gibt sie«, mischte sich Deidra ein, die Chenoas Absichten zu durchschauen schien. »Aber eben mehr wie eine Wüste. Eine, in der es auch Leben gibt, selbst wenn sie ausgedörrt und bedrohlich aussieht. Aber eben kein Ort für spirituelle Erscheinungen. Nicht mehr.« Sie tippte auf die Tischfläche. »Können wir jetzt wieder bei der Arbeit bleiben?«
Unzufrieden aktivierte Chenoa das Pad, um beschäftigt auszusehen. Ihr war klar, dass sie mit Finnley über ganz andere Dinge streiten wollte. Alles wäre so viel einfacher, wenn er sie entschieden abweisen würde, aber er liebte sie. Sie sah es in seinen Augen, fühlte es, wenn er ihr nahe war. Und er liebte seine Verlobte. Gänzlich anders, aber nicht minder intensiv. Für Taima hatte er sein Land verlassen, ertrug Vorurteile, Wertungen und Schmähungen, weil er aussah wie eine Maschine.
Chenoa hatte ihm versprochen, dass er die Zusammenführung nicht bereuen würde – wie sollte sie das halten? Vor dem Ritual hatten die Frauen miteinander telefoniert. Es war die Entscheidung seiner Verlobten gewesen, dass Chenoa es durchführen sollte, obwohl die Möglichkeit bestanden hatte, dass es sie alle in diese Lage brächte. Die Theorie konnte nicht vermitteln, was es tatsächlich bedeutete, wenn Fenrir dieses Geschenk für die durchführende Schamanin wählte. Es kam ihr vor, als würde ihre Restlebenszeit nur noch wenige Monate betragen.
Die offensichtliche Zuneigung und das Wissen um den Bund wurde von ihrem Clan sehr begrüßt. Chenoa sollte die Gefühle zum Wohle des Clans nutzen. Wenn Finnley sie statt Taima heiratete, dann bliebe das Kind bei ihr. Schon der Gedanke, eine Zukunft mit ihm und dem gemeinsamen Baby zu haben, war wie ein pures Glücksgefühl, das sich in ihr ausbreiten würde, ließe sie es zu. Sie durfte es nicht bis zu ihrem Herzen wandern lassen, wenn sie sich an ihr Versprechen halten wollte.
»Bist du noch bei uns?« Deidras Stimme fiel in ihre Gedanken wie ein Rettungsring.
Ja, noch.
Kapitel 4
Einer fünfköpfigen Delegation aus Nippon, Japan, wird während der Wikingertage Einblicke in die powtankanische Wirtschaft gewährt. Chief der Nation, der ehrenwerte Kehkehwa Pinu’u, stimmte mit dieser Einladung dem Wunsch des Nationalrats zu, Reformen in der Außenhandelspolitik in Betracht zu ziehen. Zu der heutigen Besichtigung der Astatronik Werke in Potomac Flussland hat Kehkehwa Pinu’u in seiner Rede erneut daran erinnert, dass die Weltbevölkerung gemeinsam die Verantwortung für das Klima trage und Landesgrenzen uns nicht daran hindern dürfen, zum Wohle aller zu handeln. Über eventuelle Kooperationen mit japanischen Unternehmen hüllte sich Pinu’u jedoch in Schweigen. Die Begehung der Mikroalgen-Anlagen sei zu diesem Zeitpunkt ein erster Schritt in eine bislang noch unbestimmte Zukunft.
Experten sagen, dass noch viel Zeit mit der Erstellung von Gutachten, Ratssitzungen und dem Abwägen der Vorteile und Risiken vergehen werde, bevor erste Entscheidungen getroffen werden könnten. Aber es sei gut möglich, dass es zu dauerhaften Gesetzesänderungen führen wird, die den Weg für eine Zusammenarbeit mit ausländischen Firmen ebnen sollen.
»Bei Wakan Tanka, das ist ja abgefahren!« Jaci drückte seinen Freunden seinen Rucksack in die Hände und rannte zu dem Wald aus Totempfählen, die über die Fläche von einem Quadratkilometer durcheinander aufgestellt worden waren. In der Broschüre stand, dass es 1500 Stück waren, die bis zu drei Meter in die Höhe ragten und die Kunst der Totemverehrung von den ersten Ahnen bis jetzt zeigten. »Seht euch das an!«
Er ging an den ersten vorbei und sah an den mit Schnitzereien und Farbe übersäten Stämmen bis zu den Spitzen hinauf. Bis zur Ankunft hatte der Schulausflug nach einer langweiligen Pflichtveranstaltung geklungen, aber dieser Anblick entschädigte für die dreistündige Busfahrt.
Pelipa und Hahko folgten ihm, nicht minder staunend, streckten ihre Hände nach den bunten Stämmen aus, um manche zu berühren, und blinzelten gegen die Mittagssonne, um die Spitzen zu entdecken.
»Kommt, wir laufen etwas vor«, rief Jaci. Er wollte seiner Lehrerin nicht zuhören, wie sie diesen magischen Anblick mit trockenen Ausführungen über die powtankanische Geschichte ruinierte. In seinem Clan wurde viel Wert auf das Weitertragen der historischen Ereignisse gelegt. Er hätte ein Buch über Friedensläufer, Einflüsse der unterschiedlichen Stämme, große Persönlichkeiten und das harmonische Zusammenleben mit der Natur und dem großen Geist schreiben können. Zudem wusste er, was die Schnitzereien bedeuteten und dass manche Totempfähle in diesem Wald Mahnmale waren, die vor Invasoren warnten. Die Wikingertage hatten gerade erst begonnen, er musste sich noch die ganze Woche mit all dem historischen Zeug auseinandersetzen. Ihm stand eher der Sinn nach Abenteuergeschichten, fantastischen Begegnungen mit Geistern und spirituellen Kräften. Seine Freunde und er hatten schon vor einem Jahr damit begonnen, heimlich Aufstand der Krieger zu spielen, obwohl es ihnen verboten worden war. Ihre Eltern hielten dieses Rollenspiel für gewaltverherrlichenden Unsinn, der junge Köpfe mit falschen Ideen füllte. Mit ihren fünfzehn Jahren gefiel es ihnen, die Treffen im Verborgenen abzuhalten, das verlieh den imaginären Heldenreisen einen gewissen Nervenkitzel.
»Lasst uns in die Mitte laufen und in unsere Rollen schlüpfen«, schlug er vor.
Pelipa überholte ihn und drückte ihm den Rucksack gegen die Brust. »Aber dann trägst du deinen Kram selbst«, sagte sie. »Du magst der Spielleiter sein, aber das macht dich noch lange nicht zum Anführer, der seine Lakaien schleppen lässt.«
Verlegen schulterte er sein Gepäck und wurde etwas rot. Jeder außer Pelipa selbst schien zu wissen, dass er sich in seine Freundin verknallt hatte. Oder sie ignorierte es gekonnt, weil er nicht ihr Typ war. So wie sie ihre Geistkriegerin spielte, stand sie mehr auf starke, kampflustige Kerle, weswegen sie einander im Rollenspiel näher waren als im realen Leben. Wenn er Narrek spielte, konnte er sehr dominant und durchsetzungsfähig sein, auch Pelipa und Hahko ließen sich in ihren Rollen nicht die Butter vom Brot nehmen. Dann fiel all der Druck, den die Clans auf sie ausübten, von ihnen ab, und sie hatten mal das Sagen. Im wahren Leben war Rebellion gegen die Alten ein Abenteuer, das nur sinnlose Schmach verursachte, also fügten sie sich lieber.
Pelipa lief weiter vor und berührte dabei mit der Rechten die Totempfähle, an denen sie vorbeirannte.
»Jetzt glotz nicht so verliebt, lauf lieber schneller.« Hahko schubste ihn leicht, damit er sich beeilte. Sie hatten nur zwei Stunden, bevor sie wieder in den Bus gepfercht wurden.