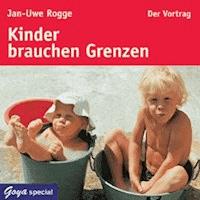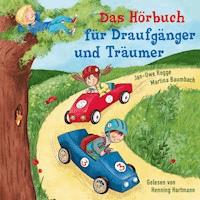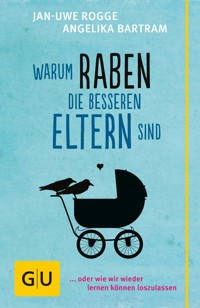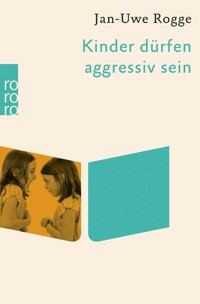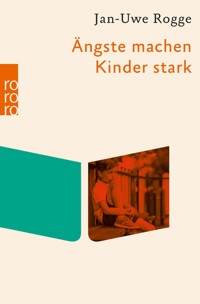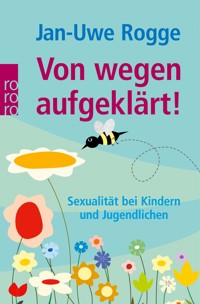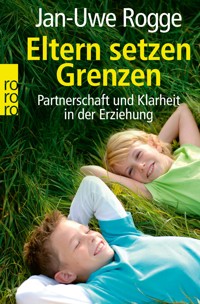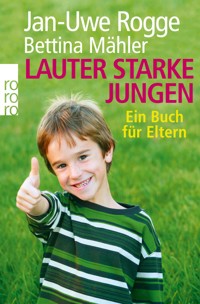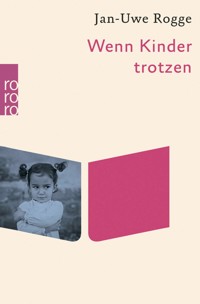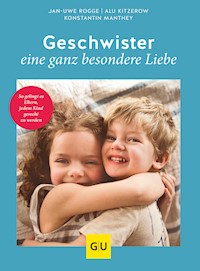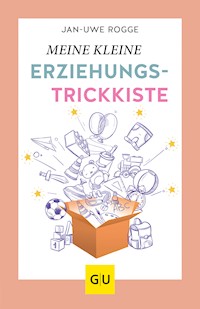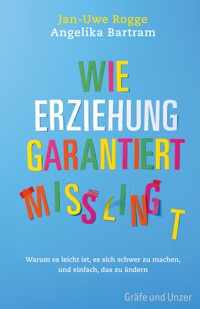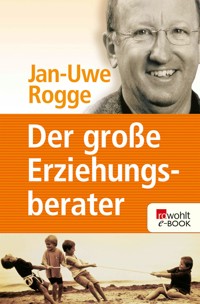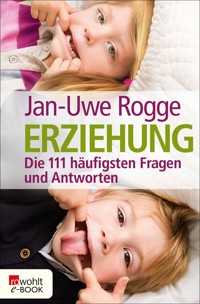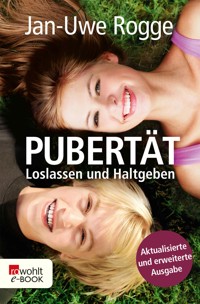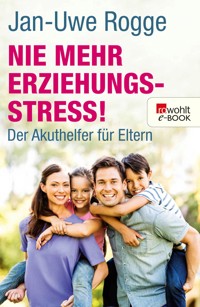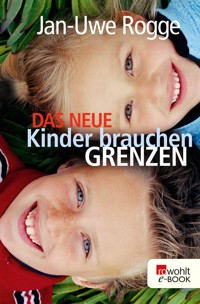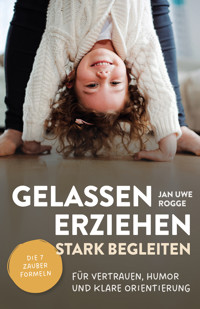
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlagshaus Stopfer
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Gelassen erziehen, stark begleiten Hast du manchmal das Gefühl, dass der Druck, alles richtig zu machen, deine Freude am Elternsein überschattet? Überfordern dich die widersprüchlichen Erziehungsratschläge aus deinem Umfeld und sehnst du dich danach, gelassener und sicherer im Umgang mit deinem Kind zu werden? Stell dir vor, du könntest die hohen Erwartungen hinter dir lassen, endlich eine neue Richtung einschlagen und dabei trotzdem eine starke, liebevolle Beziehung zu deinem Kind aufbauen. Dann ist dieser Ratgeber von Jan-Uwe Rogge genau der Richtige für dich! "Gelassen erziehen, stark begleiten" ist ein persönlicher Begleiter auf dem Weg zu einem entspannteren Familienalltag. Das Buch zeigt dir, wie du deinem Kind den Raum zur freien Entfaltung und gleichzeitig die notwendige Führung gibst, die es braucht. Mit inspirierenden Tipps und wertvollen Beispielen aus der Praxis erfährst du, wie du den täglichen Erziehungsstress reduzierst, Konflikte auf positive Art und Weise löst und in deiner Rolle als Elternteil über die hinauswächst. Dieses Buch hilft dir: - eine authentische Eltern-Kind-Beziehung aufzubauen - Konflikte stressfrei und souverän zu lösen - Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten zu gewinnen - Entspannung statt Erziehungsdruck - Kinder in ihrer Einzigartigkeit zu verstehen - gesunde Grenzen zu etablieren und zu wahren - deinen eigenen Erziehungsstil zu finden - Kindern emotionale Sicherheit zu geben - den Familienalltag harmonisch zu gestalten Mit "Gelassen erziehen, stark begleiten" lernst du, deine Erziehung aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Schritt für Schritt führt dich dieses Buch durch zentrale Themen wie Geduld, Gelassenheit und Selbstakzeptanz in der Elternschaft und unterstützt dich dabei, deine eigenen Erwartungen zu hinterfragen. Es geht darum, dich und dein Kind so anzunehmen, wie Ihr seid, und gemeinsam in kleinen, wirkungsvollen Schritten zu wachsen – frei von unrealistischen Idealvorstellungen und voller Freude. - Klarheit und Selbstbewusstsein entwickeln – Erfahre, wie du deinen eigenen Erziehungsstil findest, festigst und Vertrauen in deine Fähigkeiten aufbaust. - Individuelle Stärken entdecken – Lerne, wie du auf die Einzigartigkeit deines Kindes eingehst und förderst, ohne Vergleiche anzustellen. - Weniger Perfektion, mehr Authentizität – Schaffe eine harmonische Atmosphäre, in der Fehler akzeptiert werden und sowohl du als auch dein Kind voneinander lernen könnt. - Balance zwischen Führung und Freiheit – Freue dich über wertvolle Tipps, wie du deinem Kind notwendige Orientierung gibst und gleichzeitig Freiräume schaffst, in denen es sich frei ausleben kann. - Persönliche Grenzen aufzeigen – Verstehe, wie du mit deinem Kind deine Grenzen klar und deutlich kommunizierst, aber dabei einfühlsam und liebevoll vorgehst. Stell dir vor, du könntest die kostbaren Momente mit deinem Kind in vollen Zügen genießen und jeden Tag entspannt und voller Freude angehen – ganz ohne Unsicherheiten und Selbstzweifel. Jan-Uwe Rogge zeigt dir, wie du deinen Erziehungsalltag mit mehr Leichtigkeit meistern und gleichzeitig eine vertrauensvoll und authentische Beziehung zu deinem Kind aufbauen kannst. Befreie dich von Idealbildern und Erwartungsdruck. Gehe den ersten Schritt für ein erfülltes Miteinander, das euch als Familie wachsen lässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1. Es gibt nichts Neues unter der Sonne
2. Bloß alles richtig machen!
Perfekte Lösungen passen häufig nicht
Nicht nach dem Warum, sondern nach dem Wozu fragen
Was ist falsch? Was ist richtig?
3. Die Übung in Geduld bewahrt vor dem Verlust der Gelassenheit
4. Die Sieben Zauberformeln
4.1Gebt Kindern Räume … und richtet eure eigenen ein
… und richtet eure eigenen ein: das Frauenzimmer
4.2Lasst Kindern Zeit … und gestaltet euch eure
Vom Glück der Langeweile und vom Wert der Zerstreuung
Vom Wert der Rituale
… und gestaltet sie euch selbst
4.3Schenkt Kindern Vertrauen … und (vertraut) euch
Vertrauen schenken
Gefühle lesen lernen
Von sicheren und unsicheren Kindern
Kinder wollen ermutigt werden – und Eltern auch
4.4Lasst Kinder spielen und träumen … und nehmt euch diese Freiheit auch
Wer träumt, hat mehr vom Leben
Vom Recht der Kinder auf Fantasie
Lernen, Leistung und Motivation
Über Fairness und Respekt
4.5Nehmt Kinder in ihrer Einzigartigkeit an … und akzeptiert euch so, wie ihr seid
4.6Begleitet Kinder ins Leben … und schaut auf euren eigenen Weg
Paradoxie des Lebens – Loslassen und Halt geben
Trotz – die Unabhängigkeitserklärung des Kindes
Pubertät – Zeit des Aufbruchs und Chance für alle
Entwicklung in Übergängen
Time to say Goodbye
Abschied
Wie Kinder ihren Auszug erleben
Hänschen wird zum Hans
Das leere Nest
4.7Bietet Kindern Orientierung und Vielfalt … und werdet Leuchttürme
Doch zurück zu den Begriffen Autorität und Erzieherpersönlichkeit
Auseinandersetzungen zwischen Eltern und Kind
Antiautoritäre Erziehung und Laissez-faire
Die Machtfrage
Partnerschaftlichkeit und Gleichwertigkeit
Gleichwertig heißt nicht gleichrangig
Geduld und Weisheit
Was Kinder brauchen
Begleitet Kinder ins Leben und schaut auf euren eigenen Weg
5. Mit Humor, Herz und Vertrauen – das stärkt Eltern und Kinder
Die Menschenfreundlichkeit des Humors
Kinder das Schwimmen lehren
Dankbarkeit, Glück und Demut
Herzenswärme
Die Liebe zur Unvollkommenheit
Die Freundlichkeit des Fehlers
Bedingungslosigkeit
Staunen und Wachsen
Kinder lieben Großeltern
6.Zum guten Schluss – ein paar tröstliche Gedanken
1.Erziehung ist Beziehung – zu sich selbst und zum Kind
2. Erziehung ist Vielfalt
3. Erziehung ist Herausforderung
4. Erziehung ist Dankbarkeit und Demut
„Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen vergessen, was du gesagt und was du getan hast. Sie vergessen aber nie, wie sie sich bei dir gefühlt haben.“ (Maya Angelou)
"Humor und Geduld sind zwei Kamele, mit denen du durch jene Wüste kommst." (Arabisches Sprichwort)
1. Es gibt nichts Neues unter der Sonne
Wer mehr als vierzig Jahre in der Begleitung von Kindern und Eltern tätig ist, dem wird meist die Fragen gestellt: Was ist denn heute anders geworden? Ist Erziehung schwieriger geworden? Oder gar einfacher? Sind Eltern gestresster? Oder sind die Kinder gar schlimmer, auffälliger, unerzogener?
Eine gereizte Verbissenheit hat sich ja eine Hilflosigkeit darüber breitgemacht, was nun der beste Weg sei, um glückliche, allzeit zufriedene Kinder zu erziehen.
Manche Ratgeber – und davon gibt es eine Unmenge – kommen immer noch wie Betriebsanleitungen oder Rezepte daher. Kinder werden zu Projekten. Man nehme mehr davon, etwas davon und ein Spritzer davon – und schon hat man fast das perfekte Kind: Es lernt, ruhig zu schlafen, hält sich wie selbstverständlich an Regeln, fühlt sich aufgehoben, sicher und geborgen ist, weil all seine Bedürfnisse befriedigt werden.
Wenn es doch nur so einfach wäre! „Es gibt nichts Neues unter der Sonne“, so heißt es im Alten Testament beim Philosophen Kohelet. Es sind die gleichen Fragen, die Eltern heute wie vor vierzig Jahren beschäftigen, das sehnsüchtige Verlangen nach ganz einfachen, jederzeit umsetzbaren Tipps, die mit absoluter Sicherheit auch funktionieren. Aber die gibt es nicht! Erziehung ist doch kein Schlaraffenland!
Dafür sind Kinder – Gott sei's gedankt – zu verschieden. Sie sind einzigartig und unvergleichlich. Das Gleiche gilt für die Eltern. „Vergleiche ein Kind nie mit einem anderen, sondern nur mit sich selbst“, schrieb Pestalozzi schon vor mehr als zweihundert Jahren. Und was er den Kindern zugestand, gilt gleichermaßen für Eltern. Vergleiche – das konstatierte schon der Philosoph Kierkegaard – sind der Anfang der Unzufriedenheit, weil man es immer richtiger, besser und perfekter machen will. Bloß keinen Fehler machen – schon gar nicht in der Erziehung! Die Katastrophen sind vorhersehbar!
Es wird dem Perfektionismus das Wort geredet. Ein Machbarkeitswahn durchzieht viele Diskussionen. Da setzt es Ratschlag an Ratschlag! Doch Ratschläge sind wie Schläge, deren blaue Flecken man erst hinterher merkt. Abschied vom Perfektionismus ist angesagt. Kleine Brötchen schmecken häufig intensiver als die mit viel Hefe aufgeblasenen.
„Der Weg ist das Ziel“, lautet ein viel zitierter Satz. Das Ziel – eine perfekte Erziehung, die sich am Kind orientiert. Mein Eindruck ist vielmehr: Das Ziel – eben die perfekte Erziehung, die ein perfektes Kind hervorbringt – steht im Weg. Es blockiert, es behindert, es verhindert. Es erzeugt Zweifel, Unsicherheit und Minderwertigkeitsgefühle. Selbstsicherheit, die notwendig und unabdingbar ist, um Wege mit Selbstvertrauen zu gehen, verwandelt sich in Unsicherheit, Stress entsteht und Unzufriedenheit baut sich auf.
So wichtig der Blick auf das Kind und die Befriedigung seiner Bedürfnisse nach Verbundenheit ist, so wichtig ist auch der Blick auf die Eltern! Allzu häufig ist Eltern-Bashing der Tenor mancher Bücher, Artikel und Schlagzeilen. Tatsache ist jedoch: Nur wenn es den Eltern gut geht, geht es auch den Kindern gut. Nur Eltern, die sich sicher aufgehoben fühlen (und das meint emotional, sozial und materiell), können ihren Kindern Sicherheit und Geborgenheit geben. Kinder wollen keine Hochleistungseltern, die für jedes Problem sofort um eine perfekte Lösung wissen und nur das Beste für ihr Kind wollen.
Ein zwölfjähriges Mädchen hat mir einst in einer Beratung mitgeteilt: „Meine Mutter will nur das Beste für mich!“, um dann nachdenklich hinzuzufügen: „Aber was bleibt dann für mich?“ Philosophie pur!
„Wie erziehe ich richtig?“, „Wie löse ich ein Erziehungsproblem auf richtige Weise?“ oder „Wie sage ich meinem Kind richtig, dass es sich morgens beeilen soll?“ – Das sind Fragen, die immer wieder gestellt werden. Man will nicht nur erziehen, man will „richtig“ erziehen. Erziehung stellt aber keine Technik dar und ist kein Hochleistungssport. Erziehung ist eine Zumutung – aufseiten der Eltern wie der Kinder. Zumutungen lassen sich aber nur aushalten, wenn die Beziehungen passen. Erziehung ist mithin Beziehung – Beziehung zu sich selbst (als Mutter, Vater etc.) und Beziehung zum Kind. Wer sich als Elternteil mit all seinen Stärken und Schwächen annehmen kann, sich seiner Kompetenzen, aber auch seiner Unzulänglichkeiten bewusst ist, kann auch seine Kinder so annehmen, wie sie sind – mit all ihren unvergleichlichen Eigenarten.
Kinder sind kein Experimentierfeld für Wünsche, Bedürfnisse und Sehnsüchte, die einem in der eigenen Kindheit unerfüllt geblieben sind.
Erziehung ist Beziehung. Sie hat nichts mit Ziehen zu tun. Man schaut dem Gras beim Wachsen zu, heißt es in einem afrikanischen Sprichwort. Man zieht nicht am Grashalm, damit dieser schneller wächst. Wer am Halm zieht, reißt ihn mitsamt den Wurzeln aus der Erde. Er verdorrt!
Ähnliches gilt auch für die Erziehung. Sie ist die Begleitung der Kinder im Hier und Jetzt. Erziehung ist keine Vorbereitung auf das Leben, sie geschieht im Augenblick. „Während du Pläne machst“, so hat es John Lennon einmal ausgedrückt, „da passiert das Leben.“ Und wer Kinder ins Leben begleitet, kann davon so manches (Klage-)Lied singen.
Eltern sind nicht selten frustriert von dem, was ihnen der Alltag und die „lieben Kleinen“ bieten. Sie geben sich alle Mühe, aber die Mühen der Ebene sind voller Tücken und Hindernissen. Eltern wissen häufig viel über Erziehungstechniken – und trotzdem funktionieren sie oft nicht. „Bei mir klappt es einfach nicht! Warum nur?“ Das ist eine Klage, die wie Selbstkasteiung daherkommt. Die Gründe mögen vielfältig sein, doch manches „Scheitern“ hat wenig mit elterlicher Inkompetenz zu tun – vielmehr mit einem fehlenden Wissen über die Entwicklungsbesonderheiten von Kindern! Wer mehr darüber weiß, dass Trotzen, das Streben nach Autonomie, normal, aber eben von Kind zu Kind unterschiedlich ist, wer Kenntnis darüber hat, dass Kinder ihren ganz eigenen Schlafrhythmus haben, wird anders damit umgehen.
Die Entwicklung eines Kindes ist keine stete Aufwärtsentwicklung. Sie ist ein Gemenge von Fortschritt, Stillstand und – auch das gehört dazu – von Rückschritt. Solches Wissen entlastet, trägt zur Gelassenheit bei, stärkt die Beziehung zwischen Eltern und Kind, spannt ein stabiles Netz, das Frustrationen aushalten lässt.
Aus diesen ersten Überlegungen lassen sich sieben Sätze ableiten:
Doch aufgepasst: Zum Klatschen gehören zwei Hände, lautet eine indische Weisheit. Deshalb müssen die Sätze ergänzt werden: Wer Kindern Räume gibt, schafft auch für sich selbst Räume. Wer Kindern Zeit gibt, nimmt sich selbst Zeit. Wer Kindern Vertrauen schenkt, vertraut sich selbst! „Wünsch‘ dir Glück“, heißt es im „Lied vom Hänschen klein“, wenn das Kind in die Welt zieht – und nicht: „Pass bloß auf!“
Das bedeutet: Vertrauen in sich selbst und in das Kind. Oder frei nach Udo Lindenberg: „Hinterm Horizont geht‘s weiter!“ Wer Kinder ins Leben begleitet, sie ziehen lässt, der weiß: Umwege erweitern die Ortskenntnis. Wer Kinder in ihrer Einzigartigkeit annimmt, vergleicht nicht – auch nicht sich selbst mit anderen Eltern.
Ein Kind an die Hand zu nehmen, bedeutet, ihm Halt zu bieten. Die Botschaft lautet: Halte mich, aber lass mich los! Lass mich los, aber halte mich!
Kinder lieben dabei die Unterschiedlichkeit von Erziehungsbeziehungen. Wenn man in der Erziehung an einem Strang zieht, verwechselt man – frei nach John Wayne – Erziehung mit Hinrichtung.
Doch nicht nur Kinder wollen angenommen werden. Das gilt gleichermaßen für Eltern: Sie brauchen Annahme, Bestärkung und Denkanstöße. Deshalb nehmen meine Überlegungen die Perspektive der Kinder genauso ernst wie die der Eltern. Kinder und Eltern sind gleichwertig, Jesper Juul würde gleichwürdig sagen. Kinder sind Geschenke, von denen man viel lernen kann. Aber es braucht einen Rahmen, um das zu erkennen und zu erleben.
Zurück zum Ausgangspunkt: „Es gibt nichts Neues unter der Sonne!“ Prediger Kohelets wunderbarer Satz aus dem Alten Testament beinhaltet keine Fortschrittsfeindlichkeit. Natürlich gibt es viele wissenschaftliche Erkenntnisse, die zum Verständnis und zum psychischen und physischen Wohlergehen der Kinder beigetragen und die das Zusammenleben in Familien bestärkt haben.
Darum geht es mir nicht, wenn ich Kohelet zitiere. Es ist ein anderer Gedanke: Mir fällt auf, dass man in der Erziehung alles richtiger, vor allem sicherer machen will. Man sucht nach Zutaten, um dem Kind eine absolut sichere Zukunft zu garantieren und alle Gefahren von ihm abzuhalten. Für manche Eltern scheinen Kinder wie Projekte zu sein, die man versucht zu gestalten oder auch zu verwirklichen. Schließlich will man sich später nichts nachsagen lassen. Man hat doch alles (aus-)probiert.
Das ist nun kein neuer Gedanke. Schon Aristoteles soll 600 v. Chr. sinngemäß formuliert haben, ein perfektes Kind zeuge man am besten bei Südwind. Er war aber Pragmatiker genug, um hinzuzufügen: Sollte der Wind einst aus einer anderen Richtung geblasen haben, dann müsse man die Segel anders setzen. Welch ein lebens- und kinderfreundlicher, ja bejahender Gedanke. Und zugleich ein ganz pragmatischer: Kinder und sich selbst so anzunehmen, wie man ist und nicht, wie man es gerne hätte. Und damit die Vorstellung loszulassen, es gäbe in der Beziehung zu den Kindern und zu sich selbst nur einen Weg, der die sichere Zukunft, das Wohlergehen gewährleistet. Dieses Loslassen macht frei, setzt Kräfte frei – für Neues und Unbekanntes. Sonst bleibt man in eingefahrenen Bahnen, eben: „Nichts Neues unter der Sonne!“ Und das, obwohl sich so vieles verändert hat und die gesellschaftlichen wie individuellen Rahmenbedingungen sich gewandelt haben.
Man nehme die digitalen Medien. Obwohl sie stark in das alltägliche Zusammenleben eingreifen, bleiben jene Fragen erhalten, die man schon während der Lesesuchtdebatte am Ende des 18. Jahrhunderts stellte. Damals wurde vor den problematischen Folgen des Lesens gewarnt, weil sich bei Kindern durch zu langes Stillsitzen das Blut verdicken und die Fantasien überstrapazieren würde. Liest man Ratgeber aus der heutigen Zeit, streicht das Wort „Buch“ und ersetzt es durch „Computer, Internet und Mobiltelefon“, dann passen die Sätze haargenau. Es geht um Warnungen, Begrenzungen, um das Wie-lange und das Was, um negative (manchmal auch spekulative) Folgen und um vorhersehbare Schäden.
Es geht bei einem übermäßigen Medienkonsum aber nicht um die individuellen Hintergründe, das Wozu. Es geht nicht um den Blick auf alltägliche, reale Gefährdungen, die man ja durchaus konstatieren kann. Denn sie gehören dazu, wenn man Kinder ins Leben begleitet. Man kann sie nicht vor Gefährdungen schützen, man kann aber dazu beitragen, dass sie das selbst tun. Hilfe zur Selbsthilfe – so das Credo von Maria Montessori. Auch dieser Satz wird viel zitiert, doch nicht immer in seiner Tiefe und Nachhaltigkeit verstanden und umgesetzt.
Medien – ob alt oder neu, ob analog oder digital – rufen Auseinandersetzungen hervor, bringen Kontroversen mit sich, weil die Sichtweisen so vielschichtig, die Perspektiven so verschieden sind.
Da sind die Kinder: Je älter sie werden – desto faszinierender werden die digitalen Medien. Aber schon jüngere Kinder sind „Medienexperten“, die sich dem Faszinosum des Fernsehens oder des Laptops kaum oder nur schwer entziehen können. Kinder werden – wie Erwachsene auch – in den Bann gezogen. An den Medien kommt eben kaum jemand vorbei.
Da sind die Meinungen und Erfahrungen der Kinder: Er finde das Fernsehen „einfach cool“, sagte der knapp sechsjährige Paul. Am liebsten schaue er Zeichentrickserien. Er überlegte kurz: „Am liebsten alleine!“ Seine Mutter würde immer dazwischenreden, das mache dann keinen Spaß. „Vor allem ihre Kommentare nerven!“ Er sage doch auch nichts, „wenn sie Blödsinn schaut!“ Und die siebenjährige Caroline ergänzte: „Das Tablet ist mir schon ganz wichtig!“ Auf den würde sie am wenigsten verzichten wollen. Der zehnjährige Ben setzte andere Prioritäten: „Die Glotze ist mir jetzt nicht mehr so wichtig wie der Computer, der Laptop oder das Internet. Wenn es das Zeug nicht gäbe, wäre das völlig uncool.“
Kinder leben in einem mediatisierten Umfeld. Sie gehen von klein auf mit analogen wie digitalen Medien um, auch wenn die Bindungskraft des Fernsehens relativiert wird. Natürlich sind fast alle Haushalte, in denen Kinder aufwachsen, mit Radio, Fernseher, Computer, Internet oder Handy ausgestattet. Und auch die Ausstattung mit medialer Hardware, die den Drei- bis Zwölfjährigen zur Verfügung steht, nimmt zu. Doch aufgepasst: Apokalyptische Bilder, die das Ende der Kindheit oder der Familie hinaufbeschwören, überzeichnen.
Befragt man sie aber nach ihren Interessen, dann stehen Freundschaften, das Spiel und der unmittelbare Kontakt an erster Stelle. Das wird häufig übersehen. Oder um es mit den Worten des neunjährigen Carlos zu formulieren: „Wenn ich am Computer herumdaddele, sieht meine Mutter das sofort. Aber wenn ich mit Freunden zusammen bin und spiele, das übersieht sie!“
Damit ist die Perspektive der Eltern angesprochen. Diese sind nicht selten hin- und hergerissen zwischen Verantwortung und Hilflosigkeit. Manche fühlen sich überfordert, spüren um die Bedeutung von Fernsehen und Internet für Kinder und wissen um die Macht, die man damit in den Händen hat. Sie nutzen diese: „Wenn du nicht aufräumst, dann gibt es kein Fernsehen!“ Oder: „Wenn du deine Hausaufgaben nicht machst, dann ist Schluss mit dem Handy!“ So eskaliert manch Situation. Hinter vielen Auseinandersetzungen, die sich an der Mediennutzung entzünden, steckt ein Machtkampf, an dessen Ende nur Verlierer stehen.
„Aber was ist denn die Alternative?“, fragte neulich der Vater des zehnjährigen Matthias. „Soll man denn gar nichts mehr sagen? Alles laufen lassen?" Eltern haben eine Erziehungsverantwortung, der sie nachkommen müssen. Eltern sind – und das weiß man aus vielen Studien zur Vermittlung von Medienkompetenz – wichtig. Vater und Mutter, aber zugleich Lehrerinnen und Lehrer stellen bedeutsame Vermittlungsinstanzen dar, wenn es um einen aktiven Umgang mit Medien geht. Sie geben einen Rahmen vor, an dem sich Kinder orientieren können. Aber, so hört man es häufig, man könne doch sowieso nichts mehr machen, man ist doch den Launen der Kinder hilflos ausgeliefert. Welch Irrtum! Eltern bleiben Bezugsinstanzen, auf welche Kinder schauen. Nicht widerspruchsfrei! Sie versuchen, sich an Grenzen zu reiben, sie auszutesten. Resignation ist nicht angesagt – vielmehr Mut und die eigene Haltung zu verdeutlichen. Natürlich versuchen Kinder, die elterlichen Haltungen aufzuweichen: „Aber alle anderen dürfen!“ Oder: „Alle anderen haben!“ Dann gerät man als Mutter oder Vater schnell in ein Ungleichgewicht: „Bin ich wirklich zu streng? Reglementiere ich zu viel? Müsste ich nicht großzügiger sein?“
„Erziehung ist Vorbild und Liebe“, hat der Pädagoge Pestalozzi vor über 200 Jahren einmal geschrieben – zu einer Zeit, in der es noch keine elektronischen Medien gab. Vorbild sein bedeutet, eine Haltung vorzuleben und eben nicht einfach nur „vorzulabern“.
Vorleben heißt authentisch sein! Wer Räume will, die frei von Medien sind, ist gut beraten, den Fernseher oder das Mobiltelefon während des Essens abzuschalten und sich auf die anderen Personen am Tisch einzulassen.
Aber eigentlich habe man doch keine wirkliche Chance „gegen die Allmacht der Medien“, erklärte ein Vater von zwei Söhnen im Alter von acht und zehn Jahren. Und wenn man doch einmal Grenzen setzen wolle, gebe es sofort Diskussionen und Ärger, so eine Mutter von drei Kindern zwischen vier und elf Jahren: „Du hast einfach keine Chance mehr gegen den Fernseher, das Handy oder den Computer!“
Zweifelsohne prägen analoge oder digitale Medien den Familienalltag, aber Hilflosigkeit, die nicht selten mit einer gehörigen Portion Selbstmitleid daherkommt, kann man etwas entgegensetzen.
Dazu eine kurze Geschichte, eine Szene aus einem Seminar mit Großeltern und Enkelkindern: Der zwölfjährige Boris berichtete, wie er seine achtzigjährige Oma Maria für den Computer begeistert hat. Das sei gar nicht so einfach gewesen. Sie wollte das Handy nicht anfassen, den Computer, die Maus schon gar nicht, weil die rot blinkte und die Oma wohl dachte, sie bekäme dann einen elektrischen Schlag. Er schmunzelte. Doch er habe nicht aufgegeben. „Und jetzt macht sie seit einiger Zeit Online-Banking!“, er lächelte seine Großmutter an. Nun spiele er mit ihr am Computer „richtige Action-Spiele“ und sie hole mehr Flugzeuge vom Himmel als er. Boris schmunzelte hintersinnig: „Aber nur, weil ich sie gewinnen lasse!“ Er machte eine Pause: „Aber sie hat mich früher bei Mensch-ärgere-dich-nicht gewinnen lassen!“ Authentische Persönlichkeiten sind für Kinder wichtig, an ihnen orientieren sie sich.
Die Horrorbilder von einer digitalen Demenz sind mir allzu wehleidig. Nicht die Medien sollten im Zentrum der Diskussion stehen, sondern diejenigen, die damit umgehen. Auch wenn man manchmal den Eindruck hat, Kinder würden sich dem Gespräch mit den Eltern verweigern, sich zurückziehen und in die Welt der Medien fliehen, dann mag das auch daran liegen, wie Eltern kommunizieren. Der neunjährige Markus sagte: „Medien fragen nicht aus. Sie sind einfach still!“ Und weiter: „Endlich geht es in den Filmen nicht ums Lernen und die Schule!“ Und das sei gut.
Was die Medienvielfalt anbetrifft, ist die gegenwärtige Situation unvergleichlich. Für die Erziehung von Kindern – verstanden als die Beziehung zwischen Eltern und Kindern – bedeutet diese Vielfalt Herausforderung:
Da ist die digitale Revolution, die besondere Fähigkeiten herausbildet und erfordert. Kompetenzen, die manchen Erwachsenen, vornehmlich Vater und Mutter, die noch im analogen Zeitalter aufgewachsen sind, sprachlos machen und Unverständnis ausbilden. Man blickt nicht mehr durch! Der Satz: „Das hat es früher nicht gegeben!“, gilt mehr denn je. Früher war einst das Zeitalter der Bücher. Jene Druckerzeugnisse, die gegenwärtig hochgejubelt werden, begegnete man einst mit großer Skepsis!
Ende des 18. Jahrhunderts führte man im mitteleuropäischen Raum, vornehmlich im deutschen Lande, eine „Lesesucht-Debatte“. Man stritt darüber, ob und wenn ja, wie lange – vor allem aber, was gelesen werden sollte.
Ähnliche Fragen, die man sich heute stellt. Fragen, die mit jedem neuen Medium aufkamen – seien es Zeitschriften, Comics, Kino, Fernsehen, Videorecorder oder schließlich Computer, Laptops, MP3-Player und Smartphones. Immer ist da etwas Neues, noch nie Dagewesenes, etwas Unheimliches, das den Erwachsenen Angst macht und Unsicherheit verbreitet.
Nun soll hier nicht der Eindruck entstehen, dass es letztlich nichts Neues unter der Sonne gäbe. Zweifelsohne verändern die neuen digitalen Medien die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Waren diese beim Lesenlernen – sei es zu Hause, in der Schule oder im Kindergarten – auf die Erwachsenen angewiesen, gilt dieser Grundsatz nicht mehr: Heranwachsende gehen selbstbewusst und selbstverständlich mit den digitalen Medien um – ja, so manche Erwachsene lernen von ihren Kindern. Sie sind Lehrmeister ihrer Eltern. Das bedeutet aber nicht, dass sich damit die Erziehungsverantwortung verschiebt. Eltern bleiben – auch im digitalen Zeitalter – Vorbilder, die den Kindern bestimmte Grundsätze vorleben: Sie sind Vorbilder, an denen sich Kinder orientieren. Sie lassen zu oder setzen Grenzen!
Hinzu kommt ein anderer, gewichtiger Faktor: Digitale Medien sind ständig verfügbar und begleiten Kinder wie Erwachsene rund um die Uhr. Man kann sich ihnen kaum entziehen.
Zudem sind digitale Medien multifunktional – wobei sich die Frage stellt, ob analoge Medien das nicht auch waren. Klar ist aber: Digitale Medien erfüllen drei Funktionen:
Für Eltern, Erwachsene und pädagogisches Fachpersonal bedeutet das, diesen Besonderheiten gerecht zu werden.
Befunde aus wissenschaftlichen Untersuchungen weisen einen übereinstimmenden Nenner auf: Die Familie hat einen zentralen Einfluss auf die Vermittlung von Medienkompetenz. Der von Pestalozzi am Ende des 18. Jahrhunderts formulierte Grundsatz „Erziehung ist Vorleben“ bestätigt sich noch im digitalen Zeitalter. Das Vorleben führt zu einem selbstbestimmten und eigenständigen Umgang mit Medien. Natürlich darf man dabei den Freundeskreis nicht außer Acht lassen, der ja ohnehin „immer mehr darf“.
Das Wort „mehr“ hat aber meist nur einen quantitativen Aspekt. Die Maxime, wonach weniger mehr ist, gilt gleichermaßen für die Medienerziehung, die mehr sein muss, als sich nur über die Nutzungsdauer zu erregen. „Mehr“ bedeutet Beziehung zu sich selbst als Eltern und zu den Kindern.
Man kann Kinder nicht vor Gefährdungen schützen, aber man kann dazu beitragen, dass sie das selbsttätig und selbstbewusst tun. Hilfe zur Selbsthilfe, so das Credo von Maria Montessori, bedeutet also:
Es geht nicht allein um Medien, es geht um Kommunikation, Achtsamkeit, Respekt und erzieherische Grundhaltungen, die wichtiger sind denn je.
Und noch ein Gedanke, bevor man sich auf das Buch einlässt: Manchmal tauchen Gedanken, Sprachbilder wiederholt auf. Das geschieht mit Absicht, um mir wichtige Gedanken zu verstärken und zu unterschiedlichen Kontexten zu beleuchten.
2. Bloß alles richtig machen!
Wenn man etwas liest, so die Meinung von Eltern, klingt alles ganz einfach. Aber im Alltag und im Stress vergisst man so vieles!
Zugegeben, es ist manchmal ein Kreuz mit der Kindererziehung. „Egal, wie man‘s macht“, erklärte mir ein Vater, „man macht‘s falsch. Wenn ich sauer bin, mein Kind mal anschreie, entwickle ich Schuldgefühle!“ Er schaute mich an. „Aber wenn ich mein Kind nicht anschreie, obgleich es sich nicht an Absprachen hält, dann quäle ich mich noch stärker und frage mich hinterher ständig: Warum hast du keine Grenzen gesetzt? Wo bleibst du mit deinen Gefühlen?“
Dieser Vater ist in einer klassischen Falle: Er kann nicht „immer richtig“ handeln. Entweder stellt er seine eigenen Bedürfnisse hinten an, denkt nur an die Wünsche des Kindes, oder er verstößt gegen seine Grundsätze, ein Kind nicht anzuschreien.
In vielen Eltern-Kind-Beziehungen wollen die Eltern perfekt sein – und perfekt meint, einem selbstverordneten Ideal zu entsprechen. Dafür verzichten sie oft darauf, ihre eigenen Gefühle zu artikulieren. Eine merkwürdige Situation: Es scheint manchmal befreiender zu sein, spontan etwas „Falsches“ zu tun, etwa zu schimpfen, als stunden- oder tagelang mit heruntergeklappter Unterlippe durch die Wohnung zu laufen, dem anderen ein beleidigtes Gesicht zu präsentieren, um ihm ohne Worte, aber ebenso nachdrücklich zu zeigen, wie schlecht und unmöglich dieser Mensch ist.
Zweifellos haben alle Familienmitglieder Anspruch darauf, angemessen behandelt zu werden. Aber dies gelingt nicht immer. Wer die Schwäche hat, Fehler zu begehen, sollte die Stärke besitzen, sich zu entschuldigen – nicht unwillig, hingenuschelt oder weil es sich so gehört, sondern als ernstgemeinte Wiedergutmachung und mit der Absicht, künftig andere Konfliktlösungen zu entwickeln als die ungenießbare Melange aus Zuckerbrot und Peitsche oder den wortlosen, beleidigten Rückzug.
Perfekte Lösungen passen häufig nicht
Eine Mutter berichtete „Ich habe eine Absprache mit meinen Söhnen. Sie sollen mich mittags dreißig Minuten allein lassen. Ich brauche diese Ruhe. Aber nach zehn Minuten kommt Benjamin, mein Jüngster, vier Jahre alt, ins Zimmer, weil er Durst hat. Ich habe zu ihm ganz bestimmt gesagt: ‚Du weißt ja, wo alles steht. Geh!‘ Dann habe ich mit dem Finger zur Tür gewiesen. Ein klassischer Rausschmiss, er ist aber gegangen. Und ich hab‘ mir sofort gedacht, war das richtig? Gibt es nicht vielleicht eine elegantere Lösung?“ Sie dachte einen kleinen Augenblick nach, dann klang ihre Stimme ganz bestimmt: „Ja, es muss eine bessere Lösung geben, eine, die alle zufriedenstellt!“
Wiederum eine paradoxe Situation: Da führt eine Handlung zum gewünschten Ergebnis. Der Sohn verstößt gegen eine getroffene Absprache, die Mutter besteht auf Einhalten der Absprache. Sie artikuliert ihre Bedürfnisse. Das Kind akzeptiert dies – wenn auch nicht freudestrahlend. Trotzdem ist die Mutter unzufrieden. Sollte Benjamin etwa sagen: „Mutter, ich danke dir, dass du so konsequent bist“? Mütter, Väter und pädagogisch Handelnde scheinen nie zufrieden zu sein. Sie haben Schwierigkeiten, Grenzen zu setzen, aber unendlich viel mehr Schwierigkeiten mit den Konsequenzen und die allergrößten Probleme mit den eigenen Gefühlen, die sich aus den vollzogenen Konsequenzen ergeben. Wer Grenzen setzt, konsequent handelt, wird nicht geliebt, vielmehr respektiert und geachtet – manchmal auch gehasst. Diese Seiten gehören zu einer gefühlsmäßig reifen Eltern-Kind-Beziehung. Aber der Perfektionismus lässt diese Schatten nicht zu.
Nicht selten macht sich Resignation breit. Wenn ich mit Eltern Situationen und Ideen entwickle, um Probleme bei der Grenzsetzung zu lösen, höre ich schnell den Satz: „Habe ich alles schon versucht. Das klappt nicht!“ Aber was hin und wieder nicht funktioniert, muss nicht für alle Zeiten verworfen werden. Eltern – wie andere pädagogische Handelnde – sind in der Situation eines Schlossers, der ein unbekanntes Schloss zu knacken hat. Wenn er perfekt sein will, hat er Hunderte von Schlüsseln dabei, die er so lange ausprobiert, bis einer passt. Das kann lange dauern und manchmal passt überhaupt kein Schlüssel. Der clevere Türöffner benutzt deshalb einen Dietrich. Ein Dietrich öffnet ein Schloss, ohne dessen spezifische Einzelheiten bis ins Detail zu kennen. Mal passt ein Dietrich, mal nicht, dann kommt ein anderer zum Einsatz.
Das Öffnen eines unbekannten Schlosses ist vergleichbar mit dem Lösen eines Problems. Wenn man lange über die Ursachen nachdenkt, kommt man möglicherweise zu einer absolut richtigen Lösung – meist aber nicht, sitzt doch ein kleiner Specht im Hinterkopf, der ständig auf eine bessere Lösung pocht.
Nicht nach dem Warum, sondern nach dem Wozu fragen
Aus eben diesem Grunde helfen „Warum?“-Fragen wenig, um einen Streit aus der Welt zu schaffen. Das wissen Eltern und trotzdem werden sie gestellt. Auf insistierende „Warum?“-Fragen erhält der Erwachsene ein achselzuckendes „Darum!“, ein trotziges „Weil andere Schuld haben!“, ein verlegenes Grinsen oder ein leises „Weiß nicht!“. Lösungsorientierter ist die Verwendung von Fragen, die Dietrichen gleichkommen. Diese Vorgehensweise konzentriert sich nicht auf das „Warum?“ – „Warum machst du das?“, sondern darauf, dass ein Kind so handelt, wie es handelt, eben bummelt, andere schlägt.
Daraus entsteht eine unterschiedliche Lösungsperspektive: Während „Warum?“-Fragen den Blick zurückrichten, verändern „Wozu?“-Fragen – „Wozu handelt ein Kind so, wie es handelt?“ – den Blickwinkel. Sie stellen das Kind mit seiner Umgebung in den Mittelpunkt – z.B. ein Kind, das um sich schlägt, um damit Aufmerksamkeit zu bekommen. Solche „Wozu?“-Fragen zwingen den Erwachsenen zu einer genaueren Beobachtung des Kindes: „Was hat das Kind davon, wenn es so handelt, wie es handelt? „Wozu?“-Fragen bleiben im Hier und Jetzt, in der Gegenwart des Kindes, und bringen eine veränderte zweite Perspektive mit sich: „Wie kann ich gemeinsam mit dem Kind sein Verhalten ändern?“ – „Welche Lösungen bietet das Kind an?“
Peter Rudolf, ein Vater, hörte aufmerksam zu und runzelte die Stirn: „Das mit den Dietrichen und den Wozu-Fragen ist ja alles schön und gut. Aber auch nicht einfach. Also, wenn ich jetzt sauer auf meinen zehnjährigen Christoph bin. Er hat sich nicht an Absprachen gehalten. Also, ganz konkret: Wenn er sein Zimmer nicht aufräumt, seine Klamotten rumliegen lässt, sodass sie zerknittert und dreckig sind, werden sie nicht gewaschen. Er verspricht hoch und heilig, aufzuräumen. Gut, ich weiß aber schon im Vorhinein, dass er dann ständig die gleichen Sachen anzieht und irgendwann stinken, oder was weiß ich. Was denken dann die Leute?“
In diesem kurzen Gesprächsausschnitt ist ein anderer Punkt perfektionistischer Erziehung angedeutet.
Eltern verzichten deshalb auf Absprache und Konsequenz, weil sie meinen, die Folgen ihres Handelns voraussehen zu können. Meist sind es Fantasien darüber, was nicht funktioniert. Die negative Prophezeiung trifft dann nicht selten als eine sich selbst erfüllende Vorhersage ein. Eltern betrachten konsequentes Erziehungshandeln häufig unter problematischen Vorzeichen („Was alles passieren könnte!“), kaum unter einer produktiven Perspektive – und dies selbst dann nicht, wenn sich positive Folgen zeigen und Eltern sich in ihrer konsequenten Haltung bestätigt sehen.
Mit den Dietrichen zu arbeiten meint deshalb, mehr von dem zu praktizieren, was funktioniert – „Tue mehr davon!“, das heißt: Entscheidungen für bestimmte pädagogische Handlungsmuster gelten nur für einen bestimmten Zeitraum, dann passen sie nicht mehr, die Schlösser haben sich verändert, neue Dietriche müssen her. Dies spricht nicht gegen die alten. Sie sind nicht generell überholt, sie passen nur momentan nicht mehr, müssen deshalb nicht verworfen oder gar weggeworfen werden. Kinder (und Eltern) entwickeln sich, und damit entwickeln sich auch die Beziehungen und verändern sich Grenzen.
Dieses Gefühl, nicht zur Ruhe zu kommen, ist das „Nervende“, wie es eine Mutter ausdrückte: „Da hast du das Kind sauber. Und danach kommt es auf diese Schimpfwörter aus dem Kindergarten, und kaum hast du das klar, sitzt er auf dem Hausdach und schreit: ‚Ich bin Tarzan.‘ Und wenn du gut drauf bist, rufst du: ‚Deine Liane ist hier unten! Komm runter!‘ Und wenn du schlecht drauf bist, machst du alle Fehler der Welt auf einmal. Und so geht‘s weiter – du denkst morgens beim Aufstehen schon: Was der Tag wohl heute noch bringt?“
Was ist falsch? Was ist richtig?
Zwei (irrationale) Überzeugungen rufen jene Probleme hervor, die viele Eltern und pädagogisch Handelnde im Umgang mit Fehlern haben: Ich werde ärgerlich, vielleicht sogar wütend, wenn der Erziehungsalltag nicht so ist, wie ich ihn mir vorstelle oder vorgestellt habe. Klar ist man frustriert!