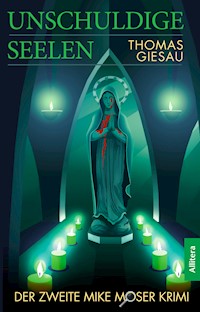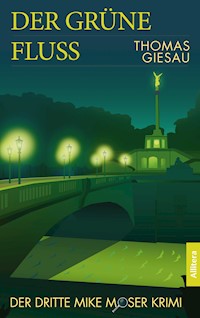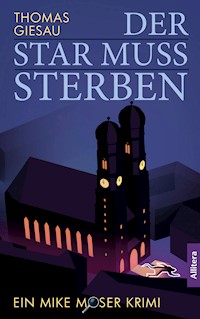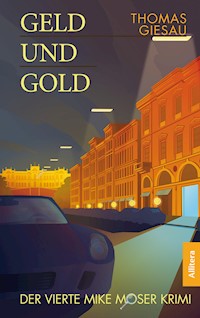
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Allitera Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»Geld und Gold« ist nach »Der Star muss sterben«, »Unschuldige Seelen« und »Der grüne Fluss« der vierte Krimi aus der Reihe um den Münchner Ermittler Mike Moser (»Die vier Fälle des Mike Moser«). Ein Münchner Juwelier trauert um seinen Sohn, der das Geschäft übernehmen sollte. Selbstmord, sagt die Polizei, Mord, glaubt der Vater.Herausfinden, was zutrifft, soll Moser. Der ist allerdings privat angeschlagen. Zum ersten Mal hat er jemanden erschossen. Zwar aus Notwehr, trotzdem verfolgt ihn dieser Vorfall bis in seine Träume. Der Dönerimbiss seines Freundes Akif, der bislang Zufluchtsort und zweites Zuhause für Moser war, existiert nicht mehr. Und seine Exfrau will erneut heiraten. Einen anderen, versteht sich. Also stürzt sich Moser in die Arbeit, wäre doch gelacht, wenn er diesen Fall nicht lösen könnte …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Giesau heißt im wahren Leben nicht so. Den Namen Giesau, zusammengesetzt aus den Münchner Stadtvierteln Giesing und Au, hat er als Pseudonym für seine vierteilige Krimireihe um den Münchner Privatdetektiv Mike Moser angenommen. Der gebürtige Münchner war viele Jahre als Filmjournalist tätig, heute ist er Buch- und Drehbuchautor.
Weitere Informationen über den Verlag und sein Programm unter: www.allitera.de
November 2016 Allitera Verlag Ein Verlag der Buch&media GmbH, München © 2016 Buch&media GmbH Umschlaggestaltung: Moritz Mayerhofer | studionice, Berlin ISBN print 978-3-86906-878-7 ISBN epub 978-3-86906-879-4 ISBN pdf 978-3-86906-880-0 Printed in Europe
I
Wie lange dauert es, bis Alkohol im Körper abgebaut ist? Darüber hätte ich aus eigener Erfahrung problemlos Auskunft geben können. Eine andere Frage war nicht so leicht zu beantworten: Wie lange dauert es, bis Schuldgefühle und Selbstvorwürfe im Kopf abgebaut sind? Ich wusste es nicht, denn ich war gerade dabei, diese Erfahrung zu machen, aber ich ahnte schon, dass es lange dauern würde, verdammt lange. Und dass mir all das die Arbeit an dem Fall, zu dem ich mich hatte überreden lassen, nicht gerade erleichtern würde. Ich schaffte es ja nicht einmal, mich aufs Autofahren zu konzentrieren.
Hoffentlich war uns niemand gefolgt. Denn als wir in Karlsfeld ankamen, wurde mir klar, dass ich nicht aufgepasst hatte. Immer wieder hatte es während der Fahrt Momente gegeben, in denen meine Gedanken sich selbstständig machten, ihre eigenen Wege gingen und ich wie ein Automat beschleunigte, bremste oder die Richtung änderte, ohne auf meine Umgebung zu achten. Ich wusste, was das bedeuten konnte, ich kannte die Gefahr, in der sich die Leute befanden, die sich mir anvertraut hatten. Aber ich hatte es nicht verhindern können. Das, was meinen Kopf besetzt hielt, war stärker als alle guten Vorsätze. Es hatte in den vergangenen Wochen allen Versuchen widerstanden, es zu vertreiben oder im Alkohol zu ertränken, und mich in einen Zustand versetzt, den ich, vorsichtig ausgedrückt, nur als beschissen bezeichnen konnte.
»Wir sind da, Herr Moser«, sagte Frau Gisela Tanner.
»Gleich da vorne rechts.«
Ihr zwölfjähriger Sohn Jonas, der hinter ihr auf dem Rücksitz saß, sagte gar nichts. Ich konnte sein Gesicht im Rückspiegel sehen. Er starrte vor sich hin, als ginge ihn das alles nichts an. Als ich die beiden von zu Hause abholte, hatte er nur dumpf »Hallo« gesagt, wortlos seiner Mutter geholfen, die beiden Koffer ins Auto zu wuchten, und sich dann auf den Rücksitz fallen lassen. Seine Mutter bemühte sich wenigstens, ein freundliches Gesicht zu machen, zwang sich auch mal ein Lächeln ab, doch ihre angespannten Gesichtszüge, die dunklen Schatten unter den leicht geröteten Augen zeigten, wie ihr wirklich zumute war. Wir waren, alles in allem, eine ziemlich traurige Fuhre, die da in den Norden Münchens und darüber hinaus unterwegs war.
Ich hielt vor dem dreistöckigen, langgestreckten Haus, wir holten das Gepäck aus dem Kofferraum und fuhren mit dem Lift in den dritten Stock hoch. Es war eine recht geräumige Dreizimmerwohnung, nett eingerichtet und mit einem Balkon, der fast die ganze Breite der Wohnung einnahm. Ich trat hinaus und stellte fest, dass man vom Haus gegenüber die gesamte Wohnung überblicken konnte.
»Sie sollten am Abend immer die Vorhänge zuziehen«, sagte ich zu Frau Tanner, die mich zur Tür begleitete.
»Machen wir«, antwortete sie. »Und Sie sind sich sicher, dass Ihnen niemand gefolgt ist?«
»Bin ich«, sagte ich und ging zum Lift. Ich wollte nicht, dass sie mir ins Gesicht sah.
Ich fuhr nach München zurück. Karlsfeld gehört ja, verwaltungsmäßig, bereits zu Dachau, liegt aber, bevölkerungsmäßig, im Münchner Einzugsgebiet, also dort, wo die Menschen hinziehen, die sich die Innenstadt nicht mehr leisten können. Billig ist es aber auch dort schon lange nicht mehr.
Warum hatte ich mich bloß auf diese Geschichte eingelassen? Schuld daran war Hannah Rechling, Redakteurin bei der Abendpost, mit der mich einmal mehr als nur berufliche Interessen verbunden hatten. Oder immer noch verbanden, so genau vermochte ich das nicht zu unterscheiden. Sie hatte mich mit Erich Tanner zusammengebracht.
Ich war nur ungern zu dem Treffen gegangen, um das Hannah mich vor ein paar Tagen gebeten hatte. Sie hätte da vielleicht einen interessanten Auftrag, hatte sie gesagt. Da dies aber eine Sache sei, die mit ihrer Arbeit in der Redaktion nichts zu tun habe, wollte sie mich in einem Café in der Nähe treffen. Ich hatte gezögert, weil ich dachte, sie hätte da nur etwas aufgetan, um mich zu beschäftigen, um mich aus dem tiefen Loch herauszuholen, in das ich gefallen war. Aber was war, wenn ich gar nicht herauswollte, wenn es mir gefiel, mich in Selbstvorwürfen und Selbstmitleid zu vergraben? Wenn ich, verdammt noch mal, nicht wollte, dass sie sich einmischte!
Das, was geschehen war, ließ sich in einem kurzen Satz zusammenfassen: Ich hatte einen Menschen getötet. So etwas kann ja mal passieren in diesem Beruf, sollte man sich da ganz cool sagen und versuchen es wegzudrücken. Einmal hatte es ja schon geklappt. Es war ein Psychopath gewesen, der mich und meinen Sohn hatte ermorden wollen. Zum Schluss ging es nur noch um die Frage: Er oder wir? Wir waren mit viel Glück übrig geblieben, und es hatte mir hinterher nicht viel ausgemacht, ihn ins Jenseits geschickt zu haben. Diesmal jedoch war es anders gewesen, ganz anders.
Hannah war schon da, als ich das Café betrat. Bei ihr am Tisch saß ein Mann, der die Sechzig bestimmt schon lange hinter sich hatte. Dichtes weißes Haar, rundes Gesicht, dem senkrechte Falten die früher mal vorhanden gewesene Gemütlichkeit ausgetrieben hatten, helle, müde Augen. Zur Begrüßung erhob er sich nur andeutungsweise. »Meine Knie«, sagte er entschuldigend. Nachdem ich ein Mineralwasser bestellt hatte, bat er Hannah, mir zu sagen, worum es ging. »Sie können bestimmt besser reden als ich.«
Sie sah wieder mal ziemlich unverschämt gut aus. Aber wenn sie ihre graugrünen Augen auf mich richtete, konnte ich darin keine Zuneigung oder Ähnliches erkennen, sondern eher eine Art misstrauischer Besorgnis. Es ging mir auf die Nerven, aber dann blickte sie wieder sachlich und begann zu erzählen.
Der Mann, der mir gegenüber saß, hieß Erich Tanner und war Goldschmied. Zusammen mit seinem Sohn Helmut betrieb er einen Laden in der Innenstadt, in der Müllerstraße, der passabel lief. Man konnte nicht reich werden, aber es gab keine finanziellen Probleme. Schließlich gehörte die Ecke hier zum angesagten Glockenbachviertel, und da wohnten nicht gerade die Ärmsten der Armen. Aber nachdem vor vier Jahren seine Frau gestorben war, ging es mit Tanners Gesundheit schnell bergab. Zu seiner Arthrose, an die er sich fast schon gewöhnt hatte, kamen noch Herzprobleme, und das brachte ihn dazu, den Laden an seinen Sohn Helmut zu übergeben und nur noch gelegentlich in der Werkstatt mitzuarbeiten. Helmut Tanner hatte eine etwas andere Vorstellung von der Art des Schmucks, er machte ein moderneres Design, der Alte hatte nichts dagegen, es verkaufte sich gut.
Mein Gegenüber schien zu merken, dass Hannahs ausführliche Schilderung mich zusehends langweilte, und mischte sich ein. »Aber dann hat sich mein Sohn auf diese Leut einglassen, und als er wieder aussteigen wollt, war's zu spät.« Er verstummte und starrte auf seine leere Kaffeetasse. Vielleicht dachte er, Hannah hätte mich schon vorher über das informiert, was dann geschah.
»Wieso zu spät?«, fragte ich.
Er schaute nur kurz auf. »Weil sie ihn umbracht ham.«
Davon hatte Hannah mir nichts gesagt. Sie hatte nur von einem Goldschmied gesprochen, der ein Problem habe. Mord also. Schon wieder. Ausgerechnet jetzt. Nicht mit mir!
Ich griff nach meinem Glas, erinnerte mich, dass nur Wasser drin war und kein Alkohol, und trank es trotzdem leer. »Mord ist Sache der Polizei. Das geht mich nichts an. Viel Glück«, sagte ich und stand auf.
»Mike, bitte!« Das war Hannah. Sie sah mich an, in ihrem Blick lag so einiges, was mich unter normalen Umständen berührt hätte, mich aber jetzt nicht interessierte. Natürlich hatte sie mir absichtlich verschwiegen, worum es hier ging.
Tanner stand ebenfalls auf. »Ich kann Sie verstehen, Herr Moser. Danke für Ihre Geduld. Tut mir leid, dass Sie umsonst 'kommen sind.«
Das hatte mir gerade noch gefehlt! Ich lehnte es ab, ihm zu helfen, und er entschuldigte sich bei mir. Plötzlich fühlte ich mich sowas von mies, dass ich bei der Bedienung einen Cognac bestellte und mich wieder setzte. Ich vermied es, Hannah anzusehen, und sagte zu Tanner, der auch wieder auf seinem Stuhl saß: »Moment noch. Weshalb wollen Sie, dass ich ermittle und nicht die Polizei?«
»Weil die Polizei es für einen Unfall hält. Sogar einen Selbstmord schließt sie net aus. Totaler Blödsinn!«
Sein Sohn, sagte Tanner, habe mit »diesen Leuten« nichts mehr zu tun haben wollen, aber sie hätten ihn unter Druck gesetzt und als er sich weiterhin weigerte nachzugeben, hätten sie sich zu einer Besprechung auf der Seeshaupt getroffen. Die Seeshaupt war eines der Rundfahrtschiffe auf dem Starnberger See.
»Wieso ausgerechnet dort?«
»Koa Ahnung. Ich weiß ja net amal, ob's seine Idee war oder ihre. Vielleicht hat er sich da sicher gfühlt. Auf so einem Schiff hat man ja an besseren Überblick, hat er vielleicht 'denkt.« Er machte eine Pause, schnaufte tief durch und sagte dann: »Was passiert is, hab i ja erst viel später erfahren, von der Polizei.«
Er verstummte. Das Schreckliche, das dort geschehen war, konnte er nicht in Worte fassen. Hannah übernahm: »Er ist über Bord gegangen, niemand hat gesehen, wie. Es soll eine Zeugin geben, die auch von der Polizei vernommen wurde. Aber sie war angeblich zu weit weg, um Genaueres zu erkennen.«
»Sie hat also überhaupt nichts mitbekommen?«, hakte ich nach.
»Nein, wie ich schon sagte.« Hannah klang genervt. »Sie hat nur angegeben, dass ein paar Leute ihn festhalten wollten, es aber nicht geschafft hatten.«
Ihre Ungeduld konnte mich von meiner nächsten Frage nicht abbringen: »Klingt irgendwie seltsam, findest du nicht? Was für Leute waren das denn? Die Polizei muss sie doch vernommen haben.«
»Keine Ahnung, verdammt! Für uns war die Sache erledigt, wir haben da nicht weiter nachgebohrt. Aber das wäre dann ja deine Aufgabe.«
Tanner merkte natürlich, dass sich da zwischen uns eine ungute Spannung aufbaute. Es war ihm sichtlich peinlich, und er sagte zu Hannah: »Bitte, könnten Sie weiter erzählen?«
»Natürlich, entschuldigen Sie. Also, man hat Helmut Tanner schnell herausholen können, aber es war zu spät. Er ist in die Schraube geraten. Wir haben damals darüber berichtet, aber als die Polizei die Ermittlungen einstellte, war auch für uns Schluss.«
Bald darauf habe Tanner sich an die Zeitung gewendet und behauptet, es sei kein Unfall, sondern Mord gewesen. Man verwies ihn an Bodo Pasch, den Polizeireporter, doch auch der winkte ab. Solange er keine konkreten Hinweise habe, könne er nichts machen. Er sei schließlich kein Detektiv. Aber es gäbe da eine Kollegin in der Redaktion, die habe Kontakt zu einem, der ziemlich gut sei.
»Er hat wirklich ›ziemlich gut‹ gesagt«, sagte Hannah und sah mich an.
Unter normalen Umständen hätte ich mit einer flapsigen Bemerkung geantwortet, aber sie waren nicht normal. Also knurrte ich nur »Von mir aus« und wandte mich Tanner zu:
»Wie ist das alles gelaufen. Bitte von Anfang an.«
Was Tanner mir nun ziemlich umständlich klarzumachen versuchte, ließ sich in wenigen Sätzen zusammenfassen: Sein Sohn hatte sich zur Geldwäsche missbrauchen lassen, vielleicht auch als Hehler von gestohlenem Schmuck. Von Leuten, die international vernetzt waren. Und als er ankündigte, aussteigen zu wollen, wurde er ermordet. Wahrscheinlich hatte er seinen Geschäftspartnern gedroht, sie auffliegen zu lassen, wenn sie ihn nicht ziehen ließen. Alles, was Tanner erzählte, hörte sich logisch an – nur als ich ihn nach Details fragte, nach Namen, musste er passen. Sein Sohn hatte ihn nicht eingeweiht, er wollte seinen Vater da raushalten. Erst ganz zum Schluss habe er einiges zugegeben.
»Aber er muss sich doch abgesichert haben, bevor er diese Leute unter Druck setzte«, sagte ich. »Es muss Unterlagen geben, die er irgendwo deponiert hat. Bei einer Person, der er vertraut. Und das können doch wohl nur Sie sein.«
»Stimmt. Das denken auch die Scheißtypen, mit denen er z'tun ghabt hat. Deshalb hat er alles woanders hinbracht. Er hat mir nimmer sagen können, wohin.«
Tanner schwieg, und in meinem Kopf wirbelten zahlreiche Fragen durcheinander. Eine verdrängte alle anderen: Warum in aller Welt sollte ich mir das antun? Aber es gab da auch eine Antwort, die, ganz leise, von irgendwoher in mein Gehirn sickerte: Weil du nur mit einem neuen Auftrag aus dem Loch wieder rauskommst, in dem du feststeckst, du Idiot! Aber musste es ausgerechnet dieser sein?
Hannah mischte sich ein. »Bevor wir weiterreden … Ich glaube, es gibt da eine ziemlich dringende Sache, die wir gleich jetzt entscheiden sollten.«
»Stimmt«, sagte Tanner. »Sie haben mich angerufen und gesagt, dass sie sich meine Familie vornehmen, wenn i net innerhalb von drei Tagen die Unterlagen übergeb. Oder wenn i die Polizei einschalt. Und dann haben sie mir noch das da gschickt.« Er zog ein Foto aus der Jackentasche und gab es mir. Es zeigte eine junge Frau, die mit einem etwa zehn, zwölf Jahre alten Jungen gerade ein Auto besteigen wollte.
»Ihre Schwiegertochter?«, fragte ich.
»Ja, mit meim Enkel. Er hat auch noch a Schwester, die is vierzehn, aber die is net da.«
Wieso nicht da? In so einer Situation sollte die Familie doch eigentlich zusammenbleiben. Vermutlich war mir anzusehen, was ich dachte, denn Tanner sagte: »Die Mia is ziemlich eigenwillig, liegt wahrscheinlich am Alter. Und der Tod vom Vater hat sie total aus der Bahn gschmissn. Jedenfalls hat sie sich geweigert, sich mit Mutter und Bruder irgendwo zu verstecken. Sie is gestern mit der Bahn nach Rosenheim gfahrn. Mir ham in der Gegend mal a Ferienwohnung ghabt, die Leut dort mögen sie, sie ham zwei Kinder in ihrem Alter. Die Mia kann dort bleiben, so lange sie will, es sind ja noch Ferien. Vielleicht hilft es ihr ja.«
Von mir aus. Eine Person weniger, um die ich mich zu kümmern hatte. Vorausgesetzt, ich übernahm den Fall.
»Wir sollten die beiden in Sicherheit bringen«, sagte Hannah.
Musste sie eigentlich immer dazwischenreden? Ich unterdrückte das, was ich sagen wollte, und sagte stattdessen zu Tanner: »Kennen Sie jemand, bei dem man sie vorübergehend unterbringen könnt?«
»Ja.«
Einen Notausgang wollte ich mir aber noch offenhalten:
»Wenn ich innerhalb einer Woche keine konkreten Anhaltspunkte für einen Mord gfunden hab, steig i aus. Klar?«
Tanner nickte. Hannah schaute demonstrativ an mir vorbei.
Wie sollte es nun weitergehen? Ich war auf der Rückfahrt von Karlsfeld und wusste immer noch keine Antwort auf diese Frage. Gisela Tanner und ihr Sohn waren jetzt in der Wohnung ihrer Schwester, die in einer Woche aus dem Urlaub zurückkehren würde. Sie hatte nichts dagegen gehabt, dass die beiden vorübergehend dort wohnten. Und dann? Die Leute, mit denen Helmut Tanner sich eingelassen hatte, würden auch nach einer Woche noch keine Ruhe geben. Und sie mussten davon ausgehen, dass der Vater informiert war. Der hätte natürlich zur Polizei gehen können, aber was konnte er denen schon erzählen? Und vor allem: Er hätte seinen Sohn beschuldigen müssen. Der war zwar tot, aber das änderte nichts an den Gefühlen des Vaters. Und er hatte keinen Beweis dafür, dass Helmuts Tod kein Unfall war.
Bei unserem Treffen im Café hatte er mir auch geschildert, wie es anfing. Wenigstens das hatte er später von seinem Sohn erfahren. Eines Tages war ein Mann in den Laden gekommen, hatte sich einiges zeigen lassen und dann ohne langes Herumreden das teuerste Stück, einen goldenen, diamantenbesetzten Armreif für zwölftausend und einen Ring für viertausend Euro gekauft. Und er bezahlte bar. Helmut Tanner wollte sich den Ausweis zeigen lassen, doch der Kunde lehnte ab, schließlich sei er nach dem Geldwäschegesetz erst ab einem Einzelkauf von fünfzehntausend Euro verpflichtet, sich auszuweisen. Das hier seien aber nur zwei Einzelkäufe. Und dann sagte der Kunde, wenn sie sich jetzt einigten, kämen noch weitere gute Geschäfte auf ihn zu. Das mit den zwei Einzelkäufen war natürlich Unsinn, aber Helmut Tanner, der plante, ein Haus zu kaufen und das Geld gut gebrauchen konnte, gab nur zu gerne nach.
Er sei überrascht gewesen, wie gut die Geschäfte plötzlich liefen, sagte der Vater, und er habe sich gewundert: »Der hat sogar Schmuck verkauft, den i vorher noch nie gsehn hab, den konnt er gar net selber hergstellt ham. Aber wenn ich ihn danach gfragt hab, is er immer gleich ausgrast. Alles is in Ordnung, hat er gsagt, er hätt a Bezugsquelle im Ausland, alles ganz legal. Sowas wie Outsourcing. Ich hab ihm kein Wort glaubt.«
Ich änderte die Fahrtrichtung. In solchen Situationen, wenn ich das Gefühl hatte festzustecken, half manchmal ein Gespräch mit meinem Freund Akif in dessen Dönerladen. Ich pflegte ihm keine Details über den Fall zu verraten, mit dem ich gerade zu tun hatte, aber schon ein paar ungefähre Angaben genügten ihm, um Vorschläge zu machen und von Erfahrungen mit ähnlichen Problemen zu berichten. Meistens lag er damit voll daneben, aber manchmal war eben doch etwas dabei, das mir weiterhalf. Und überhaupt war ich gerne dort, in dem kleinen Kabuff, das »Lokal« zu nennen schon gewaltig übertrieben gewesen wäre. Die Atmosphäre, die manchmal recht merkwürdigen Gestalten, die da herumhingen, all das tat mir gut und half dabei, Abstand zu gewinnen. Ich war schon längere Zeit nicht mehr dort gewesen und gespannt, was aus der Kündigung geworden war, von der Akif mir vor ein paar Monaten erzählt hatte. Angeblich sollte das Haus, ein Altbau, saniert werden.
Ich bog um die Ecke, das Haus stand noch und hatte sich nicht verändert. Aber dann schaute ich durch die Scheibe, und sah erst mal gar nichts: düstere Leere, nur der nackte Dönerspieß ragte nach oben, nichts drehte sich mehr, die Szenerie hatte etwas Obszönes. Ich trat ein. Kisten standen herum, ein schaler Geruch nach kaltem Bratfett hing in der Luft und der Tresen war leer und poliert, was jedoch die zahllosen Flecken nicht zum Verschwinden gebracht hatte. Ein Tisch mit zwei Stühlen stand noch da, das übrige Mobiliar war verschwunden.
Im Nebenraum, der Akif als Lager diente, rumpelte es. In Jeans und T-Shirt, ohne die übliche weiße Schürze, kam er heraus. »Hallo, mein Freund. Du kommst gerade noch zur rechten Zeit. In zwei Tagen bin ich hier weg.«
Ich hatte mich von meiner Überraschung noch nicht erholt.
»Ist es wirklich schon so weit?«
»Ja. Und es ist alles geregelt. Möchtest du etwas trinken? Zu essen gibt es leider nichts mehr.«
Ich nickte, und er holte zwei Flaschen Augustiner aus dem immer noch eingeschalteten Kühlschrank. Wir stießen an, und ich meinte: »Besonders traurig schaust ja net aus.«
»Bin ich auch nicht. Hab ich nur noch ein kleines Problem zu lösen. Aber du, mein Freund, du siehst ziemlich scheiße aus. Was ist passiert?«
Richtig, er wusste es ja noch nicht. Sollte ich es ihm erzählen? Natürlich, wem auch sonst. Nur Hannah wusste noch Bescheid und Kommissar Ingo Kramsky von der Mordkommission, aber der nur von Amts wegen.
»Kann ich einen Schnaps haben?«, fragte ich. Akif war kein Freund von harten Sachen, aber ich wusste, dass er für alle Fälle immer eine Flasche bereit hielt.
»Ausnahmsweise«, murmelte er, ging hinter den Tresen und füllte ein Schnapsglas mit Obstler. Mit Raki, Ouzo und ähnlichen Anisschnäpsen hatte er es nicht so.
Ich kippte den Obstler, bildete mir ein, es würde mir besser gehen und erzählte.
In einem Baumarkt hatte es einige Diebstähle gegeben, man hatte auch schnell einen Verdächtigen gefunden, und als man in seinem Spind eine teure Bohrmaschine entdeckte, schien die Sache klar zu sein. Zumal Anton Krontaler, so hieß der Mann, vorbestraft war: Körperverletzung, die aber schon lange zurücklag. Der Filialleiter hatte ihn jedoch nicht gleich entlassen, sondern nur nach Hause geschickt und dann mich angerufen. Ich sollte ihm helfen, die Sache zu klären, denn Krontaler würde vehement seine Unschuld beteuern. Und er sei ein guter Mitarbeiter.
Das war nicht gerade ein Auftrag, der mich begeisterte, aber ich hatte mit dem Filialleiter früher mal zu tun gehabt, weshalb ich nicht nein sagen konnte. Ich machte mich an die Arbeit, es dauerte nur ein paar Tage, und ich hatte herausgefunden, dass eine Kassierin sich bedient hatte. Und als sie Angst bekam, aufzufliegen, hatte sie den Verdacht auf Krontaler gelenkt.
Der Filialleiter freute sich, dass es so ausgegangen war. Er wollte ihm die gute Nachricht persönlich überbringen und bat mich, ihn zu begleiten, Krontaler sei manchmal ziemlich cholerisch. Unterwegs erzählte mir der Filialleiter, sein Mitarbeiter habe zuletzt viel Pech gehabt, vor ein paar Wochen habe ihn auch noch seine Frau aus der gemeinsamen Wohnung geworfen, jetzt wohne er in seinem Schrebergarten im Stadtteil Thalkirchen. Seine Tochter würde ihn dort gelegentlich besuchen.
Ich machte eine Pause. Ich hätte gern noch einen Obstler gehabt, aber ich wusste, dass Akif mir jetzt keinen geben würde. Was den Alkohol anging, hatte er so seine Grundsätze.
Also redete ich weiter. Wir kamen nach Thalkirchen und gingen durch die Schrebergartenkolonie. Schon von Weitem hörten wir laute Stimmen, anscheinend ein Streit. Als wir ankamen, sahen wir in einem der Gärten einen etwa fünfzigjährigen Mann vor seinem Häuschen, offenbar total besoffen. Vor ihm standen zwei Männer, die auf ihn einredeten, neben ihm versuchte eine junge Frau vergeblich, ihn zu beruhigen.
»Seine Tochter Hedwig«, erklärte mir der Filialleiter.
Bei dem Streit schien es darum zu gehen, dass die Männer Krontaler zu erklären versuchten, er könne hier nicht länger wohnen bleiben. Das sei nun mal nicht erlaubt.
»Soll i vielleicht unter der Isarbruckn schlafen?«, brüllte Krontaler. »Wollt's ihr mi jetzt ganz fertigmachen? I hab doch sonst nix mehr!«
»Jetzt schlaf erst mal dein Rausch aus, Anton«, versuchte einer der Männer ihn zu beruhigen.
Krontaler wollte antworten – doch da sah er den Filialleiter und mich näherkommen. »Super! Noch einer, der mich rausschmeißen möcht!«, schrie er. »Wohnung weg, Frau weg, Job weg! Jetzt is Schluss! Aber bevor i abtret, nehm i a paar von euch mit!«
Plötzlich hatte er eine Pistole in der Hand und fuchtelte damit herum.
»Alles ist aufgeklärt«, versuchte ihn der Filialleiter zu beruhigen. »Sie sind unschuldig, Herr Krontaler.«
»Jetzt auf einmal. Ich glaub euch nix mehr, ihr Scheißtypen!« Krontaler schwankte hin und her, zielte mit der Pistole mal auf den einen, mal auf den anderen … »Papa, hör auf!«, schrie seine Tochter.
Inzwischen zog ich die Beretta hinten aus dem Hosenbund. Warum ich sie mitgenommen hatte, vermochte ich später nicht mehr zu sagen. Es musste etwas mit Schicksal zu tun gehabt haben, mit meinem und mit dem von Krontaler. Es ging alles viel zu schnell. Die Tochter griff nach seinem Arm, um die Hand mit der Pistole herunterzudrücken, aber der schwankende Lauf war immer noch auf uns gerichtet, gleich würde es knallen – ich schoss. Ich zielte auf die Beine, so ungefähr, es musste ja schnell gehen, ich bin schließlich kein Kunstschütze …
Im selben Augenblick, in derselben verdammten Zehntelsekunde, stürzte Krontaler, durch das Ziehen seiner Tochter zusätzlich aus dem Gleichgewicht gebracht, nach hinten. Und die Kugel traf nicht die Beine, sondern schlug weiter oben ein. Bauchschuss.
»Tot?«, fragte Akif.
»Nicht gleich. Später, im Krankenhaus.«
Akif sah mir ins Gesicht, stand wortlos auf und goss mein Schnapsglas voll. Ich leerte es und sagte: »Seine Pistole war nicht geladen.«
Gefühlte zwei Minuten lang sagten wir gar nichts. Vielleicht waren es aber auch nur zehn Sekunden.
»Aber du hast keine Schuld«, sagte Akif vorsichtig.
»Nein, das hat die Polizei festgestellt. Und auch der Staatsanwalt. Es war Putativnotwehr, Notwehr zum Schutz Dritter. Also ist alles in Ordnung. Eigentlich kein Grund, sich beschissen zu fühlen.«
Akif antwortete nicht. Was hätte er auch sagen sollen.
Ich verabschiedete mich. Als ich meinen in einiger Entfernung geparkten Wagen aufschloss, sah ich vor Akifs Haus, vor der Einfahrt, einen großen dunklen BMW anhalten. Zwei Männer stiegen aus, sie sahen auch irgendwie türkisch aus, und verschwanden im Laden. Warum sollte ich da stehen bleiben und abwarten? Zwei Türken besuchen einen Türken. Trotzdem blieb ich stehen und wartete ab. Vielleicht wächst einem ja nach vielen Detektivjahren so etwas wie ein zusätzlicher Instinkt zu. Ein Instinkt für Übles und Bedrohliches. Schon nach wenigen Minuten kamen sie wieder heraus und fuhren weg. Ich ging zurück.
Akif lag in der Ecke und versuchte gerade stöhnend, sich aufzurichten. Er blutete aus der Nase und aus dem Mund. Die beiden Typen hatten ihn zusammengeschlagen. Ich half ihm, sich auf einen Stuhl zu setzen, fand hinterm Tresen Papierservietten und reichte sie ihm, damit er sich das Blut abwischen konnte. Auch am Kopf hatte er eine Schramme, er war gegen die Wand geprallt.
»Ich hab dir doch vorhin gesagt, es gibt noch ein kleines Problem«, stöhnte er. »Vielleicht ist es doch ein bisschen größer.«
»Willst du es mir sagen?«
»Noch nicht. Sieh erst mal zu, wie du mit deinem Problem zurechtkommst. Und jetzt geh bitte. Ich rufe meine Frau an, die kümmert sich um mich.«
»Ich kann wirklich nichts für dich tun?«
»Später vielleicht.«
Ich sah ein, dass es sinnlos war, ihm etwas entlocken zu wollen, was er nicht sagen wollte. Ich ging.
Dann war ich zu Hause. Ich fühlte mich dort nicht wohl, aber weggehen wollte ich auch nicht. Ich wäre doch nur in der Kneipe gelandet, um mich volllaufen zu lassen. Das konnte ich zu Hause billiger haben. Ich trank erst mal ein Bier, ich wusste genau, wie es weitergehen würde. Ich rang mich jedoch dazu durch, ein paar Scheiben der Fleischwurst aus dem Supermarkt in die Pfanne zu schmeißen, drei Eier drüber, fertig. Dazu passte natürlich am besten ein Bier und dann noch ein Bier.
Es wurde allmählich Abend. Wir waren allein in der Wohnung, meine Gedanken und ich. Und die Erinnerungen, aber die hatten ja auch mit meinen Gedanken zu tun. Krontaler gehörte natürlich auch dazu, eine ganz frische Erinnerung. Ich sah ihn schon wieder fallen, rückwärts, seine Tochter hielt ihn noch am Arm, der die Pistole hielt, der andere Arm ruderte in der Luft. Als meine Kugel in den Bauch einschlug, riss es den ganzen Mann nach hinten, im Sturz drehte er sich ein wenig zur Seite und knallte auf die hölzerne Schwelle. Dann war Stille. Und dann der Schrei seiner Tochter …
Ich holte den Whisky aus dem Regal. Es war ein billiger vom Discounter, aber das war jetzt scheißegal. Ich wusste, dass das keine Lösung war, dass es idiotisch war, aber es musste einfach sein. Und für kurze Zeit half es ja auch. Ich holte ein schönes, dickwandiges Whiskyglas aus dem Schrank, auf Stil sollte man schließlich auch beim Besaufen nicht ganz verzichten, und schaltete den Fernseher ein.
Es war die Zeit der Vorabendserien. Schmalztriefender Kitsch im Ersten, ein dämlicher Krimi im Zweiten und Regionales im Dritten, ich schaltete hin und her, schaute auch mal bei den Privaten rein, doch da war es noch schlimmer. Ich ließ dann einfach irgendwas laufen, um nicht ganz allein zu sein, und schaltete den Ton ab. Und machte das Glas wieder voll. Und so weiter.
Die Gedanken kreisten immer noch. Um Krontaler im Speziellen, um meinen Beruf im Allgemeinen, Akif tauchte auch auf, blutend am Boden liegend, und dann war plötzlich Hannah da.
Ausgerechnet Hannah. Ausgerechnet jetzt.
Ich wusste, dass ich mir über meine Beziehung zu ihr klar werden musste, über meine Gefühle für sie. Aber nicht jetzt, wo überhaupt nichts mehr klar war. Ich mochte sie, sie mich bestimmt auch, vielleicht war es bei ihr sogar mehr. Vielleicht auch nur in meiner Einbildung.
Krontalers Tochter verdrängte Hannah aus meinem Kopf. Etwa eine Woche nach dem Tod ihres Vaters, meine Unschuld war inzwischen offiziell festgestellt worden, war ich zu ihr gefahren. Was hatte ich mir bloß erhofft? Absolution? Verständnis? Womöglich sogar Trost? Wie dämlich muss man sein, um so etwas zu glauben! Natürlich hatte sie mich angeschrien, mich einen Mörder genannt und mir die Tür vor der Nase zugeschlagen.
Die Zeit verging langsam, aber sie verging. In der Whiskyflasche war nicht mehr viel drin, soweit ich das feststellen konnte. Ich griff nach ihr und fegte dabei eine Bierflasche vom Tisch, die noch halbvoll gewesen war und sich jetzt auf den Boden entleerte. Es war mir egal. Im Bauch hatte ich plötzlich ein komisches Gefühl. Ich hielt es für Hunger, stemmte mich hoch und schwankte zum Kühlschrank. In einer Plastikschale war ein Rest kalter Apfelstrudel. Richtig schön kalt, dazu noch zwei, drei Schluck lauwarmes Bier aus einer der herumstehenden Flaschen …
Ich kam nicht mehr bis zur Kloschüssel, sondern kotzte ins Waschbecken.
Am nächsten Morgen erwachte ich auf der Couch im Wohnzimmer, der Fernseher lief immer noch. Ohne Ton. Und es stank gottserbärmlich. Ich machte mich ans Aufwischen und Lüften, das dauerte seine Zeit, und ohne ein frisches Bier hätte ich es nicht geschafft.
Auf der Seeshaupt roch es besser. Nach frischem Wind, nach Sonne und Wasser und überhaupt nach allem, wonach es bei mir zu Hause nicht gerochen hatte. Ich stand an der Reling, blinzelte durch verquollene Augen auf das schäumende Kielwasser, versuchte die pochenden Kopfschmerzen zu ignorieren und beglückwünschte mich zu der Idee, hier heraus an den Starnberger See gefahren zu sein. Nach einer heißen Dusche, zwei Tassen Kaffee und zwei Aspirin war sie plötzlich da gewesen, die Idee: Helmut Tanner war auf der Seeshaupt ums Leben gekommen, also musste ich mir den Tatort doch mal ansehen! Es würde vermutlich nichts bringen, aber einen Eindruck brauchte ich wenigstens. Redete ich mir ein, denn der Hauptgrund war wohl, dass ich einfach raus wollte, dass ich hoffte, Wind und Sonne würden meiner Stimmung ein wenig auf die Sprünge helfen.
Gestern Abend, bevor ich wegdämmerte, war mir noch Tania eingefallen, meine Ex. Wäre sie noch da, hätte mich das Geschehene bestimmt nicht so fertig gemacht. Wäre! Hätte! Mein Beruf war schließlich der Grund dafür gewesen, dass es mit uns nicht mehr geklappt hatte. Ich musste allein zusehen, wie ich da wieder rauskam.
Aber ich war ja nicht zum Vergnügen hier, also begann ich einen Rundgang um das Schiff. Erich Tanner hatte erzählt, sein Sohn sei wahrscheinlich vorne, am Bug, über Bord gegangen. Es waren weniger Passagiere auf dem Schiff als ich befürchtet hatte, es lag wahrscheinlich an der frühen Morgenstunde, kurz nach zehn. Nun ja, für mich war das früh.
Ich ging also das mittlere der drei Decks entlang, bis zum Bug, wo eine kleine Aussichtskanzel wie eine Nase nach vorne hinausragte. Ich stieg sogar hinauf, und einen Augenblick lang dachte ich an den Film Titanic, in den mich eine Bekannte geschleppt hatte. Die Hauptdarstellerin steht mit ausgebreiteten Armen über dem Bug, den Geliebten dicht hinter sich, der Wind zaust am Kleid, aber sie ist so glücklich, dass ihr überhaupt nicht kalt ist. Meine Bekannte fand das großartig, ebenso wie den endlos lange dauernden Untergang, der bald darauf folgte. Und sie war nachher so sauer auf mich, weil ich etwas von einer Kitsch- und Heulorgie sagte, dass sie mich allein nach Hause gehen ließ.
Ich kam zu dem Schluss, dass der Sturz des Helmut Tanner hier vorne wohl kaum erfolgt sein konnte, er wäre höchstens auf das Unterdeck geknallt. An der Seite hingegen wäre es möglich gewesen. Also ging ich zurück, erspähte unter mir einen Mann von der Schiffsbesatzung, der entspannt an der Reling lehnte, und stieg zu ihm hinunter aufs untere Deck.
Dann lehnte ich ebenso entspannt neben ihm und fragte:
»Wie ist das eigentlich? Wenn man da runterfällt, kann es einen da in die Schraube ziehen?«
Sein Kinn- und Backenbart wies ihn als echten Seemann aus, sein sächsischer Akzent eher weniger. »Klar kann es das«, sagte er. »Da sehen Sie gar nicht gut aus, hinterher.«