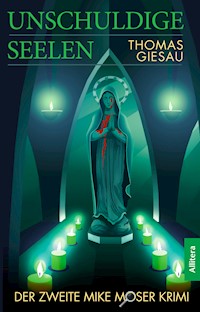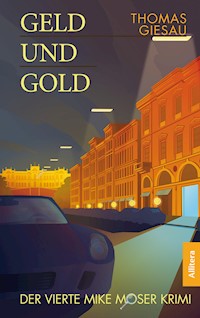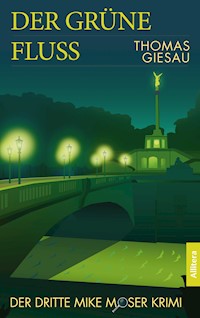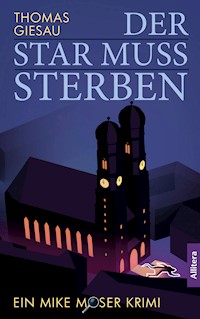
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Allitera Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Privatdetektiv Mike Moser ist ein Münchner »Gwachs«. Und er mag seinen Job und seine Stadt. Meistens. Als er aber engagiert wird, weil eine bekannte Schauspielerin während der Dreharbeiten zu ihrem neuesten Film einen Drohbrief erhalten hat, ist er wenig begeistert: Er soll als ihr Bodyguard herhalten! Andererseits - einen Kurzurlaub am bilderbuchgleichen Drehort am Starnberger See, noch dazu mit saftigem Honorar, schlägt man auch wieder nicht aus. Moser beginnt zu ermitteln und während er noch vermutet, dass das Ganze einfach ein PR-Gag ist, stolpert er über die erste Leiche. Und plötzlich steckt er drin, der Moser, in einer brisanten Jagd nach dem Täter … »Der Star muss sterben« ist der erste Band von insgesamt vier Krimis um den Münchner Ermittler Mike Moser
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
THOMAS GIESAU heißt im wahren Leben nicht so. Den Namen Giesau, zusammengesetzt aus den Münchner Stadtvierteln Giesing und Au, hat er als Pseudonym für seine vierteilige Krimireihe um den Münchner Privatdetektiv Mike Moser angenommen. Der gebürtige Münchner war viele Jahre als Filmjournalist tätig, heute ist er Buch- und Drehbuchautor.
Thomas Giesau
Die vier Fälle des Mike Moser
Band 1: Der Star muss sterben
Weitere Informationen über den Verlag und sein Programm unter: www.allitera.de
März 2015 Allitera Verlag Ein Verlag der Buch&media GmbH, München © 2015 Buch&media GmbH Umschlaggestaltung: Moritz Mayerhofer | studionice, Berlin isbn print 978-3-86906-703-2 isbn epub 978-3-86906-714-8 isbn pdf 978-3-86906-715-5 Printed in Germany
I
Ich hatte in der Innenstadt zu tun gehabt und fuhr nun zurück, den Rosenheimer Berg hoch und am Gasteig-Kulturzentrum vorbei. Die Sonne spiegelte sich in der schmalen, vom Boden bis unters Dach reichenden Fensterfront, die das Gebäude in zwei Hälften teilte, und mir fiel wieder mal ein, was ein Kritiker, natürlich ein norddeutscher, einmal über dieses Gebäude geschrieben hatte. Er hatte es mit einem menschlichen Hinterteil verglichen. Man muss den monumentalen Backsteinbau ja nicht unbedingt schön finden, aber so ein Vergleich kann wohl nur einem Hamburger Preußen einfallen.
Ich fuhr oft hier hoch, denn ich wohnte da oben. Nicht im geldigen, vornehmen Bogenhausen, sondern gleich daneben, im angenehmen, sympathischen Haidhausen. Mit vielen alten Häusern, noch nicht alle luxussaniert, mit kleinen Läden und Kneipen und einem Flair, das auch das hippe Loft-Gesocks, das es zuhauf in solche Gegenden zieht, noch nicht zerstören konnte. Die Mieten sind allerdings teuer geworden, zum Teil sogar sauteuer. Münchnerisch eben. Trotzdem wohne ich immer noch da, zu einem erschwinglichen Preis. Fünfter Stock ohne Lift, wer will das schon.
Jetzt jedoch musste ich nach Bogenhausen. Ich war unterwegs zum Pressebüro Harald Leschmann, und das war, wie ich dem Internet entnommen hatte, zuständig für Film- und Fernsehpromotion, für Public Relations, Fotoservice, Medienkontakte und noch vieles andere, das ich inzwischen wieder vergessen hatte. Gestern Nachmittag hatte mich das Sekretariat des Pressebüros angerufen, Herr Leschmann bäte mich um einen Besuch, die Angelegenheit sei dringend. Es handle sich um einen Auftrag. Worum es dabei ging, wollte man allerdings nicht verraten. Mit Film und Fernsehen hatte ich bis jetzt noch nie zu tun gehabt.
Das Büro Leschmann residierte im Parterre eines schicken zweistöckigen Neubaus. Hohe Rundbogenfenster in weißer Fassade, halbrunder, gläserner Erkervorbau, sauber getrimmtes Rasenstück mit großer Buchs-Kugel davor. Die bis zum Boden reichenden Fenster gewährten einen ungehinderten Einblick ins Innere. Hinter einem großen, fast leeren Schreibtisch saß ein Mann mit Stirnglatze und telefonierte.
»Einen Augenblick bitte, ich werde Sie gleich anmelden«, sagte das perfekt zum Ambiente passende weibliche Wesen hinter dem kleinen Schreibtisch, schenkte mir ein neutrales Empfangslächeln und gab die Tatsache meiner Ankunft per Telefon weiter. Ich sah mich in dem großen Vorraum um, der fast schon eine kleine Halle war. An der Wand links vom Eingang hing das riesige Hochformat-Foto eines Pudels. Er saß vor einem weißen Hintergrund, hatte eine cremefarbene Schleife um den Hals und einen Ausdruck im Pudelgesicht, den ältere Damen als »einfach süß« zu bezeichnen pflegen. Trotzdem fragte ich mich, was der Köter hier zu suchen hatte; er passte so gar nicht zu den abstrakten farbigen Bildern ringsum.
»Hallo, Herr Moser, Harald Leschmann ist mein Name. Schön, dass Sie kommen konnten!« Der Typ mit der Stirnglatze, den ich vorhin durchs Fenster gesehen hatte, eilte nun mit dynamischem Schritt auf mich zu. Wir schüttelten uns die Hand und ich folgte ihm in sein Büro.
Hier sah es noch um einige Grade edler aus. Schwarze Ledersessel, Schreibtischplatte aus grauem Marmor, darauf ein Laptop und eine vielknopfige Telefonanlage. An der Wand ein großer Bildschirm und im Raum verteilt Deckenfluter und Leuchten von einer Stil- und Preisklasse, wie sie bestimmt in keinem Kaufhaus zu finden waren. Im Wandregal aus glänzenden Stahlstreben und beige gelacktem Holz Bücher und Zeitschriften in kunstvoll arrangierter Unordnung. Eines stand für mich sogleich fest: Mit dem Geld, das hier in der Luft lag, war auch eine aufwendige Recherche zu finanzieren.
Leschmann war etwa in meinem Alter, zweite Hälfte vierzig. Um die einsachtzig groß, schlank. Wenn er einen Bauchansatz hatte, so war dieser durch den gut geschnittenen grauen Anzug erfolgreich kaschiert. Darauf saß oben ein runder, durch die wenigen Haare und die randlose Brille noch kugeliger wirkender Kopf, der Intelligenz und satte Selbstgefälligkeit ausstrahlte. Er verbreitete jene Art von gelackter Freundlichkeit, mit der ich schon immer Probleme hatte. Aber wahrscheinlich war so etwas nötig, um in seinem Job und dieser Branche bestehen zu können.
Leschmann hatte bemerkt, dass ich meine Umgebung musterte, und fragte: »Gefällt es Ihnen?«
»Ja, sehr«, antwortete ich und fügte noch hinzu: »Guter Stil.«
Er hatte so eine Reaktion erwartet, trotzdem schien ihm noch etwas zu fehlen. Ich sah auch gleich, was es war: Im Regal gleich neben dem Schreibtisch, also so, dass jeder Besucher es sehen musste, stand das gerahmte Foto einer schönen, dunkelhaarigen jungen Frau. Ich sah es an und bemühte mich um einen bewundernden Gesichtsausdruck.
»Meine Frau«, sagte Leschmann. »Sie war Topmodel.«
»Respekt«, sagte ich und fand das gleichzeitig ziemlich dämlich, aber etwas anderes fiel mir nicht ein. In einer Ecke hinter seinem Schreibtisch lehnte eine kleinere Ausgabe des Pudelfotos an der Wand. »Ihr Hund?«, fragte ich.
Der Kugelkopf nickte. »Ja. Ist doch ein klasse Foto, oder? Wir überlegen gerade, ob wir nicht mehr daraus machen können. Vielleicht so eine Art Firmenlogo.«
»Gute Idee«, sagte ich und dachte, dass es sich bei dem Pudel nur um einen Toppudel handeln konnte.
Eine Sekretärin brachte Kaffee und Leschmann fragte sie: »Hat Seidl sich schon gemeldet?«
»Ja, vor ein paar Minuten. Er ist unterwegs.«
Die Sekretärin verschwand, und Leschmann kam endlich auf den Zweck unseres Treffens zu sprechen. Er zog ein Blatt Papier aus einer Klarsichthülle und legte es mir hin. »Da, lesen Sie.«
Es war ein Computerausdruck auf einem DIN-A4-Bogen. In einer mindestens achtzehn Punkt großen Fettschrift war da folgender Text zu lesen:
Ilona Samm, diese Rolle wird deine letzte sein.
Bereue deine Sünden, denn du wirst sterben.
Bald!!!
Ilona Samm, der Name sagte mir etwas. Erst vor Kurzem hatte ich ihn in der Zeitung gelesen. Eine Schauspielerin, die gerade irgendwas fürs Fernsehen drehte. Ich legte das Papier auf den Schreibtisch zurück. »Dazu müssten Sie mir jetzt aber ein bisschen was erzählen.«
Und Leschmann erzählte. Ein privater Fernsehsender hätte vor zehn Tagen mit den Dreharbeiten zu einem TV-Movie begonnen, das den Arbeitstitel »Schwarzer Himmel« trüge und in dem Ilona Samm die weibliche Hauptrolle spiele. Samm, die in den letzten Jahren in den USA gelebt hätte, wolle mit dieser Rolle in Deutschland ihr Comeback versuchen. Der Drohbrief sei in einem neutralen Umschlag vor zwei Tagen in ihrem Hotel abgegeben worden.
»Haben Sie den Umschlag noch?«, fragte ich.
»Nein. Sie hat ihn weggeworfen.«
»Wie praktisch. Und was soll ich nun Ihrer Meinung nach tun, was die Polizei nicht auch tun könnte?«
»Genau das wollte ich mit Ihnen besprechen. Wir möchten nämlich vorerst keine Pferde scheu machen …«
»'tschuldigung, wer genau ist ›wir‹?«
»Wir? Also, im Prinzip sind das die Berliner Produktionsfirma, sie heißt ›Komet-Film‹, und mein Unternehmen hier. Ich berate den Sender, mache PR für ihn, kümmere mich mit meinen Leuten um die Pressekontakte und so weiter. Natürlich ist auch der Sender selbst beteiligt, er ist schließlich der Auftraggeber, aber den wollen wir vorerst raushalten.«
»Wenn ich Sie richtig verstehe, halten Sie den Drohbrief gar nicht für so gefährlich?«
Mein Gegenüber nahm die Brille ab und sah mich mit leicht zusammengekniffenen Augen an. »Nun ja, man darf so etwas natürlich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Andererseits …« Er rieb sich die Nasenwurzel mit Daumen und Zeigefinger und setzte die Brille wieder auf. »Andererseits kommen solche Briefe in unserer Branche schon gelegentlich vor. Was glauben Sie, was die sogenannten Promis oft für Post bekommen! Da merkt man erst, wie viele Verrückte unter uns leben. Seit es die sozialen Netzwerke gibt, wo man sich anonym ausschleimen kann, hat sich das noch gesteigert.«
Ich trank einen Schluck Kaffee und wartete ab. Leschmann redete weiter.
»Ich vermute also, dass es sich hier um einen üblen Scherz handelt, und deshalb sollten wir zunächst auf die Polizei verzichten. Trotzdem müssen wir natürlich etwas tun, wir müssen vor allem Ilona Samm zeigen, dass wir die Sache ernst nehmen. Sie ist nämlich schon sehr beunruhigt.«
Jetzt musste ich doch etwas dazu sagen. »Was Sie brauchen, ist ein Bodyguard, kein Privatdetektiv. Ich bin Ermittler, kein Aufpasser.«
»Das weiß ich, Herr Moser, das weiß ich. Schließlich gehören Sie in Ihrer Branche zu den Topleuten, deshalb habe ich mich ja an Sie gewandt.«
O Mann! Mir war klar, weshalb er das sagte, aber es tat mir trotzdem gut. Und wie scheißfreundlich er mich dabei angrinste!
»Ich habe mir also vorgestellt, dass Sie regelmäßig am Drehort nach dem Rechten sehen, aber zwischendurch ruhig auch mal, wenn es Sie reizt, Erkundigungen nach dem Schreiber des Briefes einziehen. Im Übrigen würde der Job höchstens fünf Tage dauern, dann ist die Samm hier abgedreht. Und was Ihr Honorar angeht … Beim Fernsehen ist man nicht knauserig. «
Die Telefonanlage summte und eine weibliche Stimme gab das Eintreffen von Georg Seidl bekannt.
»Kleinen Moment noch, ich gebe Ihnen Bescheid«, erwiderte Leschmann.
Das hier schien genau die Art Auftrag zu werden, die ich nicht leiden konnte. Wegen einer vermutlich nicht ernst gemeinten Drohung den Aufpasser spielen. Allerdings, welche Art von Auftrag konnte ich denn wirklich leiden? So ein Abwehrgefühl wie gerade jetzt hatte ich oft und in letzter Zeit immer häufiger. Das mit den Ermittlungen nach dem Schreiber des Drohbriefs hatte Leschmann doch nur gesagt, um mir einen zusätzlichen Anreiz zu bieten, in Wahrheit war es ihm völlig wurscht. Blieb als einziges möglicherweise überzeugendes Argument nur das Honorar.
»Herr Seidl ist freier Mitarbeiter«, erklärte mir Leschmann. »Er macht die Pressearbeit für diese Produktion. Ich habe ihn herbestellt, weil er über Details besser Bescheid weiß als ich. Außerdem hat er Unterlagen, die Ihnen bei Ihrer Arbeit vielleicht nützlich sein können.«
»Ich hab noch nicht ja gesagt.«
»Ich weiß.« Er lächelte kumpelhaft. »Aber vielleicht werden wir uns doch noch einig. Sagen Sie mir einfach mal, was Sie sich so als Honorar vorstellen.«
Ich dachte an das, was er vorhin angedeutet hatte, und nannte ganz cool das Eineinhalbfache meiner üblichen Sätze. Wie ich befürchtet hatte, machte es ihm überhaupt nichts aus.
»Einverstanden. Aber das müsste dann schon bedeuten, dass Sie sich während der fünf Tage voll dieser Aufgabe widmen. Also Dauerpräsenz am Drehort.«
»Und der ist wo?«
»Ach so, das wissen Sie ja noch nicht. Am Starnberger See, in der Nähe von Berg. Sie müssten also dort übernachten.«
»Übernachten?«
Er sah mich an, als hätte ich versucht, seinen Scharfsinn zu testen. »Mordanschläge passieren nun mal vorwiegend in der Dunkelheit. Sehen Sie keine Krimis?«
»Manchmal. Aber ich werde da draußen nicht den Nachtwächter markieren.«
Er lachte kurz und ein bisschen zu laut. »Das verlangt auch keiner von Ihnen. Sie verbringen den Abend in Gesellschaft schöner Frauen und suchen anschließend Ihr Zimmer auf, das wir für Sie reservieren lassen.«
Ein paar Tage am Starnberger See? Warum auch nicht, der Wetterbericht hatte ein Hochdruckgebiet angekündigt. Aber ich wollte nicht gleich in Euphorie verfallen. »Könnten Sie veranlassen, dass das Honorar für zwei Tage als Vorschuss angewiesen wird?«
»Machen wir.« Er drückte auf einen Knopf seiner Sprechanlage. »Herr Seidl soll jetzt bitte reinkommen.«
Georg Seidl kam rein, ich stand auf, und Leschmann machte uns miteinander bekannt. Ich schätzte ihn auf etwa fünfzig, sein bleiches, sommersprossiges Gesicht sah nach zu viel Alkohol und zu wenig Schlaf aus, er hatte eine Hängewampe und trug eine speckige Lederweste über dem aus der Cordhose hängenden blau-weiß gestreiften Hemd.
»Haben Sie alle Unterlagen dabei?«, fragte ihn Leschmann.
»Selbstverständlich.« Seidl wollte sein abgeschabtes schwarzes Aktenköfferchen aufmachen, aber Leschmann wehrte ab.
»Nein, nicht hier. Am besten gehen Sie mit Herrn Moser ins Besprechungszimmer hinüber. Da können Sie sich in Ruhe unterhalten.« Er lächelte mich an, und diesmal wirkte er fast schon sympathisch. »Also dann, auf Wiedersehen, Herr Moser, und viel Erfolg. Wir werden uns ja bestimmt noch öfter sehen.«
Also setzte ich mich mit Georg Seidl ins Besprechungszimmer ans Ende eines langen Tisches. Er gab mir die Pressemappe, die er zusammengestellt hatte und die neben einigen Informationstexten auch Fotos der Hauptdarsteller enthielt. Weitere stünden im Internet zur Auswahl, hieß es. Natürlich nahm ich sofort die von Ilona Samm zur Hand.
Sie sah wirklich sehr gut aus. Auch wenn mir klar war, dass es sich hier um sorgfältig ausgesuchte PR-Fotos handelte, wenn ich also von der dargestellten Attraktivität einiges abzog, mir die großen dunklen Augen weniger strahlend, die vollen Lippen weniger einladend dachte, so kam ich doch um eine Feststellung nicht herum: Ilona Samm war eine schöne Frau. Keine glattpolierte, austauschbare Model-Schönheit, sondern ein Gesicht mit Charakter. Was das für einer war, verriet das Foto allerdings nicht.
Ich legte es auf den Tisch zurück. »Können Sie mir etwas über die Dame erzählen?«, fragte ich Seidl.
Der wies auf die Texte in der Mappe. »Steht eigentlich alles hier drin. Lebenslauf, Filmografie, ein paar Anekdötchen …«
»Sicher. Aber vielleicht gibt's ja noch a paar Infos, die net für die Öffentlichkeit bestimmt san.« Ich fiel bewusst ins Münchnerische, die für diese Stadt typische Hochdeutsch-Abmilderung, weil ich dem Akzent des PR-Mannes entnommen hatte, dass auch er so etwas wie ein Einheimischer war. Und weil so etwas halt gleich eine vorläufige Vertrauensbasis schafft.
Er ging sofort auf die angebotene Sprecherleichterung ein. »Na ja, ich weiß ja net, was für Sie interessant is.«
Alles, woraus sich vielleicht ein Hinweis auf den Briefschreiber ergeben könnte, erklärte ich ihm. Branchen-Insider wie er wüssten da doch bestimmt so einiges.
Seidl kratzte sich nachdenklich am Bauch. »Na ja, besonders viel gibt’s da net …« Er zögerte noch ein wenig und kam dann auf die Zeit zu sprechen, die Ilona Samm in den USA verbracht hatte. Nach ihren ersten deutschen Filmerfolgen – »Aber des steht ja alles in meim Text« – sei sie dort hinübergegangen, um, wie damals die Boulevardblätter schrieben, Hollywood zu erobern. Über ein paar Nebenrollen sei sie allerdings nicht hinausgekommen, sie habe allerdings auch mal in einer Las- Vegas-Revue auf der Bühne gestanden, zweite Reihe, Dritte von links – »In meim Text steht des alles a bisserl positiver« –, und dann einen stinkreichen Geschäftsmann kennengelernt. »Der soll angeblich a paar Probleme mit’m Finanzamt ghabt ham, Geldwäsche oder so, aber davon steht natürlich nix in meim Text, da is des nur die ganz große Liebe.«
»Hat er sie gheirat?«
»Naa. Angeblich will er aber.«
Ansonsten, meinte Seidl, wisse er auch nicht viel mehr über die jüngste Vergangenheit des Stars. Seiner Meinung nach könne es sich bei dem Verfasser des Drohbriefs nur um einen Spinner handeln. Die Samm sei schließlich erst vor zwei Wochen nach Deutschland zurückgekommen, da werde sie sich wohl kaum schon Todfeinde geschaffen haben. »Obwohl …« Er zögerte weiterzusprechen.
»Obwohl was?«
»Na ja … aber des bleibt unter uns, gell … sie is schon ein ziemliches Miststück. Wie die d’Leut ausnützt, sagenhaft. Aber Sie wern sie ja bald selber kennalerna.« Zum ersten Mal konnte ich einen Anflug von guter Laune auf seinem Gesicht entdecken. Offensichtlich freute er sich schon darauf, wie die Diva mit mir umspringen würde.
Ich ließ ihm seine Vorfreude und drückte einen Gedanken aus, der mir gerade gekommen war: »Sagen S’ mal, wär des net a gute Idee, den Drohbrief der Presse zukommen zu lassen? Das gäb doch einen Mordswirbel, a prima Reklame …?«
Er schüttelte den Kopf. »Naa, wirklich net. So an Wirbel könnten mir überhaupts net brauchen. I muss im Gegenteil jetzt alles fein dosieren, damit auch noch was gschriebn wird, wenn des Ding in einem Jahr oder so übern Sender geht.« In dem Moment erkannte er den Hintergedanken meiner Frage, er lief vor Ärger rosa an und fiel ins Hochdeutsche zurück: »Wollen Sie vielleicht andeuten, ich könnte den Brief geschrieben haben?«
»Nein, natürlich net. Wenn's so wär, hätten Sie der Presse doch schon längst an Tipp gebn. Außerdem glaub ich net, dass Sie sowas nötig ham.«
Ganz so ehrlich, wie es hoffentlich klang, hatte ich es allerdings nicht gemeint. Seidl konnte den Brief ja verfasst haben, um für alle Fälle einen Trumpf in der Hinterhand zu haben, falls das Medieninteresse an dem Ding hier, wie er es nannte, nicht groß genug war. Obwohl mir diese Vermutung doch eher unwahrscheinlich vorkam. Und überhaupt: Warum machte ich mir Gedanken über den Absender des Briefs, in ein paar Tagen war das Ganze ja ausgestanden, ich würde ein sattes Honorar kassieren und diesen merkwürdigen Auftrag schnell vergessen haben.
Zum Schluss unseres Gesprächs fiel mir noch eine eher technische Frage ein: »Die Pressemappe da, die Texte und die Fotos, verschicken Sie des alles mit der Post?«
»Früher war des so. Jetzt nur ausnahmsweise. Des meiste geht per E-Mail raus. Is halt schneller und billiger. A Internetseitn gibt’s aa und bei Twitter und Facebook hamma ihr Accounts eingricht. Ohne die Networks geht nix mehr.«
Am Morgen danach war das Wetter genau so, wie man es sich für Mitte Mai vorstellt. Blauer Himmel, mit ein paar Zierwölkchen gesprenkelt, eine leichte Brise fächelte die schon recht sommerlichen Temperaturen auf ein angenehmes Maß zurück, die Bäume trugen ihr Laub noch frisch und hellgrün. Ich fuhr zum Starnberger See und war ziemlich gut drauf. Nur eines trübte ein wenig meine Stimmung: Ich hatte mein kleines Reisekopfkissen vergessen, ohne das ich normalerweise nie auswärts nächtige.
Es war kurz nach neun, als ich auf die Straße einbog, die am Ostufer des Sees entlangführt. In einer der Luxusvillen, die dort mit Seeblick und großen Parkgrundstücken den Neid der Spaziergänger erregen, sollte heute und in den nächsten Tagen gedreht werden. Das hatte mir Georg Seidl gestern auch noch mitgeteilt.
Ich rollte die schmale Uferstraße entlang. Links reihten sich die feudalen Behausungen und Parks derer, die sich diese edle Wohnlage leisten konnten, aneinander, rechts der Straße lagen die zu den Behausungen gehörenden Bootshäuser auf kleinen Seegrundstücken, die allein für sich einen Normalsterblichen schon glücklich gemacht hätten, und dahinter erstreckte sich die einzige Fläche, die nicht rundum eingezäunt war: der Starnberger See. Eine der reichsten Gegenden Deutschlands war das hier, aber wenn mir einer angeboten hätte, hier zu wohnen – ich hätte es wahrscheinlich abgelehnt. Immer nur den See vor Augen und viel gepflegtes Grün und gepflegte reiche Nachbarn, aber keine Kneipe um die Ecke, keine einfachen, aber interessanten Leute im Haus und auf der Straße, mit denen man sich unterhalten könnte, kein richtiges Leben letztendlich … In der Stadt war es einfach schöner. Da fiel mir ein, dass ich wieder einmal vergessen hatte, die Wohnungsanzeigen durchzusehen. Mein Zuhause in Haidhausen, Altbau, Mansarde, kleine Dachterrasse, war zwar recht angenehm, aber im fünften Stock ohne Lift, und man wird ja nicht jünger.
Das fragliche Haus an der Seestraße zu finden war nicht schwer. Eine Menge Autos stand vor dem Grundstück, darunter zwei Lkws mit kastenförmigen Aufbauten, die hinteren Flügeltüren geöffnet. Ich sah Stative, Scheinwerfer, Metallrohrgestelle und einen Haufen anderen technischen Kram, dessen Zweck mir unbekannt war. Zwei Arbeiter räumten gerade geräuschvoll darin herum. Ich stellte den Wagen ab und betrat das Grundstück durch das große, weiß gestrichene Eisengittertor, das weit offen stand. Das einstöckige, weitläufige Haus stand etwa dreißig Meter weit dahinter, etwas erhöht, mit elegant geschwungenem Walmdach und großen Fensterfronten.
Die vornehm satte Gediegenheit, die das Anwesen verströmte, wurde durch die Autos, die auch in der Auffahrt geparkt waren, und die Leute, die hier aus und ein gingen oder auch nur herumstanden, empfindlich gestört. Zwischen den Wagen standen zwei Männer, und als ich mich näherte, bekam ich das Ende eines Wortwechsels mit.
»I lass mich von Ihnen net wegschickn«, sagte der eine, ein großer, stämmiger Mann in den Dreißigern, der vor Aufregung und unterdrückter Wut Schwierigkeiten hatte, die Worte verständlich herauszubringen. »Die Ilona, also die Frau Samm, hat gsagt, i kann bleim, hat s' gsagt. Und wenn die sagt, i kann bleim, dann bleib i.«
Der andere, ein paar Jahre älter, hager und einen Kopf kleiner, die Sonnenbrille an einer Kette um den Hals baumelnd, brachte das Kunststück fertig, ihn von oben herab anzusehen. »Was Sie nicht sagen! Na, dann wollen wir das doch gleich mal klären.« Er wollte zum Haus gehen, doch dann sah er mich. »Noch ein Besuch? Darf ich fragen, zu wem Sie möchten?«
»Ich heiße Moser, Mike Moser. Ich möchte zu Herrn Kohler.«
Kohler, das hatte mir gestern Leschmann noch gesagt, war der Produktionsleiter und über mein Engagement informiert.
»Ah, Tag, Herr Moser. Wir haben Sie schon erwartet. Mein Name ist Hansing, ich bin der Aufnahmeleiter. Herr Kohler ist im Moment nicht da, aber er hat mir Bescheid gesagt. Bitte kommen Sie mit, ich mache Sie mit den wichtigsten Leuten bekannt.«
Produktionsleiter, Aufnahmeleiter … Wo war da der Unterschied? Bei passender Gelegenheit würde ich mich danach erkundigen. Im Augenblick jedoch interessierte mich etwas anderes. »Mit ungebetenen Zuschauern haben Sie wohl öfter Probleme?«, fragte ich Hansing, während wir nebeneinander auf das Haus zugingen.
»Hier eigentlich nicht«, antwortete er. »In das Grundstück trauen sich die Leute nicht rein. Aber wenn Sie den Typen von eben meinen, das ist etwas anderes. Der kennt unseren Star von früher, sie hat sich neulich auch mal mit ihm unterhalten, und seitdem schleicht er hier dauernd um den Set rum. Ziemlich durchgeknallt, der Kerl, bildet sich ein, er muss auf sie aufpassen.«
»Wieso kennt er sie von früher? Hat er auch mit Film oder Fernsehen zu tun?«
Hansing stieß ein abfälliges Schnauben aus. »Der? Bestimmt nicht. Soviel ich weiß, stammt er aus demselben Münchner Stadtviertel wie die Samm. Jugendfreundschaft oder so.«
Ilona Samm war also in München geboren. Und dieser Pressemensch, dieser Seidl, hatte mir nichts davon gesagt. Ich hätte mir seine Unterlagen gestern Abend doch noch genauer ansehen sollen. In den Zeitungen hatte es bestimmt auch gestanden, aber ich lese diesen Star- und Schicki-Schrott ja nie.
Inzwischen hatten wir das Haus betreten und standen in einer großen Wohnhalle. Hellrosa Marmorfußboden, dicke Teppiche, sündhaft teures Mobiliar, teils modern, teils ausgesucht antiquarisch, es war alles recht eindrucksvoll, auch wenn es nicht mein Geschmack war. Jetzt allerdings sah es nur noch nach Filmkulisse aus, mit den Scheinwerfern, die in den Ecken standen, den hellen Gazetüchern, die wahrscheinlich irgendwelcher Lichteffekte wegen aufgespannt waren, der Kamera auf dem wuchtigen Stativ und all den Leuten in lässiger Arbeitskleidung dazwischen. Etwas weiter hinten, neben einer schweren, mit eisernen Bändern beschlagenen Truhe, in einem mit grobem braunem Leinen bespannten Stahlrohrsessel, die Lesebrille auf der Nasenspitze und ein dickes Drehbuch auf den Knien, saß Ilona Samm.
Sie bewegte beim Lesen die Lippen, offenbar prägte sie sich ihre Dialogsätze ein. Erst als wir dicht vor ihr standen, blickte sie hoch und nahm, als sie einen Fremden sah, die Brille ab. Auch ihr Gesicht, fand ich, sah nach Filmkulisse aus, so makellos glatt und perfekt geschminkt, wie es war. Trotzdem, trotz der guten Arbeit der Maskenbildner, trotz der rasanten dunkelblonden Kurzhaarfrisur war da etwas in diesem schönen Gesicht, das sagte: Vorsicht, Freunde, ich hab schon einiges hinter mir, an Jahren und an Erfahrungen, also richtet euch danach!
»Ilona, darf ich dir Herrn Moser vorstellen«, sagte Hansing, der Aufnahmeleiter. »Den Privatdetektiv.«
Sie lächelte sofort strahlend und streckte mir ihre Hand entgegen. »Hallo, Herr Moser! Das ist schön, dass Sie kommen konnten. Suchen Sie sich etwas zum Sitzen und leisten Sie mir Gesellschaft.«
Hansing mischte sich ein. »Ich sollte Herrn Moser vielleicht noch ein paar anderen Leuten vorstellen …«
»Ich übernehme das. Sonst noch was?«
»Ja. Es ist wegen diesem, äh, Toni … Er ist schon wieder da und sagt, du hättest ihm erlaubt, sich am Set aufzuhalten.«
»Behauptet er das? Nun, ganz so direkt habe ich das wohl nicht gesagt. Aber er ist halt eine etwas simple Natur. Und fürchterlich anhänglich. Stört er denn?«
»Nicht direkt. Aber wenn wir jedem erlauben würden …«
»Aber das tun wir ja auch nicht, oder? Also sei so lieb und lass dem guten Toni sein Vergnügen. Aber er soll sich im Hintergrund halten. Bei Gelegenheit sag ich es ihm auch noch selber. Einverstanden?«
Hansing zuckte mit den Schultern. »Wenn du meinst.« Er war sichtlich angesäuert, sagte aber nichts mehr und ging.
Ich setzte mich zu Ilona Samm. Sie trug einen seidenen, spitz und tief ausgeschnittenen und in verschiedenen Blauschattierungen schillernden Hausmantel, und ich fragte mich, ob das ihre Aufmachung für die nächste Szene war oder ob sie so was nur zwischendurch anzog. Sie beugte sich vor, um das Drehbuch auf den Boden zu legen, wobei ich feststellen konnte, dass sie darunter nicht sehr viel anhatte. Aber es war ja auch ziemlich warm hier drin.
»Wie heißen Sie eigentlich mit Vornamen, Herr Moser?«
»Mike. Eigentlich Michael, aber schon in der Schule haben sie mich immer so gerufen. Und dabei bin ich dann eben geblieben.«
»Es klingt ja auch hübscher. Darf ich Sie Mike nennen? Und Sie sagen am besten Ilona zu mir. Ja?«
»Gerne. Haben Sie was dagegen, wenn ich gleich auf das zu sprechen komme, weswegen ich hier bin?« Immer, wenn ich mich nicht ganz sicher fühle, und das war in dieser ungewohnten Umgebung der Fall, ziehe ich mich aufs Sachliche zurück.
»Natürlich nicht. Sie sollen hier ja schließlich einen Job erledigen. Also, was kann ich für Sie tun?«
»Zunächst eine ganz simple Frage beantworten. Haben Sie irgendeinen Verdacht, vielleicht auch nur eine leise Ahnung, wer den Brief geschrieben haben könnte?«
»Weder Verdacht noch Ahnung, tut mir leid.«
»Wie sieht's denn mit Feinden aus? Sind da welche darunter, denen man so was zutrauen könnte? Vorausgesetzt, Sie haben überhaupt welche.«
Sie lachte laut auf, ein perfektes, tausendfach gelachtes Strahlelachen, ein paar Leute sahen neugierig zu uns her. »Das haben Sie jetzt aber schön gesagt. Natürlich habe ich Feinde, eine ganze Menge sogar, fürchte ich. Ich bin nämlich nicht immer lieb und nett, müssen Sie wissen.« Sie wurde wieder ernst und sah mir mit einem Blick in die Augen, von dem ich annahm, dass er zu ihrem normalen Filmrepertoire gehörte. Aber er machte mir trotzdem zu schaffen. »Vermutlich sind da sogar ein paar darunter, die gegen mein vorzeitiges Ableben nichts einzuwenden hätten. Aber von denen ist keiner hier, und außerdem würden die mir wohl kaum vorher einen Brief schreiben. Also auch da absolute Fehlanzeige, lieber Mike.«
»Das macht nichts. Im Grunde bin ich ja nur hier, um auf Sie aufzupassen. Obwohl das eigentlich nicht mein Beruf ist.«
»Ich weiß. Deshalb bin ich Ihnen ja auch besonders dankbar.«
Das war jetzt ein bisschen dick aufgetragen. Aber es machte mir nichts aus. Sie fügte dann noch hinzu, dass ich selbstverständlich nicht den ganzen Tag über während der Aufnahmen hier bleiben müsse; inmitten all der Leute würde ihr bestimmt niemand etwas tun.
»Und dann passt ja auch noch der Toni auf«, sagte ich.
Zu meinem Erstaunen schien sie das überhaupt nicht witzig zu finden. »Ach der … Am besten beachten Sie ihn gar nicht.«
Die seltsame Verbindung zwischen den beiden interessierte mich aber, und deshalb fragte ich: »Woher kennen Sie ihn eigentlich?«
Der Blick, der mich jetzt traf, war unverkennbar aus dem persönlichen Repertoire und ließ das Mikroklima zwischen uns deutlich erkalten. »Von früher. Aber ich wüsste nicht, was das mit Ihrem Auftrag zu tun hätte.«
Ich zuckte mit den Schultern. »So was weiß man nie. Aber lassen wir das. Ich werde also vor allem am Abend in Ihrer Nähe sein und mir auch die Umgebung und die anderen Hotelgäste ansehen. Nachts allerdings sollten Sie Ihre Tür gut abschließen, ich werde nämlich nicht davor Posten beziehen.«
Sie lächelte schon wieder. »Das erwarte ich auch nicht. Sie müssen mir nur sagen, wo ich Sie notfalls erreichen kann.«
»Das weiß ich selbst noch nicht. Die Produktion wollte mir in Ihrem Hotel ein Zimmer besorgen. Ich hoffe, man hat es nicht vergessen. Ich werde für alle Fälle meine Handynummer hinterlegen.«
Ein Mann mittleren Alters, Halbglatze und Mehrtagebart, trat auf uns zu. »Ilona, wir wären soweit.«
»Okay.«, sagte sie und stand auf. Dann machte sie uns miteinander bekannt. Er war der Regisseur und hieß Peter Gershof. »Vielleicht können wir uns später mal unterhalten«, meinte er, nachdem wir uns die Hände gereicht hatten. »Sie haben ja bestimmt so einiges zu erzählen.«
Wieder einer, der glaubte, das Leben eines Privatdetektivs liefe in der Realität ebenso abwechslungsreich ab wie im Fernsehen. Da würde ich halt, wenn es denn wirklich zu dieser Unterhaltung käme – wozu ich nicht die geringste Lust verspürte –, einiges Erlebte möglichst attraktiv zusammenfassen müssen. Kommt ja letztlich immer nur darauf an, wie man was erzählt. Der Fall allerdings, mit dem ich gerade zu tun hatte – war es überhaupt ein Fall? –, der würde später wohl auch bei geschicktester Erzählkunst nichts hergeben. Es ging langweilig los, und es versprach, stinklangweilig weiterzugehen, das war mein Eindruck, der sich mehr und mehr festigte, je länger ich hier bei den Dreharbeiten zu »Schwarzer Himmel « herumhing.
Schwarzer Himmel … Ich hatte gestern Abend ja noch in den Unterlagen geblättert, die Seidl mir gegeben hatte, und gelesen, dass im Mittelpunkt der Handlung eine reiche Familie stand, die ein großes Chemie-Unternehmen besaß. Aber die Tochter und zukünftige Erbin war aus der Art geschlagen, sie hielt es mit den Umweltschützern, dann gab es eine Explosion in der Fabrik, deren Ursachen vertuscht werden sollten, aber die Umweltschützerin hatte ein gschlampertes Verhältnis, einen Journalisten, und der wollte alles aufdecken, und dann gab es Intrigen und einen Mord und zum guten Schluss war der Himmel wieder blau. Heiliger Strohsack!
Ilonas blau schillernder Hausmantel gehörte doch zur Handlung! Das war so ziemlich die wichtigste Erkenntnis der nun folgenden Stunde. Ich sah zu, wie einige Szenen ein paar Mal wiederholt wurden, ich lernte den Kameramann kennen und stellte darüber hinaus fest, dass praktisch jeder hier am Set wusste, wer ich war und warum ich mich hier aufhielt. Und dass niemand die Sache mit dem Drohbrief wirklich ernstzunehmen schien. Auch Ilona selbst machte nicht gerade den Eindruck, als sei sie beunruhigt, und das passte so gar nicht zu dem, was mir Leschmann gestern gesagt hatte. Ich beschloss, nicht weiter darüber nachzugrübeln, sondern nur noch an den Scheck zu denken, der nach Abschluss dieses Auftrags eintreffen würde.