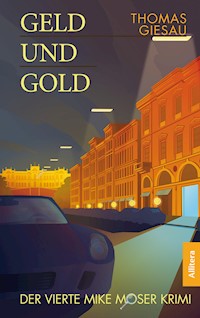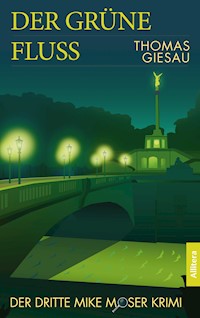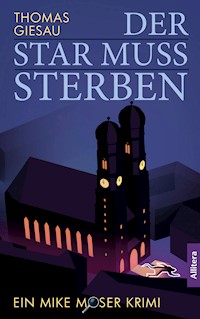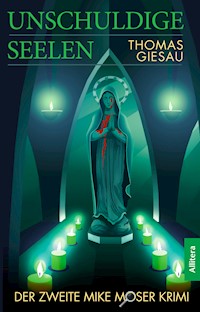
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Allitera Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Für seinen neuen Fall geht der Münchner Detektiv Mike Moser weit, sehr weit: Er meditiert. Es bleibt ihm auch nichts anderes übrig, wenn er dem Geheimnis der Sekte auf die Spur kommen will, die in einem Schloss unweit von München residiert. Schon sein Detektivkollege Udo Stutz war bei seinem letzten Fall auf diese Gemeinschaft gestoßen - und jetzt lebt er nicht mehr. Zufall? Moser schleicht sich inkognito in die Sekte ein. Er weiß um die Gefahr, aber er hat keine Wahl: Um Leben zu retten, muss er sein eigenes aufs Spiel setzen. Und es wird wieder einmal sehr knapp …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
THOMAS GIESAU heißt im wahren Leben nicht so. Den Namen Giesau, zusammengesetzt aus den Münchner Stadtvierteln Giesing und Au, hat er als Pseudonym für seine vierteilige Krimireihe um den Münchner Privatdetektiv Mike Moser angenommen. Der gebürtige Münchner war viele Jahre als Filmjournalist tätig, heute ist er Buch- und Drehbuchautor.
Weitere Informationen über den Verlag und sein Programm unter: www.allitera.de
September 2015 Allitera Verlag Ein Verlag der Buch&media GmbH, München © 2015 Buch&media GmbH Umschlaggestaltung: Moritz Mayerhofer | studionice, Berlin ISBN PRINT 978-3-86906-760-5 ISBN EPUB 978-3-86906-795-7 ISBN PDF 978-3-86906-796-4 Printed in Europe
I
Der Vorhang begann sich zu schließen. Langsam glitten die beiden Hälften von rechts und links aufeinander zu, aus Lautsprechern im Hintergrund erklang Greensleeves, der helle Raum in der Mitte der Bühne, zwischen den Vorhanghälften, wurde immer schmaler. Ein paar Leute in der ersten Reihe erhoben sich, auch ich, in der vorletzten, stand auf und schaute auf den von vier mehrarmigen Leuchtern angestrahlten Sarg und das darauf abgelegte Gebinde dunkelroter Rosen. Dann war der Vorhang zu, die Musik von hinten lief noch weiter, und von vorne hörte ich unterdrücktes Schluchzen. Und einen Augenblick lang dachte ich, nun müsse sich der Vorhang teilen, Udo Stutz müsse heraustreten und sich verbeugen. Aber dazu war Udo nicht mehr imstande, er lag im Sarg und würde sich in Kürze bei knapp tausend Grad Celsius in Asche verwandeln.
Nur dreiundfünfzig Jahre war er alt gewesen, der Privatdektektiv Udo Stutz, als er mit dem Motorrad aus der Kurve geflogen und dann von einem kräftigen Ahorn gestoppt worden war. Höchstens sechzig Stundenkilometer sei er gefahren, hatte mir die Witwe erzählt, als ich ihr vorhin, vor Beginn der Zeremonie, kondolierte, und er sei ein guter Fahrer gewesen. Keiner von diesen Geschwindigkeitsfreaks, die Kopf und Kragen riskierten, und er habe die Strecke gut gekannt.
»Er ist oft da raus gefahren«, sagte sie. »Es hat ihn entspannt. Aber ich habe trotzdem immer Angst gehabt.« Die unterdrückten Tränen erstickten ihre Stimme, sie konnte nicht weitersprechen, ihr Sohn, den ich bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal sah, legte den Arm um ihre Schultern und zog sie weg. Er mochte um die Zwanzig sein und sah seinem Vater sehr ähnlich. Ich war ihm dankbar, was soll man bei solchen Anlässen schon sagen.
Die Familie, die Verwandten, die Freunde und die Bekannten hatten dann die vorderen Reihen im Krematorium des Münchner Ostfriedhofs okkupiert, sie füllten den kalten, mit pseudogriechischen Säulen ausgestatteten Raum gut zur Hälfte. Da ich mich zu keiner dieser Gruppen zählte, hatte ich mich weiter hinten in eine leere Stuhlreihe gesetzt.
Und da sah ich, dass ich nicht der einzige Trauergast war, der sich von den anderen abgesondert hatte. Noch jemand saß da, zwei Reihen vor mir, zwischen unbesetzten Stühlen, ich erkannte zarte hellblonde Locken über einem hochgeklappten Mantelkragen, und als sie den Kopf ein wenig zur Seite drehte, wurde meine Vermutung zur Gewissheit: Es war Christa Berner. Ich hätte sie gerne angesprochen, aber das hier war wohl nicht die richtige Gelegenheit dafür. Noch bevor die Musik verklungen war, stand sie auf und verschwand im Ausgang.
Gleich danach ging auch ich. Grau und windig war’s draußen, ein Wetter, das zum Anlass passte, aber ich war trotzdem froh, der düsteren Stimmung da drinnen entkommen zu sein. Es bleibt ja niemandem erspart, hin und wieder einen anderen Menschen auf seinem letzten Weg zu begleiten, und früher hatte mir das auch nicht viel ausgemacht. Aber in den letzten Jahren war das anders geworden, und ich hatte gerade wieder einmal erkennen müssen, dass diese Entwicklung weiterging. Die ganze Atmosphäre, die Ansprachen, die Musik, die trauernden Angehörigen und schließlich ganz einfach die schwer begreifbare Tatsache, dass jemand, der immer dagewesen war, plötzlich nicht mehr da ist – all das hatte mich schon ganz schön ins Grübeln gebracht. Und während ich den schmalen Weg zwischen den Gräberreihen entlangging, wurde mir klar, dass es weniger das unwiderrufliche Verschwinden der Person Udo Stutz war, das mir zu schaffen gemacht hatte, als meine eigene Vergänglichkeit, die sich da ins Bewusstsein drängte, mich die Distanz verlieren ließ und sozusagen mich selbst in den Sarg legte. Immerhin hatte ich ja die Mitte vierzig schon eine Weile hinter mir, damit bestimmt auch mehr als die Hälfte meines Lebens, und da darf man schon mal nachdenklich werden. Ich ging schneller, ich musste raus aus dem Friedhof. Dann erreichte ich den Ausgang, sah einen Strafzettel unterm Scheibenwischer und wurde so ins reale Leben zurückgeholt. Weiter vorne, an der Bushaltestelle, sah ich Christa Berner stehen. Ich hätte sie mitnehmen sollen, aber ich blieb meinem Vorsatz treu und sprach sie nicht an.
Dafür sprach mich jemand an. Ich erkannte sie sofort, trotz der tristen Aufmachung mit dunklem Mantel und übergezogener Kapuze. Sie hieß Gloria Pokalke und war zu dessen Lebzeiten die Sekretärin von Udo Stutz gewesen. Ich kannte sie nur aus seinem Büro, wo sie im Vorzimmer die Anrufe und die Besucher empfing und, wie Stutz mir einmal sagte, alles perfekt im Griff hatte, auch sein großes Archiv, das er sich im Laufe der Jahre angelegt hatte und das sie, nach einem selbst entwickelten System, in den Computer übertrug. »Sie findet alles«, hatte er gesagt. »Manchmal sogar mehr als sie soll.«
Wahrscheinlich hatte er damit einen gelegentlichen Übereifer ausdrücken wollen, aber ich hatte nicht nachgefragt. Es hatte mich nicht interessiert, was vielleicht auch daran liegen mochte, dass die Dame selbst mich nicht interessierte. Sie erinnerte mich an eine Englischlehrerin, die ich auf dem Gymnasium gehabt hatte. Mittelblondes, streng nach hinten gekämmtes und dort von einer farbigen Klammer zusammengehaltenes Haar, prüfender Blick durch leicht getönte Brillengläser, distanziertes Gebaren und norddeutsche Sprechweise. Sie war sehr schlank, ziemlich groß, Mitte bis Ende dreißig, und sie pflegte mich nicht stärker zu beachten als ich sie.
»Tag, Herr Moser, kann ich Sie kurz sprechen?«, fragte sie.
»Bitte«, sagte ich, nicht sehr erfreut über diese Verzögerung.
»Es geht um die laufenden Fälle von Udo. Es gibt da ein paar, die sich nicht so ohne Weiteres abwickeln lassen. Ich habe mit Frau Stutz gesprochen, und sie wäre damit einverstanden, dass Sie das übernehmen. Darf ich Sie dazu in den nächsten Tagen mal anrufen?«
Deshalb hätte sie mich nicht extra hier ansprechen müssen. »Natürlich, jederzeit«, sagte ich. Die zu erledigenden Fälle stapelten sich ja nicht gerade bei mir.
Aber sie blieb stehen.
»Ist noch was?«, fragte ich, bemüht, meine Ungeduld nicht sichtbar werden zu lassen.
»Vielleicht. Es betrifft den Unfall. Es gibt da etwas, das ich noch klären muss …« Sie sprach immer leiser, zögerlicher. »Vielleicht werde ich Sie bitten müssen, mir zu helfen. Udo war doch Ihr Freund, oder?«
»Nun ja«, erwiderte ich. Es klang nicht sehr überzeugt.
Aber das machte nichts, Gloria Pokalke schien bereits zu bereuen, was sie gesagt hatte. »Ich will Sie nicht länger aufhalten», sagte sie. »Ich rufe Sie an. Wegen der offenen Fälle.«
Sie ging rasch weg und ich sah zu, dass ich nach Hause kam.
Da sah es inzwischen nicht mehr aus wie zu Hause. Überall standen Umzugskartons, teils gefüllt, teils noch zusammengefaltet. Halb ausgeräumte Schränke, abgenommene Bilder und Vorhänge verkündeten, dass hier bald ein Umzug stattfinden sollte. Ich hatte mich dazu entschieden, meine Dachwohnung in Haidhausen zu verlassen. Der Entschluss war endgültig, aber ich wusste noch immer nicht, ob er richtig gewesen war. Meine zukünftige Bleibe lag im Münchner Norden, in Schwabing, nicht weit vom Mittleren Ring, eigentlich eine recht schöne Wohnung, wenn auch nicht so groß wie meine jetzige, aber darin hatten wir früher ja auch zu dritt gewohnt. Udo Stutz hatte sie mir vermittelt.
Auch so ein Entschluss hat seine Geschichte. Die hier begann in einer Nacht, in der ich hundemüde von einer ergebnislosen Observierung zurückkam und keine, aber wirklich überhaupt keine Lust mehr hatte, die fünf Treppen zu meiner Dachwohnung hochzusteigen. Natürlich stieg ich dann doch hoch, aber ich beschloss, nun endlich das in die Tat umzusetzen, was ich mir schon lange vorgenommen, aber immer wieder verschoben hatte: Ich wollte mir eine andere Wohnung suchen. Eine mit Lift. Man wird ja nicht jünger.
Nachdem ich das zwei Monate lang getan und nichts Passendes gefunden hatte und die Sache allmählich begann mir auf die Nerven zu gehen, erzählte ich Udo Stutz davon. Udo war auch Detektiv, ein paar Jahre älter als ich, er hatte früher bei einer großen Detektei gearbeitet, sich dann selbstständig gemacht, aber immer noch gute Kontakte zu ein paar großen Wirtschaftsunternehmen, von denen er regelmäßig Aufträge bekam. Er hatte es zu einem Reihenhaus, einem eigenen Büro und einer Sekretärin gebracht, und manchmal leitete er einen Auftrag an mich weiter, wenn er keine Zeit dazu hatte. Oder keine Lust, wie ich vermutete, denn es waren nicht gerade die attraktivsten. Überprüfungen von Firmenmitarbeitern, vor allem von solchen, die sich um einen wichtigen Posten bewarben, Aufklärung von internen Diebstählen und so weiter. Aber mit irgendetwas muss man schließlich sein Geld verdienen.
»Vielleicht kann ich dir helfen«, hatte Udo gesagt, und tatsächlich rief er mich ein paar Tage später an. Er kenne da einen Hausbesitzer, bei dem sei gerade eine Wohnung frei geworden. »Das Ganze läuft über ein Maklerbüro, dagegen ist nichts zu machen, aber du kannst es dir ja mal ansehen.«
Drei Zimmer, Küche, Bad, Balkon, stand in den Unterlagen der Maklerin, die sie mir zufaxte. Und dazu das Übliche: Quadratmeter, Stockwerk, Preis. Und ganz wichtig: Lift. Ein Altbau in Nordschwabing, teilrenoviert. Das alles klang nicht schlecht, ausgenommen das Stadtviertel, mit dem Münchner Norden hatte ich es nicht so. Aber daran würde ich mich eben gewöhnen müssen.
Ich redete mir also ein, das wäre vielleicht eine gute Gelegenheit und schritt deshalb recht zuversichtlich gestimmt mit der Maklerin über die einhundertzwei Quadratmeter Parkettboden, hörte mit halbem Ohr, wie sie die Vorteile der Wohnung pries, platzierte in Gedanken schon Schreibtisch, Besucherstuhl und Kaffeeautomat und suchte die Ahnung zu verdrängen, dass ich ganz schön verdienen musste, um mir das hier auf Dauer leisten zu können.
»In drei Wochen können Sie einziehen, dann ist alles fertig renoviert«, sagte die Maklerin, eine rundliche Frau fortgeschrittenen Alters, die auf erstaunlich hohen Absätzen übers Parkett stöckelte.
»Sehr schön«, sagte ich.
Die Wohnung lag im vierten Stock, bis hierher reichte auch der Lift. Darüber gab es noch zwei kleine Wohnungen unterm Dach. Eine der Wohnungen, hatte die Maklerin gesagt, sei die des Hausmeisters.
Als ich wieder zu Hause war, setzte ich mich in meinen alten Ohrensessel, und mir wurde klar, dass das hier bald nicht mehr mein Zuhause sein würde. Und das nur wegen des fehlenden Lifts. Oder gab es noch andere, tiefer liegende Gründe, das hier aufzugeben und in den gesichtslosen Münchner Norden zu ziehen? Natürlich gab es die, da machte ich mir nichts vor.
Es waren unzählige Gründe, es waren all die glücklichen Stunden, die ich hier zusammen mit Tania und unserem Sohn Patrick verbracht hatte, bevor alles auseinanderfiel. Das hing noch in der Luft, klebte unsichtbar an Möbeln und Wänden, begrüßte mich, wenn ich morgens aufstand und verfolgte mich abends ins Bett. Natürlich nicht unentwegt und jeden Tag, die Scheidung lag ja schon ein paar Jahre zurück, und in der Zwischenzeit war auch schon mal das eine oder andere weibliche Wesen hier über Nacht geblieben. Aber es war nie von Dauer gewesen. Ich führte das immer auf die Umstände zurück, es hatte halt nicht so gepasst, doch in Wirklichkeit wusste ich genau, warum das so war. Und damit sollte jetzt Schluss sein, ich würde umziehen und diese Vergangenheit für immer hier zurücklassen.
Drei Tage später ging ich wieder zur zukünftigen Wohnung, um einiges auszumessen. Ich solle mir vom Hausmeister den Schlüssel geben lassen, hatte die Maklerin gesagt. Den Vertrag hatte ich schon unterschrieben, ich wollte jetzt nicht mehr lange überlegen. Als ich in den Lift stieg, drängte sich noch einer mit hinein, ungefähr mein Alter, leicht transpirierend, das hellblaue T-Shirt spannte überm Bauch. Einer von der jovialen Sorte, mit der ich noch nie viel anfangen konnte.
»Sie sind der neue Mieter, stimmt’s?«, sagte er.
»Stimmt«, sagte ich.
»Na, dann auf gute Nachbarschaft. Ich heiße Nagler, ich wohne direkt unter Ihnen. Schaun S’ doch einfach mal bei uns rein.«
Er streckte sogar die Hand aus, ich ergriff sie – sie fühlte sich teigig an – und nannte meinen Namen.
Dann waren wir im dritten Stock, er stieg aus, grinste mich aus seinen rötlichen Bartstoppeln heraus an und rief über die Schulter zurück: »Man sieht sich!«
Der Hausmeister hieß Korreuter, so stand es an der Tür im fünften Stock. Bevor ich läutete, warf ich einen Blick auf die Tür gegenüber. Ein Zettel war drangeklebt, darauf stand in rundlicher, etwas krakeliger, schwer lesbarer Schrift ein Name, den ich als Berner entzifferte. Ich läutete beim Hausmeister.
Der Mann, der die Tür öffnete, trug einen grünen Trainingsanzug, der aussah, als würde sein Besitzer auch darin schlafen. Er mochte etwa Mitte dreißig sein, geschätzte fünfzehn, zwanzig Kilo Übergewicht, nicht besonders groß, eine Bierfahne umwehte ihn, obwohl es erst drei Uhr am Nachmittag war, und ich dachte, als ich ihn so ansah, dass Namen wie Öztürk oder Lazarides besser zu ihm passen würden als Korreuter. Runder Kopf, dichtes, zu einer Bürste geschnittenes schwarzes Haar, dunkler Fünftagebart, dazu helle blaugraue Augen, die mich nicht sehr freundlich ansahen.
»Herr Korreuter?«, fragte ich sicherheitshalber.
»Ja, und?«
Ich sagte, wer ich war und was ich von ihm wollte. Er händigte mir die Wohnungsschlüssel aus, ich bedankte mich und ging zu meiner zukünftigen Bleibe hinunter.
Es mochte etwa eine Viertelstunde vergangen sein, ich war gerade mit den Schlafzimmermaßen beschäftigt, als ich im Treppenhaus eine laute Auseinandersetzung hörte. Zwei Männer stritten miteinander. Mir war, als hätte ich auch noch eine Frauenstimme gehört. Ich öffnete leise die Tür, machte einen Schritt hinaus und schaute nach oben. Ich konnte nur die untere Hälfte der beiden Männer sehen, eine davon gehörte, die grüne Trainingsanzughose verriet es, zu Korreuter. Ihr gegenüber standen hellblaue Jeansbeine, die ziemlich designermäßig aussahen und unten mit braunen, feinen, bestimmt recht teuren Schuhen abschlossen.
»Unverschämtheit! Was mischen Sie sich hier ein, das geht Sie überhaupt nichts an!« Das waren die Designerjeans.
»Was mich was angeht, des entscheid’ i selber«, antwortete Korreuter. »Sie lassen gefälligst die Frau Berner in Ruhe, und damit basta. Und jetzt verschwinden S’ freiwillig, bevor S’ die Treppn runterfliegn!«
»Nicht anfassen!« Der mit den Jeans trat einen Schritt zurück. »Gut, ich gehe. Aber das wird Ihnen noch leid tun. Ihnen beiden!«
Ich ging rasch wieder in die Wohnung zurück, zog die Tür zu und lugte durch den Türspalt hinaus. Ich konnte den Mann, der da die Treppe herunterkam und auf meiner Etage die Kurve nahm, nur ein, zwei Sekunden lang sehen, ich erkannte eine Lederjacke und ein Aktenköfferchen, vom Gesicht nur noch die linke, unrasierte Seite. Alt konnte er nicht sein, dazu ging er auch zu schnell. Und er verzichtete auf den Lift.
Oben war jetzt wieder die weibliche Stimme zu hören. Ich konnte nicht verstehen, was sie sagte, sie war ziemlich leise, und deshalb trat ich wieder auf den Treppenabsatz hinaus. Das alles ging mich überhaupt nichts an, ich hätte mich weiter mit meinem Metermaß beschäftigen sollen, aber wer kann da schon widerstehen! Die Neugier ist eine durchaus legitime menschliche Eigenschaft, dazu braucht man nicht mal den Detektivberuf als Ausrede.
»… aber das war doch selbstverständlich«, sagte Korreuter gerade. »Wenn Sie der Kerl wieder belästigt … gleich bei mir klingeln!«
Die Antwort konnte ich nicht verstehen, ich machte also noch einen Schritt auf die nach oben führende Treppe zu, das schon leicht wellige Treppenparkett knarrte – und oben erschienen zwei Köpfe und schauten zu mir herunter: der von Korreuter und noch ein zweiter …
Engel können nur ganz oben wohnen, gleich unterm Dach, das ist nur natürlich. Ich sah hellblonde Locken, die ein zartes, blasses Gesicht umrahmten, zwei große erschrockene Augen schauten mich an, vom Dachfenster fiel Licht auf die Locken und ließ sie aufleuchten. Durchsichtig sah das aus, leicht, ätherisch, es hätte mich nur mäßig erstaunt, wenn der Engel jetzt weggeflogen wäre. Aber dann machte Korreuter den Mund auf und holte mich in die Realität zurück.
»Is was?«, knurrte er.
Ich hätte nur mal nachsehen wollen, was da draußen los sei, sagte ich.
»Nix is los.« Freundlichkeit gehörte offenbar nicht zu seinen Primärtugenden.
Ich schaute den Engel an. »Ich heiße Moser«, sagte ich. »Ich bin der neue Mieter.«
»Angenehm, Berner«, hauchte sie, dann verschwand sie.
Während ich in die Wohnung zurückging, hörte ich noch, wie der Hausmeister halblaut auf seine Nachbarin einredete. Er schien sich als ihr Beschützer zu fühlen, was mir auch sofort einleuchtete. Es gibt Frauen, die solche männlichen Verhaltensweisen unwiderstehlich herausfordern, die hier war geradezu der Prototyp. Ich trat ans Fenster und sah unten einen dunklen Porsche wegfahren. Vermutlich war das der Wagen des Besuchers. Was hatte die zarte, scheinbar recht schreckhafte Elfe da oben mit ihm zu tun? Es ging mich nichts an, es interessierte mich auch nicht, und deshalb ging ich wieder ins Wohnzimmer zurück und überlegte, wo ich den Ohrensessel hinstellen sollte. Er schien nicht so recht hier hereinzupassen.
In den beiden nächsten Tagen kam ich nicht dazu, mich um die neue Wohnung und den Umzug zu kümmern. Ich musste den Fall zu Ende bringen, an dem ich gerade arbeitete. Er ging mir ziemlich auf die Nerven, aber wenn nichts Besseres im Angebot ist … Ich konnte es mir nicht leisten, allzu wählerisch zu sein. Also hatte ich mich, nach einem Tipp von Udo Stutz, von einem Inkassobüro anheuern lassen, einen Schuldner zu überprüfen, aus dem offenbar nichts mehr herauszuholen war. Aber so ganz sicher war man sich nicht, und so engagierte man einen Detektiv, der das arme Schwein genauer unter die Lupe nehmen sollte.
Mein »Zielobjekt« hatte ein Unternehmen für Bio-Isolierstoffe betrieben, Dämmstoffe aus Naturfasern und so weiter, und war damit Pleite gegangen. Er hieß Peter Steinbuchner, war schon in den Fünfzigern und nicht unsympathisch. Und er schien wirklich keinen müden Euro mehr zu haben. Nachdem ich ihn ein paar Tage lang beobachtet, sein Umfeld erkundet und nichts entdeckt hatte, was darauf hindeutete, dass er etwas beiseite geschafft haben könnte, hatte ich ihn in einer Kneipe »zufällig« kennengelernt.
Jetzt ging ich wieder hin, fest entschlossen, es dabei bewenden zu lassen. Aber außer einer Menge über Isolierstoffe und die Ungerechtigkeit des Unternehmerlebens erfuhr ich nichts Neues. Der Mann war am Ende, auch sein Häuschen gehörte inzwischen der Bank, und seine Frau, so erzählte er mir kurz vor Mitternacht, wolle ihn nun auch verlassen.
»Ich kann’s ihr net verdenken«, sagte er und schaute mich mit wässrigen Augen an. »Wer will schon mit so einem verheiratet sein. Firma in den Sand gesetzt, Endstation Sozialhilfe.«
»Na, na, so schlimm wird’s schon net werden.« Ich zog die Brieftasche, um zu bezahlen. Steinbuchner tat mir leid, aber das half uns beiden auch nicht weiter.
Am Tag darauf hämmerte ich gerade meinen Bericht in den Laptop, als das Telefon klingelte. Es war Herr Nagler, den ich im Aufzug kennengelernt hatte. Ob ich morgen Abend gegen 19 Uhr Zeit hätte, er habe ein paar Leute aus dem Haus, »die wichtigsten«, zu einem kleinen Imbiss eingeladen, und da ich ja nun auch dazu gehöre, obwohl ich noch nicht eingezogen sei …
»Ja gut, ich komme gerne«, sagte ich. »Danke für die Einladung.«
Das war nicht gerade die Art von Zusammenkünften, die mich reizte, aber ich wollte mich nicht gleich von Anfang an ausschließen. Und es war auch eine Gelegenheit, die anderen Hausbewohner kennenzulernen – wenn auch nur »die wichtigsten«, wie Nagler gesagt hatte. Es interessierte mich schon, wen einer wie er für wichtig oder unwichtig hielt.
Am nächsten Tag also, kurz nach sieben, läutete ich im dritten Stock bei Naglers. Ich hatte sogar ein paar Blümchen dabei für die Dame des Hauses. Allerdings war ich der Einzige, der an sowas gedacht hatte. So an die zehn, zwölf Leute standen in Naglers großem Wohnzimmer, zwischen der Schrankwand aus Eiche mit integriertem großen Fernseher und den an die Wand geschobenen dicken, gelbbraun gemusterten Polstermöbeln. Das machte also, mich eingeschlossen, so an die sechs, sieben Mietparteien. Von den zwölf, die sich im Haus befanden. Nagler machte mich mit den anderen bekannt, deren Namen ich ebenso schnell wieder vergessen hatte, wie sie mir genannt wurden. Und als dann die Gespräche begannen, verspürte ich bald den dringenden Wunsch, die von Nagler als uninteressant eingestuften Leute kennenzulernen; ich hatte so das Gefühl, als könnte eine Unterhaltung mit ihnen anregender sein als mit den hier Versammelten. Langweiliger bestimmt nicht.
Es gab Bier und Weiß- und Rotwein und ein paar ganz leckere Häppchen, man stand und saß in Naglers Wohnzimmer und Küche, aber selbst nach drei Gläsern Rotem empfand ich die dumpfe Spießigkeit, die wie klebriger Nebel alles einhüllte, als immer beklemmender. War ich überheblich? Natürlich, aber in so einer Umgebung ist dies das einzige Mittel, das einen vor der totalen Resignation bewahren kann.
Aber dann erfuhr ich endlich etwas, das mich wirklich interessierte. Ich hatte gefragt, ob denn die junge Frau von ganz oben nicht eingeladen sei, der wäre ich neulich auf der Treppe begegnet.
»Die Berner? Die wäre doch sowieso nicht gekommen«, antwortete Frau Nagler, ebenso ausladend wie ihr Mann und gerade damit beschäftigt, einen in der Mikrowelle aufgewärmten Zwiebelkuchen in kleine Stücke zu schneiden. »Die hat zu keinem Kontakt. Aber wenigstens grüßt sie auf der Treppe.«
»Außerdem ginge es ihr hier bestimmt zu unchristlich zu«, sagte ein schätzungsweise Sechzehnjähriger, Nagler junior, wie ich erfahren hatte, und griff sich eines der Kuchenstückchen. »Ich hab ihr mal geholfen, eine schwere Einkaufstasche hochzuschleppen und bin kurz in die Wohnung rein. Mann, alles voll mit Marienbildern. Voll krass. Wohin du schaust, überall die Heilige Maria. Lauter Bilder mit Heiligenschein. Und in der Ecke hängt der Jesus am Kreuz und wundert sich.«
»Klaus, du sollst nicht so über Dinge reden, die anderen heilig sind«, tadelte Frau Nagler.
Ein gegelter und gesprächiger Versicherungsmakler, der alle anderen mit seinen abgestandenen Witzen langweilte, kam in die Küche. Er hatte das Gesprächsthema mitbekommen.
»Ach, die Berner«, sagte er. »Die braucht uns sowieso nicht, die hat ja ihren väterlichen Freund.« Und dabei grinste er so, dass jeder gleich wusste, was damit gemeint war.
Aber es interessierte mich nun mal, und deshalb fragte ich naiv: »Sie hat einen Freund?«
Das Grinsen wurde noch um einen Grad schmieriger. »Nun ja, Genaues weiß man natürlich nicht. Ich weiß nur, dass dieser Stuss oder Stutz oder wie er heißt, sie regelmäßig besucht. So ein bulliger Typ, um die Fünfzig. Ich habe seinen Namen zufällig mitbekommen, als er mal mit dem Handy telefoniert hat.«
»Ja, stimmt, den hab ich auch schon gesehen«, sagte Klaus. »Also einen besseren Geschmack hätte ich der Marientussi schon zugetraut.«
»Klaus!« Das war Frau Nagler, die diese Enthüllungen jedoch ebenfalls sehr interessiert verfolgte.
Ich war mehr als interessiert, ich war platt. Stutz also, mein Kollege und Beinahe-Freund Udo Stutz kümmerte sich um die blonde Elfe vom fünften Stock! Ich wusste, dass er den Hausbesitzer kannte, dadurch war ich ja an meine Wohnung gekommen, und auf die gleiche Weise vermutlich die junge Frau an ihre. Aber dass er auch nachher noch nach ihr sah … Ich konnte nicht glauben, dass er was mit ihr hatte. Stutz, verheiratet, ein erwachsener Sohn, war einem gelegentlichen Abenteuer nicht abgeneigt, so viel hatte ich im Laufe der Jahre mitbekommen, aber ausgerechnet mit der Berner, dieser anscheinend sehr religiösen jungen Frau? Ich konnte es mir nicht vorstellen. Eine verspätete Vater-Tochter-Beziehung vielleicht?
»Wie lange wohnt sie denn schon hier?«, fragte ich.
»Noch nicht so lange«, antwortete Frau Nagler. »So an die zwei Monate.«
Warum hatte Stutz mir nichts von der Bewohnerin im fünften Stock erzählt? Er wusste ja inzwischen, dass ich die Wohnung genommen hatte. Ich würde ihn bei nächster Gelegenheit fragen müssen.
Der Versicherungsvertreter fing an, mir auf die Nerven zu gehen. »Sie sind doch Detektiv«, sagte er. »Sie könnten doch bestimmt herausbekommen, was da oben los ist.«
Ich hatte meinen Beruf bis jetzt für mich behalten, die Leute im Haus würden ihn noch früh genug erfahren. Spätestens dann, wenn ich unten neben der Haustür mein kleines Messingschild angebracht hatte. M. Moser – Private Ermittlungen. In meiner bisherigen Wohnung war das nie ein Problem gewesen, die anderen Mieter hatten sich daran gewöhnt, dass manchmal recht seltsame Leute zu mir kamen. Der Vertreter konnte es nur von Korreuter erfahren haben, der es vom Hausbesitzer hatte. Dem hatte ich ja meinen Beruf nennen müssen. Aus seinem Gesichtsausdruck bei der Vertragsunterzeichnung hatte ich geschlossen, dass er das nicht unbedingt für eine seriöse Tätigkeit hielt; ohne die Fürsprache von Stutz hätte ich die Wohnung wohl nie bekommen. Stutz hatte offenbar großen Einfluss auf ihn.
Jetzt war es also raus, und die Reaktion war dementsprechend.
»Was, a richtiger Detektiv san Sie?«, sagte Frau Nagler, die bis jetzt ein bemühtes Hochdeutsch gesprochen hatte, und sah mich mit Augen an, aus denen die in unzähligen Fernsehfilmen gewonnene Erfahrung über die kriminellen Seiten des Lebens sprach. Auch auf Klaus, den Sohn der Naglers, hatte diese Eröffnung sichtlich Eindruck gemacht.
Die Neuigkeit verbreitete sich schneller unter den Anwesenden als Frau Naglers Zwiebelkuchen. Man wollte von mir Näheres wissen, ich sollte Geschichten erzählen, Gefährliches berichten. Gleichzeitig begegnete ich hier auch wieder dem Gesichtsausdruck des Vermieters, Überlegenheit und Distanzierung des braven Bürgers gegenüber einem als eher halbseiden eingeschätzten Ambiente ausdrückend. Ich zog mich mit zwei, drei kleinen Anekdoten aus der Affäre, gab dann vor, noch etwas Dringendes erledigen zu müssen – »Aha, wichtige Ermittlung«, grinste einer – und verabschiedete mich.
Zwei Tage später rief mich Gloria Pokalke an, die Sekretärin von Udo Stutz. Ihr Chef war tot. Motorradunfall.
Den Abend nach der Beerdigung verbrachte ich, wie so viele Abende, wie viel zu viele Abende, in meiner Stammkneipe. Natürlich ging mir da auch das überraschende Hinscheiden von Udo durch den Kopf, ich musste an die Flüchtigkeit des Lebens denken, an die irdische Vergänglichkeit und den ganzen Rest. Was mir jedoch noch stärker zu schaffen machte, war die plötzliche Erkenntnis, dass ich mit meinem Umzug auch diese Stammkneipe aufgeben musste. Deshalb sprach ich dem Alkohol stärker zu als üblicherweise – einfacher ausgedrückt: Ich war total breit, als ich mit einiger Mühe wieder zu Hause ankam. Und am nächsten Vormittag noch ziemlich benebelt, als mich Gloria Pokale anrief.
Sie hätte mich ja schon nach der Beerdigung angesprochen und von Udos offenen Fällen erzählt. Davon sei nur noch ein Fall übrig geblieben, alle anderen habe sie stornieren können. Sie hoffe, das sei in meinem Sinn, ich hätte ja bestimmt schon genug um die Ohren. Ob ich denn bald im Büro vorbeikommen könne, um das alles zu besprechen.
Wollte sie mich auf den Arm nehmen? Sie klang ganz ernst, anscheinend glaubte sie wirklich, jeder Privatdetektiv hätte so viel zu tun wie ihr verblichener Chef. Ich würde gerne kommen, sagte ich, allerdings ginge das erst morgen, heute hätte ich leider keinen Termin mehr frei. Wir verabredeten uns also für nachmittags, fünfzehn Uhr.
»Super«, sagte sie. »Dann bis morgen. Vielen Dank auch.«
Sie schien ja richtig erleichtert zu sein, so kannte ich sie gar nicht.
Am nächsten Morgen hatte ich nach dem Frühstück gerade nach dem Tabellenstand des TSV 1860 gesehen (wie üblich zu weit unten) und las im Polizeibericht etwas über das Verschwinden einer jungen Frau samt Baby, man vermute das Schlimmste, als es an der Tür klingelte. Ich öffnete.
Vor mir stand Gloria Pokalke, schwer schnaufend nach dem Erklimmen der fünf Stockwerke. »Darf ich reinkommen?«, keuchte sie.
Sie trat ein und blieb erst mal vor der Tür stehen, die zu meiner kleinen Dachterrasse führte, um wieder zu Atem zu kommen.
»Schön ist das hier«, bemerkte sie und schaute auf die Haidhauser Dächer rundum.
Ich bat sie Platz zu nehmen. »Was kann ich für Sie tun?«
Sie entschuldigte sich wegen ihres vorzeitigen Kommens, aber sie müsse sofort mit mir reden, es sei wirklich dringend. Dann sah sie mich mit einem Ausdruck an, den ich nicht deuten konnte, und fragte: »Wie gut kannten Sie eigentlich Udo Stutz?«
Seltsam. Eine ähnliche Frage hatte sie mir schon mal gestellt, gleich nach der Beerdigung. »Ziemlich gut, denke ich. Soweit man sich eben kennt, wenn man seit Jahren immer mal wieder zusammenarbeitet. Privat eher weniger. Warum wollen Sie das wissen?«
Es schien ihr nicht leicht zu fallen, das zu sagen, was sie sagen wollte. Dann war es soweit: »Ich glaube, Udo Stutz ist ermordet worden.«
Ich schwieg, aber nicht aus Taktik, sondern weil mir die Worte fehlten. Stutz ermordet? Also kein Unfall?
»Sind Sie sicher?«, war das erste, was mir dazu einfiel.
»Nein. Andernfalls wäre ich jetzt nicht hier bei Ihnen, sondern bei der Polizei.«
Ich überhörte die Ungeduld und bat um nähere Angaben. Sie begann also zu erzählen, zuerst noch nach den richtigen Worten suchend, dann immer flüssiger. Stutz’ Witwe hatte sie gebeten, sich um den Verkauf oder die Verschrottung des Motorrads zu kümmern, sie selbst würde es nicht über sich bringen, sich mit dem Gerät zu befassen, das schuld sei am Tod ihres Mannes. Sie wolle auch kein Geld dafür. Die Polizei hatte die Maschine schnell freigegeben, es schien ja eindeutig menschliches Versagen gewesen zu sein, und Gloria Pokalke hatte, zusammen mit einem ihr bekannten Tankwart, festgestellt, dass man sie durchaus noch verkaufen konnte. Ein paar Beulen, Scheinwerfer kaputt und noch einige weitere, unschwer zu reparierende Kleinigkeiten. Der Tankwart wollte sich darum kümmern, sie vereinbarten, sich die Kosten und den Erlös halbe-halbe zu teilen.
»Der Tankwart hat die Maschine erst mal gründlich gewaschen, sie war durch den Unfall ja völlig verdreckt. Und als sie dann vor der Tankstelle stand, habe ich sie mir näher angesehen, einfach so«, erzählte sie. »Und da habe ich hinten links, an der Verkleidung, etwas entdeckt.« Sie machte eine Pause, nicht, um die Spannung zu steigern, sondern um ihre zunehmende Aufregung unter Kontrolle zu bekommen. Die Maschine, sagte sie dann, sei blauschwarz lackiert, ein helles Blau mit breiten schwarzen Streifen, und auf dem hellen Blau nun, auch noch ein, zwei Zentimeter ins Schwarze hineinreichend, habe sie auf der linken Seite hinten eine Schramme entdeckt, und darauf silbergraue Lackreste. »Silbergrau und hellblau, das übersieht man leicht, verstehen Sie?«, setzte sie hinzu.
Ich verstand vor allem Bahnhof. »Eine Schramme? Wo genau?«, wollte ich wissen, nur um überhaupt etwas zu sagen, denn das Ganze kam mir reichlich abwegig vor.
»Hinten links, wie ich bereits sagte«, war die nun schon leicht genervt klingende Antwort. »Kotflügel, Verkleidung, was weiß ich, wie das genau heißt.« Sie schaute mir ins Gesicht, sah dort, was ich dachte, und meinte spitz: »Sie können sich wirklich nicht vorstellen, was das bedeutet?«
Wo wäre ich, wenn ich mich über jede zickige Besucherin aufregen würde! Also blieb ich beispielhaft gelassen und antwortete: »Ich kann mir eine ganze Menge vorstellen. Jetzt zum Beispiel denke ich, dass das noch nicht alles ist. Also erzählen Sie erst mal weiter.«
»Na gut. Ich bin dann, am nächsten Tag, nachmittags, zur Unfallstelle gefahren. Eine leichte Linkskurve, völlig harmlos, man müsste schon ein blutiger Anfänger sein, um da von der Straße abzukommen.«
Als sie so dastand und sich umsah und dann am Straßenrand auf und ab ging, bemerkte sie etwa hundert Meter entfernt einen Mann auf einem Traktor, der irgendein landwirtschaftliches Gerät über eine Wiese zog und immer wieder zu ihr herüber schaute. Sie achtete jedoch nicht weiter darauf, fuhr wieder los und machte nach ungefähr einem Kilometer in einem Dorf Halt, um dort in einem Gasthof eine Kleinigkeit zu essen. Und natürlich, um zu versuchen, etwas über den Unfall zu erfahren. Vielleicht hatte ja jemand etwas bemerkt, Udo Stutz fuhr schließlich ziemlich oft hier durch die Gegend, er liebte diese schmalen, kurvenreichen Straßen, auf denen nie viel los war.
»Waren Sie schon mal in so einem Gasthof auf dem Lande?«, fragte sie jetzt, mit senkrechter Falte auf der Stirn.
Gasthof auf dem Lande! Eine Bauernwirtschaft war es halt gewesen, in die sie da geraten war, sowas gab es ja immer noch, und da herrschte nun mal ein etwas urigeres Ambiente, als sie es wohl gewohnt war. Vielleicht erfuhr ich ja noch, woher sie stammte, aus Bayern bestimmt nicht. Ihr scharfkantiges Hochdeutsch enthielt nichts, was auf irgendeine Region hingedeutet hätte. Ich hätte sie gerne beobachtet, dort in dem Gasthof auf dem Lande, wie sie versuchte, mit den Eingeborenen ins Gespräch zu kommen.
»Schon öfter«, antwortete ich. Und ich fügte, bewusst ins Münchnerische fallend, hinzu: »Ham S’ an Kulturschock erlebt, gell!«
Sie schaute mich erstaunt an, einen Augenblick lang dachte ich, sie würde lächeln, aber sie wollte so etwas jetzt nicht zulassen. Wenigstens verschwand die senkrechte Falte. »Ganz so schlimm war es nicht. Die haben mich schon verstanden, nur umgekehrt gab’s Schwierigkeiten. Und sowas von maulfaul.«
Sie hatte es dann schnell aufgegeben, irgendetwas aus den Wirtsleuten herausholen zu wollen. »Mir ham nix gsehn«, war der gemeinsame Nenner dessen, was sie in Erfahrung bringen konnte. Sie wollte dann etwas essen und hatte die Wahl zwischen aufgewärmtem Lüngerl mit Knödel und kaltem Wurstsalat.
»Ja mei«, sagte ich, »die Essenszeit war halt schon vorbei.«
»Schon klar. Ich hatte ja auch kein Sushi erwartet. Aber trotzdem …«
Sie entschied sich für den Wurstsalat und hatte ihn erst zu einem Drittel aufgegessen, als ein neuer Gast die Wirtsstube betrat. Arbeitskleidung, mittleres Alter, speckiger Filzhut – sie erkannte ihn sofort wieder: Es war der Mann auf dem Traktor, der sie beobachtet hatte. Er schaute sich um, außer der Wirtin und Gloria Pokalke war nur ein alter Mann im Raum, der in der Ecke in sein schales Bier starrte, und setzte sich dann zu Gloria an den Tisch. »Mit Verlaub«, sagte er dabei. Den Hut behielt er auf.
Zuerst war sie nicht gerade entzückt, dass er sich, bei den vielen freien Plätzen, ausgerechnet zu ihr setzte, sie vermutete eine Anmache und lag damit, wie sich später zeigen sollte, auch nicht ganz falsch. Aber er hatte auch noch anderes im Sinn. Ob sie mit dem Motorradfahrer verwandt sei, der da neulich verunglückt war? Der sei ja oft hier durch die Gegend gefahren, auch im Wirtshaus hier habe er schon mal Brotzeit gemacht. Ja, sagte sie, sie sei seine Schwester.
Wenigstens vermied sie es, als sie mir von dem Gespräch berichtete, bayerischen Dialekt imitieren zu wollen. Es gibt nichts Grauenvolleres, als Norddeutschen bei solchen Versuchen zuzuhören. Der Mann erzählte ihr also, er habe an den Tagen vorher ein paarmal einen großen silberfarbenen Geländewagen gesehen, der die Straße entlanggefahren war, ziemlich langsam, als ob er auf etwas wartete. Einmal sei er mit dem Traktor auf ihn zugerollt, um ihn zu fragen, ob er ihm helfen könne – aber da habe der Fahrer plötzlich Gas gegeben und sei weggezischt. Auch an dem bewussten Tag sei er ihm aufgefallen, doch da sei er mit einem Affenzahn über die schmale Landstraße gerast.
»Verstehen Sie jetzt?«, fragte Gloria Pokalke und schaute mich erwartungsvoll an.
»Nun ja«, sagte ich. »Silberner SUV, silberne Lackreste am Motorrad. Das kann natürlich das bedeuten, was Sie vermuten. Es kann aber auch der reine Zufall sein. Übrigens: Möchten Sie was trinken?«
»Nein, ich möchte nichts trinken. Ich möchte nur, dass Sie mich endlich ernst nehmen. Oder ist es Ihnen wirklich völlig egal, was da passiert ist?«
Ich erkannte, dass ich mich allmählich interessierter zeigen musste. So einfach, wie ich gehofft hatte, würde ich diese recherchierfreudige Sekretärin bestimmt nicht mehr los, und es gab da ja wirklich, wie ich mir widerstrebend eingestand, ein paar merkwürdige Umstände. Obwohl ich immer noch nicht an das glauben wollte, was sie mir als Schlussfolgerung auftischte. Andererseits: Dass ein Detektiv sich Feinde macht, ist ja nicht gerade ungewöhnlich.
»Es ist mir nicht egal«, entgegnete ich deshalb. »Ich möchte nur keine voreiligen Schlüsse ziehen. Hat der Mann noch etwas gesagt, vielleicht ist ihm irgendetwas an dem Fahrer aufgefallen.«
»Das habe ich ihn auch gefragt. Er glaubte sich an einen Schnurrbart erinnern zu können, war sich aber nicht sicher. Und an eine Sonnenbrille.«
»Sonst wusste er nichts?«
»Nein. Nur dass er mit mir mal essen gehen wollte.«
»Wow! Lüngerl mit Knödel? Haben Sie zugesagt?«
Sie warf mir einen vernichtenden Blick zu, ich grinste trotzdem, und jetzt, oh Wunder, lächelte auch sie. Stand ihr gar nicht schlecht.
Wir wurden beide gleich wieder sachlich, und ich versprach, mir das Motorrad zusammen mit ihr anzusehen. Sie nannte mir die Adresse der Tankstelle und wir verabredeten uns für den nächsten Vormittag. Dann war sie weg, und ich dachte nur kurz über das nach, was sie mir eben erzählt hatte.
Am nächsten Morgen, ich war gerade dabei, das Frühstücksgeschirr in der Spülmaschine zu verstauen, klingelte das Telefon. Es war Gloria Pokalke. Aber wir seien doch erst in zwei Stunden verabredet, konnte ich gerade noch sagen, als sie mich auch schon unterbrach: »Stellen Sie sich vor, das Motorrad ist weg, verkauft! Gestern Abend noch, der Käufer hat es in einem Kleinlaster gleich mitgenommen.«
Ein Gefühl der Erleichterung überkam mich, aber es hielt nicht lange vor.
»Er hat einen guten Preis bezahlt, ohne zu feilschen«, sagte sie.
»Woher hat er denn gewusst, dass die Maschine zu verkaufen war? Sie hatten doch noch keine Anzeige aufgegeben, oder?«
»Nein. Nur neben der Kasse hing ein Zettel.«
»Also purer Zufall?«
»Sieht so aus. Aber der Tankwart hatte den Eindruck, dass der Mann genau wusste, was er suchte. Er wollte nicht mal warten, bis die Schäden repariert waren. Und noch etwas: Er trug einen Schnurrbart!«
Ich unterdrückte eine Bemerkung über die mutmaßliche Zahl der Schnurrbartträger in dieser Stadt. Denn allmählich wurden es auch für mich zuviel der Zufälle. »Es gibt doch bestimmt einen Kaufvertrag. Steht da die Adresse des Käufers drin?«
»Ja. Und die Telefonnummer habe ich auch herausgefunden. Ich habe dort schon angerufen, aber nur seine Frau war da. Heute Nachmittag, ab drei, hat sie gemeint, ist er wahrscheinlich zu Hause. Ich habe ihr gesagt, ich hätte noch ein paar Sachen, die zum Motorrad gehörten, und die wollte ich loswerden.«
Ihre Frage, ob ich mich um drei Uhr mit ihr dort treffen wolle, konnte ich jetzt nicht mehr mit Nein beantworten. Vielleicht war es ja ganz gut, diesen ominösen Schnurrbarträger kennenzulernen, und wenn es nur dazu diente, die ganze Mordverdachts-Geschichte anschließend ad acta zu legen. Blieb allerdings noch die Frage, wie dieser Käufer überhaupt von dem Motorrad erfahren hatte. Wenn es wirklich kein Zufall war, musste jemand die Sekretärin beobachtet haben.