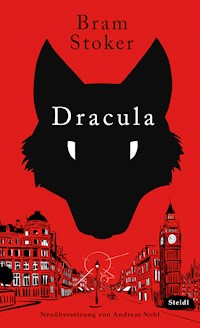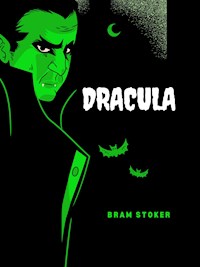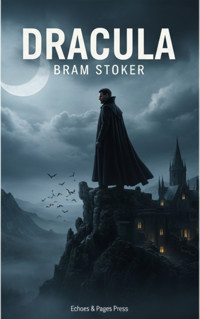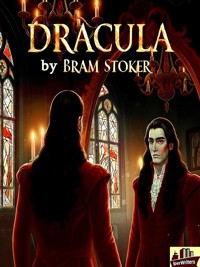5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Hölle lacht gellend, wenn das Grauen erwacht!
›Gruselschulz‹ widmet sich in seinen Höllengelächter-Bänden den Meistern des Grusels vergangener ›Tage‹. In diesem 2. Band nimmt er sich weitere britische Autoren wie Bram Stoker, R. L. Stevenson, Sir Arthur Conan Doyle, J. McArdwell, Edith Nesbit, Amyas Northcote, Lord Dunsay, Montague Summers, H. G. Wells, Richard Middleton, Dick Donovan und J. H. Riddell vor. Einige Geschichten liegen in deutscher Erstübersetzung vor, bei anderen wurden Inhalte für neue Storys verwendet.
Dem schließen sich Geschichten von ›Gespensterhoffmann‹ an, bearbeitet oder in Neufassung. Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass eine junge Generation Hoffmanns virtuose Sprache und das historische Ambiente nicht mehr versteht: Ein magischer Fechtlehrer zwingt Jugendliche zur Unterwerfung … bis zum grässlichen Ende. Ein Hauptmann besitzt eine ähnlich tödliche Gabe. Die tote Tante geistert verheerend. Ein Soldat hat irre Halluzinationen; was ist dran? Im Wald geistert ein Kinder massakrierender Unhold. Der Blick in den magischen Spiegel hat Grausiges zur Folge. Ein Wahnsinniger mordet seine besten Kunden. Ein Gespenst erschreckt die Gäste einer Pension zu Tode; modrige Leichen verzehrende Nachthexen; zuletzt das Grauen um Mitternacht.
Es folgen Horrorgeschichten, die ›Gruselschulz‹ in freier Anlehnung an Ideen der Gebrüder Grimm entwickelt hat: Auf Amalia und ihr makabres Los folgen: Trude, die gerne Mädchen brutzelt; der Babys schlachtende Herr Wolf; jemand, der seine Bräute verwurstet; die Gruselgeschichte der schönen Diana und des gerissenen Kinderpärchen Margie und Jonny.
Ein Muss für jeden Fan des klassischen Grusels …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
J. McArdwell, Montague Summers, Lord Dunsay, Amyas Northcote
Edith Nesbit, Dick Donovan, H. G. Wells, Richard Middleton, J. H. Riddell,
Sir Arthur Conan Doyle, Bram Stoker, R. L. Stevenson, Barrett Willoughby,
E. & H. Heron, E. T. A. Hoffmann, Gebrüder Grimm
Gellendes Höllengelächter
Das 2. große Bärenklau Exklusiv Grusel- und Horror-Lesebuch
herausgegeben von Meinhard-Wilhelm Schulz
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Dieter Rottermund mit Bärenklau Exklusiv, 2023
Korrektorat: Sandra Vierbein
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten
Das Copyright auf den Text oder andere Medien und Illustrationen und Bilder erlaubt es KIs/AIs und allen damit in Verbindung stehenden Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren oder damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung erstellen, zeitlich und räumlich unbegrenzt nicht, diesen Text oder auch nur Teile davon als Vorlage zu nutzen, und damit auch nicht allen Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs nutzen, diesen Text oder Teile daraus für ihre Texte zu verwenden, um daraus neue, eigene Texte im Stil des ursprünglichen Autors oder ähnlich zu generieren. Es haften alle Firmen und menschlichen Personen, die mit dieser menschlichen Roman-Vorlage einen neuen Text über eine KI/AI in der Art des ursprünglichen Autors erzeugen, sowie alle Firmen, menschlichen Personen, welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren um damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung zu erstellen; das Copyright für diesen Impressumstext sowie artverwandte Abwandlungen davon liegt zeitlich und räumlich unbegrenzt bei Bärenklau Exklusiv
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Gellendes Höllengelächter
Das 2. große Bärenklau Exklusiv Grusel- und Horror-Lesebuch
1. J. McArdwell: Eine fleischfressende Pflanze
2. Montague Summers: Das Taggespenst
3. Lord Dunsay: Der Gang nach Lingham
4. Amyas Northcote: Die Senke der Ziegelsteine
5. Edith Nesbit: Der Tod kommt in der Nacht.
6. Dick Donovan: Blut trieft von der Decke
7. H. G. Wells: Pastor und die Schwarze
8. Richard Middleton: Der Beerdigungskontrakt
9. J. H. Riddell: Das Haus am Vauxhall Walk
10. Sir Arthur Conan Doyle: Der mörderische Hengst
11. Bram Stoker: Die Jungfrau von Nürnberg
12. R. L. Stevenson: Eine Galgenmoritat
13. Barrett Willoughby: Eine Nacht allein im Blockhaus
14. E. & H. Heron: Die Story von Medhans Lea
15. E. T. A. Hoffmann: Der unheimliche Fechtmeister
16. E. T. A. Hoffmann: Hauptmann Clemens
17. E. T. A. Hoffmann: Die Tante als Gespenst
18. E. T. A. Hoffmann: Mein Kriegskamerad Boris
19. E. T. A. Hoffmann: Der Satan vom Walde
20. E. T. A. Hoffmann: Der unheimliche Spiegel
21. E. T. A. Hoffmann: Der Juwelier
22. E. T. A. Hoffmann: Eine unheimliche Nacht im Gasthof
23. E. T. A. Hoffmann: ›Da werden Weiber zu Hyänen‹
24. E. T. A. Hoffmann: Um Mitternacht im Alten Rom
25. Gebrüder Grimm: Amalia la bella (NF)
26. Gebrüder Grimm: Frau Trude
27. Gebrüder Grimm: Herr Wolf und das siebte Geißlein
28. Gebrüder Grimm: Eine Blaubartstory [›Fitschers Vogel‹]
29. Gebrüder Grimm: Diana
30. Gebrüder Grimm (Nr. 15): Margie & Jonny
Register
Das Buch
Die Hölle lacht gellend, wenn das Grauen erwacht!
›Gruselschulz‹ widmet sich in seinen Höllengelächter-Bänden den Meistern des Grusels vergangener ›Tage‹. In diesem 2. Band nimmt er sich weitere britische Autoren wie Bram Stoker, R. L. Stevenson, Sir Arthur Conan Doyle, J. McArdwell, Edith Nesbit, Amyas Northcote, Lord Dunsay, Montague Summers, H. G. Wells, Richard Middleton, Dick Donovan und J. H. Riddell vor. Einige Geschichten liegen in deutscher Erstübersetzung vor, bei anderen wurden Inhalte für neue Storys verwendet.
Dem schließen sich Geschichten von ›Gespensterhoffmann‹ an, bearbeitet oder in Neufassung. Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass eine junge Generation Hoffmanns virtuose Sprache und das historische Ambiente nicht mehr versteht: Ein magischer Fechtlehrer zwingt Jugendliche zur Unterwerfung … bis zum grässlichen Ende. Ein Hauptmann besitzt eine ähnlich tödliche Gabe. Die tote Tante geistert verheerend. Ein Soldat hat irre Halluzinationen; was ist dran? Im Wald geistert ein Kinder massakrierender Unhold. Der Blick in den magischen Spiegel hat Grausiges zur Folge. Ein Wahnsinniger mordet seine besten Kunden. Ein Gespenst erschreckt die Gäste einer Pension zu Tode; modrige Leichen verzehrende Nachthexen; zuletzt das Grauen um Mitternacht.
Es folgen Horrorgeschichten, die Gruselschulz in freier Anlehnung an Ideen der Gebrüder Grimm entwickelt hat: Auf Amalia und ihr makabres Los folgen: Trude, die gerne Mädchen brutzelt; der Babys schlachtende Herr Wolf; jemand, der seine Bräute verwurstet; die Gruselgeschichte der schönen Diana und des gerissenen Kinderpärchen Margie und Jonny.
Ein Muss für jeden Fan des klassischen Grusels …
***
Gellendes Höllengelächter
Das 2. große Bärenklau Exklusiv Grusel- und Horror-Lesebuch
von Meinhard-Wilhelm Schulz
1. J. McArdwell: Eine fleischfressende Pflanze
a. Der Bericht des Mr. William M. Shultz
Ein volles Jahr ist jetzt schon verstrichen, seit mich Margie geheiratet hat. Ich hatte nicht die Kraft, es zu verhindern. Ob ich wollte oder nicht, ich zog zu ihr ins hübsche Häuschen bei Richmond, unfern der Themse, um ihr den Haushalt zu besorgen, während sie arbeiten ging, um mich zu versorgen. Sie war Fünfunddreißig, zehn Jahre älter als ich und übernahm zuhause das Kommando.
Unser Heim ist ein betagter Bungalow mit Balkon; davor eine alte Garage samt rostigem Minicooper; drum herum der gepflegteste Ziergarten, den jemals jemand in Great Brittan angelegt hat, denn Margie war eine begnadete Gärtnerin und züchtete die seltensten Blumen. Ihr Garten war in Quadrate eingeteilt, ein jedes einer besonderen Art vorbehalten; ein vom Summen und Brummen zahllosen Insekten erfülltes Meer von Blüten. Einmal im Monat erhielt ich die Erlaubnis, mich dort umzuschauen.
Auf einer Gartenschau, in die ich mich verirrt hatte, hatte sie aufgegabelt und aus meiner Idylle in Lambeth herausgerissen. Obwohl ich keine Ahnung von Zierpflanzen hatte, war in meiner alten Bleibe wenigstens ein Gummibaum zu sehen gewesen.
Rein äußerlich war Margie ein toller Käfer; rank und schlank, ziemlich groß, einen halben Kopf größer als ich; nicht ohne Rundungen und Kurven, die sie freigebig und offenherzig zur Schau stellte. Als bekennende Emanze verschmähte sie natürlich jedwede weibische Unterwäsche und war bekennender FKK-Fan.
Im städtischen Freibad war sie als ›das scharfe Biest ohne Oberteil‹ bekannt und musste sich mit dem Fünfmetersprungturm begnügen, weil es leider keinen höheren gab. Wenn sie zufällig mal keinen anderen jungen Mann vernaschte, selten genug, verlustierte sie sich sogar mit mir, was auch mal vorkam.
Während sie tagsüber dem Beruf nachging, kümmerte ich mich um die Küche, kaufte Lebensmittel ein, spielte den Putz- und Hausmann und musste ihr in Abständen dabei helfen, Blumenkästen mit unbekannten Gewächsen in die nächste Ausstellung zu schleppen, wo ihr der erste Preis so gut wie sicher war.
Freitagnachmittag aber sowie den gesamten Sonntag hatte ich frei und gammelte in Londons City herum oder goss mir im Stehimbiss ein Guinness in den Kopf.
Kam ich mal zu spät nach Hause oder hatte einen über den Durst getrunken, setzte es Prügel. Doch auch daran gewöhnte ich mich, selbst wenn ich mir wie ein besetztes Land vorkam. Im Untergrund bildete sich nämlich eine Widerstandbewegung.
Eines Tages brachte ich einen Blumentopf mit nach Hause. Drin keimte eine unscheinbare grüne Pflanze. Triumphierend stellte ich sie auf die weiße Decke des Wohnzimmertischs, die daraufhin einen braunen Fleck aufwies. Meine Margie betrachtete sie eine Weile und schüttelte schließlich den Kopf:
»Was hast du denn da für einen Mist gekauft, dieses Unkraut?!«
»Es ist kein Unkraut«, sagte ich und deutete auf ein merkwürdiges Blatt der Pflanze. Es war längsoval, innen konkav und an seinen Rändern mit borstenartigen Auswüchsen versehen; wie eine hohle rundum mit spitzen Fingern bewehrte Hand. Im Innern dieser Hand sah man silbrig-weißlich schimmernde Härchen.
Margie schüttelte den Kopf, ja, sie war sogar angewidert von der Hässlichkeit meiner Pflanze und zischte:
»Wirf das abscheuliche Ding sofort auf den Komposthafen!«
»Nein«, wagte ich zu widersprechen, »es ist meine Pflanze. Ich werde sie gießen und düngen, bis sie groß und stark ist.«
Margie wunderte sich über meinen auflodernden Widerstandsgeist und dachte sich ihr Teil, denn sie sagte spöttisch:
»Und wozu soll der Schund da denn nützlich sein?«
»Dazu«, sagte ich triumphierend und packte eine Hummel an den Flügeln, die gerade damit beschäftigt war, eine von Margaretes Orchideen zu bestäuben. Wütend brummte das Insekt. Ich aber ließ mich nicht beirren und hielt es in die klaffende Hand meiner Pflanze. Augenblicklich schnappte sie zu. Die Hummel war gefangen. Weil sie aber zu dick war, um ganz drin zu verschwinden, vergitterte die Pflanze den Fluchtweg mit den Borsten am Rand des teuflischen Blattes, während Margarete einen schrillen Schrei ausstieß.
Die Hummel zappelte noch eine Zeitlang und kämpfte erbittert ums Leben. Dann erschlaffte sie und starb.
»Es ist eine Venusfliegenfalle«, sagte ich, »und ernährt sich von Insekten. Jetzt gerade scheidet sie ihre Verdauungssäfte aus, mit der sie die Hummel zersetzt. Danach nimmt sie alles Verwertbare in sich auf, um das zur Falle umgestaltete Blatt wieder zu öffnen und den ungenießbaren Rest hinaus zu stoßen.«
»Ist ja furchtbar! Dass es so was aber auch geben muss! Nur ein Vollidiot kauft sich sowas«, sagte Margie und ging ihrer Wege.
Mir war ihr pfiffiger Gesichtsausdruck aufgefallen. Daraus war zu schließen, dass sie meinem Liebling das Leben zur Hölle machen wollte. Ich nahm mir darum vor, auf den grünen Freund mit Argusaugen aufzupassen.
Kaum zwei Tage war ich im Besitz meiner ersten eigenen Pflanze, der ich wieder eine fette Hummel zuführte, als das Gewächs zu welken begann. Kein Gießen, kein Dünger brachte Besserung.
Am dritten Tag war die Venusfliegenfalle vor dem Eingehen. Voller übler Ahnung tauschte ich das Erdreich aus, in dem sie stand. Als ich dran schnupperte, stach mir ein stechender Geruch in die Nase. Margie hatte da ihre Finger im Spiel gehabt. Doch mit neuem Humus erholte sich das Pflänzlein wieder. Ich setzte es auf Fliegendiät, bis es sich so sehr gekräftigt hatte, dass ich es im Garten auspflanzen konnte, neben der Wand der Garage, wo ich mir einen einzigen Quadratmeter des Gartens angeeignet hatte, einen von über zweihundert, ohne Margie um Erlaubnis zu bitten.
Als ich mich danach in der Küche an den Versuch heranwagte, das zu bratende Fleisch nach ihren Vorschriften zu würfeln, trat sie herzu – sie hatte sich drei Wochen Urlaub genommen – und schlug mir in einem ihrer berüchtigten Wutanfälle ins Gesicht.
In ihrer Hektik hatte sie leider übersehen, dass ich rein zufällig das frisch gewetzte Fleischermesser in Händen hielt und lief unglückseliger Weise hinein. Es blieb ihr mitten in der Brust stecken. Sie tat keinen Mucks, fiel um und war tot, mausetot.
Ich hatte zunächst noch keine Gelegenheit, mich um die Leiche zu kümmern, denn es war an der Zeit, das Radio anzustellen, um die neueste Folge der ›Archers‹ nicht zu verpassen. Es war vergnüglich, wie immer, doch dann holte mich der Ernst des Lebens ein. Ich hatte eine hübsche Leiche in der Küche liegen, das Messer immer noch in der Brust. Kurz dachte ich nach und kam zum Schluss, dass mir die Bobbies das Märchen vom Unfall nicht abnehmen würde. Der gesamten Nachbarschaft war schließlich bekannt, dass wir so idyllisch wie Hund und Katze zusammenlebten und bei uns regelmäßig die Fetzen flogen.
Mein erster Gedanke war, sie im Garten zu verscharren. Doch das könnte sich rächen, wenn eines Tages die Beamten von Scotland Yard mit Hacken und Schaufeln auftauchten, denn Knochen verrotten leider Gottes verdammt langsam.
Dann gedachte ich, sie nachts zur Themse zu schleppen und einfach ins Wasser zu werfen. Doch auch dieses Plänchen könnte in die Hose gehen, wenn man sie dort treiben sähe, herausfischte und erfolgreich als meine Frau identifizierte.
So zog ich ihr erst mal das Messer aus der Brust und machte mich ans Werk. Nach zwei Stunden Schwerstarbeit hatte ich das Fleisch von den Knochen getrennt und vergrub es neben der Garagenwand. Die Knochen schlug ich mit einem Vorschlaghammer kurz und klein, stopfte sie in einen Sack und entleerte ihn im Schutze der Dunkelheit in die sanft vorüberrauschende Themse.
Die nächsten Tage verschlief ich. Es regnete Hunde und Katzen, bevor sich das Wetter allmählich besserte. Als ich am zwölften Tag wieder in Margies Garten trat, wartete eine Überraschung auf mich.
Fast alle ihre Blumen waren nämlich den Unbilden der Witterung zum Opfer gefallen. Meine Pflanze aber war im Schutz der Garagenwand tüchtig emporgewachsen und hatte Ableger gebildet. Die vielen Fangblätter waren schon so groß, dass sie sogar Spatzen zur Strecke bringen konnten. Ja, diese herrliche Venusfliegenfalle war jetzt mein ganzer Stolz.
Zu Beginn der fünften Woche hatte ich Besuch. Die Bobbies waren gekommen, weil man Margie am Arbeitsplatz vermisste. Ich log, sie sei auf Reisen gegangen und hätte nichts mehr von sich hören lassen. Doch man glaubte mir nicht und unterzog den gesamten Garten einer gründlichen Untersuchung.
Als man auch an der Garagenwand zu buddeln begann, fragte ich mich, ob es nicht das Beste wäre, ein Geständnis abzulegen. Aber die Herren fanden zu meiner Überraschung nicht das Geringste.
Meiner Venusfliegenfalle freilich hatten sie schwer zugesetzt, weil ihre inzwischen tief ins Erdreich vorgedrungenen Wurzeln teilweise durchtrennt worden waren. Emsig wässerte und düngte ich meinen erklärten Liebling darum in den nächsten Tagen, aber dennoch welkte er vor sich hin. Kaum noch fand ich Schlaf vor Kummer.
Niedergeschmettert ging ich eines Nachts am Ufer der Themse entlang, als ich einen Dackel erblickte, der sein Gedärm entleerte, mitten auf der Uferpromenade. Mit gekonntem Griff hatte ich den Köter am Wickel, drehte ihm den Kragen um und ließ ihn in einer eigens dafür mitgebrachten Einkaufstasche verschwinden.
Zu Hause angekommen, zog ich ihm das Fell über die Ohren, wie ich es als Hausmann bei den Kaninchen gewohnt war. Dann weidete ich ihn aus und drehte ich ihn durch den elektrischen Superfleischwolf, der sogar in der Lage ist, Knochen zu zermalmen. Ja, ich verarbeitete den Köter zu Hackfleisch und gab ihn dann portionsweise in die Fangblätter meiner Venusfliegenfalle. Zu meiner Freude stand sie bereits am nächsten Tag wieder in Saft und Kraft. Doch die Nahrung war bald aufgebraucht. Ich ging wieder auf die Jagd.
Fünf Hühner, drei Enten, ein Truthahn, ein fetter Metzgerhund sowie ein magerer Dalmatiner samt einem Dutzend Katzen waren meine Beute. Die Venusfliegenfalle überwucherte nun den ganzen Garten, ja, sie drang sogar durch sämtliche Fenster und Türen, die sie aus den Angeln hob, ins Haus ein. Es war ein berauschendes Gefühl, faul im Bett zu liegen und überall vom saftigen Grün des Lieblings umgeben zu sein.
Doch es kam der Tag, an dem die Pflanze keine tierische Nahrung mehr zu sich nehmen wollte. Gewiss erinnerte sie sich ans Fleisch meiner Frau, das sie damals mit den Wurzeln aufgesogen hatte, bis alles aufgebraucht war. Demnach musste ich jetzt auf Menschenjagd gehen, wenn ich ihr das Leben retten wollte.
Zu mitternächtlicher Stunde lauerte ich von nun an den letzten Passanten auf. Mein erstes Opfer war ein süßes Mädchen. Aus dem Versteck heraus hatte ich zugehört, wie sie sich lautstark mit ihrem Freund auseinandersetzte. Obwohl sie eine gut figurierte Zuckerpuppe war, hatte er sie offenbar mit einer anderen betrogen.
Weil sie ihn ›Schwein‹ nannte, ließ er sie stehen, um das Weite zu suchen. Sie war übrigens Schneiderin, rothaarig und sommersprossig. Als ich ihr die Drahtschlinge um den Hals legte und zuzog, blickte sie mich erstaunt an, bevor sie erstickte. Ihr folgten weitere Damen, denn ihr zartes Fleisch schmeckte der Venusfliegenfalle besser als das von Männern. Dies fand ich rasch heraus.
Der Kampf ums Überleben meiner Pflanze wird immer schwieriger, denn ganz London ist im Aufruhr. Die Strandpromenade wimmelt nur so von Polizisten. Man ist fieberhaft auf der Suche nach dem Ungeheuer, das da angeblich die Passanten in den Fluss zerrt, um sie zu fressen. Die Times nennt mich das ›Promenadenphantom‹; der ›DailyMirror‹ das ›Promenadenmonster‹. Seit fünf Tagen bin ich schon ohne Beute, und mein Liebling hungert.
b. Bericht des Oberinspektors Edgar Wallace (Scotland Yard)
Es war der siebzehnte November des Jahres 1957, als ich mit Inspektor Charly Brown, meinem Kollegen, an der Uferpromenade der Themse patrouillierte. Alles war gespenstisch still. Der Mond ließ das dunkle Wasser des Flusses geheimnisvoll blinken.
Ich wollte mir gerade eine Pfeife anzünden, als ein grausiger Schrei die Gegend erschütterte. Er schien von überall her zu kommen, so schrill, wie wenn ein Schwein geschlachtet würde und ebbte dann wellenförmig ab, um einer bedrückenden Stille das Feld zu räumen. Uns beiden lief es eiskalt den Rücken hinunter.
War ein Mord geschehen? Wir spähten in alle Richtungen. Charly deutete schließlich auf ein uraltes Haus, um das herum und über das hinweg die riesigen Blätter einer unbekannten Pflanze wucherten. Vorsichtig näherten wir uns dem verdächtigen Objekt, aber es gab kein Durchkommen. Wir standen vor einer grünen Wand, so fürchterlich zugewuchert war das Gebäude.
Ich ersuchte den Yard um Verstärkung. Man hieß uns geduldig zu sein, denn man könne nicht bei jedem nächtlichen Schrei in Kompaniestärke anrücken. Ich beschrieb den Zustand des gespenstischen Hauses, und man hatte endlich ein Einsehen.
Doch erst bei Morgengrauen trafen meine Kollegen mit Sägen und Äxten ein und bestaunten die seltsame Pflanze. Einer von uns kannte sich in Botanik aus und meinte, wenn das Biest nicht so gigantisch groß wäre, könnte es eine Venusfliegenfalle sein.
Mit diesen Worten schob er einen Besenstiel in eines der aufgeklappten Fangblätter. Krachend schlug es zu und spaltete das Holz in zwei Stücke. Jetzt wussten wir Bescheid und begriffen, dass jeder von uns in Lebensgefahr geriet, wenn er sich einem Fangblatt näherte. Darum gingen wir von nun umsichtig vor und hieben ein jedes dieser Blätter, das wir geschlossen vorfanden – es waren insgesamt fünf – mit unseren Äxten kurz und klein. Im Inneren der jeweiligen Falle entdeckten wir Klumpen stark verdauten Hackfleischs.
Schließlich waren wir bis ins Haus vorgedrungen. Dort sahen wir mit Grausen, dass die Pflanze das gesamte Innere des Gebäudes erobert und sogar massive Wände durchbrochen hatte. Überall hingen hungrig an langen Stielen seine Schlünde.
Wir arbeiteten uns ins Wohnzimmer vor. Unterhalb eines geschlossenen Fangblatts lag ein Paar Hausschlappen. Wir schlugen es ab und zersägten es. Eine halbverdaute männliche Leiche kam zum Vorschein und plumpste zu Boden; unverkennbar der Herr des Hauses, Mr. William M. Shultz, dessen Frau Margie vor über einem Jahr verschwunden war. Auf dem Wohnzimmertisch lag ein Buch mit handgeschriebenen seinen Aufzeichnungen. Es war in feuerrotes Schweinsleder eingebunden.
Bibliographisches Nachwort
Die Kurzgeschichte beruht auf einer makabren Idee der bei Wikipedia leider nicht verzeichnete Autorin (?) Jamie McArdwell. Sie berichtet von einem gefräßigen Efeu; der Titel: ›The Green Umbilical Cord‹. Björn Craig aus Basel stellte Gruselschulz vor einiger Zeit den englischen Text zur Verfügung.
Auch wenn dieser Schulz meint, es sei wenig spektakulär, die Wurzeln eines scheinbar ungefährlichen Efeus mit Leichenteilen zu düngen, fand er die Story im Grunde gar nicht übel und hat das Unheil der Venusfliegenfalle angedichtet und alles neu geschrieben; dennoch: Thank You very much, my dear Björn!
***
2. MontagueSummers: Das Taggespenst
a. Vorbemerkung des Herausgebers
Was Gespenster anbetrifft, stellt sich erstens die Frage, ob es sie überhaupt gibt und zweitens, warum sie, wenn sie wirklich einmal auftreten, immer mitten in der Nacht, genauer genommen in der Geisterstunde zwischen null und ein Uhr ihr Unwesen treiben. Gibt es denn keine unheimlichen Gestalten, die auch einmal am helllichten Tag Angst und Schrecken verbreiten?
Ich selbst schien vor vielen Jahren von einem Taggespenst heimgesucht zu werden, aber weil es gar kein Geist war, blieb mir nur der Schrecken in Erinnerung, der mich fast das Leben gekostet hätte.
Es war am Tage, nachdem wir unseren Nachbarn Heinz Rat zu Grabe getragen hatten, als mich ein Passant mit einem »guten Morgen, der Herr« bedachte. Als ich mich umdrehte, um den Gruß zu erwidern, lächelte mir der Verstorbene ins Gesicht.
Der Schock war so gewaltig, dass ich das Bewusstsein verlor und zu Boden stürzte. Als ich wieder zu mir kam, fand ich mich im Krankenhaus wieder. Der Arzt, den man über die Gründe informiert hatte, erklärte mir, dem immer noch vom Grauen geschüttelten, das sei gar nicht der Tote gewesen. Heinz Rat habe nämlich einen Zwillingsbruder, Fritz Rat, der nicht von ihm zu unterscheiden sei. Diesem sei ich zufällig begegnet.
Seitdem glaubte ich nicht mehr an Gespenster, bis ich eines Tages eines Besseren belehrt wurde, auch wenn Zweifel bleiben. Alles drehte sich wieder einmal um ein altes Haus, typisch!
b. Die Geschichte vom Taggespenst
Mein Name ist Schultze, Willibald Schultze. Ich wurde zu Rostock in der bescheidenen Hütte meiner Eltern und Großeltern geboren und lebte jahrelang dort, bis ich ins Nachbarhaus umsiedelte, eine hoch aufragende uralte Villa.
Seit einiger Zeit war sie leer gestanden, denn kaum war ein Mieter eingezogen, verließ er sie schon wieder, bis überhaupt keiner mehr einzog. Zunächst hatte ich keine Ahnung, warum. Erst als die Frau des verstorbenen Generals Norman von Wellerhoff dort wohnhaft geworden war, erfuhr ich die Gründe. Ich vernahm es von den beiden unter Schock stehenden Töchtern der Generalin, und als ich es erfuhr, war es für die gute alte Lady schon zu spät.
Wellerhoff, in Afghanistan stationiert, war in einen Hinterhalt der Taliban geraten. Nach seinem Tode verließen seine Frau Hilda mit den Töchtern Kabul und kehrten nach Deutschland zurück, um nach einer neuen Bleibe Ausschau zu halten. Da sie schon als Mädchen in Rostock gelebt hatte, beschloss sie, dort für immer zu bleiben.
Zu diesem Zweck suchte sie eine Rostocker Maklerfirma auf, das Büro der Gebrüder Johann & Carlo Schmitt. Nur kurz hatte sie auf dem Plüschsofa verbracht, als sie auch schon ein Amtsdiener in die Kanzlei geleitete. Ein wohlbeleibter Herr ging ihr entgegen und reichte ihr die grübchenreiche rechte Hand:
»Frau Generalin Wellerhoff, wie ich vermute«, sagte er und bot ihr einen Sessel an, auf dem sie Platz nahm.
»Ich bin Carlo Schmitt, Inhaber dieser Firma«, sagte er und lächelte sein freundlichstes Maklerlächeln.
»Womit kann ich dienen?«
»Ich stamme von hier«, sagte die Generalin, »und da mein Mann verstorben ist, suche ich in dieser Stadt ein Haus. Ich hoffe, Sie haben ein Angebot für mich. Die Kosten sind nebensächlich.«
Carlo blickte auf seine Hände hinab, die über der mit grünem Leder bespannten Platte seines Mahagonischreibtisches ruhten, seufzte tief und rief dann den Gehilfen herein.
»Francesco, bringen Sie mir den Ordner ›Häuser von Rostock‹!«
Ehe man sich’s versah, lag eine dicke Mappe vor ihm, auf der in goldenen Lettern ›Rostocker Villen‹ stand. Carlo öffnete sie und blätterte scheinbar ziellos in ihr herum, bis er das Richtige gefunden hatte. Seine Miene hellte sich nämlich auf:
»Ich vermute, das wäre was für Sie«, sagte er und reichte ihr heraus geheftete Blätter, auf denen in Hochglanz die schönsten Farbfotos einer prächtigen Villa prangten.
»Das Haus war vermietet. Seit einem Jahr steht’s leer. Wir haben’s mehrfach angeboten, aber es fand sich kein Interessent. Jetzt soll’s verkauft werden. Der Besitzer wird nämlich in Kürze nach Kanada auswandern. Daher müssen wir’s geradezu verschenken.«
Frau Wellerhoff nahm sich die Anzeige vor, erblickte ein himmlisches Haus, mit Erdgeschoss und zwei oberen Stockwerken und steilem Giebel samt wunderschönen Erkern an jeder Ecke. Anbei befand sich der Text der Annonce mit einem Preis für das prächtige Objekt von lächerlichen 300.000 Euro.
Verblüfft legte sie die Blätter zurück, ohne zu bemerken, wie sehr sie sich schon in das Haus verliebt hatte. Dem Makler aber war ihr Gesichtsausdruck nicht entgangen. Er summte:
»Ein schöneres Haus, meine Dame, kann ihnen niemand bieten, fabelhaft viel Raum für ihre Töchter; ideal für eine Generalin.«
»Aber«, sagte sie, »warum ist es so preiswert? Weshalb hat es bisher noch niemand gekauft?«
»Das werden Sie sehen, wenn wir’s besichtigen«, sagte Schmitt, der den Fisch nicht mehr von der Angel lassen wollte.
»Ich denke, wir machen morgen einen Ortstermin. Mein Chauffeur wird uns hinbringen. Wie wäre es um neun Uhr?«
Frau Wellerhoff nickte ergeben, während ihr Schmitt den Arm anbot und sie würdevoll zur Türe hinauskomplimentierte.
Anderen Tages fuhr man nach Warnemünde. Die herbstliche Landschaft leuchtete, aber während Frau Wellerhoff und ihre Töchter entzückt zum Fenster hinaussahen, brütete Schmitt über den Akten und fand keine Zeit für derartig unwichtige Dinge, bis man schließlich Straße und Haus erreicht hatte.
Inmitten schmucker Gebäude stand ein altes Gemäuer, dessen vordere Front von Efeu überzogen war. Wie leere Augenhöhlen starrten die Fenster auf die Besucherinnen hinab. Die früher grün gestrichenen Flügel des Tores, durch das wohl einst die hochherrschaftlichen Kutschen eingefahren waren, hingen schief in den Angeln, kurz: Das Haus war im Zustand der Verwahrlosung, auch wenn oben die Erker sich kühn über das Schlinggewächs erhoben.
»Ich weiß, was Sie denken«, sagte Schmitt, »aber bevor Sie dem Objekt den Rücken kehren, sollten sie es auf eine Besichtigung ankommen lassen. Es wird sich lohnen.«
Dazu setzte er sein jovialstes Lächeln auf, sprang aus erster aus dem Auto und hielt den Damen die Türen auf. Eine nach der anderen stiegen sie auf seinen Arm gestützt aus und sahen kopfschüttelnd auf die uralte Villa.
Der Makler stieß die Flügel des Tores auseinander. Quietschend und knarrend bewegten sie sich auf verrosteten Angeln. Dann führte er die Damen über unkrautumwachsene Pflastersteine zur wurmstichigen Haustür. Er hatte einen rostigen Schlüssel mitgebracht und öffnete sie nach wiederholten Versuchen.
Man befand sich nun in einer gewölbten Halle, die man mit Hilfe eines Kamins beheizen konnte, der von grün-goldenen Kacheln umsäumt war. Doch die Tapete hing in Fetzen von den Wänden. Die spitzbogigen Fenster waren in Nischen der Außenwand eingelassen, sodass man links und rechts auf einer Bank Platz nehmen und ungesehen dem Treiben auf der Gasse zusehen konnte, durch einen Vorhang von innen her unsichtbar gemacht. Möbel gab’s keine:
»Dahinter ist die Küche«, sagte Schmitt, »eine Prachtküche.«
Sie gingen durch ein gotisches Portal in den nach hinten liegenden Raum, der vor Schmutz und Staub starrte.
»Keine Sorge, Madame«, sagte der Makler, »alles ist in bester Ordnung. Man müsste nur mal gründlich putzen.«
Dann führte er sie zum Treppenhaus, einer Freitreppe mit Stufen von Buchenholz, die in gusseisernen Stützen verankert waren. Zu dritt nebeneinander schritten sie hinauf ins erste Obergeschoss, wo sie eine vergleichbare Verwahrlosung empfing. Der Blick über rote Dächer und hinaus auf die See entschädigte dafür.
»Hier können Sie leben wie Gott in Frankreich«, sagte er, »jede von Ihnen hätte ein großes eigenes Zimmer. Hinzu kommt noch ein Wohnzimmer, das Sie gesehen haben müssen.«
Während die Schlafzimmer nur mit einer Holzdecke versehen waren, zeigte sich das Wohnzimmer als ein gewölbter Raum mit feiner, aber reparaturbedürftiger Stuckdecke. Der Kamin durfte in keinem der zahlreichen Zimmer fehlen.
»Nun hinauf ins Reich der Dienstboten«, rief Schmitt betont fröhlich, und man stieg einer nach dem anderen eine steile Treppe hinauf ins Wolkenkuckucksheim. Kammern samt Erkern empfingen sie. Die Mädchen klatschten vor Freude in die Hände und sagten, dass sie ihr Zuhause am liebsten dort oben beziehen wollten.
Carlo lächelte angesichts des gewonnenen Spieles, obwohl ihm das sorgenzerfurchte Gesicht der Generalin nicht entgangen war.
»Meine Liebste«, rief er, »wo könnten Sie ein schöneres Daheim kaufen als dieses hier? Sobald neue Tapeten und Fußböden angebracht sind, und das Gebäude auch außen überholt ist, müssen Sie hier glücklich werden.«
Dennoch erbat sich Frau Wellerhoff noch das Gutachten eines Architekten. Als sie es in Händen hielt, war ihr Entschluss, das kleine Schloss zu kaufen, so gut wie sicher. Ihr eigener Makler riet ihr allerdings, den Preis noch ein um 50.000 herunter zu handeln. Zu ihrer Überraschung ging Schmitt darauf ein. Schon in den nächsten Wochen tobten sich die Handwerker im alten Gebäude aus.
Schließlich zog sie samt Töchtern sowie den aus Kabul mitgebrachten Möbeln ein. Es blieb nur ein letztes Problem. Die Putzfrau war plötzlich krank geworden, und eine Aushilfe ließ sich so rasch nicht finden. Daher fuhr die Lady mit dem ersten Morgenzug nach Rostock, um eine Arbeitsvermittlung aufzusuchen und einige Besorgungen in der Stadt zu machen.
›Alice‹ und ›Mary‹, wie ihre Töchter unbedingt genannt werden wollten, blieben daheim und durchstöberten das Haus.
Es mochte gegen zwölf Uhr sein, als sie auf der großen Treppe einem Mädchen begegneten, das barfuß daher kam. Sie war in ein kurzärmeliges zerlumptes rosa Kleidchen gehüllt war, das ihr kaum übers Gesäß reichte und prächtige Schenkel enthüllte. Das blonde Haar ringelte sich fettig über ihre Schultern. Sie war von oben bis unten mit Schmutz besudelt, als ob sie sich tagelang nicht gewaschen hätte. Ihr entströmte ein stechender Körpergeruch.
Ohne die beiden zu beachten, kehrte sie Stufe für Stufe den Staub auf eine Schaufel aus Blech und schüttete ihn dann in einen rostigen Eimer. Wenn sie sich dabei bückte, rutschte das Kleid weit, weit nach oben und legte einen schwarzen Schlüpfer frei.
»Ist das die neue Küchenhilfe, von der Mama sprach«, flüsterte Alice, während es ihr eiskalt über den Rücken lief.
»Gewiss! Wer sonst soll’s sein«, antwortete Mary unsicher.
Die scheinbare Aushilfsangestellte warf nur einen flüchtigen Blick auf die beiden und setzte ihre Tätigkeit fort.
»Mutter muss verrückt sein«, sagte Mary mit dem Ausdruck des Ekels auf dem Gesicht, »eine derart schmutzige Schlampe eingestellt zu haben. Was sollen die Nachbarn von uns denken, wenn sie an der Türe läuten, unser guter alter James gerade im Dachgeschoss zu tun hat und ihnen dann dieses widerliche Biestöffnet? Wenn Mutter zurück ist, werde ich von ihr verlangen, dass sie das Dreckstück feuert. Aber eine gute Figur hat sie, das muss der Neid ihr lassen. Man müsste sie eine Stunde lang in die Wanne stecken.«
Alice nickte grimmig, ohne dass sie das Mädchen auch nur eines Blickes gewürdigt hätte. Der Abend kam, es wurde finster, und Mutter war immer noch nicht zurück. Kaum aber war die Nacht hereingebrochen, da war die stumme Haushaltshilfe wie vom Erdboden verschluckt.
Kurz darauf rief man die Mädchen aus dem Rostocker Krankenhaus an, wo die Mama nach einem Sturz im Treppenhaus eingeliefert worden war. Sie müsse unter Beobachtung bleiben. Wahrscheinlich könne sie sie bereits am übernächsten Morgen nach Hause fahren. Die Mädchen beruhigten sich und suchten nach der Haushaltshilfe. Als sie nirgendwo zu sehen war, sagte Alice:
»Die dumme, dumme Ziege ist, als es Abend wurde, nach Hause gerannt statt hier ihre Kammer zu beziehen. Sie sieht aus, als wäre sie nicht ganz bei Trost, auch wenn ich sie um ihre Figur beneide. Vielleicht ist sie ja taubstumm, denn sie sagt nichts«, meinte sie wütend und beschloss, am Morgen mit ihr ein paar Worte zu wechseln.
»Wenn sie sich nicht fügt«, sagte sie zornig, »muss sie gehen.«
Von all dem hatte ich, ihr Nachbar, natürlich nicht die geringste Ahnung und erfuhr alles erst mit Verspätung. Also machte ich mich am nächsten Morgen auf die Socken, um den Damen meinen Antrittsbesuch abzustatten. Gegen zwölf Uhr klopfte ich an ihre Tür.
Butler James öffnete und sah mich fragend an; ich sagte:
»Guten Morgen! Mein Name ist Schultze. Ich wohne nebenan und wollte Sie begrüßen. Ich hoffe, ich störe nicht.«
»Kommen Sie herein in die gute Stube«, sagte James, »die Damen werden sich freuen. Die Lady ist leider nicht zu Hause. Man hat uns gedrahtet, sie werde frühestens morgen nach Hause kommen. Darf ich Ihnen einen Tee anbieten?«
»Gewiss; gerne«, sagte ich, doch jedes weitere Wort blieb mir im Halse stecken, als ich dicht hinter dem so korrekt gekleideten und nach einem herben Parfüm duftenden Butler diese schmutzige Küchenhilfe erblickte. Das rosa Kleidchen war mit Dreck besudelt. Die verschmierte Schürze zerschlissen und zerrissen. Unter der löchrigen Haube quoll in Strähnen rotes verfilztes Haar hervor.
Gewiss blickte ich geschockt aus der Wäsche. Das fremde Mädchen muss es bemerkt haben, denn sie grinste mit schiefem Maul und war augenblicklich durch die hintere Tür der Halle gehuscht und im Bereich der Küche verschwunden, aus der heraus schon kurz zuvor das Klappern von Tellern und Tassen erklungen war.
Die Köchin bereitete gerade das Mittagsmahl zu und musste das Mädchen gesehen haben. James freilich hatte von all dem nichts bemerkt, wunderte sich nur über meinen seltsamen Gesichtsausdruck und fragte, ob mir nicht wohl sei. Ich verneinte.
Dann ließ er mich an der Tafel Platz nehmen und rief die Damen herein, mit denen ich mich über Gott und die Welt unterhielt, insbesondere über ihre Erlebnisse in Afghanistan und die Reise nach Hause. Das schmutzige Mädchen wagte ich nicht zu erwähnen, und die beiden jungen Frauen nannten sie mit keinem Wort. Erheitert verließ ich meine lieben neuen Nachbarn.
Am Sonntag fuhr ich mit ihnen zusammen zur Kirche. James sollte daheimbleiben und das Haus hüten. Die Köchin, Frau Elfi Obermaier, wollte uns etwas später folgen. Zuerst müsse sie noch nach der Warmwasseranlage sehen. Sie ging dazu vom Dachgeschoss Richtung Heizungskeller hinunter. Gerade hatte sie das Erdgeschoss erreicht, als sie dort jemanden geschäftig hin und her laufen hörte. Sonst war alles gespenstisch still. Wer konnte das sein? Sie rief:
»James! Sind Sie das im Keller?«
Niemand antwortete; dann das samtene Geräusch von Tritten auf der Kellertreppe, die jäh in die Küche hinaufführte. Frau Obermaier blieb erstarrt auf der breiten Stiege stehen und lauschte angespannt: Rasseln und Klappern aus der rückwärtigen Küche. Jemand rumorte in ihrem ureigenen Reich!
Wütend sprang sie die restlichen Stufen hinunter, rannte durch die Halle und riss die Küchentüre auf, um den Eindringling auf frischer Tat zu ertappen, sah aber nur das Mädchen dort, die vermeintliche Aushilfsputzfrau, wie sie mit Tellern und Tassen hantierte.
»Was hast du hier zu suchen«, rief Efi empört.
Das Mädchen drehte sich nervenzerreißend langsam um. Ein hässliches Grinsen breitete sich auf seinem weißen Gesicht aus. Sie sagte überhaupt nichts. Sie entschuldigte sich nicht ob ihres unerlaubten Eindringens. Sie huschte in die Speisekammer, die nur diesen einzigen Eingang und keinen Ausgang besaß. Wutschnaubend folgte ihr Elfi, um sie in der Falle, in die sie gegangen war, zu stellen. Doch als sie die Tür aufriss und hinein starrte, fand sie den Raum leer vor. Nur der Geruch verfaulenden Fleisches lag drin, als ob sich die Maden über den Sonntagsbraten hergemacht hätten.
Vom Grausen gepackt rannte sie durch die stille Halle, zurück zur Treppe und sprang nach oben. Schon erreichte sie den mittleren Absatz, wo ein gotisches Fenster Licht spendete, und da! Draußen vor der Glasscheibe erschien leichenhaft das breit grinsende Gesicht der Putzhilfe; Scheitel nach unten, Hals nach oben; ein mit Lederhaut überspannter Totenschädel.
Kreischend rannte Elfi die Treppe wieder hinunter und stürzte auf die Gasse, wo sie ohnmächtig zusammenbrach.
Wilhelm, mein Butler, fand sie dort leblos liegen, hob sie auf und brachte sie in unser Haus, wo sie wieder zu sich kam. Totenbleich war sie und berichtete stammelnd von ihrem Erlebnis. Hände und Füße aber konnte sie nicht mehr bewegen. Der Schlag hatte sie getroffen, und sie starb wenige Tage später in unserem städtischen Hospital. Der Schock hatte sie hinweggerafft.
Wilhelm erzählte mir dann, als ich vom Kirchgang zurückkam, was man ihm vor geraumer Zeit berichtet hatte. Dass es in alten Häusern unheimlich zugeht, war mir zwar bekannt, aber alle Geister, von denen ich jemals gehört hatte, waren um Mitternacht unterwegs gewesen. Dass es auch Taggespenster gibt, wollte ich nicht glauben. So schwieg ich denn. Gewiss hatte sich die Alte das alles nur eingebildet, dachte ich und ließ dem Verhängnis seinen Lauf.
Gegen Abend kam die Lady nach Warnemünde zurück; mit ihr eine dicke Frau, die sich als neue Putzhilfe herausstellte und Margarete Grüner nannte. Als die Generalin sie ihren Töchtern vorstellte, staunten diese nicht schlecht, weil man bisher geglaubt hatte, das scheue Mädchen im rosa Minikleid sei die gesuchte Aushilfe. Doch als man sich nach ihr umblickte, war sie verschwunden. Wie üblich, war sie mit Einbruch der Dämmerung gegangen. Jetzt wusste die gesamte Familie, dass sie hier nichts zu suchen hatte.
»James«, sagte die Frau Wellerhoff, »wenn sich das freche Mädchen wieder blicken lässt, halten Sie sie fest, damit wir sie der Polizei übergeben können.«
Der Butler nickte, obwohl er die Hübsche in rosa Kleidchen noch nicht gesehen hatte. Er hielt alles nur für einen Schabernack, den sich Alice und Mary ausgedacht hatten. Damit schien er recht zu behalten, denn obwohl man Tag für Tag nach der unverschämten Person Ausschau hielt, ließ sie sich nicht mehr blicken. Indem die Mädchen nun täglich im Bikini am Strand flanierten, um den Männern zu imponieren, vergaßen sie den Zwischenfall ganz und gar.
Schließlich kamen die trüben Tage des Novembers, an denen James die Kamine zum Glühen brachte. Dennoch jagten eisigen Winde von der See her übers Land und trieben den drei Damen einen Schauer nach dem anderen über den Rücken. Die huschenden Schatten im abendlichen Zwielicht verbreiteten eine seltsame Stimmung im uralten Haus an der Küste.
Von melancholischen Gefühlen ergriffen, erhoben sich die Generalin und ihre beiden Töchter eines Tages vom Mittagsmahl an der großen Tafel inmitten der gewölbten Halle. Die Mädchen blieben unschlüssig unten stehen, während die Lady über die Stufen der prächtigen Treppe hinaufstieg, um sich ein Verdauungsschläfchen zu gönnen. Schon hatte sie den mittleren Absatz erreicht, da schrie Alice von unten zu ihr hinauf:
»Mama! Sie ist wieder da. Sie steht oben vor der Treppe. James, kommen Sie doch und helfen Sie uns, das Biest festzuhalten!«
Doch James konnte nicht kommen, denn ihm war das Mädchen bereits zuvor auf der Kellertreppe begegnet. Es war barfuß, wie immer, gewesen, steckte trotz der Jahreszeit im rosa Minikleid und starrte vor Schmutz. Als er sie greifen wollte, war er mitten durch sie hindurch geschritten. Vor Schreck war er die Stiege hinuntergestürzt und hatte sich den Knöchel gebrochen.
Also warf sich Frau Wellerhoff selber auf das schmutzige stinkende und dennoch bezaubernde Wesen und wollte sie packen. Ihre beiden Töchter sahen von unten, wie ihre Mutter mitten durch die luftige Gestalt hindurchgriff und dann mit einem gellenden Schrei die volle Länge der Treppe hinunterstürzte.
Nachdem sie sich mehrfach überschlagen hatte, kam sie vor den Füßen der Töchter mit gebrochenem Genick zum Liegen. Scheußlich war der Anblick des scheinbar schief auf dem Rumpf sitzenden Kopfes. Alice und Mary rannten kreischend auf die Gasse und stürmten geradewegs in mein Heim gegenüber.
Was sie mir erzählten, klang zu grausig um wahr zu sein. Ich ließ sie in der Obhut meiner Frau zurück und ging mit meinem Diener hinüber, um zu sehen, was zu tun sei.
Wir fanden die Lady tot vor der Treppe. Eine rötliche Pfütze hatte sich um ihren Kopf ausgebreitet. Dem verletzten Butler James halfen wir aus dem Keller nach oben.
Als ich ihn fragte, warum er die Treppe hinuntergefallen sei, gab er mürrisch zur Antwort, er sei eben ausgerutscht und gestürzt. Ein ungewisser Schatten hätte ihn erschreckt. Doch das sei gewiss nur Einbildung gewesen, ein Trugbild im trüben Licht des Kellers.
Wir brachten ihn ins Krankenhaus. Zurückgekommen, vernahm ich die Geschichte aus dem Munde der beiden Mädchen. Immer aber, wenn ich Genaueres wissen wollte, widersprachen sie einander, bis schließlich beide behaupteten, die düsteren Schatten des Novembers müssten sie genarrt haben.
Ein Verwandter nahm sich der beiden an. Ich luchste ihnen das Gemäuer zum halben Preis ab. Kurz darauf veräußerte ich meine eigene Hütte fürs Doppelte und zog ins benachbarte Schloss. Dort wohne ich noch immer, denn es wird nicht mehr heimgesucht.
Kaum nämlich hatte ich es erstanden, als ich mich schon mit etlichen Maurern auf die Suche machte. Überall klopften wir die Wände ab, bis wir schließlich im tiefsten Keller fündig wurden. Der dumpfe Klang ließ auf einen Hohlraum schließen.
Wir brachen die Wand auf und fanden eine angekettete mumifizierte Tote. Es war ein Mädchen von vielleicht Achtzehn, an dem in Fetzen ein rosa Kleidchen hing. Der Körper war eingetrocknet und verhutzelt, aber nicht verwest. Ein scheues Grinsen stand ihr im Gesicht. Irgendjemand hatte dem armen Ding vor hundert Jahren das Genick gebrochen und die Leiche dann eingemauert.
Ich sorgte für die Bestattung. Pastor Robert Braun hielt eine rührende Leichenrede auf die Unbekannte. Anschließend ließ ich das Grab mit Marmor einfassen und stellte eine Sitzbank drauf.
Im Sommer blühen dort nun die Rosen, rosa Rosen, und die Kinder unserer Stadt, die manchmal, wenn sie es eilig haben, über den Kirchhof abkürzen, erzählen steif und fest, dort auf der Bank ein schönes Mädchen im rosa Kleidchen gesehen zu haben, das ihnen freundlich zuwinkte. Immer aber, wenn man sich näherte, habe man sehen können, dass es nur die Rosen waren, die sich sanft im warmen Hauch des Sommerwindes wiegten.
Nachwort des Nachbarn und Erzählers
Naturgemäß habe ich Nachforschungen angestellt und begab mich dazu ins städtische Archiv, um etwas über den Bauherrn des kleinen Schlosses herauszufinden. Doch all meine Bemühungen verliefen im Sande, denn die entsprechenden Seiten des Grundbuches waren herausgetrennt.
Als ich dann im Verzeichnis der Einwohner unter der entsprechenden Hausnummer nachsah, erging es mir nicht besser. Nur so viel steht fest: Ab dem zweiten Besitzer hatte es niemand lange in diesem Gebäude ausgehalten. Schließlich stand es so lange leer, bis es dem Enkel des letzten Bewohners gelang, die Villa über die Kanzlei der Gebrüder Johann & Carlo Schmitt an Generalin Wellerhoff zu verscherbeln. Das ist alles. Das Geheimnis blieb ein Geheimnis.
Bibliografisches Nachwort
Der britische Geistliche Montague Summers (1880-1948) liebte einerseits das Theater, andererseits die Welt des Unheimlichen. Über Letzteres publiziert er mehrfach im Magazin ›Everybody’s Weekly‹. In seinem Todesjahr erschien dort (Ausgabe vom 3. Januar) als kurze Gespenstergeschichte sein ›The Between Maid‹. In dieser ›Aushilfsmagd‹ wird zunächst darüber gehandelt, ob Geister nur nachts anzutreffen seien.
Er widerspricht dem entschieden und meint, Erscheinungen am helllichten Tage gäbe es. Sie könnten erschreckender sein als die nächtlichen. Dazu führt er die oben genannte ›Aushilfsmagd‹ an, die nur vier Textseiten umfasst.
Summers gehört nicht mehr der glückhaften Epoche unter Queen Victoria an sondern hat das Grauen der Weltkriege miterlebt. Vielleicht formte ihn das mehr, als er selber glaubte, denn auf den Schlachtfeldern waren die ›Taggespenster‹ allgegenwärtig.
Michael Siefener hat die Story wiederentdeckt. Die Herausgeber der ARCANA (G. Lindenstruth & R. Bloch) haben sein Vorwort und die Übertragung in ARCANA 18, 2004, S. 54-60 abgedruckt.
Gruselschulz hat die Skizze mit Genuss gelesen und obige Novelle daraus geformt, die nur wenige gemeinsame Punkte mit dem Original aufweist. Ohne die Vorlage von Mr. Summers sowie der obigen Übersetzung wäre sie freilich nicht zustande gekommen: Thank you very much, Mr. Summers and Mr. Siefener!
***
3. Lord Dunsay: Der Gang nach Lingham
[Vorbemerkung des Übersetzers: Der extrem grobeText des Originals wurde sprachlich nicht geschönt. Der Erzähler hat einen in der Krone. Ursprüngliche Absätze sind beibehalten.]
»Da gibt es sowas wie eine Vorstellung, ich könnte keine Geschichte erzählen, ohne irgendeine Art von Drink intus zu haben«, sagte Jorkens, »und ich habe nicht die geringste Ahnung, weshalb dergleichen Vorstellungen umgehen; diesen Nachmittag kam mir gerade eine Geschichte in den Kopf, falls du eine aktuelle Erfahrung eine Geschichte nennen willst. Sie ist ein Bisschen abwegig, und wenn du drauf aus bist, sie zu hören, will ich sie dir erzählen. Aber ich kann dir versichern, dass ein Drink dazu absolut unnötig ist.«
»Oh, ich weiß«, sagte ich.
»Alles, was ich wissen will«, sagte Jorkens, »ist, wenn du’s weitergibst, dass du’s in so einer Weise erzählst, dass die Leute dir glauben. Da gab’s nämlich Leute, ich will nicht viel drüber sagen, aber da gab’s Leute, die haben solche Erzählungen, wie ich sie dir erzählt habe, als reine Erfindung abgetan. Ein Mann verglich mich sogar mit Münchhausen. Es sollte wohl schmeichelhaft für mich sein, aber er machte den Vergleich:
Schmerzlich für mich und schmerzlich, sollte ich denken, für deinen Verleger. Es ist die Art, wie du solche Erzählungen erzählst. Sie waren wahr genug, jede von ihnen; aber es war die Art, wie du sie erzähltest, dass irgendwie solche Zweifel aufkamen. Du wirst in Zukunft besser drauf achtgeben, nicht wahr?«
»Ja«, sage ich, »ich will’s mir merken.«
Und damit begann er mit seiner Geschichte.
»Ja, es ist ganz gewiss abwegig, ganz gewiss! Und ich stelle mir vor, du wirst es mir in dieser Darstellung nicht glauben. Andererseits hätte doch jedermann, der jemals die Geschichte irgendeines Erlebnisses, das er gehabt hatte, erzählte, das langweiligste und alltäglichste ausgewählt, damit man’s ihm auch abnimmt: die Darstellung einer Eisenbahnfahrt, sagen wir von Penge nach Victoria Station. Auf sowas sind wir nicht verfallen; drauf kannst du dich verlassen.«
[Penge ist ein Stadtteil Groß-Londons sdl. der Themse, sdl. von Sydenham. Sein Bahnhof liegt ca. 10 km. Luftlinie südöstlich von Viktoria Station. Dieser Bahnhof findet sich am Nordrand von Chelsea, knapp einen Kilometer ndl. der Themse und außerdem rund drei Meilen (ca. 5 km.) südwestlich von Kensington. Vielleicht fand unser Klub-Treffen dort im ›Bahnhofshotel‹ statt.]
»Nein, nein«, sagte ich.
»Sehr gut«, sagte Jorkens.
Ein paar weitere Klubmitglieder setzten sich dann neben uns, und Jorkens sagte:
»Ich kann mich dran erinnern, als wär’s gestern gewesen, an eine lange Straße im Osten Englands, gesäumt von Pappeln. Drei Meilen lang muss sie gewesen sein, und Pappeln standen beiderseits der Straße, den ganzen Weg entlang; unmittelbar dahinter flaches Moorland: Man hatte Gräben durch die Moore gezogen, aber sumpfige Flecken waren noch geblieben. Hier und da links und rechts der Gräben schwankte noch das Röhricht, einer Armee gleichend, die gegen die Menschen mit üblem Erfolg gefochten hat, zerstreut, aber noch nicht vernichtet; und sie hatten sich nicht mit dem Entwässern der Moore zufriedengegeben, denn sie hatten begonnen, die Pappeln zu fällen. Das war’s, wobei sie waren, als ich die Straße erstmals sah, mit ihren zwei geraden Reihen von Pappeln wie grüne und silberne Federn über die Ebene erstreckt, und ich muss sagen, sie fällten sie hübsch. Sie ließen sie quer über die Straße stürzen, weil es das leichter machte, sie auf die Karren zu hieven, und das Verkehrsaufkommen, welches sie damit unterbrachen, war es nicht wert, sich drüber Gedanken zu machen. Auf jeden Fall konnten sie’s drei Meilen weit auf sich zukommen sehen, in beiden Richtungen, falls überhaupt jemals jemand kam, ausgenommen das Ding, von dem ich erzählen will. Also gut, sie sägten einen Baum um, der zwischen zwei andere auf die Straße fallen sollte, ein Durcheinander ihrer Zweige verursachend, und da war gerade noch genug Platz, es zu tun, mit kaum zwei Fuß Zwischenraum. Und sie machten es so hübsch, dass nicht ein Blatt das andere berührte: Gewaltig anzusehen, kam er zwischen den beiden anderen Bäumen herunter, und all die kleinen Blätter, die auf ihn zeigten, schwankten und flatterten ängstlich, als er mit diesem seinem letzten Atemzug hinter sie stürzte. Das war so hübsch vonstattengegangen, dass ich meinen Hut zog und beifällig jubelte. Ein jeder dürfte so gehandelt haben. Man bricht aber nicht in Jubel aus über das, was am Boden liegt, wenigstens nicht in aller Öffentlichkeit. Doch man hört ja nicht für immer auf zu denken, und es dauerte vielleicht fünf Minuten, bis ich mich über diesen Schrei des Triumphes zu schämen anfing, welcher sein Echo über der dem Untergang geweihten Allee erschallen ließ.
Es war der letzte Baum, den sie an diesem Tag fällten, und rasch machte ich mich allein auf den Rückweg zum Dorf Lingham, wo die nächsten menschlichen Behausungen standen, drei Meilen übers Moorland entfernt, und die Abenddämmerung begann damit, die Pappeln verschwimmen zu lassen. Die Holzfäller mit ihren Karren nahmen den Weg in die andere Richtung. Ihre lauten hellen Stimmen, wenn sie redeten und ihre Zurufe an die Pferde ebbten bald ab und gerieten außer Hörweite. Und dann herrschte Stille, unterbrochen nur vom Geräusch meiner Schritte und vom schwächsten Geräusch, das da hinter mir wisperte; ich hielt es für das Geräusch des Windes in den Wipfeln der Pappeln, doch es wehte kein Wind.
»Ich bin mir sicher, das haben wir nicht«, sagte ich und gab dem Kellner ein Zeichen, denn zweifellos ruhte in Jorkens’ Gedächtnis irgendetwas, das ihn auch jetzt noch erschütterte. Als er dann wieder ganz bei sich war, dankte er mir fürs Erste, ganz der gute alte Kumpel, der er war, und dann nahm er den Faden der Erzählung wieder auf:
»Ich hatte noch keine vierhundert Yards hinter mich gebracht, als es mir mit grausiger Gewissheit klar wurde, dass das Ding, welches da hinter mir her war, nichts Menschliches an sich hatte. Der davon ausgehende Schock war womöglich noch übler als die ursprüngliche Erkenntnis, dass ich verfolgt wurde. Es bestand nun nicht mehr der geringste Zweifel daran, dass mir jemand folgte: Ich konnte die abgemessenen Schritte hören; aber das waren keine eines Menschen, und – wisst ihr – wenn ich über die Felder blickte, war alles menschenleer, flach, eben und sumpfig; da hatte ich das Gefühl – man kriegt es ziemlich leicht, wenn man so einsam ist, wie ich es war – dass das da, falls da irgendetwas war, was gegen den Mensch hatte, und dass dann ich derjenige war, den seine Wut zu Fall bringen musste. Und je mehr das verblassende Licht des Abends alles düster und geheimnisvoll erscheinen ließ, desto heftiger überkam mich dieses Gefühl. Ich denke, ich könnte sagen, ich hielt mich zauberhaft gut, indem ich tapfer ausschritt, während diese Schritte da hinter mir lauter wurden. Nur mich umzuschauen, traute ich mich nicht. Ich hatte Angst davor zu wissen, was mir folgte; das gebe ich offen zu. Ich hatte gesteigerte Furcht davor zu wissen, dass es nichts Menschliches an sich hatte. Doch ich blieb verstockt beim festen Vorsatz, meiner Furcht nicht Tür und Tor zu öffnen, einmal abgesehen davon, dass ich mich nicht umblickte. Es war aber nicht die Erinnerung an irgendetwas, von dem ich euch bislang berichtet habe, dass es meine Kehle gerade eben austrocknete …«
Jorkens brach ab und nahm noch einen tiefen Schluck. In der Tat, er leerte seinen Humpen:
»Ein grausiger Schreck stand mir noch bevor, eine verfluchte Furcht, die mich dann dermaßen schüttelte, dass ich fast auf die Straße gestürzt wäre, und dass es mir manchmal auch jetzt noch eiskalt den Buckel runter läuft und mich oft des Nachts heimsucht. Wir alle, wie ihr wisst, wir alle sind so stolz auf das königliche Reich der Lebewesen und dermaßen vollständig damit beschäftigt, dass uns jeder beliebige Angriff von außerhalb seiner in Verblüffung stürzt und nach Luft schnappen lässt; und genau das war bei mir so, als ich begriff, dass das, was da hinter mir her war, gewiss kein Lebewesen war. Ich hörte das ›Stampf-Stampf-Stampf‹ der Schritte und ein gewisses zögerliches Zischen, aber niemals Atemgeräusche. Die ganze Zeit über hätte ich mich umblicken sollen, aber ich wagte es nicht. Die harten schweren Schritte hatten nichts Weiches, nichts von Fleisch und Blut an sich. Tatzen waren es nicht und auch keine Hufe. Und sie waren jetzt so nah herangekommen, dass man das Geräusch tiefen Atmens hätte hören müssen, wäre es nur irgendein Lebewesen gewesen. Und in solchen Augenblicken ist es ein geistiges Erkennen, eine Intuition, ein inneres Fühlen, welche uns leiten und lenken. Nennt es, wie ihr wollt. Sie sagten mir glasklar, dass das Ding keiner von uns war, nichts Sanftes, kein Sterblicher! Nichts dergleichen war es; nichts war es.
Jene Augenblicke, in denen ich mich entscheiden wollte, mich umzublicken, währen ich mit gleich festen Schritten weiter ging, waren die grausigsten meines Lebens. Ich konnte meinen Kopf nicht drehen. Und dann blieb ich stehen und drehte mich mit dem ganzen Körper um. Ich weiß nicht, warum ich es auf diese Weise tat. Vielleicht lag da ja ein gewisses Maß an Kühnheit in der Bewegung, welche mir irgendwie wieder die Herrschaft über mich selbst verlieh, was mich nunmehr vor der Panik bewahrte, und die wäre ganz gewiss mein Ende gewesen. Wäre ich davongerannt, wäre ich erledigt gewesen. Ich drehte mich rechts herum und wieder zurück. Ich sah, was hinter mir war.
Ich hatte euch erzählt, wie ich gejubelt hatte, als die Pappel fiel. Ich stand ja ganz in ihrer Nähe. Und die Männer waren seit Wochen am Pappelfällen. Ich erinnerte mich noch an das Aussehen des Baums, bei dem ich stand und jubelte; konnte mir das Muster seiner Zweige merken. Und ich erkannte ihn jetzt wieder. Er war genau in der Mitte der Straße. Eine Wurzel war nach oben gerichtet. Erdklumpen klebten dran, und er stampfte hinter mir her, die Straße runter nach Lingham.
Denkt mal bloß nicht wegen irgend so einer Art von Ruhe, welche ich ausstrahle, wenn ich euch das alles erzähle, dass ich damals ruhig war! Wenn ich sagte, ich wäre lediglich von grenzenloser Furcht gefoltert gewesen, hieße das, euch die reinste Lüge erzählen. Eine einzige Sache allein ließ mich meinen erschütterten Sinn unter Kontrolle behalten, und das war, dass man nicht rennen durfte. Alte Geschichten kamen in mir auf, Geschichten von Männern, die von Löwen verfolgt wurden. Und mein Sinn war fähig, ihre Lehre zu befolgen, zu handeln, wie sie er lehrten: Renne niemals! Es war der letzte Funke Weisheit, der noch in meinem armen Hirn verblieben war.
Naturgemäß versuchte ich, meine Schritte unmerklich zu beschleunigen. Ob ich damit Erfolg hatte oder nicht, weiß ich nicht. Der Baum war entsetzlich dicht hinter mir. Ich drehte mich nicht mehr um, aber ich wusste, was Sache war, wusste es aufgrund des Geräusches seiner entsetzlichen Schritte, wenn er die Füße wie eine Krabbe anhob, um dann grauenvoll wie ein Elefant aufzustampfen, und ich wusste vom Blick auf die Blätter, dass die Zweige allesamt nach hinten hingen, während er hinter mir hereilte: Und ich rannte nicht!
Und die anderen Bäume schienen mich zu beobachten: Da war nicht diese Aura des Unnahbaren, wenn leblose Dinge, so sie wirklich seelenlos sind, auf uns einwirken. In weiter Ferne lag da der Respekt, welchen man dem Menschen zollt. Ich war grässlich alleine, der Wut all dieser Pappeln ausgesetzt, und denkt dran: Ich hatte niemals eine von ihnen gefällt.
Meine Knie waren nicht so schwach, um nicht zu rennen. Ich hätte es tun können: Es war nur mein guter Instinkt, der mich davon abhielt, letzter wirksamer Rest meines Verstandes, der mir noch geblieben war. Ich wusste, dass ich, sollte ich rennen, der gewaltigen Verfolgung durch den Baum hilflos ausgesetzt wäre. Es ist nur vernünftig, wenn man es mit Verstand betrachtet, wie auch jeder von euch, der hier sitzt, das kann, dass etwas, welches hinter dir her ist, was immer es sei, gewiss nicht die Absicht hat, dich ungeschoren davon kommen zu lassen; und je mehr du versuchst, ihm zu entkommen, in desto größere Wut bringst du es. Und dann waren ja noch die anderen: Ich wusste nicht, was sie zu tun beabsichtigten. Bislang waren sie nur aufmerksame Beobachter, aber ich war so grausig alleine dort, kein menschliches Wesen in Sicht, dass es das Beste war, ruhig voran zu schreiten, als ob alles seine Richtigkeit hätte, indem ich die Überheblichkeit voll ausschöpfte, welche, wie ich vermute, dass man sie so nennen müsste, unsere Einstellung gegenüber den unbeseelten Dingen kennzeichnet.
Als die Abenddämmerung hereinbrach, begannen die Schnepfen über dem leeren Brachland, das flach und einsam rund um mich herum lag, zu wummern, und ich hätte mich irgendwie in Gesellschaft fühlen können, ich in meiner grausigen Klemme, bei diesen sanften Stimmen aus dem Tierreich, nur dass ich irgendwie oder sonst nicht so recht fühlen konnte, von welcher Seite sie aufgestiegen waren, und es ist ja wirklich ein ungewöhnlicher Klang, das Wummern der Schnepfe, wenn du dir nicht sicher sein kannst, ob es freundlich gemeint ist. Die gesamte Luft stöhnt mit ihm.
[Schnepfe (snipe): Eine einst weit verbreitete Unterart der Stelzvögel mit langem, löffelförmigem Schnabel, in Unterarten gegliedert. Schnepfen sind Anrainer der Gewässer und Moorbewohner. Durch Kanalisierung der Flüsse und Trockenlegung der Moore sind sie selten geworden. Im Text ist von der ›Mittelschnepfe‹oder ›gemeinen Sumpfschnepfe‹ die Rede, die in der Tundra der ganzen Welt brütet. Sie lässt ein Schnappen hören, das durch Klappern mit dem Schnabel entsteht. Im Text ist aber mit »drumming – trommeln, wummern« folgendes gemeint: »Beim Aufstehen (der Schnepfe) vernimmt man ein … Geräusch, welches N. als ›wuchtelndes Getöse‹ bezeichnet« (Brehms Tierleben Bd. 10, S. 54).]
Gewiss hemmte nichts dieses Klanges das Folgen der Bäume, wie man hätte hoffen mögen, hätten sich nur irgendwelche Verbündete aus dem Tierreich schützend um mich zusammengetan. Krähen kamen herüber, vollkommen gleichgültig, und immer noch dauerte die Verfolgung an. In meinem Schrecken vergaß ich, dass ich ein Mann, ein Mensch war. Ich erinnerte mich nur noch dran, dass ich ein Lebewesen war. Ich schöpfte nur irgendeine trügerische Hoffnung, als die Krähen vorüber flogen und die Federn der Schnepfen durch die Lüfte schnitten, dass diese grässlich wachsamen Pappeln und das Entsetzen, welches hinter mir her war, zurückfinden könnten an ihren ursprünglichen Platz. Aber das Geräusch der Schnepfen schien nur die Einsamkeit zu vergrößern, und die Krähen schienen nur zur zunehmenden Dunkelheit beizutragen, und nichts brachte die Pappeln von ihrem grausigen mit ihrer Natur unvereinbaren Tun ab. Mir aber blieb nichts anderes übrig, als mein erbärmlicher Trick: hinkend gehend, als ob ich müde wäre, wobei ich mich mit dem einen Bein eines längeren beschleunigten Schrittes bediente als mit dem anderen; manchmal länger; manchmal schneller, immer abwechselnd und darauf achtend, was von beidem besser trog; aber diese armseligen Mätzchen bringen nicht viel; was auch immer leise dir folgt, du hast deinen Schritt gewiss nach dem Abstand zwischen dem Ding und seiner Beute einzurichten, ebenso, wie du auf deinen Gang zu achten hast, um sie entsprechend aufeinander abzustimmen. Obgleich ich auf diese Weise hin und wieder meinen Vorsprung vergrößerte, so wurde doch bald das Rauschen der Luft in den Zweigen lauter, und das Stampf-Stampf, welches ich des Nachts noch heute höre, wenn ich Alpträumen ausgesetzt bin. Es ist ein Geräusch, das man auf der Stelle wiedererkennt; es ist unterschiedlich zu allem, was auch immer anders ist.
Drei Meilen [ca. 5 km.], das klingt nicht nach weit. Es ist nicht mehr als von hier nach Kensington.
[Kensington ist ein vornehmer Stadtteil westlich der City Londons. Wenn man einen Radius von ca. 5 km. um Kensington zieht, erkennt man, dass das Gespräch ebenso in der City wie in einem Außenbezirk stattgefunden haben kann; vielleicht bei Victoria Station (s.o.), wohin damals alle gut kommen konnten.]




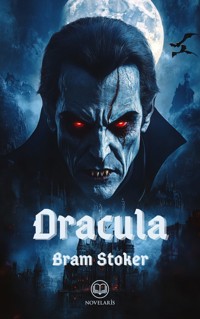

![DRACULA by Bram Stoker [2025 Kindle Edition] - The #1 Classic Vampire Horror Novel that Inspired Nosferatu | FREE with Kindle Unlimited - Bram Stoker - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/1519075e598819811bf5aaf3b61c7775/w200_u90.jpg)