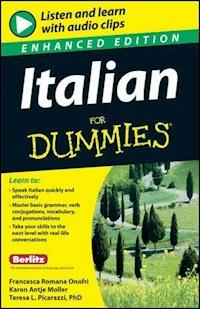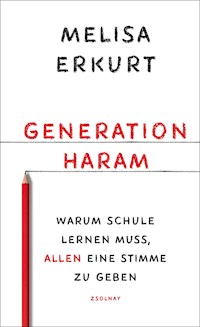
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
„Das Buch von Melisa Erkurt sollte Lektüre werden in der Ausbildung von Pädagog*innen und Lehrkräften. Es zeigt präzise, pragmatisch, konstruktiv die Verfehlungen und Unwegsamkeiten der Bildungssysteme, in denen viele Kinder aus ‚bildungsfremden‘ Familien auf der Strecke bleiben … Eine Wucht!“ Saša Stanišic Melisa Erkurt ist als Kind mit ihren Eltern aus Bosnien nach Österreich gekommen. Sie hat studiert. Sie arbeitet als Lehrerin und Journalistin. Sie hat es geschafft. Doch sie ist eine Ausnahme. Denn am Ende eines Schuljahres entlässt sie die Klasse mit dem Wissen, dass die meisten ihrer Schülerinnen und Schüler nie ausreichend gut Deutsch sprechen werden, um ihr vorgezeichnetes Schicksal zu durchbrechen. Hier wächst eine Generation ohne Sprache und Selbstwert heran, der keiner zuhört, weil sie sich nicht artikulieren kann. Über den „Kulturkampf“ im Klassenzimmer befinden einstweilen andere. Melisa Erkurt leiht ihre Stimme den Verlierern des Bildungssystems. Nicht sie müssen sich ändern, sondern das System Schule muss neue Wege gehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Jetzt sind die Verlierer dran mit Reden! Die Journalistin und Lehrerin Melisa Erkurt gibt denen eine Stimme, die im System Schule nicht gehört werden. Ein Perspektivenwechsel in der BildungsdebatteMelisa Erkurt ist als Kind mit ihren Eltern aus Bosnien nach Österreich gekommen. Sie hat studiert. Sie arbeitet als Lehrerin und Journalistin. Sie hat es geschafft. Doch sie ist eine Ausnahme. Denn am Ende eines Schuljahres entlässt sie die Klasse mit dem Wissen, dass die meisten ihrer Schülerinnen und Schüler nie ausreichend gut Deutsch sprechen werden, um ihr vorgezeichnetes Schicksal zu durchbrechen. Hier wächst eine Generation ohne Sprache und Selbstwert heran, der keiner zuhört, weil sie sich nicht artikulieren kann. Über den »Kulturkampf« im Klassenzimmer befinden einstweilen andere. Melisa Erkurt leiht ihre Stimme den Verlierern des Bildungssystems. Nicht sie müssen sich ändern, sondern das System Schule muss neue Wege gehen.
Melisa Erkurt
Generation haram
Warum Schule lernen muss, allen eine Stimme zu geben
Paul Zsolnay Verlag
Inhalt
Vorwort
Chancenlos von Anfang an
Das Privileg, eine Heimat zu haben
»Wieso können Sie so gut Deutsch?«
#metwo
Generation haram
Muhammed ist ein Urteil
Muslimische Mädchen
Kunst ist nur für Österreicher
Vorzeigemigrantin
Vergesst die Eltern
Was ist eine »Brennpunktschule«?
Verliererin bis zuletzt
Schule in der Krise
Ziele — zum Schluss
Literaturhinweise
Für alle, die nie eine Chance hatten. Für die Verlierer dieses Bildungssystems. Das ist für uns.
Und für meine Mama. Für dich war ich trotz allem immer eine Gewinnerin. Alles für dich.
Vorwort
Jetzt sind mal die Verlierer dran mit Reden!
Im Dezember 2016 habe ich eine Reportage mit dem Titel »Generation haram«, über die Verbotskultur muslimischer Teenager in Wien, veröffentlicht, die in Österreich und auch über die Grenzen hinaus für Schlagzeilen sorgte. Nach drei Jahren Leitung eines Schulprojekts an Wiener Brennpunktschulen hatte ich einen Einblick in österreichische Klassenzimmer gewonnen. Ein gefährlicher Trend, den ich damals beobachtete: Muslimische Burschen schränken mit »haram« (»verboten« im Islam)-Rufen den Alltag ihrer muslimischen Mitschülerinnen ein.
Die Öffentlichkeit sehnte sich offenbar nach jemandem, der endlich ansprach, was sich irgendwie alle schon dachten: Diese muslimischen Kinder und Jugendlichen sind das eigentliche Problem. Angebliche Schweinefleisch- und Nikoloverbote in Schulen, Zwangsheirat von jungen Mädchen, reaktionärer Islamunterricht, mangelnde Deutschkenntnisse, abwesende und streng konservative Eltern und vor allem das Kopftuch — über kaum eine Gruppe wird mehr diskutiert als über migrantische und speziell muslimische Schülerinnen und Schüler.
Als 2018 das Buch »Kulturkampf im Klassenzimmer« der Wiener Lehrerin Susanne Wiesinger erschien, eine Abrechnung mit dem Stadtschulrat, der gescheiterten Integration und vor allem dem Islam, gerieten muslimische Schülerinnen und Schüler erneut in den Fokus der Öffentlichkeit. Es scheint, als könnte man vieles, was in »Problemschulen« falsch läuft, an ihnen festmachen. 2018 habe auch ich entschieden, mehr darüber zu erfahren, und nach drei Jahren beim Migrantenmagazin biber und Schulprojektleitung mit über 500 Schülerinnen und Schüler aus ganz Wien beschlossen, selbst an einer Schule zu unterrichten. 2016 hatte ich bereits mein Lehramtsstudium für Deutsch und Psychologie und Philosophie abgeschlossen, im Schuljahr 2018/19 habe ich die Fächer erstmals an einer Wiener AHS mit über achtzig Prozent Migrationsanteil unterrichtet. Ich dachte, mich könnte nach meiner Arbeit aus den Jahren zuvor mit so vielen unterschiedlichen Schülerinnen und Schülern nichts mehr überraschen. Aber welche Schwierigkeiten wirklich vorherrschen und wie schwer wir da wieder herauskommen, wurde mir erst in diesem einen Jahr wirklich bewusst. Dann kamen das Jahr 2020 und Covid-19, das Virus, das die Welt lahmlegte. Corona kostete Menschenleben, Arbeitsplätze und Existenzen und ließ die soziale Schere weiter aufgehen — so auch im Bildungsbereich. Corona offenbarte die Folgen sozialer Ungleichheit in der Schule schonungslos, sodass spätestens ab diesem Zeitpunkt keiner mehr sagen kann, er hätte nicht gewusst, wie ungerecht unser Bildungssystem ist. Es zeigte sich, dass in Wirklichkeit nur Kinder mit bildungsnahen Eltern eine Chance haben, meist Kinder ohne Migrationshintergrund.
Trotzdem sind es in der Bildungsdebatte meist autochthone privilegierte Personen, die über die weniger privilegierten Kinder und Jugendlichen und ihre Familien schreiben und berichten, über jene Gruppe, die offenbar die größten Probleme in der Schule hat und — laut vielen — auch macht. Ich habe selbst Migrationshintergrund, muslimischen Background und bin als Flüchtlingskind 1992 im Zuge des Jugoslawienkriegs aus Bosnien-Herzegowina nach Österreich geflüchtet. Ein muslimisches Flüchtlingsmädchen mit Arbeitereltern, die ihm in der Schule nicht helfen konnten — eine klassische Bildungsverliererin also, mein Schicksal schien laut Statistik schon vorgezeichnet, denn in Österreich wird Bildung nach wie vor vererbt, Menschen mit meinem sozioökonomischen und kulturellen Background werden keine Hochschulabsolventinnen.
Auch ich schien anfangs diese Rolle zu erfüllen: Im Kindergarten habe ich nicht gesprochen, nicht, weil ich kein Deutsch konnte, sondern weil mich die neuen Eindrücke überforderten. In der Volksschule sprach ich weiterhin kaum, man hätte meine Introvertiertheit auch hier leicht mit mangelnden Deutschkenntnissen oder der Unterdrückung muslimischer Mädchen erklären können. Meine Eltern wussten weder ob ich die Hausübung erledigt, noch wann ich Schularbeiten hatte, sie arbeiteten rund um die Uhr. Obwohl ich lauter Einser hatte, war zunächst nicht klar, ob ich ans Gymnasium (AHS) kommen sollte, vielleicht doch an die Hauptschule (NMS) oder gar die Sonderschule wie meine Cousins? Zufällig landete ich im Gymnasium. Nach der vierten Klasse Unterstufe riet trotz guter Noten sogar mein Vater mir, lieber eine Lehre zu machen, Matura brauchen Kinder wie ich nicht. »Solche wie wir dürfen in Österreich nur arbeiten, nicht studieren«, sagte er. Ich maturierte trotzdem und schloss einige Jahre später die Universität ab — das Gefühl, da aber gar nicht hinzugehören, blieb bis zuletzt.
Vor Jahren war ich dieses kleine muslimische Mädchen, das nicht sprach, ich weiß also gut, wie es sich anfühlt, wenn immer andere über und für einen sprechen. Ich habe lange gebraucht, bis ich meine eigene Stimme gefunden habe. Und jetzt, da ich sie habe, werde ich nicht mehr leise sein, ich werde auf all jene hinweisen, die sonst immer nur als Objekte in der Berichterstattung vorkommen.
Ich habe mit hunderten Schülerinnen und Schülern zusammengearbeitet, die genauso aufgewachsen sind wie ich. »Wieso sprechen Sie so gut Deutsch, wie haben Sie es geschafft, etwas zu werden?«, fragten mich diese Kinder und Jugendlichen oft. Dabei war ich weder klüger als sie, noch hatte ich bessere Voraussetzungen. Schaut man sich die Biografien von erfolgreichen (oder was die Mehrheitsgesellschaft zumindest als erfolgreich empfindet) Migrantinnen und Migranten an, sind sie oft sehr ähnlich: Es gab da eine Person in ihrer Bildungslaufbahn, die an sie geglaubt hat. Dass sich das Bildungssystem eines der reichsten Länder der Welt auf eine einzelne Person verlässt, ist ein Skandal. Aber auch wir Bildungsaufsteigerinnen und -aufsteiger haben Diskriminierung, vor allem in der Schule, erfahren, die uns hat doppelt und dreifach mehr leisten lassen als unsere autochthonen Mitschülerinnen und Mitschüler, um zu beweisen, dass wir hierhergehören.
Welche Auswirkungen dieses Overperforming von Migrantinnen und Migranten hat, wird sich erst in Zukunft zeigen. Fest steht aber, dass ich lange dachte, dass Bildung der Schlüssel zur gelungenen Integration sei. Ich schloss die Uni ab, war nie arbeitslos, habe die deutsche Sprache sogar studiert, und trotzdem erlebe ich nach wie vor Diskriminierung. Genauso wie meine ehemaligen Schülerinnen und Schüler. Auch die bestausgebildeten Migrantinnen und Migranten stoßen in Österreich noch immer an eine gläserne Decke. Mit welcher Motivation soll sich so die nächste Generation von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund einen Bildungsaufstieg erarbeiten? Es ist ein Märchen, ihnen zu erzählen, dass sie mit Bildung in Österreich alles erreichen können.
Im Gegensatz zu mir fehlt den meisten von ihnen aber die Sprache, um auszudrücken, was falsch läuft, und das Selbstbewusstsein, Veränderung einzufordern. Denn auch das habe ich in den letzten Jahren gelernt: Das Deutsch und der Selbstwert vieler Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die hier geboren oder aufgewachsen sind, ist katastrophal. Der Unterricht — allen voran der Deutschunterricht —, wie er heute geführt wird, wird dieses Defizit niemals ausgleichen können, egal wie engagiert die Lehrperson ist. Ich habe in meinem Unterrichtsjahr alle pädagogischen und fachlichen Tricks angewandt und habe am Ende des Schuljahres die Klassen verlassen, mit dem Wissen, dass die meisten von ihnen trotzdem nie ausreichend gut Deutsch sprechen und schreiben werden, um ihr vorgezeichnetes Schicksal zu durchbrechen. Woher sollen sie auch die Motivation nehmen, das Schicksal zu durchbrechen, wenn da niemand ist, der als Vorbild dient, der an sie glaubt? Und eines kann ich Ihnen sagen: Es braucht unfassbar viel Motivation, so viel, wie man eigentlich von keinem Kind verlangen kann, um diese ungeheure Anstrengung aufzuwenden, das vererbte Bildungsschicksal anzukämpfen.
Was hat sich also getan, seit ich 1992 nach Österreich kam? Seit ich 2016 »Generation haram« veröffentlichte? Seit ich 2018 Lehrerin wurde? Dominieren muslimische Verbotskultur und Kulturkämpfe die Klassenzimmer? Werden Migrantenkinder auch in absehbarer Zukunft die größten Leistungsnachteile im österreichischen Bildungssystem erleiden? Wächst gerade eine Generation ohne Sprache und Selbstwert heran, der einfach keiner zuhört, während die immer Gleichen das Wort in der Bildungsdebatte erhalten? Jetzt sind mal die Verlierer dran mit Reden!
Chancenlos von Anfang an
Bildungsalltag vom Kindergarten bis zur Matura
Ich schaffe es gerade noch ins Lehrerinnen-Klo. Dann breche ich in Tränen aus, wie eine halbe Stunde zuvor noch meine Schülerin. Ich hatte der Klasse ihre Deutsch-Schularbeiten zurückgegeben, und Hülya hatte wieder ein Nicht genügend. Sie hörte sich tapfer meine Worte an, dass die Note lediglich eine Momentaufnahme sei, nichts über sie oder ihr Können aussage, dass wir das bis zur nächsten Schularbeit schon gemeinsam hinkriegen würden, dass ja außerdem auch andere Leistungen zur Endnote beitragen. Sie nickte und schwieg, ihre braunen Augen wichen meinem Blick aus.
Es ist dieser Blick, der mir im Laufe des Schuljahres leider zu oft begegnet ist, der Blick der krampfhaft versucht, keine Tränen zuzulassen, nicht mehr weiterweiß, sich fragt, wie den Eltern erklären, dass es wieder ein Fünfer ist, den Eltern, die kein Geld für Nachhilfe haben, selbst nicht helfen können, manchmal gar nicht wollen, dass das Kind in eine weiterführende Schule geht. Die sich von dem Fünfer darin bestätigt fühlen, dass ihr Kind nicht gut genug für die Schule ist. Hülya glaubt sowieso längst, dass sie nicht gut genug für das Gymnasium ist. Politik und Gesellschaft glauben es auch. Denn Kinder mit Hülyas Background schaffen selten einen Bildungsaufstieg. Wie könnte Hülya also selbst daran glauben?
Schon in der Volksschule rieten ihr die Lehrer zur Neuen Mittelschule (NMS), sie wollte aber ins Gymnasium und setzte sich durch. Doch seit der ersten Klasse Gymnasium führen die Professorinnen und Professoren immer wieder Gespräche mit ihr und ihrem älteren Bruder, Gespräche darüber, dass sie vielleicht an die Neue Mittelschule wechseln sollte, dann eine Lehre machen. Hülya sei doch so fleißig.
Auch ich sollte so ein Gespräch mit Hülya und ihrem Bruder führen, die Eltern sprechen nicht Deutsch, also kommt der Bruder mit, der nicht älter als zwanzig sein kann. Die Eltern sitzen im Hintergrund und hören stumm zu. Ich kenne die Familie nicht, ich weiß nicht, ob sie wollen, dass Hülya ein Gymnasium besucht, oder ob es dem Bruder recht ist, dass die Schwester nach der Pflichtschule aufhört. Lehrerkollegen, die Hülya schon länger unterrichten, raten mir, ihr andere schulische Optionen ans Herz zu legen, aber ich weiß aus Gesprächen mit dem Mädchen, dass sie unbedingt am Gymnasium bleiben will. Doch auch mir ist klar, dass sie es mit diesen Deutschkenntnissen, dem fehlenden Selbstwertgefühl und der nicht vorhandenen Unterstützung zu Hause nicht bis zur Matura schaffen wird. Andere Kollegen wieder fürchten, dass Hülyas muslimische Eltern wollen, dass sie heiratet und daheimbleibt. Ich weiß nicht, wie sie darauf kommen, es gibt überhaupt keine Anzeichen in diese Richtung, aber plötzlich schwirrt auch mir vor dem Gespräch mit ihrer Familie dieser Gedanke durch den Kopf. Ich bringe es am Ende nicht über mich, der Familie zu raten, Hülya von der Schule zu nehmen, sie möchte doch so gerne bleiben, außerdem ist sie doch erst dreizehn, wer weiß, wie sie sich entwickelt. Ich lege der Familie stattdessen eine gute Nachhilfelehrerin und ganz viele Bücher ans Herz.
In anderen Worten: Ich habe als ihre Lehrerin versagt. Eigentlich sollte es keine Nachhilfe brauchen, ich als ihre Lehrerin sollte das ausgleichen können. Ich habe in meinem Lehramtsstudium aber nicht gelernt, wie ich Schülerinnen wie Hülya unterrichte. Ich habe nur gelernt, wie ich Annas und Pauls unterrichte und mich dabei auf ihre zusätzliche Unterstützung von daheim verlasse. Im Prinzip habe ich also gelernt, wie ich Hülyas aussortiere, damit weiterhin hauptsächlich Kinder aus bildungsaffinen Familien das Gymnasium abschließen und alle anderen abgeschreckt werden.
Wie sich Hülyas Familie Nachhilfe leisten soll, kann ich ihr nicht sagen. Für ein Mädchen wie Hülya wäre eine kostenlose Ganztagsschule mit Betreuung in Kleingruppen die Rettung. Vielleicht schaffe ich es nicht, Hülya abzuschreiben, weil sie mich an mich erinnert. Ich hätte damals auch nicht ans Gymnasium gehen sollen, sogar mein Vater meinte, dass das nichts für mich wäre. Aber genau wie Hülya wollte ich unbedingt.
All das geht mir durch den Kopf, während ich die Schularbeiten austeile, noch blickt Hülya hoffnungsvoll durch den Raum, sie scheint zuversichtlich, diesmal zumindest ein Genügend geschafft zu haben, schließlich hatte sie doch geübt. Aber es hat nicht gereicht, obwohl ich bei der Benotung bereit gewesen wäre, alle Augen zuzudrücken, ihren individuellen Fortschritt zu berücksichtigen. Aber Hülya macht noch immer erhebliche inhaltliche und grammatikalische Fehler, sie schreibt »der Mädchen«, ihre Sätze ergeben keinen Sinn. Der sprachliche Ausdruck ist der eines Mädchens, das erst seit kurzem in Österreich ist.
Das dachte ich tatsächlich auch, als ich am ersten Schultag Hülya und die Klasse kennenlernte. Und zwar nicht nur bei ihr, ich war mir nach dem ersten Kennenlernen bei vielen sicher, dass sie noch nicht allzu lange in Österreich leben konnten. Doch sowohl Hülya als auch der Rest der Klasse war hier geboren oder zumindest aufgewachsen und besuchte zu dem Zeitpunkt die dritte Klasse eines Wiener Gymnasiums.
Wie hatte Hülya, die stellvertretend für viele Kinder und Jugendliche mit denselben Deutschdefiziten steht, es überhaupt bis ins Gymnasium geschafft, fragten sich all ihre Lehrerinnen und Lehrer, denn natürlich machte sich der Sprachmangel auch in den Nebenfächern bemerkbar. Wie soll ich es innerhalb eines Jahres schaffen, ihre rudimentären Sprachdefizite auszugleichen und gleichzeitig alle anderen zu unterrichten und den Stoff durchzubringen, fragte ich mich als ihre Deutschlehrerin.
»Wieso können Sie so gut Deutsch, obwohl Sie nicht von hier sind?«, ist die meistgestellte Frage, die mir Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund stellen. Sogar bei einem Vortrag vor angehenden Volksschullehrerinnen kam am Ende eine Gruppe von jungen Migrantinnen Anfang zwanzig zu mir, die mich für mein Deutsch bewunderten: »Man hört Ihnen gar nicht an, dass Sie nicht aus Österreich stammen«, sagten sie mir und äußerten ihre Ängste: »Werden uns die Eltern unserer österreichischen Schülerinnen und Schüler ernst nehmen, wenn sie unseren Akzent hören?« Das waren lauter junge Frauen, die in Österreich geboren und an Wiener Gymnasien maturiert hatten.
Das Niveau vieler Wiener Gymnasien in den sozioökonomisch schwächeren Bezirken unterscheidet sich kaum von dem einer Neuen Mittelschule. Oft haben die Kinder an den Gymnasien aber Eltern, die zumindest die Ressourcen hatten, sich über die Schulwahl in Österreich zu informieren. Oft besuchten diese Kinder Volksschulen in den Bezirken, wo die meisten Kinder dieselben Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache haben wie sie selber, sodass die Volksschullehrerin entweder allen schlechte Noten hätte geben müssen oder die Notengebung individuell zu dehnen wusste.
Auch ich habe das getan. Wenn es nach dem Benotungssystem, das ich im Studium kennengelernt habe, gegangen wäre, hätte ich das ganze Schuljahr über niemandem ein Sehr gut oder ein Gut in Deutsch geben dürfen. Bis zu meiner Zeit als Lehrerin an einem Gymnasium war ich eigentlich der Meinung, dass eine Gesamtschule all unsere Probleme im Bildungsbereich lösen würde. Ich dachte, das Zweiklassenschulsystem würde fehlende Durchmischung, Konflikte und Deutschmängel produzieren.
Doch viele Gymnasien in Wien haben mittlerweile dieselben Probleme wie Neue Mittelschulen. Mir ist bewusst geworden, dass die Trennung der Kinder im Alter von zehn Jahren zwar noch immer viel zu früh, die Förderung in diesem Alter gleichzeitig aber viel zu spät kommt. Wenn man mit Volksschullehrerinnen spricht, berichten auch sie schon von einem Akzent beim Deutschsprechen, von geringem Vokabular und nicht vorhandener Grammatik bei Kindern, die hier geboren und aufgewachsen sind. Es ist also die vorschulische Bildung, auf die wir uns viel stärker konzentrieren müssen.
Die Volksschule ist die einzige gemeinsame Schule, die wir aktuell haben. In den öffentlichen Volksschulen herrscht in manchen Bezirken noch eine Durchmischung von Kindern unterschiedlicher Herkunftsländer, Sprachbiografien und sozioökonomischen Verhältnissen. Wobei auch das abhängig vom genauen Wohnort ist. In Wien sitzen in manchen Klassen zwanzig Kinder mit Migrationshintergrund, während es in anderen Bezirken ganz anders aussieht.
Außerdem kommen nicht alle Kinder mit denselben Voraussetzungen in die Volksschule. Manche waren davor ein Jahr im Kindergarten, andere drei Jahre, wieder andere gar zuvor noch in der Kindertagesstätte oder bei einer Tagesmutter. Sie haben also alle einen unterschiedlichen Erfahrungsschatz im Umgang mit anderen Kindern, Autoritätspersonen beziehungsweise Pädagoginnen und Pädagogen und einem geregelten Tagesablauf.
Ich kenne viele Familien, die zu Hause eine andere Sprache als Deutsch sprechen und glauben, dass es am besten ist, wenn ihr Kind die ersten paar Jahre nur mit der Erstsprache aufwächst und dann mit vier oder fünf im Kindergarten Deutsch lernt. Das klingt plausibel. Nur habe ich in Gesprächen mit Kindern und Jugendlichen, wenn ich mich mit ihnen über ihre Sprachbiografien unterhalten habe, festgestellt, dass die Kinder, deren Eltern das so gehandhabt haben, oft negative Assoziationen mit der deutschen Sprache verbinden. Deutsch ist die Sprache, in der sie im Kindergarten am Anfang nichts verstanden haben, sprachlos waren, anders als die anderen Kinder. Selbst wenn sie das schnell nachgeholt haben, Kinder lernen Sprachen ja unglaublich schnell, bleibt eine schlechte Erinnerung, die sie sich später nicht erklären können.
Freundinnen und Freunden, die Türkisch als Herkunftssprache haben, wurde von ihrer Volksschullehrerin gesagt, dass sie nicht mit den anderen türkischen Kindern spielen sollen, sonst würden sie nie Deutsch lernen. Dass diese Lehrpersonen Kinder »türkisch« nannten, obwohl sie hier geboren und aufgewachsen waren, und sich nur bei diesen Kindern in die Auswahl der Freundschaften einmischten — wir wissen, wie wichtig die Bindung zu Gleichaltrigen ist —, beeinflusste die Beziehung meiner Freundinnen und Freunde zur deutschen Sprache und Schule negativ.
Bei meiner Arbeit an Schulen stellte ich fest, dass Legasthenie fast ausschließlich bei Schülerinnen und Schülern mit Deutsch als einziger Muttersprache diagnostiziert wurde. Lese- und Rechtschreibschwächen bei mehrsprachigen Schülerinnen und Schülern führten Lehrpersonen dagegen häufig automatisch auf die Mehrsprachigkeit der Kinder zurück.
Dabei hat Mehrsprachigkeit in keiner Weise einen negativen Einfluss auf den Erwerb des Deutschen. Der Umgang mit Mehrsprachigkeit in diesem Land hat dagegen einen enorm negativen Einfluss, sowohl auf das Deutsch der Kinder und Jugendlichen als auch auf ihre Herkunftssprachen. Unser Bildungssystem erwartet, dass sich diese Kinder sprachlich dem Bildungsbürgertum anpassen, »und das hat natürlich Auswirkungen auf die Chancen der Kinder, die aus anderen Teilen der Gesellschaft stammen, unabhängig davon, ob sie nun zu Hause noch weitere Sprachen erwerben oder einsprachig deutsch aufwachsen«, konstatiert die Duden Streitschrift »Deutschpflicht auf dem Schulhof? Warum wir Mehrsprachigkeit brauchen.«
Derzeit gibt es in Österreich ein verpflichtendes Kindergartenjahr, das heißt, man verlässt sich im Grunde komplett auf die Volksschulpädagoginnen. Sie müssen es in vier Jahren schaffen, die unterschiedlichen Startbedingungen in den Griff zu bekommen. Dass das nicht möglich ist, zeigen Gespräche mit Volksschullehrerinnen und -lehrern und Lehrpersonen an den Neuen Mittelschulen, die sich fragen, wieso die Schülerinnen und Schüler so wenige Kompetenzen mitbringen, wie sie es überhaupt durch die Volksschulzeit geschafft haben.
Ich habe mich im Laufe der Jahre mit vielen Volksschullehrerinnen unterhalten. Zur ganz aktuellen Einordnung für dieses Buch treffe ich eine Volksschullehrerin, die seit drei Jahren im zehnten Wiener Gemeindebezirk unterrichtet. Ihre Erzählung bestätigt nur, was ich zuvor schon von anderen Kolleginnen gehört habe: Unter den momentanen Bedingungen liegt es völlig in den Händen des Elternhauses, welches Kind erfolgreich ist. 24 Kinder sitzen in ihrer dritten Klasse, sie haben Eltern aus sechs Nationen. Die meisten Kinder sind hier geboren, nur die zwei geflüchteten afghanischen Kinder und ein Mädchen, das ganz neu dazugekommen ist und die Deutschförderklasse besucht, sind nicht in Österreich geboren.
»Ich konnte schon am Ende der ersten Schulwoche sagen, welches Kind es nach den vier Jahren ins Gymnasium schaffen wird und welches nicht«, sagt sie mir. Sieben der 24 Kinder werden es ins Gymnasium schaffen, der Rest kommt in die Neue Mittelschule. Was die sieben Kinder von den anderen unterscheidet? Sie haben Eltern, die zu Hause mit ihnen üben.
Die anderen Eltern bringen sich gar nicht ein, die wenigsten interessieren sich für die Leistungen der Kinder, es geht ihnen nur darum, dass kein Fünfer im Zeugnis steht. »Beim Elternsprechtag erzähle ich von den Problemen ihrer Kinder. Aber alles, was sie wissen wollen, ist, ob ihr Kind eh nicht sitzenbleibt. Wenn ich verneine, passt alles für sie, und sie hören mir nicht mehr zu.« Drei Viertel der Eltern arbeiten nicht, vor allem die Mütter sind oft daheim. Das führt dazu, dass die Kinder auch keine Vorbilder haben. Sie wissen nicht einmal, welche Berufe es gibt oder was Berufe sind.
»Ich schaffe es nicht, das in der Schule nachzuholen, was zu Hause fehlt«, sagt die Lehrerin, die selber Migrationshintergrund hat. Am Anfang der ersten Klasse hat sie das noch versucht, bis sie gemerkt hat, dass sie mit der Jahresplanung komplett in Verzug ist.
»Wenn die Kinder in die erste Klasse kommen, können sie Dinge nicht, die sie längst können sollten: die Farben, die Dinge im Federpennal benennen. Sie wissen nicht, wie man die Jacke zumacht oder dass man keine Unterhose unter der Badehose trägt, weil sie zuvor noch nie schwimmen waren.« Nicht selten kommen die Kinder im Winter ohne Socken in die Schule.
Aber auch die sprachlichen Kompetenzen fehlen. »Die Kinder können weder ihre Erstsprache noch Deutsch. Sie wissen nicht, in welcher Sprache sie sich verständigen sollen.« Wenn sie etwas auf Deutsch nicht ausdrücken können, schlägt sie ihnen vor, es in ihrer Erstsprache zu sagen, aber auch hier fehlt der Wortschatz. Sie versuchen sich dann mit »Dingsda« zu behelfen. »Man merkt, dass die Eltern zu Hause wenig mit den Kindern reden und unternehmen.« Die Lehrerin fügt Bilder zu Elternbriefen hinzu, weil viele Eltern sonst nicht verstehen, was in dem Brief verlangt wird.
Theoretisch könnte sie Kinder bis zur zweiten Klasse zurückstufen lassen. Dafür braucht sie aber das Einverständnis der Eltern, die das meistens aber nicht wollen. »Dann muss ich die Kinder bis zur Vierten mitschleppen«, gibt sie zu. Vom Klassewiederholen hält sie nichts. »Die Lücken, die diese Kinder haben, sind so groß, da hat es keinen Sinn, sie durchfallen zu lassen. Das wird das Kind nicht in dem einen Jahr, in dem es sitzenbleibt, nachholen können. Das Kind verliert dadurch bloß ein Jahr der Schulpflicht. Bleibt es dann zusätzlich in der NMS sitzen, könnte es schon in der zweiten Klasse NMS die Schule abbrechen, ohne Pflichtschulabschluss, weil es die Schulpflicht beendet hat.«
Ein solches Kind, das sie »mitschleppt«, ist ein Bub, dessen Eltern aus Tschetschenien stammen. Der Bub schlägt die anderen Kinder und hat Geld aus der Klassenkassa gestohlen. Er hört nicht auf seine Lehrerin und lässt sich einfach nicht beruhigen. Obwohl sie seine Eltern mehrmals in die Schule bittet, kommen sie einfach nicht und reagieren nicht auf ihre Nachrichten. »Ich hab die Familie da schon abgestempelt: asoziale Eltern, denen ihr Kind egal ist«, sagt die Lehrerin. Doch als es die Mutter schließlich doch zum Elternsprechtag schafft, erfährt sie, dass ihr Schüler einen querschnittsgelähmten und schwerkranken Bruder hat. Die Eltern verbringen die meiste Zeit im Krankenhaus bei ihrem zweiten Sohn. Die Familie hat wenig Geld, der Volksschüler nicht einmal einen Schreibtisch daheim.
»Zu achtzig Prozent weiß ich nicht, was bei meinen Schülerinnen und Schülern zu Hause los ist«, erzählt die Lehrerin mir. »Und selbst wenn ich von ihren Schicksalen erfahre, uns steht eine Schulpsychologin für den ganzen Bezirk zur Verfügung. Der Antrag für sonderpädagogischen Förderbedarf dauert Monate bis zu einem halben Schuljahr, bis ihn jemand anschaut. Davor braucht man für diese schulpsychologische Begutachtung überhaupt erst mal die Unterschrift der Eltern. Viele wollen das nicht.«
Die Eltern wollen sich nicht eingestehen, dass ihr Kind Förderbedarf hat, für viele bedeutet das, sie hätten etwas falsch gemacht. In vielen Kulturkreisen und unteren sozialen Schichten ist es ein Stigma, wenn das Kind psychologische oder sonderpädagogische Hilfe benötigt.
Die meisten ihrer Schülerinnen und Schüler hätten kein eigenes Zimmer, wo sie in Ruhe schlafen oder Hausübung machen können, erzählt mir die Lehrerin. Die älteren Geschwister schauen oft fern im selben Zimmer, während sie Schulaufgaben erledigen sollen, es ist schwer für die Kinder, sich daheim zu konzentrieren.
»Als ich das erste Mal meinen Schülerinnen und Schülern vorgelesen habe, wussten sie nicht, was ich da überhaupt mache. Das war so ungewohnt für sie, sie wussten nicht, wie sie sich verhalten sollen, mittlerweile lieben sie es.« Die Lehrerin ist oft die erste Person im Leben dieser Kinder, die ihnen ein Buch zeigt und vorliest. Wie sollen diese Kinder so in unserem Schulsystem bestehen?
Die Halbtagsschule, wie sie in Österreich noch immer die Regel ist, setzt die aktive Mitarbeit der Eltern am Schulerfolg ihrer Kinder voraus. Die Eltern haben hierzulande eine riesengroße Bedeutung für den Bildungserfolg des Nachwuchses — erst wenn man diese Verantwortung auslagert, kann die Vererbung von Bildung gestoppt werden.
Nicht nur Bildung, sondern Erziehung muss in der Schule genauso wie im vorschulischen Bereich erfolgen. Nichts darf mehr vorausgesetzt werden. Wir können an den Startbedingungen dieser Kinder nichts ändern, aber wir dürfen sie nicht dafür bestrafen. Wir müssen die Schule an sie anpassen, umgekehrt wird es nicht klappen, da kann man sich noch so viele Sanktionen für die Eltern der Kinder überlegen. Es wird immer Familien geben, die sich nicht ausreichend um ihre Kinder kümmern können oder wollen. Natürlich macht es auch mich wütend, wenn ich sehe, dass sich manche Eltern einfach keine Mühe geben, aber diese Kinder haben nichts von meiner Wut auf ihre Eltern. Wir müssen uns von der Illusion verabschieden, alle Eltern mit ins Boot holen zu können.