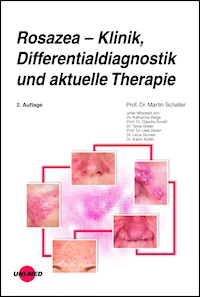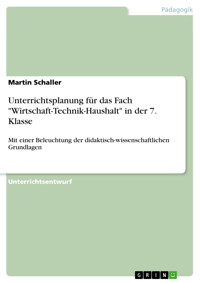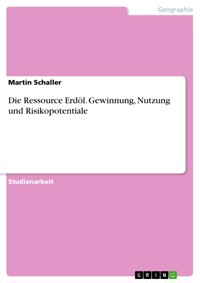Geographieunterricht 4.0: Chancen und Risiken digitaler Medien für die Arbeit im Geographieunterricht E-Book
Martin Schaller
34,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Science Factory
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die fortschreitende Digitalisierung und Vernetzung prägt zunehmend all unsere Lebensbereiche. Auch die Geographie als Unterrichtsfach kann sich nicht vor den neuen Ansprüchen einer digitalen Zukunft verschließen. Digitale Medien können die ganze Welt ins Klassenzimmer bringen. Außerdem bieten sie eine hervorragende Eignung für selbstorganisiertes Lernen in der Schule oder Zuhause und die Aneignung methodischer, sozialer und medialer Kompetenzen. Was so schön und einfach klingt, lässt sich bisweilen jedoch nur schwer praktisch umsetzen. In vielen Schulen fehlen das Material sowie die technischen Kenntnisse. Zudem eignen sich nicht alle Anwendungen gleichermaßen für die Nutzung im Unterricht. Martin Schaller stellt in seiner Publikation deshalb vier neue Lernmedien genau vor. Dabei hilft er mit konkreten Tipps auch bei der Umsetzung im eigenen Klassenzimmer. Anhand der onlinebasierten Lernplattform geo:spektiv, der Lern-App Dynamic Plates, der VR-Software Expeditions und der AR-App TamAR zeigt Schaller, wie die neuen Medien den Unterricht bereichern können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 103
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2018 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Hinweis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Annäherung an die Forschungsfrage
1.3 Methodik und Aufbau der Arbeit
2 Theoretische Grundlagen
2.1 Geographie als Wissenschaft und Schulfach
2.1.1 Gegenstand und Ziele der Wissenschaft Geographie
2.1.2 Lehr- und Lernziele des Schulfaches Geographie
2.2 Lerntheoretische Hintergründe
2.2.1 Lernen und Lerntheorien
2.2.2 Bedeutung von Medien für das Lernen
2.2.3 Bedeutung von Motivation und Interesse für das Lernen
2.2.4 Unterrichtsprinzipien des Geographieunterrichts
2.3 Medien im Geographieunterricht
2.3.1 Klassifikation geographischer Unterrichtsmedien
2.3.2 Funktionen von Medien im Geographieunterricht
2.3.3 Leistung klassischer Unterrichtsmedien im Geographieunterricht
2.3.4 Leistung digitaler Medien im Geographieunterricht
2.3.5 Lernmethoden im Spannungsfeld digitaler Medien
2.3.6 Medienkompetenz
3 Chancen und Risiken digitaler Medien für die Arbeit im Geographieunterricht
3.1 Onlinebasierte Lernumgebung am Bsp. „geo:spektiv“
3.1.1 Begriffsbestimmung onlinebasierte Lernumgebung
3.1.2 Vorstellung der onlinebasierten Lernumgebung „geo:spektiv“
3.1.3 Untersuchung der Eignung onlinebasierter Lernumgebungen für den Geographieunterricht am Beispiel „geo:spektiv“
3.1.4 Ableitung von Chancen und Risiken onlinebasierter Lernumgebungen am Beispiel „geo:spektiv“
3.1.5 Unterrichtsvariante
3.2 Lern-Apps für Tablet und Smartphone am Beispiel der App „Dynamic Plates“
3.2.1 Begriffsbestimmung Lern-Apps
3.2.2 Vorstellung der Lern-App „Dynamic Plates“
3.2.3 Untersuchung der Eignung von Lern-Apps für den Geographieunterricht am Beispiel „Dynamic Plates“
3.2.4 Ableitung von Chancen und Risiken von Lern-Apps am Beispiel
„Dynamic Plates“
3.2.5 Unterrichtsvariante
3.3 Virtual Reality am Beispiel der App „Expeditions“
3.3.1 Begriffsbestimmung Virtual Reality
3.3.2 Vorstellung der App „Expeditions“
3.3.3 Untersuchung der Eignung von Virtual Reality für den Geographieunterricht am Beispiel „Expeditions“
3.3.4 Ableitung von Chancen und Risiken von Virtual Reality am Beispiel „Expeditions“
3.3.5 Unterrichtsvariante
3.4 Augmented Reality am Beispiel der App „TamAR“
3.4.1 Begriffsbestimmung Augmented Reality
3.4.2 Vorstellung der App „TamAR“
3.4.3 Untersuchung der Eignung von Augmented Reality für den Geographieunterricht am Beispiel der App „TamAR“
3.4.4 Ableitung von Chancen und Risiken von Augmented Realityam Beispiel „TamAR“
3.4.5 Unterrichtsvariante
4 Fazit und Ausblick
5 Quellenangaben
Hinweis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Klassifikation von Unterrichtsmedien
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
Der private wie berufliche Alltag der Menschen wird zunehmend von einer immer schneller fortschreitenden Digitalisierung und Vernetzung aller Lebensbereiche geprägt.[1] Und auch die Geographie als Unterrichtsfach der allgemeinbildenden Schulen kann sich nicht vor den Realitäten und (Bildungs-)Ansprüchen einer digitalen Zukunft verschließen. Einerseits, da in der Geographie als Zentrierungsfach Erkenntnisse und Methoden anderer von der Digitalisierung betroffener Fächer zusammenfließen und zum anderen, da die Geographie selbst auf vielfältige Art und Weise von jener beeinflusst wird. Wissenschaftlich-geographische Methoden, Arbeitsmittel und Medien erfuhren durch den technischen Fortschritt der letzten Jahrzehnte eine deutliche Pluralisierung im Sinne einer quantitativen Zunahme und qualitativen Aufwertung.[2] Insbesondere nennt die Fachliteratur Methoden der sekundären Datenaufnahme (z.B. Datengewinnung aus GIS, Luft- oder Satellitenbildern), der Datengewinnung im Labor (z.B. chemischen Analysen, Datierungen), sowie der Datenanalyse und Datenaufbereitung (z.B. Systemanalysen mithilfe komplizierter mathematisch-statistischer Verfahren aus großen Datenmengen), welche sich heute der neuen Möglichkeiten moderner Hard- und Software bedienen. Die Ergebnisse geographischer Arbeit werden mithilfe des Internets der weltweiten Forschergemeinde zugänglich gemacht.[3] Auch bedingen bildungspolitische Vorgaben einen Wandel des Schulunterrichts. Die KMK betont, dass die Beherrschung von Computer-, Informations- und Kommunikationstechnologie heute eine elementare Kulturtechnik zur Teilhabe an Politik, Kultur und Gesellschaft, sowie zum Bestehen der Anforderungen der gegenwärtigen und zukünftigen Welt darstellt.[4],[5] Das Strategiepapier „Bildung in einer digitalen Welt“ der KMK definiert verbindliche Unterrichtsleitlinien, die im Ziel „individuelles und selbstgesteuertes Lernen fördern, Mündigkeit, Identitätsbildung und das Selbstbewusstsein stärken, sowie [den SuS, M.S.] die selbstbestimmte Teilhabe an der digitalen Gesellschaft ermöglichen.“ Dazu soll „möglichst bis 2021 jede Schülerin und jeder Schüler jederzeit, wenn es aus pädagogischer Sicht im Unterrichtsverlauf sinnvoll ist, eine digitale Lernumgebung und einen Zugang zum Internet nutzen können“[6]. Entsprechende Didaktik fordert eine stärkere Gewichtung der „lernbegleitenden Funktionen der Lehrkräfte“[7] und der „Verantwortung für die Gestaltung des eigenen Lernens und (…) Selbstständigkeit [seitens der SuS, M.S.]“[8]. Derartige digitale Lernumgebungen bedürfen jedoch „einer Neuausrichtung der bisherigen Unterrichtskonzepte“[9] und des Verständnisses über Medieneinsatz und -nutzung.[10] Dies stellt Lehrende hinsichtlich einer qualitätsvollen Unterrichtsgestaltung, des Lehrerhandelns, sowie den eigenen medialen Qualifikationen und Kompetenzen vor große Herausforderungen.[11]
1.2 Annäherung an die Forschungsfrage
Doch Bildungstrends sind unter Umständen nicht nur problematisch zu bewerten, sondern können auch Lösungen zutage fördern, mit denen neue und alte Probleme überwunden werden können. Heute findet sich im Internet zu nahezu jedem Unterrichtsthema aktuelles Text-, Bild- und Videomaterial. Durch Ergänzung klassischer Medien um digitale Medieninhalte kann das Defizit klassischer Medien hinsichtlich deren Aktualität ausgeglichen werden. Digitale Medien bringen die ganze Welt ins Klassenzimmer. Sie dienen zur Konstruktion authentischer problemorientierter Lernsituationen und schaffen eine Voraussetzung für die Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen.[12] Interaktive Lernsoftware gestattet Lernenden beispielsweise das Anhalten, Vor- und Zurückspulen von Videos oder Animationen. Dies erleichtert den SuS das Verständnis komplexer Prozesse und leistet einen Betrag zur Individualisierung und Effizienzsteigerung des Lernens.[13] Adaptive Lernplattformen mit intelligenten Bewertungs- und Feedbackfunktionen ermöglichen neue Formen selbsttätigen Lernens und zielen neben der Vermittlung von Fachwissen auf den Aufbau methodischer, medialer und personeller Kompetenzen.[14] VR dient der Überbrückung raumzeitlicher Distanzen und bringt den Lerngegenstand zum Lernenden.[15] AR ergänzt beispielsweise Lehrbücher um zusätzliche virtuelle Inhalte und erhöht deren Informationsgehalt, Anschaulichkeit, sowie Zugänglichkeit für verschiedene Lerntypen.[16] Dies zeigt, dass die Auseinandersetzung mit der Rolle und Wirkung digitaler Medien für Unterricht, Lernen und Lernprozesse einen wesentlichen Stellenwert für die Lehrerarbeit haben sollte. Das führt zur Motivation, die Chancen und Risiken digitaler Medien für die Arbeit im Geographieunterricht zu untersuchen. Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit lässt sich in weitere Unterforschungsfragen ausdifferenzieren:
Welchen didaktisch-methodischen Prinzipien unterliegt Geographie?
Worin begründen sich diese Unterrichtsprinzipien?
Welche Bedeutung haben Medien für Unterricht, Lernen und Lernprozesse?
Welche Merkmale zeichnen klassische und digitale Medien aus?
Welche Vor- und Nachteile folgen aus dem Lernen mit digitalen Medien?
Womit kann der Einsatz digitaler Medien im Geounterricht legitimiert werden.
Welche Chancen und Risiken für die Arbeit im Geographieunterricht können aus der Verwendung digitaler Medien abgeleitet werden?
1.3 Methodik und Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Arbeit nimmt mit der onlinebasierten Lernplattform „geo:spektiv“, der Lern-App „Dynamic Plates“, der VR-Software „Expeditions“ und der AR-App „TamAR“ vier Lernmedien unter der Fragestellung in den Blick, inwiefern diese in den Geographieunterricht integriert werden können, welche Leistungen sie dabei für Unterricht und Lernen erbringen und welche didaktischen Herausforderungen auftreten können.
Es handelt sich um eine Theoriearbeit. Die Analyse, die sie anstrebt, ist argumentativ-deduktiver Art und wird anhand thematisch relevanter Forschungsliteratur vorgenommen. Bei der Thematik handelt es sich um relatives Neuland. Zwar wurden bisher vielfältige allgemeine Abhandlungen über die prinzipielle Eignung, sowie über die Vorzüge und Herausforderungen digitaler Medien im Schulunterricht verfasst, jedoch wurden diese Aussagen selten anhand konkreter Untersuchungen von Medien und noch seltener im Kontext der speziellen Ziele und Anforderungen des Geographieunterrichts belegt. Aus diesem Grund wird auch auf Literatur und empirische Befunde aus den Forschungsfeldern Medienpädagogik und E-Learning zurückgegriffen, um deren Erkenntnisse auf die Geographiedidaktik zu übertragen. Die Untersuchung wird von folgenden einschränkenden Parametern begrenzt: Bildungs- und Erziehungsziele des Faches Geographie, sowie methodische Forderungen an den Unterricht werden auf Bundesebene (gerade in Bezug zur Digitalisierung des Lernens) auf Basis der KMK-Strategiepapiere und auf Landesebene auf Grundlage des Sächsischen Lehrplanes des Fach Geographie für die Oberschule herausgearbeitet.
2 Theoretische Grundlagen
Als Grundlage der Untersuchung der Eignung digitaler Medien für die Arbeit im Geographieunterricht erfolgt vorab eine Bestandsaufnahme des gegenwärtigen Verständnisses geographischer Bildung und Erziehung, sowie des Unterrichtens im Fach Geographie. Methodisch-mediale Entscheidungen im Rahmen der Unterrichtsplanung können nur auf Grundlage von Kenntnissen über Lernen und Lernprozesse erfolgen. Daher ist die Untersuchung der Bedeutung von Medien für Unterricht und Lernen ein wichtiger Ausgangspunkt zur Analyse der Leistung klassischer und digitaler Unterrichtsmedien im Fach Geographie. Außerdem sollen Aspekte aufgezeigt werden, welche einen kritischen Medienumgang und die Notwendigkeit von Medienkompetenz bedingen.
2.1 Geographie als Wissenschaft und Schulfach
Die didaktisch-methodische Unterrichtsplanung wird neben Faktoren auf Ebene der Lerner von den fachlichen und überfachlichen Bildungs- und Erziehungszielen bestimmt. Gegenstand dieses Kapitels ist es, die Ziele und Inhalte des Geographieunterrichts, sowie die Besonderheiten geographischen Lehrens und Lernens aufzuzeigen.
2.1.1 Gegenstand und Ziele der Wissenschaft Geographie
Kestler verweist darauf, dass die Grundlage eines Schulfaches immer in seiner Fachwissenschaft liegt, wobei sich deren Erkenntnisse, Fragestellungen, Perspektiven und Fachmethoden auf das Schulfach auswirken und dessen fachliche Bildungsziele beeinflussen.[17] Daher ist es zunächst notwendig sich mit der Fachwissenschaft Geographie auseinanderzusetzen um sich dem Kern des Schulfaches Geographie anzunähern. Borsdorf definiert die Wissenschaft Geographie wie folgt:
„Die Geographie erfasst, beschreibt und erklärt die Geosphäre im Ganzen und in ihren Teilen nach Lage, Stoff, Form und Struktur, nach dem Wirkungsgefüge von Kräften, das in ihr wirksam ist und nach der Entwicklung, die zu den gegenwärtigen Erscheinungsformen und -strukturen geführt hat. Als angewandte Geographie schreibt sie die Entwicklungen in die Zukunft fort, bewertet diese und versucht, Hilfen für die Gestaltung des Raumes in der Zukunft zu geben.“[18]
Allerdings ist der Erdraum von seinem Erdinneren bis hoch in die Atmosphäre viel zu groß, vielfältig und komplex ist, als das er in der Gesamtheit erforscht werden kann. Der regionalgeographische Ansatz unterteilt den Erdraum in funktionale Einheiten aller Geofaktoren und untersucht diese hinsichtlich ihrer Individualität. Der allgemeingeographische Ansatz untersucht die Erdräume hinsichtlich der einzelnen Geofaktoren und versucht übertragbare Regelhaftigkeiten abzuleiten. Dabei wird in die physische Geographie, welche die Erforschung der natürlichen Umwelt ins Zentrum stellt, und die anthropologischen Geographie, welche das raumbezogene menschliche Handeln untersucht, untergliedert.[19]
2.1.2 Lehr- und Lernziele des Schulfaches Geographie
Kestler betont weiter, dass ein Schulfach nie nur das verkleinerte Abbild seiner Fachwissenschaft und ihrer Teildisziplinen darstellen darf, denn dies ließe den Erziehungsauftrag der Institution Schule außen vor. Deshalb werden die fachlichen Bildungsziele immer um Ziele auf der Werte-, Normen- und Verhaltensebene ergänzt, welche die fachlichen Erziehungsziele beschreiben.[20] Die Ziele und Aufgaben des Fach Geographie als Beitrag zur allgemeinen Bildung und Erziehung, sowie fachspezifische Ziele und Lerninhalte der Klassenstufen sind in den Lehrplänen der Bundesländer definiert. Der sächsische Lehrplan unterscheidet die Zielebenen geographischen Bildung und Erziehung in Fachwissen, Fähigkeiten, sowie Werte und Normen.[21] Diese Kompetenzzielorientierung strebt die Aneignung anwendungsfähigen Wissens an, also auf Kenntnissen und Erfahrungen aufbauende Fähigkeiten und Fertigkeiten, die zielführendes Handeln, sowie bewusstes Reflektieren von Einstellungen und Werten ermöglichen.[22] Fachwissen (Richtziel: Kenntnis von Raumstrukturen und Raumprozessen, sowie topographischen Orientierungswissens und räumlicher Ordnungsvorstellungen[23]) bildet dabei die Grundlage zur Anwendung fachmethodischer Kompetenzen (Richtziel: Aneignung geographischer Denk- und Arbeitsweisen, sowie Kommunikationsfähigkeit unter Anwendung des Fachwortschatzes[24]), welche zu einer raum- und sozialgerechten Handlungsbefähigung und Handlungsbereitschaft (Richtziel: raumbezogene Handlungs- und Sozialkompetenz[25]), sowie zur Ausbildung einer verantwortungsbewussten und solidarischen Werthaltung führen sollen.[26] Mit Verweis auf die „Bildungsstandards im Fach Geographie“ der Deutschen Gesellschaft für Geographie müssen die Ziele geographischer Bildung und Erziehung des sächsischen Lehrplanes um Moralkompetenz ergänzt werden, welche sich in der „Aufgeschlossenheit für ethische Kategorien, Schönheit und Vielfalt der Natur, Anerkennung der Gleichwertigkeit aller Völker und Kulturen sowie der Gleichberechtigung aller Menschen“[27] äußert.[28] Die DGfG beschreibt das übergeordnete Richtziel des Geographieunterrichts insgesamt als