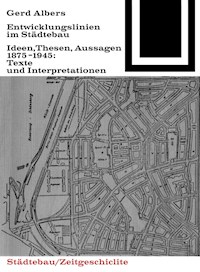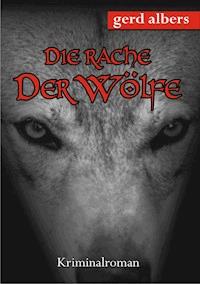22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wissenschaftliche Buchgesellschaft (WBG)
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Gerd Albers zählt zu den renommiertesten Autoren, Forschern und Lehrern in Fragen der Disziplin Städtebau. Trotz seinen international anerkannten und bis heute wegweisenden Aussagen zu Themen und Fragestellungen der städtebaulichen Planung gab es bisher keine der Fachöffentlichkeit zugängliche Sammlung seiner Schriften. Mit "Gerd Albers - Beiträge zum Städtebau in Wissenschaft und Praxis" erscheint erstmals ein Fachbuch, in dem ausgewählte Texte von Gerd Albers in gesammelter Form erneut publiziert werden. Die Veröffentlichung enthält einen beispiellosen Fundus an Erkenntnissen und Empfehlungen im Themenfeld der städtebaulichen Planung und bietet, gerade mit Bezug zu heutigen städtebaulichen Herausforderungen, sowohl Fachleuten als auch allgemein städtebaulich interessiertem Publikum eine interessante Lektüre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Institut für Städtebau und Wohnungswesen (Hrsg.)
Gerd Albers
Beiträge zum Städtebau in Wissenschaft und Praxis
Impressum
Der Herausgeber hat die Urheber- und Nutzungsrechte der Texte und Bilddateien die in der vorliegenden Publikation abgedruckt sind nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und eingeholt. Sollte es Urheber- bzw. Nutzungsrechte geben die wir nicht erkannt haben oder nicht erkennen konnten, so bitten wir die Rechteinhaber um Nachsicht sowie zur Klärung um Kontaktaufnahme mit dem Institut für Städtebau und Wohnungswesen in München.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographischeDaten sind im Internet über http://dnd.d-nb.de abrufbar
wbg Academic ist ein Imprint der wbg© 2020 by wbg (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), DarmstadtDie Herausgabe des Werkes wurde durch dieVereinsmitglieder der wbg ermöglicht.Satz und eBook: SatzWeise, Bad Wünnenberg
Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de
ISBN 978-3-534-27234-1
Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich:eBook (PDF): 978-3-534-27281-5eBook (epub): 978-3-534-27282-2
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Buch
Impressum
Inhalt
Vorwort
Kurzbiographie
Gerd Albers im Profil
Geistesgeschichtliche Entwicklung des Städtebaus, Der Wandel der Wertmaßstäbe im 19. und 20. Jahrhundert
Modellvorstellungen zur Siedlungsstruktur in ihrer geschichtlichen Entwicklung
Erneuern, Bewahren, Verändern – Alternativen für die Umwelt?
1961–1978: Ein Sechsteljahrhundert Städtebau
Ziele, Aufgaben, Methoden, Ziele, Aufgaben, Methoden, Probleme der Stadtplanung
Wandel und Kontinuität im deutschen Städtebau
Das Stadtplanungsrecht im 20. Jahrhundert als Niederschlag der Wandlungen im Planungsverständnis
Über den Rang des Historischen im Städtebau
Stadtgestaltung ohne Leitbild
Zur Lage: 25 Jahre Bundesbaugesetz
Tendenzen der Stadtentwicklung in Europa
Lehre für die Stadtplanung im Wandel
Über den Wandel der Wertmaßstäbe im Städtebau – Blick auf die letzten fünf Jahrzehnte
Vorwort
Wer bisher einen Aufsatz, einen Artikel oder zur wissenschaftlichen Bezugnahme vielleicht sogar zum Vergleich mehrere Texte von Gerd Albers, dem wohl renommiertesten, international anerkannten Autor, Forscher und Lehrer zu allen Fragen der Disziplin Städtebau lesen oder zitieren wollte, musste sich in der Regel auf eine aufwändige Suche nach unterschiedlichsten Veröffentlichungen begeben.
Trotz seiner weiterhin wegweisenden Aussagen zu Themen und Fragestellungen städtebaulicher Planung, die bis heute hoch aktuell erscheinen, gab es keine der Fachöffentlichkeit zugängliche Sammlung seiner Schriften.
Nun haben sich die Professoren Alexander Papageorgiou-Venetas und Thomas Sieverts, langjährige Freunde ihres Kollegen Gerd Albers und mit diesem zudem in gemeinsamer Mitgliedschaft der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung verbunden, der Mühe unterzogen, über ihr individuelles Interesse an einzelnen Texten hinaus, mit großer Sorgfalt etliche an unterschiedlichen Orten und von ebenso unterschiedlichen Institutionen publizierten Texte systematisch zusammen zu stellen.
Das Institut für Städtebau und Wohnungswesen (ISW), das überdies 30 Jahre von 1962 bis 1991 durch Gerd Albers geleitet und in seinem republikweiten Renommee geprägt wurde, hat sich sehr über das Angebot der beiden Wissenschaftler gefreut, diese Sammlung als einen beispiellosen Fundus an Erkenntnissen und Empfehlungen für Fortbildung und Forschung in der vorliegenden Form zu veröffentlichen.
Dass diese nun in gesammelter Form erneute Publikation der Erkenntnisse und Überzeugungen dieses außergewöhnlichen Wissenschaftlers zudem kurz nach dem Jahr erfolgt, in welchem sich sein Geburtstag zum hundertsten Mal gejährt hat, hat als weiterer, schöner Aspekt das Vorhaben bestärkt.
Den beiden angesprochenen Kollegen, die ihre Forschung aus eigener Initiative, rein ehrenamtlich und noch bis kurz vor deren Abschluss ohne die Sicherheit einer angemessenen Verbreitung ihres Arbeitsergebnisses betrieben haben, und die die Hauptlast der angesprochenen Suche wie der Aufbereitung und Interpretation der Texte trugen, ist herzlich zu danken!
Ebenso gebührt Martin Albers, dem Sohn, selbst in Zürich erfolgreich als freischaffender Städtebauarchitekt tätig und Erbe des Nachlasses seines Vaters für seine Unterstützung ganz besonderer Dank.
Darüber hinaus ist der Landesgruppe Bayern der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung e. V. und Thomas Sutor, Geschäftsführer von Oliv Architekten in München für die finanzielle Unterstützung dieser Veröffentlichung zu danken.
Schließlich ist diversen Verlagen und weiteren Trägern jeweiliger Veröffentlichungsrechte für ihre freundliche Bereitschaft zu danken, diese zugunsten der Vollständigkeit der Sammlung an das ISW zu übertragen.
Im Gegenzug möchten wir als von Bund und Freistaat Bayern gefördertes städtebauliches Institut auch mit der Publikation unserem allgemeinen Fortbildungsauftrag gerecht werden. Wir werden deshalb die Bibliotheken von Hochschulen, Akademien und Verbände, deren Tätigkeitsfeld auf Fragen zu Städtebau und Stadtplanung orientiert ist, mit Musterexemplaren ausstatten und erhoffen uns, dass die Texte verbreitet Gegenstand fachlicher Diskussionen und Lehrveranstaltungen sein werden.
Leserinnen und Lesern wünschen wir eine für sie erkenntnisreiche und gleichermaßen spannende Lektüre.
Prof. Julian Wékel
Sarah Dörr
Direktor
Wissenschaftliche Referentin
Institut für Städtebau
Institut für Städtebau
und Wohnungswesen
und Wohnungswesen
© HCU Hamburg/Foto: T. Preising
Kurzbiographie
Gerd Albers wurde 1919 in Hamburg geboren. Nach einem fast zehnjährigen Kriegsdienst bei der Marine nahm Albers mit 27 Jahren sein Architekturstudium in Hannover auf, das ihn später auch an das Illinois Institute of Technology in die USA führte.
Nach beruflichen Stationen in Ulm, Trier und Darmstadt sowie der Promotion an der RWTH Aachen, wurde Gerd Albers 1961 an die damalige Technische Hochschule München (heute Technische Universität München) berufen. Albers folgte dem Ruf und gestaltete die Lehre am Lehrstuhl für Städtebau, Orts- und Landesplanung in den folgenden knapp 27 Jahren. Darüber hinaus wirkte Albers als Dekan und Prodekan der Fakultät Architektur sowie von 1965–1968 als Rektor der Technischen Hochschule München.
Über seine wissenschaftliche Lehrtätigkeit hinaus war Gerd Albers u.a. von 1962–1991 als Direktor des Instituts für Städtebau und Wohnungswesen, von 1985–1991 als Präsident der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung e. V. sowie als Präsident der Bayerischen Akademie der Schönen Künste und der ISOCARP – Internationale Gesellschaft der Stadt- und Regionalplaner aktiv.
Sein Bestreben zur Weiterentwicklung der Lehre führte 1967 zur Einrichtung eines städtebaulichen Aufbaustudiengangs an der Technischen Hochschule München. Darüber hinaus war Albers als Senator an der Gründung der Technischen Hochschulen in Dortmund und Hamburg-Harburg beteiligt.
Gerd Albers engagierte sich Zeit seines Lebens für die Fachdisziplin und verfasste eine Vielzahl wissenschaftlicher Beiträge und Fachbücher zu den Fragen des Städtebaus und der Stadtentwicklungsplanung. 2010 wurde Albers mit dem ersten Ehrendoktortitel der HafenCity Universität für sein Lebenswerk ausgezeichnet.
Gerd Albers im Profil
Ein unvoreingenommener Geist, ein ruhig abwägender Zeitgenosse, ja ein ausgeglichener Humanist unserer Tage, war und ist zeitlebens Gerd Albers als Planer geblieben. Das für das Gemeinwohl Wünschenswerte, aber besonders auch das unter den obwaltenden Umständen Machbare, bedingten seine Zielsetzungen. In den langen Jahren seiner Lehrtätigkeit, seiner Vorträge und seiner vielfältigen Gremien- und Beratungstätigkeit seit seiner Doktorarbeit im Jahr 1957 hat er ohne Unterlass über Stadtplanung als Tätigkeit, als Beruf und als Wissenschaft nachgedacht und publiziert.
Im Laufe dieser langen Zeit, aber auch darüber hinaus, ist er in Deutschland, eine allgemein anerkannte Autorität der Begriffsklärungen, der ordnenden Geschichtsdeutung, der sich vom Tagesgeschehen mit seinen modischen Wellenschlägen distanzierenden Reflektion – eine Autorität, die unter den Aufregungen des Tages die kontinuierlichen geistigen Grundströmungen zu erfassen und festzuhalten suchte. So ist er im Laufe seines langen Lebens zum großen Konsensstifter in der sich gerade heraus bildenden Disziplin geworden und gilt mit seinen Schriften und Vorträgen als eine Art von Klassiker.
Als Hauptaufgabe der Stadtplanung sieht er die Suche nach Ordnung und Ausgewogenheit in Stadt und Gesellschaft. Räumliche Ordnung versteht er als Voraussetzung für die Vielfalt und den Reichtum städtischen Lebens; keineswegs sieht er in ihr eine Einschränkung der Freiheit. Ein Meister seines Faches, führt er einen permanenten Kampf für klare inhaltliche Festlegung von Aufgaben, Zielen, Methoden und Instrumenten der Planung.
Mit scharfem Blick, fern von jedem selbstgefälligen Dünkel, erforscht Albers das Selbstverständnis der planenden Zunft. Das geschriebene und mehr noch das öffentlich vorgetragene Wort sind seine Waffen. Seine Sprache ist klar und jeglicher modischer Wortschöpfung abhold, seine Argumentation deduktiv: soziale Gegebenheiten in ihrem geschichtlichen Zusammenhang, vorherrschende Wertmaßstäbe in der Gesellschaft, politische Bedingtheiten werden aufgespürt, wobei sich vor diesem Hintergrund die jeweiligen Zielsetzungen der räumlichen Planung abzeichnen.
Diese sind, den Notwendigkeiten folgend, in permanentem Wandel begriffen. So kann Stadtplanung, nach Albers, nicht auf ein abgeschlossenes Ergebnis – wie die Architektur – zielen. Stadtplanung, wie übrigens jegliche Planung, ist ein offener, sich stets durch Rückkoppelung selbst überprüfender und sich den Entwicklungen anpassender Steuerungsprozess. Dieser erbringt dabei nur bedingt bleibende Leistungen, da seine Aufgabe nicht darin bestehen kann, den Plan eines erwünschten Endzustandes zu erarbeiten; denn Stadtentwicklung kennt keinen Endzustand.
So ist ein weiterer Wesenszug der Gedankenwelt von Gerd Albers die historische Relativierung: Fast nichts in der Stadt ist auf Dauer angelegt, alles ist in Bewegung. Das erkennt man ganz besonders im Zeitraffer der Geschichte. Stadtplanung ist ja gerade ein Instrument, die Stadt beweglich zu halten, freilich im Rahmen einer übergreifenden robusten Ordnung. Diese geschichtsgesättigte Erkenntnis sollte dem Praktiker helfen, den Widerspruch auszuhalten, vielleicht sogar produktiv zu machen: einerseits ein Werk in seiner Qualität auf Permanenz auszurichten, andererseits für zukünftige, zwangsläufige Veränderungen an diesem Werk offen zu bleiben.
Im Stadtplaner – als dem räumlich geschulten Spezialisten und zugleich Koordinator einer multidisziplinären Arbeitsgruppe – sieht Albers einen bona fide gesellschaftlichen Agenten, einen „ehrlichen Makler“, der die vermittelnde Rolle zwischen legitimen jedoch oft kontroversen Interessen übernimmt. Seine Aufgabe ist nicht das Aufdrängen eines autoritativen räumlichen Konzepts, sondern die Ausarbeitung eines konstruktiven gesellschaftlichen Kompromisses zur jeweiligen Umweltgestaltung. Er kann diese Rolle nur positiv und kreativ ausfüllen, wenn er nicht den bequemen, jedoch faulen Kompromiss sucht, sondern bei aller Konsensfähigkeit eine Vorstellung von der „guten Stadt“ verfolgt, die ihren Fluchtpunkt in der Utopie einer guten Gesellschaft hat.
Wer in der räumlichen Planung einen offenen Prozess und im Planer einen Vermittler sieht, ist wenig dazu geneigt, sich der Stadtbaugeschichte als kritischer Darstellung realisierter Stadtkonzepte zu widmen. So ist das Anliegen Albers nicht, was erdacht, geplant und erbaut wurde, zu erforschen, sondern vielmehr das Wie, d.h. nach welchen Prinzipien und Vorgängen geplant wurde. Er widmet sich so der deutschen und europäischen Planungsgeschichte. In diesem Kontext betreibt er eigentlich geistesgeschichtliche Untersuchungen im Felde der Stadtplanung und wird zum kompetentesten Exegeten in der diesbezüglichen Forschung – ein Mentor seiner Planer-Generation!
Von unterschiedlichen Standpunkten aus untersucht Albers das Vorgehen der Stadtplanung. Er widmet sich besonders dem zeitbedingten Wechsel der Rangordnung der Werte. So erkennt er eine Verlagerung in historischer Folge, von anfangs technisch-hygienischen, dann zu gestalterisch-ästhetischen, später zu wirtschaftlich-funktionellen und zuletzt zu sozialen und sozialpsychologischen Aspekten und Prioritäten.
Ein wichtiger Teil dieses Wandels ist die Relativierung der Werte, mit der sich Gerd Albers immer wieder beschäftigt hat. Seine Erkenntnisse zu diesem Wandel könnten auf den Praktiker ernüchternd wirken, weil die Dauer der Anerkennung solcher Werte, wie Gerd Albers zeigt, erstaunlich kurz sein kann, denken wir z.B. an die Werte der Postmoderne. Wir sollten aber den Praktiker ermutigen, die eigenen Werte auf ihren Gehalt und ihre geistige Verankerung daraufhin zu prüfen, ob sie mehr als eine oberflächliche Mode darstellen. Nach einer solchen Prüfung kann er mit seinem Werk selbstbewusst den Werten seiner Zeit verpflichtet sein, in der Hoffnung, dass sein Werk in naher und ferner Zukunft als wertvoller Zeitzeuge geachtet und geschützt wird.
Als ideellen, aber auch tatsächlichen „Bauherrn“ der Planungsaufgabe sieht er die Gesellschaft, vertreten durch ihre lokalen und nationalen Repräsentanten, die jedoch oft, in den politischen Kontroversen verwickelt, ihre Führungsrolle einbüßen. Umso mehr hebt er deshalb die Rolle des Stadtplaners als potenziellen Gesellschaftsreformer hervor. Diesen, sowie die direkte Bürgerbeteiligung am Planungsprozess, betrachtet Albers als Vertreter und Verfechter der gesellschaftlichen Belange, als eine Art von „Bauherrenersatz“.
Bevorzugtes Thema seiner Forschungen sind die unterschiedlichen Auffassungen zur Strukturordnung der Stadt, die er in graphisch-schematischer Form darstellt: Art der Flächennutzung, Anlage der Infrastrukturnetze sowie Dichteverhältnisse (in ihrer gegenseitigen Abstimmung zum Aufbau des Stadtgefüges) fasst er in drei wesentliche Strukturmodelle zusammen, nämlich der Punkt-, Band-, bzw. Flächenstadt, die ihrerseits eine beträchtliche Anzahl von Mischtypen erzeugen.
Dabei lässt Albers alle erdachten Konzepte für eine ordnende Gliederung der Stadt nebeneinander gelten. Parteinahme für einzelne Modelle oder Ablehnung anderer werden gemieden. Sein Urteil folgt nicht dem eindimensionalen Denken des gestalterischen Wollens, sondern der pluralistischen Logik der alternativen Lösungsansätze. Seine Aufgabe sieht er weniger in der Konzeption raumplanerischer Entwürfe, sondern eher in deren Interpretation.
Allen stadtplanerischen Bestrebungen billigt er eine legitime ideologische, ja sogar utopische Dimension zu: „Utopie“ verstanden als idealisiertes Zielbild einer künftigen Ordnung und „Ideologie“ als Vorstellung eines Wirkungszusammenhanges zwischen menschlichem Wohlbefinden, den dazu dienlichen Umweltbedingungen und den zu ihrer Herbeiführung geeigneten Mitteln.
Ein weiteres Anliegen im Denken von Gerd Albers gilt den Leitvorstellungen in der Stadtplanung. So misstrauisch er den Leitbildern gegenübersteht, insbesondere, wenn sie sich zu vermeintlich anschaulichen, materiell konkretisierten Abbildern verfestigen, so offen ist er jenseits aller Ideologiekritik gegenüber der „Utopie“. Hier verlässt Gerd Albers seine relativierende Skepsis und macht Mut zu einem die Pragmatik transzendierenden Denken, so dass die Arbeit in Städtebau und Stadtplanung nicht Gefahr läuft, banal und geistlos zu werden.
Reserviert, ja misstrauisch betrachtet Albers die periodisch auftretenden, unbegründeten Pendelschwünge des Interesses der Planer, das sich von stadtstrukturellen zu stadtgestalterischen Fragen bewegt. Dazu verweist er auf Goethes Überzeugung, dass man das, was man den Geist der Zeiten heißt, im Grunde der Herren eigner Geist ist, in dem sich die Zeiten bespiegeln. Als „Herren“ versteht er hier selbstverständlich die Stadtplaner. Den aufeinanderfolgenden vorherrschenden Wellen der „Planungseuphorie“ bzw. des „Planungselends“, begegnet er mit grundsätzlicher Skepsis. Dazu wiederholte er die aphoristische Bemerkung, dass sich mit dem Erreichen bestimmter Ziele überhöhte Erwartungen verknüpfen, deren Nichterfüllung dann Enttäuschung und Abkehr von früheren Zielen auslöst.
Ein Wesenszug vieler Schriften ist, wie angedeutet, seine tiefe, gut begründete Skepsis gegenüber der Wirksamkeit von Stadtplanung. Diese Skepsis könnte mutlos machen. Aber das sollte sie nicht: die Skepsis schützt zwar vor zu großen naiven Erwartungen, aber sie sollte auch Kraft geben, eigene Ideen gut, auch ideengeschichtlich und wirtschaftlich, zu verwurzeln und ihnen Luft zu Veränderung und Anpassung zu lassen. Die Skepsis bewahrt vor zu leichtgewichtigen Ideen und ermutigt zu stichhaltigen Begründungen. Diese Form der Skepsis ist eine intellektuelle Herausforderung!
Eng mit der Skepsis verknüpft ist die Ambivalenz. Gesättigt mit historischem Wissen schützt sie vor zu viel Geradlinigkeit in der geplanten Entwicklung. Sie schärft den Blick für die notwendige Offenheit von Konzepten gegenüber nicht voraussagbaren Einflüssen und Auffassungen. Eine solche Offenheit setzt allerdings Stabilität und eine haltbare Grundordnung voraus. Ambivalenz kann auch Freiheit bedeuten, Situationen unterschiedlich, ja sogar gegensätzlich zu deuten und zu verstehen.
Große Vorbehalte entwickelt Albers besonders gegenüber der Gültigkeit von stadtgestalterischen Leitbildern. In gewisser Hinsicht vereinfachend sieht er im Wandel dieser Leitbilder eine Folge von „Modeerscheinungen“. In der oft wiederkehrenden Abwertung der Gestaltmerkmale der Stadt der jeweils unmittelbar vorangegangenen Zeit sieht er willkürliche „Dünungen“ eines weiter nicht definierten Zeitgeistes. Der Frage, welche Veränderungen im Alltagsleben, in den Verkehrsabläufen sowie in der Wahrnehmung des Stadtbildes den Wechsel der stadtgestalterischen Leitbilder entstehen lassen, widmet er sich nicht. Dafür erinnert er an Julius Poseners Bemerkung, dass die Gestaltung des öffentlichen Raumes sowie der ihn gliedernden Baukörper oft entweder der Darstellung oder der Verschleierung der politischen Macht dienen. Überhaupt zweifelt er an der Möglichkeit eines Konsenses über Gestaltungsgrundsätze. Lapidar betont er, dass Stadtplanung Leitzielen und nicht Leitbildern verpflichtet sei. Als unserer Zeit angemessenes Planungsziel schwebt ihm eine „studied irregularity“ (wohlüberlegte und ausgewogene Ungleichförmigkeit) der Stadtgestalt vor.
Das Wesen der Stadt ist für Albers eine Art Palimpsest, eine Aufeinanderschichtung sukzessiver Planungs- und Bauphasen. Dies führt ihn zu Überlegungen über „den Rang des Historischen im Städtebau“. Kontinuität und Wandel sind einander ergänzende Wesenszüge der Stadt. Dementsprechend ist Stadtplanung hauptsächlich „auf Steuerung oder gar Herbeiführung von Veränderungen ausgerichtet“, aber auch um die Bewahrung des Bestandes bemüht, der die Unverwechselbarkeit der Stadtidentität sichert. Denn Veränderungen führen nicht immer zu Verbesserungen. Dabei ist die Identität der Stadtgestalt nicht nur durch den Schutz erhaltenswerter Bauten zu sichern, sondern auch im Respekt des überlieferten Stadtgrundrisses, in der Einordnung des Stadtgefüges in die Landschaft sowie in der Stadtsilhouette zu finden. Am meisten aber wird – so Gerd Albers – der bauliche Maßstabsbruch einer neuen Zeit dem Bestehenden zum Verhängnis.
Zusammenfassend erinnert Albers daran, dass die Stadtplanung in Westeuropa seit 1860 bis zum heutigen Tage durch verschiedene Phasen ihres Selbstverständnisses gegangen ist. In einer langen Anfangsphase bis etwa 1960 wird die Stadtwerdung als ein eigengesetzliches Phänomen betrachtet. Der Begriff der Stadtentwicklung wird neutral angewandt: Die Stadt entwickelt sich eigenmächtig. Dementsprechend schritt man von einer anfänglichen „Anpassungsplanung“ zu einer späteren „Auffangplanung“, wobei die wesentlichen Planungsinstrumente der Fluchtlinienplan und später die Staffelbauordnung waren.
Ab 1960 verändern sich rapide die Auffassungen. Stadtplanung wird jetzt als „Entwicklungsplanung“, als bewusster Willensakt, verstanden. Man ist davon überzeugt, die „Zukunft im Griff“ zu haben. Die Bauleitplanung wird eingeführt. Es wird auf Simulationen und Planspiele gesetzt.
Seit dem Europäischen Denkmalschutzjahr (1975) und nach den aufkommenden Zweifeln an ein grenzenloses Wachstum und dem Schwinden des Glaubens an die Zweckdienlichkeit einer „Gesamtplanung“ (comprehensive planning), erstarkt die Hinwendung zur Vergangenheit und dementsprechend zur „erhaltenden Stadterneuerung“. Das Instrument der Rahmenplanung wird vorgeschlagen.
Später, unter den Gegebenheiten der demographischen Stagnation ist von „Rückbau“ überdimensionierter Bauten und Infrastruktureinrichtungen die Rede. Das Prinzip der Reservenschonung führt zum Leitgedanken der „Nachhaltigen Entwicklung“. Angebotsplanung, „publicprivate partnership“ und ortsbezogene Teilverbesserungen (disjointed incrementalism) scheinen in den letzten Jahren das Gebot der Zeit zu sein.
Im Ganzen betrachtet, zeugen die Schriften von Gerd Albers nicht nur von sehr hoher fachlicher Kompetenz, sondern auch von umfassender enzyklopädischer Bildung und breitem geistigen Horizont. Die Unvoreingenommenheit und Ausgewogenheit seiner Argumentation wirken überzeugend. Die Klarheit der Formulierungen lässt keine Zweideutigkeiten entstehen. Allerdings bemüht sich Albers stets um eine Ausgeglichenheit und Relativierung seiner Diktion und dies führt ihn oft zu ambivalenten Äußerungen und Vorbehalten sowie zum steten Wunsch, Polarisierungen abzubauen.
So tauchen Wendungen wie „einerseits, andererseits“, „zunächst, dem gegenüber“, „wie bedingt“, „vielleicht … vielleicht aber auch“ u. s. w., immer wieder in seinen Texten auf. Dies mag ein Ärgernis für manchen engagierten und von seinen eigenen Überzeugungen geleiteten Planer sein, trägt jedoch dazu bei, die Parteilosigkeit und Sachlichkeit der Argumente zu sichern. Ein weiteres Instrument, dessen Albers sich mit Vorliebe bedient, ist die gelegentliche Zuflucht zu markanten Äußerungen in Form von Zitaten wichtiger Zeitgenossen, die dem Duktus seiner Argumentation Emphase und Gewicht verleihen sollen.
Man kann die hier vorgelegte Auswahl an Schriften unter historischer Perspektive als einen wichtigen Beitrag zur Ideengeschichte von Stadtplanung lesen. Gerd Albers’ fakten- und literaturgesättigte Deutungen der Ideenströmungen, Regelungsbemühungen und Institutionenentwicklungen werden – im Sinne eines Klassikers – immer wichtig bleiben für das Verständnis der Entstehungsgeschichte dieser jungen Disziplin.
Es wäre jedoch ratsam, beim aufmerksamen Lesen darüber hinauszugehen und zu versuchen, die Aussagen der Texte konkret anzuwenden und auf gegenwärtige Aufgaben und Situationen zu beziehen, jeweils hinsichtlich der spezifischen Interessen des Lesers sowie seiner Stellung in Beruf und Gesellschaft. So gelesen, können die Schriften von Gerd Albers auch dem Praktiker bei seiner Tagesarbeit grundlegende Orientierungen geben, die seine Arbeit im guten Sinne „solide“ machen, um ein Lieblingswort von Gerd Albers aufzugreifen.
Die hier ausgewählten Texte sollen das breite Interessen- und Ideenspektrum ihres Autors widerspiegeln. Es ist das Anliegen des Herausgebers, das vielschichtige und facettenreiche Gedankengut eines der leitenden Vordenker der Stadtplanung in Deutschland auszugsweise vorzustellen und zur Verwendung in der heutigen Wissenschaft, Lehre und Planungspraxis zugänglich zu machen. So entstand die vorliegende Textsammlung als ein verdichtetes Kompendium seiner Veröffentlichungen.
Der Band möchte auch als eine posthume Hommage an seinen forschenden Genius verstanden werden.
Alexander Papageorgiou-Venetas
Thomas Sieverts
Geistesgeschichtliche Entwicklung des Städtebaus, Der Wandel der Wertmaßstäbe im 19. und 20. Jahrhundert
Erschienen in:
Vogler P. und Kühn E. (Hrsg.) (1957): Medizin und Städtebau, Ein Handbuch für Gesundheitlichen Städtebau, Verlag Urban & Schwarzenberg, S. 180–197, Verlag Urban & Schwarzenberg, München, Berlin und Wien.
I. Einführung
Ein geschichtlicher Überblick über das Gebiet des Städtebaues wird im Rahmen dieses Werkes nicht in erster Linie die gestalterische Entwicklung zum Gegenstand haben können. So aufschlußreich und bedeutungsvoll der formale Aspekt sein mag, so bedarf er doch der Ergänzung durch eine Betrachtungsweise, die den hinter den Formen wirkenden Kräften und Ideen, den ihnen zugrunde liegenden Wertungen und Geisteshaltungen gewidmet ist. So gesehen, wird die Geschichte des Städtebaues zu einem Beitrag zur Geschichte des menschlichen Selbstverständnisses.
Es soll hier versucht werden, einen Ansatz zu einem solchen Beitrag zu liefern. Der Umfang des Problems und die Fülle des Stoffes verlangen dabei eine Beschränkung in räumlicher, zeitlicher und methodischer Hinsicht. Methodisch erscheint es notwendig, sich auf die städtebauliche Literatur zu beschränken, zumal die Ausschöpfung der literarischen Quellen für das Ziel dieser Untersuchung eindeutigere Ergebnisse verspricht als die Interpretation der ausgeführten Werke, bei denen die ursprünglichen Planungsabsichten vielfach durch besondere, zum Teil zufällige Einflüsse und Bindungen überlagert werden. Über die reine Fachliteratur hinaus sollen auch solche Schriften einbezogen werden, die sich von anderen Blickpunkten aus mit dem Städtebauer und seinem Arbeitsgebiet beschäftigen.
Aus diesem Verfahren läßt sich zugleich der zeitliche Rahmen der Arbeit ableiten: die städtebauliche Problematik muß drängend und komplex genug geworden sein, um zur Entstehung einer eigenen Literatur zu führen, ehe die Untersuchung einsetzen kann. Dieser Zeitpunkt ist in Deutschland um 1870 erreicht, als die Konsequenzen der Industrialisierung mit aller Deutlichkeit sichtbar werden. Das außergewöhnliche Anwachsen der Städte, die zur Regel werdende Trennung von Wohn- und Arbeitsstätte, der Strukturwandel von der Bürger- zur Arbeiterstadt lassen überhaupt erst einen wesentlichen Teil der Aufgaben entstehen, die heute dem Städtebau gestellt sind. So ist es gerechtfertigt, diese Zäsur der industriellen Revolution als Ausgangspunkt zu wählen.
Auch für die räumliche Beschränkung ergibt sich ein Anhalt aus dem vorher Gesagten. Es sind die Zentren der Industrialisierung, in denen eine bedeutende städtebauliche Literatur entsteht: die großen Länder Mittel- und Westeuropas und die Vereinigten Staaten von Amerika. Eine Konzentration auf die deutsch-, englisch- und französischsprachige Literatur erscheint daher begründet, zumal mit ihr der Großteil aller städtebaulichen Theorie erfaßt ist. Wenn in dieser Untersuchung abstrahierend von „dem Menschen“ gesprochen wird, so ist auch dieser Begriff auf die erwähnten räumlichen und zeitlichen Grenzen bezogen.
Innerhalb des so abgesteckten Rahmens geht es also nicht um die gestalterischen und technischen Ergebnisse, nicht um den „Fortschritt“ auf dem Gebiete des Städtebaues, sondern es geht um die Erforschung der geistigen Einstellung zu den städtebaulichen Aufgaben, um die Untersuchung der Wertsetzungen.
Daß es sich in der Tat um Wertsetzungen handelt, ist erst allmählich klarer erkannt worden. Gurlitt fordert 1920 – wie mir scheint, erstmalig –, der Städtebauer müsse vor allem ein Mann sein, der „den Wert der Dinge zu schätzen und gegeneinander abzuwägen“ wisse.1 Ähnlich verlangt in jüngster Zeit Bardet vom Städtebauer „unbestechliche Wissen, schöpferische Begeisterung und Wahl der Wertmaßstäbe“,2 und Mumford definiert Planung als einen Auswahlvorgang, der Wertung und Entscheidung fordere, und zwar auf der Grundlage einer „kritischen Vergegenwärtigung – und Revision – der gängigen Wertmaßstäbe“.3 Vielfach jedoch nimmt der Städtebauer den Rahmen, innerhalb dessen er seine Arbeit leistet, als gegeben hin, ohne die Abhängigkeit der technischen Lösung von den „gängigen Wertmaßstäben“ zu erkennen, geschweige denn an deren Revision zu denken; in anderen Fällen geht er von einer eigenen, abweichenden Wertordnung aus – manchmal ohne sie klarzulegen oder zu begründen –, und häufiger, als man vielleicht erwarten sollte, entpuppt sich der Städtebauer als ein Gesellschaftsreformer, der nicht nur die Städte, sondern mit ihnen die Welt verändern will.
Sobald man diese Zusammenhänge erkannt hat, liegt die Frage nahe, ob es dem Städtebauer allein überlassen bleiben sollte, die Wertmaßstäbe für seine Arbeit zu wählen: dieses Problem, das erst jetzt ins Bewußtsein der Öffentlichkeit zu dringen scheint, wird abschließend zu erörtern sein.
II. Chronologischer Überblick
[Das 19. Jahrhundert] Untersucht man die Frage, wie sich der Städtebau des 19. Jahrhunderts mit dem Anwachsen der Städte auseinandersetzt, so ergibt sich, daß eine Gesamtschau fast vollständig fehlt. Städtebau ist ein technisches Beginnen, das bezeichnenderweise „Stadterweiterung“ heißt – ein partikulares Problem. Vereinzelt nur begegnet man einer umfassenderen Sicht der Dinge wie sie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Owen und Fourier zu eigen ist; beide erkennen zumindest in Umrissen die Forderung des industriellen Zeitalters nach einer neuen Lebensform. Ihre Vorschläge, die auf die Neugründung zahlreicher landwirtschaftlichindustrieller Siedlungen mit bis zu 2000 Einwohnern und sozialistischer Gesellschaftsordnung hinauslaufen, bleiben jedoch, von unbedeutenden Ansätzen abgesehen, Theorie. Die Wirklichkeit sieht ander aus und zeichnet sich zuerst in England mit voller Klarheit ab. Von ihr schreibt Schinkel:
„Die ungeheuren Bau-Massen in Manchester, bloß von einem Werkmeister ohne alle Architektur und nur für das nackteste Bedürfnis allein aus rotem Backstein, machen einen höchst unheimlichen Eindruck.“4
Weist auch das Wort „unheimlich“ über das rein ästhetische Urteil hinaus, so scheint doch Schinkel so wenig wie die anderen Architekten seiner Zeit erkannt zu haben, welche Aufgaben die neue wirtschaftliche und soziale Entwicklung gerade den Architekten stellte. Kennzeichnend dafür ist die im Jahre 1841 ausgesprochene Ablehnung des Berliner Architekten-Vereins, einen Wettbewerb für Arbeiterwohnungen durchzuführen, weil eine solche Aufgabe zu wenig architektonisches Interesse biete5.
Aber auch dort, wo das architektonische Interesse ansprechbar ist, beschränkt es sich auf das Einzelbauwerk, seine Formensprache und seinen Bedeutungsinhalt. Die Gestaltung der Stadt in ihrer Gesamtheit wird als Problem kaum gesehen, geschweige denn bewältigt.
Um die Jahrhundertmitte erhebt Riehl kritisch und mahnend seine Stimme gegen die Verstädterung; seine „Naturgeschichte des deutschen Volkes“ ist ein frühes Beispiel dessen, was Geddes ein halbes Jahrhundert später als Grundlage aller Planung fordert: eine eingehende Untersuchung der Landschaft, der Bevölkerung und ihrer Lebensformen.
Zunächst allerdings kommt die gewichtigste Kritik an der städtebaulichen Entwicklung aus den Reihen der Wohnungsreformer. Der umstrittene Berliner Bebauungsplan 1861–63, der Berlin zur „größten Mietskasernenstadt der Welt“6 macht, wird später von seinem Schöpfer mit einem Hinweis auf die sozialen Vorzüge der Mietskaserne verteidigt: sie werde die Durchdringung der verschiedenen Klassen und damit die Milderung der sozialen Gegensätze fördern.7
[1879] Indessen sind es gerade die Auswüchse dieser Wohnform, auf Grund derer die Gräfin Dohna vor allem anderen verlangt, die Stadtgemeinde in ihren verschiedenen Schichten solle menschlich wohnen, wobei sie den Begriff des Wohnens auf Grünflächen und Erholungsstätten ausgedehnt wissen möchte.8 Vom Städtebauer fordert sie als Grundlage seiner Arbeit eine „ungefärbte, redliche, humane Gesinnung auf christlichem Grunde“ und verlangt zugleich nach einer „gesunden Theorie über die Architektur der Großstädte sowie der Städte überhaupt“.9
Zwei Jahre später veröffentlicht Baumeister ein Buch, das als erster Ansatz zu einer solchen Theorie gewertet werden kann;10 es trägt zwar in erster Linie den Charakter eines technischen Lehrbuches, deutet jedoch zugleich eine Kritik am Stadtwachstum und eine Einbeziehung sozialer Fragestellungen an. Während die künstlerische Seite nur gestreift wird, da Schönheit „im vulgären Sinne“ Mehrkosten bedeute, erfahren die technisch-hygienischen Probleme eine ausführliche Würdigung. Ganz allgemein werden bis zum Ende der achtziger Jahre städtebauliche Fragen in erster Linie unter diesem Aspekt gesehen; Empfehlungen und Resolutionen zum Städtebau gehen bezeichnenderweise fast ausschließlich vom „Deutschen Verein für öffentliche Gesundheitspflege“ aus.
Das ästhetische Problem der Großstadt, vom Techniker noch nicht erkannt, wird von Lotze in seiner „Geschichte der Ästhetik“ angeschnitten; er sieht in den Gebäuden der Stadt „Geschäftsraum oder … Herberge einer veränderlichen Bevölkerung, die hier nicht verlangen kann, ihre individuelle Eigenart in äußerlicher Erscheinung vollständig auszuleben.“11 In seiner Forderung, dem Massenleben entsprechend sollten auch die Bauwerke auf individuelle Selbständigkeit verzichten, kündigt sich eine Entwicklung an, die späteren Generationen Anlaß zu schwerer Sorge gibt: die Unterdrückung des Individuums, die Förderung des Massendaseins durch die bauliche Umgebung.
[1889] Bevor jedoch diese Problematik erkannt wird, löst Sittes Buch über den „Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen“ eine allgemeine Hinwendung zu einem ästhetisch bestimmten Städtebau aus, dessen einseitige Betonung vielfach über Sittes Zielsetzung hinausgeht. Allerdings dringen diese ästhetischen Ambitionen nicht hinter die Fassade – weder die des Einzelbauwerks noch die der Stadt; als Arbeitsfeld für den Künstler fordert Sitte „nur wenige Hauptstraßen und Plätze, alles übrige mag er gerne dem Verkehr und den täglichen materiellen Bedürfnissen preisgeben.“12
Die wachsende Bedeutung des Verkehrs erhellt daraus, daß in Stübbens städtebaulichem Handbuch bei der Bewertung der verschiedenen Anforderungen an den Stadtplan der Verkehr ausdrücklich die erste, die Rücksichten auf die Bebauung die zweite Stelle erhalten; nicht minder wichtig als diese seien die gesundheitlichen und schließlich die schönheitlichen Anforderungen.13
Allgemein aber werden diese höher bewertet: Henrici geht es vor allem um die „praktische Ästhetik im Städtebau“, wenn auch bereits andere Bestrebungen sich andeuten. So äußert er, es sei Sache der Volkswirtschaft, im Städtebau „die Bedürfnisse klar zu legen und das Programm aufzustellen“, der Volkswirt habe „recht eigentlich in die Rolle der Bauherrschaft einzutreten“.14 Sein Vorschlag, das Stadterweiterungsgebiet in Bezirke von einer gewissen Selbständigkeit einzuteilen, ist der erste Ansatz zur heute allgemein üblichen Gliederung der Stadt – wenn auch unter ästhetischem, nicht unter soziologischem Blickwinkel entwickelt.
[1896] Einen ähnlichen Gedanken finden wir bei Fritsch, der aber mit seiner „Stadt der Zukunft“ weiter zielt: ihm geht es um die Reform der Gesellschaft. Die Großstadt ist für ihn ein wüster Häuserhaufen ohne innere Ordnung, der nur den Geist der Verwirrung und der Zuchtlosigkeit großziehen könne; durch ihre Reform will er „ordnend und richtend auf den Menschengeist zurückwirken.“15
Zugleich sieht Fritsch den Stadtplan nicht statisch, sondern entwirft ihn im Hinblick auf eine stufenweise Entwicklung, bei der die ältesten Stadtteile jeweils der Neubebauung weichen. Diese Einbeziehung des Zeitelementes steht im Gegensatz zu den üblichen Idealstadtplänen und kann als Symptom des Zurücktretens ästhetischer Gesichtspunkte gelten, unter denen ja das Unfertige, nicht in sich Geschlossene abzulehnen wäre. [1898] Im Grundsätzlichen verwandt ist Howards Konzeption der Gartenstädte, die nicht allein die Menschenballung Londons auflockern, sondern den Rahmen für eine neue und bessere Gesellschaft darstellen sollen:
„Stadt und Land müssen vermählt werden, und aus dieser freudigen Vereinigung wird neue Hoffnung, neues Leben, eine neue Kultur erwachsen.“16
Seine Gedanken, mit der Gründung von Letchworth und Welwyn Garden City in die Tat umgesetzt, wirken bis zu Englands heutigen New Towns fort; im übrigen wird zwar das ästhetische und wohnhygienische Element des aufgelockerten Wohnens im Grünen begierig aufgegriffen, das eigentliche Kriterium der Gartenstadt jedoch, die enge Beziehung von Arbeits- und Wohnstätte im Rahmen der räumlich begrenzten Stadt, nicht konsequent erstrebt, ja vielfach völlig mißverstanden.
[Die Jahrhundertwende] Um die gleiche Zeit beginnt die Großstadt ins Blickfeld der Wissenschaft zu rücken: aus Anlaß der Städteausstellung in Dresden im Jahre 1903, die den Einrichtungen des großstädtischen Lebens gewidmet ist – einem „Bereich, der in dieser Zusammenfassung noch nicht zur Darstellung gebracht worden ist“, wie man mit Stolz hervorhebt –, erscheint ein Sammelband, der sich von verschiedenen Seiten her dem Phänomen der Großstadt nähert. Die Einzelbeiträge werten in ihrer Mehrzahl die Großstadt als ein zwar noch mit gewissen Schwächen behaftetes, aber in der Entwicklung zum Guten begriffenes Gebilde, als „Bahnbrecher auf dem Wege einer aufwärts strebenden, wahrhaft sozialen Kulturentwicklung“.17Simmel allerdings kennzeichnet in seinem Beitrag den Bewohner der durch Geldwirtschaft und Verstandesherrschaft geprägten Großstadt nüchtern und kritisch: bindungslos und blasiert, verfüge er über eine Freiheit, die ihn keineswegs glücklich mache.18
Bleibt das Urteil des Soziologen Simmel wissenschaftlich-distanziert, so beweist sein Zeitgenosse Geddes – Soziologe und Biologe zugleich –, daß sich die wissenschaftliche Analyse des Bestehenden und die Aufstellung eines Programms für Planungsmaßnahmen sogar in der gleichen Person vereinen lassen. Er fordert die sorgfältige Erfassung aller Gegebenheiten, die sich auf Landschaft, Bevölkerung und Wirtschaft beziehen – „place, folk, and work“ –, und wendet sich gegen die Allzuvielen, die in der Planung nur verkehrliche und ästhetische Probleme sehen, anstatt sich „in den Geist der Stadt, ihr geschichtliches Wesen und ihre lebendige Entwicklung“ zu vertiefen.19Geddes gilt als Begründer sowohl des Planens im regionalen Zusammenhange als auch der Auffassung, daß dem sozialen Aspekt der Planung der Vorrang gebühre und daß er der wissenschaftlichen Erforschung bedürfe, anstatt – wie bisher – günstigstenfalls der gefühlsmäßigen Erfassung durch den Städtebauer überlassen zu bleiben. Geddes bleibt mit seiner engen Verknüpfung von Soziologie und Planung eine Ausnahmeerscheinung; eine mittelbare Beziehung wird durch Cooley angebahnt, der auf die Bedeutung der Primärgruppen (primary groups) für Charakterformung und Gemeinschaftsbildung hinweist. Er konstatiert das Schwinden der nachbarlichen Beziehungen in der großen Stadt des Industriezeitalters und fügt hinzu: „Wieweit dieser Wandel eine gesunde Entwicklung darstellt und wieweit eine Krankheit, ist vielleicht noch ungewiß.“20 In der Folgezeit entscheiden sich die Planer für die Deutung im Sinne der Krankheit und beginnen nach einer geeigneten Therapie zu suchen.
[1909] Gleichzeitig verstärken sich die kritischen Stimmen aus dem Bereich der Sozialpolitik, die insbesondere gegen Wohnungselend, Bodenspekulation und Grundbesitzverhältnisse gerichtet sind; in Deutschland treten vor allem Eberstadt und Damaschke hervor. Hier steht nicht das wissenschaftliche Interesse an der Stadt, sondern das soziale Verantwortungsgefühl im Vordergrund, und wenn wir einen Blick auf die der Stadt gewidmete Dichtung werfen, so ist vielfach ein ähnlicher Impuls zu spüren: Von Julius Harts Gedicht „Auf der Fahrt nach Berlin“ zu Rilkes Worten über die großen Städte – „Verlorene und Aufgelöste“ – und weiter zum lyrischen Werk Georg Heyms, in dem immer wieder der Gegensatz zwischen der dunklen, stumpfen Materie und dem Rot von Feuer und Blut das Bild der Stadt beherrscht. Die kritische Note überwiegt, wenn auch zu gleicher Zeit Loblieder auf die Großstadt gesungen werden, wie in Carl Sandburgs Gedicht „Chicago“, das die Faszination der aufstrebenden Millionenstadt widerspiegelt. In den ungebändigten Kräften der Großstadt sieht der Amerikaner seine eigene Vitalität symbolisiert, während dem Europäer die Sorge zu schaffen macht, die Großstädte könnten aufhören, Heimat zu sein. Steht daher die Kritik vielfach – wie bei Ruskin – im Zeichen einer rückwärts gerichteten Betrachtungsweise, so lassen zugleich die Utopien der zukünftigen Stadt erkennen, was an der gegenwärtigen unbefriedigend scheint: Bellamy, Morris und Wells vermitteln hier manchen aufschlußreichen Einblick.
Der kulturkritische Unterton, der in den Zeugnissen der Wissenschaft, der Sozialpolitik und der Dichtung mitschwingt, ist seit Fritsch und Howard auch in der städtebaulichen Fachliteratur vernehmbar. Schultze-Naumburgs städtebauliche Darlegungen in seinen „Kulturarbeiten“ sind zwar weitgehend von der ästhetischen Sicht Sittes bestimmt, doch verurteilt er die Stadt seiner Zeit auch vom moralischen Standpunkt aus: ein neues Ideal müsse aufgestellt werden, denn das, was uns beim Anblick unserer Städte quäle, sei nichts als der in Stein und Holz und Eisen sich offenbarende Mangel an Idealen.21
[1911] Im Zusammenhang damit findet der soziale Aspekt der städtebaulichen Arbeit zunehmende Beachtung; Marshs Formulierung, die Hinterhöfe einer Stadt und nicht die Schmuckplätze seien der wahre Maßstab ihres Wertes und ihrer Kraft22 ist dafür ebenso kennzeichnend wie Hegemanns Werk über die Berliner Städteausstellung mit seiner Betonung der sozialen Aufgabe.23
Der revolutionäre Neubeginn in Deutschland führt nach dem ersten Weltkriege zu einer Verflechtung ästhetischer Ziele und sozialer Idealvorstellungen; ihr entspringt gelegentlich – so bei Wolf – ein Streben nach Monumentalität, das jedoch bald als Mißverständnis gegenüber der sozialen Aufgabe erkannt wird.
[1921] Gleichzeitig verlagert sich das Schwergewicht der städtebaulichen Erörterungen vom ästhetischen auf das funktionelle und wirtschaftliche Gebiet; hatten volkswirtschaftliche Aspekte schon seit Henrici eine gewisse Rolle gespielt, so definiert nun Heiligenthal den Städtebau als „eine vorausschauende wirtschaftliche Tätigkeit, deren vornehmstes Werkzeug die Technik im weitesten Sinne ist“.24 Seine Konzentration auf die wirtschaftliche Seite des Städtebaues läßt ihn in seinem städtebaulichen Handbuch Sittes Hauptanliegen – die künstlerische Anordnung der öffentlichen Gebäude – mit keinem Wort erwähnen.
Die gleiche Tendenz führt dazu, daß wirtschaftliche Vorteile im Konkurrenzkampf der Nationen zu einem Ziel städtebaulicher Arbeit werden: Hegemann und Le Corbusier, Heiligenthal und Hoepfner betonen diesen Gesichtspunkt ebenso wie Sierks, dem es daneben um die klare wissenschaftliche Fundierung des Städtebaues unter dem Blickwinkel des Ingenieurs geht.
Eine ganz ähnliche Entwicklung vollzieht sich in den Vereinigten Staaten, wie die folgenden Sätze aus der Einleitung eines umfangreichen Planwerks zeigen:
„Während der Plan früher lediglich ein formvollendeter Entwurf sein wollte, strebt der moderne Plan danach, sich als produktiver Bestandteil der Wirtschaftsmaschinerie zu bewähren … Der Planer … erwartet … vom Volkswirtschaftler, daß er die Stadt selbst erkläre, ihre Existenz, ihren Charakter und ihre Funktion. Er ist überzeugt, daß man, um vernünftig zu planen, die Stadt als volkswirtschaftliches Phänomen klar erkennen müsse, und er brennt darauf, dieses Phänomen zu verstehen.“25
[1927] Gerade dort sind aber auch noch andere Kräfte am Werk, „die Stadt, ihre Existenz, ihren Charakter und ihre Funktion“ zu erklären: in den zwanziger Jahren prägt sich das Gebiet der „urban sociology“ aus. Zu seinen bedeutendsten Vertretern gehört Park, der in der Stadt das geeignete Laboratorium zur Erforschung der menschlichen Natur und der gesellschaftlichen Vorgänge sieht;26 er führt Cooleys Gedanken weiter, verbindet aber mit der Beobachtung eine Tendenz zur sozialen Reform, wie sie der amerikanischen Soziologie allgemein in höherem Maße eigen ist als der deutschen.
Auch die Stadt in ihrer Gesamtheit steht für die deutsche Soziologie noch nicht im Brennpunkt des Interesses; Brunner kann 1925 schreiben, daß „die Einordnung der dem gesamten Bauwesen eigentümlichen sozialen und wirtschaftlichen Gehalte in das System der Sozialwissenschaften noch aussteht.“27 Ganz im Sinne dieser Feststellung liegt die Forderung, die drei Jahre später auf dem Gründungskongreß der „Internationalen Kongresse für neues Bauen“ (CIAM) gestellt wird: die Architektur müsse wieder auf ihre eigentliche Ebene, die wirtschaftliche und soziologische, erhoben werden.28 Die Annäherung der Städtebauer an den Blickpunkt der Soziologen ist offenkundig: Die Arbeiten Lavedans und vor allem Poëtes in Frankreich lassen sie ebenso erkennen wie die Bemühungen Perrys um die Nachbarschaftseinheit in Amerika, wie Schumachers Schriften oder wie Hoepfners Ruf nach einem „Siedlungsingenieur“, der sich tief hineindenken müsse in menschliche Eigenart und Lebensweise: an die Stelle der Berechnung müßten Beobachtung, Denken und Abwägen treten.29 Die allmähliche Verschiebung der Wertmaßstäbe wird in einer Schrift der CIAM mit dem bezeichnenden Titel „Rationelle Bebauungsweisen“ deutlich: während Boehm und Kaufmann nur die technisch-finanzielle Seite behandeln, betont Gropius, daß für ihn der Begriff „rationell“ gleich „vernunftgemäß“ mehr umfasse als den rein rechnerischen Aspekt.
[1933] Zwei Jahre später entsteht die Charta von Athen als städtebauliches Manifest der CIAM und demonstriert die Überwindung des einseitig wirtschaftsbezogenen Denkens. Sie stellt fest, daß die Lebensbedingungen der Stadt den elementarsten biologischen und psychologischen Bedürfnissen der großen Masse ihrer Bewohner nicht entsprächen. Zugleich fordert sie vom Städtebauer, er solle menschliche Bedürfnisse und menschliche Wertmaßstäbe zum Angelpunkt aller baulichen Maßnahmen machen; die Stadt solle sich organisch und ausgewogen entwickeln und auf der materiellen wie auf der geistigen Ebene die Freiheit des Individuums und die Vorteile kollektiven Handelns sichern.
So rückt neben der Sorge für den Einzelmenschen nun auch das Bemühen um die menschliche Gemeinschaft in den Vordergrund der städtebaulichen Arbeit. Das Prinzip der Nachbarschaftseinheit wird in die Charta von Athen aufgenommen und gehört nach dem zweiten Weltkriege so sehr zum planerischen Rüstzeug, daß der Begriff gelegentlich zum Schlagwort wird. Auch wo die Nachbarschaft kritisiert wird – vor allem weil man den Verlust spezifisch städtischer Werte befürchtet –, beherrschen soziologische und sozialpsychologische Argumente die Diskussion. Diese Entwicklung ist allenthalben nachzuweisen: in der deutschen Nachkriegsliteratur wird die Nachbarschaft durchweg um ihrer gemeinschaftsbildenden Funktion willen befürwortet; Stöckli sieht in ihr geradezu ein Allheilmittel für alle städtebaulichen Probleme. In Frankreich legt Bardet besonderes Gewicht auf die Berücksichtigung der zahlreichen einander durchdringenden menschlichen Gruppen und Gemeinschaften; in der englischsprachigen Literatur endlich nimmt der Begriff „Community“ – im doppelten Sinne von Gemeinschaft und Gemeinde – eine beherrschende Stellung ein.
[1948] Mit der menschlichen Gemeinschaft steht kein abstrakter Begriff, sondern etwas lebendig sich Wandelndes im Mittelpunkt des städtebaulichen Denkens; die alten städtebaulichen Konzeptionen waren statisch, auf das fertige Gesamtkunstwerk der Stadt gerichtet, während nun das Zeitelement besondere Beachtung findet. Reichow sieht in der Stadtbaukunst eine „vierdimensionale Kunst raumzeitlicher Regie und Gestaltung“,30Umlauf fordert, die Zeit wieder zum Verbündeten der Planung zu machen,31 und Schwarz schreibt: „Der gute Plan muß die Dynamik der Geschichte mit einbauen, die ihn einmal überwindet.“32
Die gleiche Entwicklungstendenz wird an der zunehmenden Verwendung des Begriffes „organisch“ in der städtebaulichen Literatur deutlich: auch wenn über seinen Inhalt keine Übereinstimmung besteht, so ist seine Beliebtheit symptomatisch dafür, daß die bisherige Behandlung städtebaulicher Aufgaben als zu sehr den mechanisch-technischen Aspekten zugewandt empfunden wird und durch eine Betrachtungsweise ersetzt werden soll, die auch den rechnerisch nicht erfaßbaren Qualitäten des Lebens gerecht wird. So legt Reichow entscheidenden Wert auf die Forderung, die Planung müsse ihren Dispositionen das instinktive Verhalten der Menschen zugrunde legen, anstatt an den Intellekt zu appellieren, während für Neutra die physiologischen Kenntnisse und Erfahrungen im Vordergrunde stehen. Nur unter Führung der Biologie scheint ihm eine Planung denkbar, die das Weiterleben des Menschen ermöglicht; in der Sicherung dieses Zieles liegt der einzige Wertmaßstab, den er gelten läßt.33